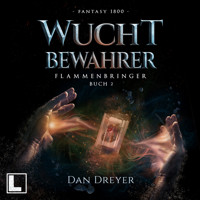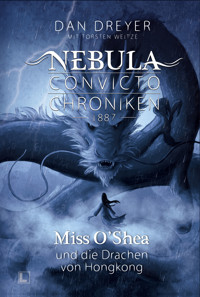Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Torsten Weitze
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Nebula Convicto Chroniken
- Sprache: Deutsch
Ein Junge aus Köln. Ein Krieg, der nie im Buch der Geschichte stand. Ein Schwur, der Jahrhunderte überdauert. Die Nebula Convicto-Chroniken 1225: ›RICHARD UND DER SCHWUR DES MÜLLERSOHNS‹ (Richard-Zyklus Buch 1) Köln, 1225. Richard träumt von mehr als Kornsäcken und Mühlradgeklapper. Als Kreuzritter durchs Dorf ziehen, sieht er in ihrer Mission nicht nur Abenteuer – sondern Wahrheit. Ohne Abschied folgt er dem Tross in den Krieg Gottes. Doch was er findet, ist keine heilige Schlacht. Es ist der Abstieg in eine Welt aus Illusion, Wahnsinn und Feuer. Was als Suche nach Ehre begann, wird zum inneren Krieg. Was als Schwur auf Gott gemeint war, bindet ihn an eine Ewigkeit im Dienst an den Unschuldigen. Dies ist der erste Schritt eines Mannes, der zum Custos werden wird: * Zum Schild gegen das Dunkel. * Zum Wächter zwischen den Welten. * Zum Ritter – geboren im Feuer, geformt im Glauben. Er suchte ein anderes Leben. Er fand die Nebula. Dies ist sein Anfang. Die offizielle Vorgeschichte zu Torsten Weitzes Nebula Convicto – die wahre Herkunft des geheimnisvollen Ritters Richard. Dark Urban Fantasy trifft historische Legende – der Auftakt einer epischen Saga
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 693
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NEBULA CONVICTO CHRONIKEN: 1225
Buch 1: »Richard und der Schwur des Müllersohns«
Von Dan Dreyer
Unter Mitwirkung von Torsten Weitze
Torsten schrieb 2017 im allerersten Buch der Nebula Convicto:›Dieser Roman ist meiner Frau gewidmet, die mich mit ihrem kompromisslosen Glauben an mich dazu ermutigt hat, meinen Traum als Autor gegen alle Widrigkeiten weiterzuverfolgen. Siehe da, sie hatte wie immer recht.‹ So ist nun dieses Buch von mir ebenfalls jener lieben Frau Weitze gewidmet.
Das hast du ziemlich gut hinbekommen. Danke dir! ;)
Autor: Dan Dreyer
Ackerstrasse 127
40233 Düsseldorf
Germany
›NEBULA CONVICTO CHRONIKEN: 1225‹
»Richard und der Schwur des Müllersohns«
© 2025, 1. Auflage
(NCCR01_EB_V01– Nummer für internen Gebrauch)
Lektorat & Korrektorat: Rainer Knietzsch
Umschlaggestaltung: Guter Punkt GmbH & Co. KG
Cover-Illustration: © Mi Ha | Guter Punkt, München
unter Verwendung von Motiven von iStock / Getty Images Plus
ISBN: 978-3-98896-014-6
•••
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
1. Kapitel: Ein Quästor, ein Custos
Ägypten, Port Said – Sommer 1889
Die große Schwarzkopfmöwe schwebte in den Lüften eines hellblauen Himmels und hoch über den tiefblauen Wogen des Mittelmeers. Nicht mehr als eine kleine Silhouette vor endloser blauer Weite. Ihre Flügel bewegten sich kaum, denn warme Aufwinde trugen sie mühelos Richtung Süden, wo am Horizont bereits die flirrende Küste Ägyptens wartete. Vereinzelte Wolken hingen wie blasse Streifen an der blauen Leinwand über ihr und rührten sich nicht. Unter ihr funkelten die Wellen im klaren Morgenlicht, sanft gewiegt von einer Brise, die nach Salz und Seetang schmeckte.
Trotz des herrlichen Wetters war die Schwarzkopfmöwe schlecht gelaunt. Ihre morgendliche Jagd hatte ihr nichts als einen leeren Schnabel und ebenso leeren Magen eingebracht. Doch Möwen zeigten so etwas nicht. Mit trotziger Selbstverständlichkeit, wie nur Möwen sie aufbringen, schwang sie sich höher in die salzige Luft und richtete ihre Flugbahn entschlossen auf die Hafenstadt. Bereits ab der Küstenlinie wurden die warmen Aufwinde stärker und drohten sie viel zu hoch gleiten zu lassen, um Beute am Boden erspähen zu können. Die Möwe zog die Schwingen enger an ihren Leib und ließ sich tiefer sinken. Mit leichten, aber ruckartigen Bewegungen des Kopfes sandte sie ihren Blick suchend über das bebaute, dicht besiedelte Land.
Von oben betrachtet glich der Hafen einem Flickenteppich aus hellen Segeln, qualmenden Dampfschiffen und geschäftigen Kais, an denen Menschen wie Ameisen hin und her wimmelten. Zwischen schaukelnden Barkassen, majestätischen Segelschiffen und schlanken Dampfern drängten sich Fischerboote mit geflickten Netzen, die ihren Fang ausluden. Auf Gleisanlagen hinter der Uferpromenade rumpelten beladene Eisenbahnwaggons vorüber. Von einem Anleger schallten gebrüllte Befehle zur Möwe hinauf. Ein französischer Offizier kommandierte einen Trupp Soldaten zum Einschiffen. Sein roter Képi saß schief auf dem verschwitzten Schädel, der Kragen der leichten Leinenjacke war offen, die goldenen Epauletten auf den Schulterklappen glänzten matt im Sonnenlicht. Die Infanteristen unter seinem Kommando waren kaum weniger gezeichnet vom Klima. Sie alle schwitzten in ihren Tropenhelmen und den khakifarbenen Uniformen. Sie trugen Gewehre und vollgepackte Rucksäcke. Einer hatte ein verbeultes Akkordeon auf dem Rücken. Die Männer bewegten sich mit der resignierten Routine alter Hasen, die wussten, dass kein Gebrüll der Welt das Gewicht der Ausrüstung minderte oder das Schiff, das auf sie wartete, schneller zum Ablegen brachte.
Die Möwe drehte eine enge Kurve über ihnen und flog weiter landeinwärts. An stolzen Kaufmannsvillen vorbei, deren weiße Mauern und grüne Fensterläden beinahe grell unter der brennenden Sonne aufleuchteten. Da sie hier aber nicht mit herumliegender Nahrung rechnen konnte, drehte sie wieder ab und tauchte in die engen Gassen der Hafengegend, wo die Gerüche von salzigem Fisch und rohem Fleisch vom heißen, staubigen Pflaster in die Lüfte stiegen. Das Stimmengewirr, das aus dem Netz der Straßen erklang, war ein babylonisches Durcheinander aus Arabisch, Englisch, Französisch und zahllosen anderen Sprachen und Dialekten. Doch das alles kümmerte die Möwe nicht.
Mit einem plötzlichen, scharfen Schrei faltete sie ihre Flügel zusammen und stürzte sich hinab auf den staubigen Boden. Direkt neben einem alten Holzfass lag ein Stück Brot, das jemand für sie dorthin geworfen hatte. Sie landete. Noch legte sie die Schwingen nicht ganz an ihren Körper. Erst ruckte ihr Kopf auf der Suche nach Gefahr herum.
Zahllose Menschen trieben einer zähen Flut gleich geschäftig durch die Gasse. Niemand schenkte ihr Beachtung. Sie entdeckte weder Hunde noch Katzen oder Ratten. Die fliegende Konkurrenz über ihr hatte den Brotkanten auch noch nicht bemerkt.
Und der Mann, der die kleine Mahlzeit für sie hatte fallen lassen, sah sie zwar an, machte aber keinerlei Anstalten, von seinem Sitz auf einem Fass aufzuspringen. Er betrachtete sie nur mit ausdruckslosem Gesicht. Sah ihr zu. Sie hüpfte vor, legte ihren Kopf zur Seite und musterte den Spender.
Er war ein großer – sehr großer –, hellhäutiger Mann mit kräftigen Schultern und ergrautem, nahezu weißem Haar. Er lehnte lässig, fast schwerfällig wirkend, an der sonnengebleichten Fassade der heruntergekommenen Hafenkaschemme, vor deren Eingang einige leere Fässer standen, von denen er eines zur Sitzgelegenheit erklärt hatte. Sein breites, dabei kantiges Gesicht hatte einen Ausdruck tiefer, nach innen gerichteter Schwermut. Seine hellblauen Augen wirkten seltsam entrückt und doch durchdringend klar. Er trug ein blutrotes Hemd mit doppelreihig geknöpftem Latz und Stehkragen und darüber einen sandfarbenen, weiten Mantel, der schon bessere Tage gesehen hatte. Sein Blick folgte der Möwe, die sich vorwagte, ihren Brotkanten schnappte und wieder zurückhüpfte.
Der Mann blieb sitzen und regte sich kaum. Er sah ihr nur nach und biss in das verbliebene Stück Brot in seiner Hand. Er kaute langsam und seufzte tief, als würde ihm die Last der gesamten Welt auf den Schultern liegen.
Als sich ein Schatten im dunklen Türrahmen der Kaschemme bewegte, sprang die Möwe noch ein, zwei Hüpfer weit, spreizte die Schwingen und schlug sie auf und ab, bis sie zurück in die Luft stieg, aus der sie herabgefallen war. Sie würde sich niedrig fliegend ins Landesinnere zurückziehen, denn auf einen Kampf mit Artgenossen um ihre unverhoffte Beute konnte sie verzichten.
Jemand trat auf die Schwelle und warf einen letzten Blick ins dunkle Innere der Kneipe.
»Shukran ‘ala al-diyafa, ya sadiqi«, sagte er ruhig. Die Stimme war tief, wohlklingend und mit einem Akzent versehen, der sich nicht recht zuordnen ließ. Dann kam der Sprecher ins Licht. Eine runde Nickelbrille mit tiefschwarzen Gläsern verbarg seine Augen. Als die grelle Sonne auf ihn traf, zischte er guttural und fletschte in unwillkürlicher Manier die Zähne. Er wischte sich mit durch einen dünnen Lederhandschuh geschützten Fingerkuppen über die Wange, nahm etwas von der fettigen Salbe auf, die sein blasses Gesicht bedeckte, und verrieb sie zwischen den Spitzen von Zeigefinger und Daumen. Dann schnaubte er. Er war von hochgewachsener, kräftiger, dabei schlanker Gestalt. Seine Garderobe war tadellos und bestand aus einem dreiteiligen, dunklen Anzug und einem staubfreien, hellbeigen Gehrock darüber, dessen modischer Schnitt in dieser Gegend ebenso selten war wie Ballsäle oder Kammerkonzerte. Sein nach hinten gekämmtes Haar und sein kurzgeschnittener Schnurrbart waren dunkelbraun, sein fettig glänzendes Gesicht blass, breit, aristokratisch.
Er trat neben den Mann auf dem Fass und legte ihm sacht die Hand auf die Schulter, wobei er die schwarzen Linsen der Brille auf die Gasse gerichtet hielt.
»Du warst schon einmal hier, nicht wahr?«, sagte er, ohne zu dem großen Mann zu sehen.
Der antwortete nicht. Er kaute langsam weiter, schluckte schließlich und legte den Hinterkopf an die raue, sonnenheiße Mauer.
»Ich kann dich nicht mitnehmen, wenn du in Gedanken abwesend bist, Richard«, sagte der Bebrillte, drückte aber die breite Schulter aufmunternd mit den Fingern. Seine Stimme klang tief und ruhig, dabei fest und klar wie Waffenstahl. »Das weißt du.«
Der Große seufzte und senkte den Blick auf das halb gegessene Brot in seiner Hand. »Ich bin mir nicht sicher, ob ausgerechnet ein Vampyr für diese Geschichte als Beichtvater taugt.«
Der andere Mann schnaubte spöttisch. »Asta-i viața. Es ist, wie es ist. Einen Besseren kann ich dir nicht anbieten, bevor wir aufbrechen. Und ganz nebenbei bemerkt, ist dieser Vampyr hier dein Vorgesetzter. Also?«
Richard schüttelte betrübt lächelnd den Kopf, schlug das rechte Bein über das linke und packte sein Knie mit einer Hand. Mit der anderen warf er den Brotrest von sich, sodass der nächste befiederte Räuber eine Mahlzeit abholen konnte. Seine Augen glitten über das Gewimmel, das ungebrochen durch die Gasse strömte. Soldaten, Matrosen, Träger, Händler, spielende Kinder. Eine Ziege, ein streunender Hund.
»Dieses Land …«, sagte er schließlich, und seine raue, belegte Stimme klang, als käme sie von weiter weg. Als müsste sie erst durch Jahre oder Jahrhunderte reisen. »… die Luft. Der Sand. Ja, ich war schon einmal hier, Quästor. Vor langer Zeit. Vor verteufelt langer, langer Zeit …«
Der blasse Mann an seiner Seite nickte. »War es der Anfang?«, fragte er.
Richard antwortete nicht sofort. Seine blassblauen Augen waren auf das Ende der Gasse gerichtet, sahen darüber hinaus und blieben am Horizont hängen, dort, wo das Meer gegen den flirrenden Dunst der Wüste stieß. »Ja«, sagte er. »Es war der Anfang von allem.«
»Dann erzähle es mir. Wenn es dadurch leichter für dich wird. Wenn nicht, dann nicht. So oder so wirst du dich zusammenreißen oder hierbleiben müssen.«
Richard schnaufte. Er schloss die Augen und knetete mit Daumen und Zeigefinger den Nasenrücken. »Es ist eine lange Geschichte, Quästor.«
»Michael.«
Richard öffnete die Augen, drehte den Kopf leicht, ohne den anderen ganz anzusehen. Er nickte und ein halbes Lächeln zuckte in seinem Mundwinkel. »Eine verdammt lange Geschichte, Michael. An deren Ende du erkennen wirst, dass es mit ›zusammenreißen‹ allein nicht getan ist.«
Michael zuckte mit den Schultern. »Tja, wenn Hierbleiben für dich keine Option ist …« Er trat einen Schritt zur Seite, prüfte mit einem kurzen Blick den Schattenwurf eines windschiefen Balkonaustritts über ihnen und setzte sich auf ein anderes Fass, das im Halbschatten stand. Die Sonne streifte ihn trotzdem. Er ignorierte sie. »Solange Morgan und Eve nicht vom Hafen zurück sind, haben wir Zeit, meinst du nicht?«
Richard mahlte mit seinen Zähnen. So fest, dass die Kiefermuskeln wie herumkullernde Walnüsse unter seiner Gesichtshaut hervortraten. »Nun gut«, raunte er.
Dann lehnte er sich vor, stützte die Unterarme auf die Oberschenkel und sprach mit rauer Stimme, als würde ihn jeder Satz etwas kosten: »Geboren wurde ich im Jahr 1205. Ich war der Sohn eines Müllers und einer Bäckerin aus einem Kaff nördlich von Köln. Ich wuchs in der Mühle auf. Wie Margaretha, meine jüngere Schwester. Vater war ein gläubiger Mann. Sehr, sehr gläubig. Mutter war klug und praktisch, mit einem scharfen Blick für Ungerechtigkeiten. Streng waren beide. Ich arbeitete mit. Es war schwer. Es war hart. Aber es war ein gutes Tagewerk … und doch … wollte ich mehr sein. Ich wollte Sinn. Ich wollte…« Er suchte kurz nach dem Wort, schnaufte dann. »… ein Ritter werden. Also bin ich den Falschen gefolgt. Und habe doch gefunden, wonach ich gesucht habe. Leider.«
»Der Kreuzzug?«, fragte Michael.
Richard schnaubte. »Ein Kreuzzug von viel zu vielen, die vor und nach diesem waren. Aber dieser verschwand, bevor er je Spuren in der Geschichte hinterlassen konnte. Die Männer landeten im Heiligen Land und … und wurden nie mehr gesehen. Verschlungen vom Sand, von einem Krieg jenseits der menschlichen Vorstellungskraft. Von der … Nebula.« Er senkte den Kopf und schloss die Augen wieder. »Und das … war der Anfang. Nicht meines Heldentums. Sondern meines Schwurs, der mich bis heute in der Welt hält …« Er wandte den Kopf zu Michael und sah ihn aus den Augenwinkeln an. »Bist du sicher, dass du diese Geschichte hören willst?«
Der Quästor nickte.
Und Richard holte Luft.
1. Teil
Von Köln bis Akkon – Vom Mühlrad zum Schwerte
2. Kapitel: Ein Morgen wie viele
»Unsere Mühle stand auf einem Hof, der dem Kloster St. Pantaleon angehörte, irgendwo zwischen Köln und Dormagen. Offiziell gehörte alles dem Herrn. Dabei gehörte es dem Abt. Oder dem Vogt. Je nachdem, wen man fragte. Wir mahlten für das Kloster. Vater betete für das Seelenheil der Familie. Und Mutter backte Brot, das besser war als alles, was je auf einem Altartisch gelegen hatte.
Wir sprachen damals ripuarisches Mittelhochdeutsch im Dialekt unserer Gegend. Glaub mir, selbst du würdest daran verzweifeln. Daher erspare ich ihn dir in meiner Geschichte.
Bei gutem Wetter konnte ich von der Anhöhe hinter dem Mühlgraben aus zwei Bauwerke in der Ferne erspähen: den dunklen Vierlingsturm von Groß St. Martin und die breite Kuppel des alten Doms, die wie ein buckeliger Schild über der Stadt schwebte. Man sagte auch, dass an besonders klaren Tagen das Dach unserer Mühle von der Stadtmauer aus zu sehen war. Ich habe es nie überprüft.
Aber hier beginnt es …«
•••
Bei Köln, im Monat März des Jahres des Herrn 1225
Wie scheinbar alle Tage zuvor – und vermutlich auch alle danach – begann dieser Tag im frühen Frühling mit dem Quietschen des Wasserrades. Es war ein vertrautes Geräusch, das durch die dicken Balken und Steinwände der Mühle drang, lange bevor das Morgenlicht die Wände streifte oder der Hahn des Nachbarn krähte. Das Rad drehte sich rhythmisch knarrend, angetrieben vom Wasser des schmalen Mühlgrabens, der sich hinter dem Haus durch die feuchten Felder schlängelte und dank der Schneeschmelze bis zur Böschungskante randvoll gelaufen war.
Richard schlug die Augen auf und sah an die verrußte Decke. Über ihm hingen Bündel getrockneter Kräuter. Einige Spinnweben spannten sich zwischen Balken und Deckenbohlen. Das Schwalbennest war trocken und unbewohnt. Alles war wie immer…
Wie jeden Morgen …
Er richtete sich auf, gähnte und hörte die Stimme seines Vaters, der im Nebenraum leise betete. Wie jeden Morgen kniete er auf den rauen Holzdielen vor dem schlichten Kreuz an der Wand und flüsterte Gebete um Kraft und Demut. Er war ein großer Mann, dessen breite Schultern vom jahrelangen Säckeschleppen und schweren Mahlsteinedrehen krumm geworden waren. Richard streckte sich und rollte den Kopf im Nacken. Noch war es nicht so weit, aber irgendwann wären auch seine Schultern so breit wie die seines Vaters … und ebenso krumm. Aber so war es wohl … wie Großvater ein Müller gewesen war, dessen Sohn ihm folgen musste, so würde auch Richard eines Tages ein alter Müller sein, der seinem Sohn das mühselige Tagewerk hinterließ. Und dieser dem seinen. Und so weiter. Und so weiter. Er gähnte noch einmal. Er gähnte so herzhaft, dass sein Kiefer knackte und ein kleiner Sprühstrahl Speichel aus seinem Rachen schoss und auf der Tunika landete, in der er geschlafen hatte. Lächelnd wischte er sich mit dem Ärmel über die Lippen und sah zu seiner Schwester.
Grete lag noch zusammengerollt auf ihrem Lager aus Stroh, den Kopf auf einen angewinkelten Arm gebettet. In ihren dunkelblonden Haaren klebte Teig vom Vortag, ihre Hände waren noch ganz weiß vom Mehl. Ihr Atem ging ruhig und gleichmäßig.
Leise sog Richard Luft durch die Nasenlöcher. Er roch, was er immer roch. Jeden Morgen … den Duft von frischem Sauerteig, vermischt mit dem Geruch des Mehls und Korns, der allgegenwärtig durch die Mühle waberte. Er kratzte sich am Kopf und schmatzte, warf die Beine über den Rand des Bettkastens und streifte die rauen Wollsocken, die Mutter geflickt hatte, über Füße und Waden. Dann stand er auf, streckte sich wieder, bis seine Gelenke das Knacken aufgaben und sich endlich mit Leben füllten, und trat ans kleine Fenster, von dem aus man in Herbst und Winter, wenn die Bäume am Ufer des Mühlbachs keine Blätter trugen, und an sehr klaren Tagen die Turmspitzen der fernen Stadt erkennen konnte. Heute aber waren sie von morgendlichem Dunst verborgen. Mit den Fingerspitzen stieß er die Läden auf, um frische Luft hereinzulassen.
Draußen färbte sich der Himmel langsam von Grau zu kaltem Blau.
Ein neuer Tag hatte begonnen.
Ein Tag wie alle anderen.
Auf dem Weg durch die Küche und zur Backstube kratzte er sich im Schritt und drückte sich den letzten Gähner aus dem Rachen. Müde öffnete er die Tür. Angenehme Wärme von der Feuerstelle trieb ihm ins Gesicht. Ein kräftiger Duft nach frischem Teig und glimmendem Holzfeuer erfüllte den Raum. Mutter war bereits bei der Arbeit. Ihr schlanker, zäher Körper zeichnete sich in der Morgendämmerung deutlich gegen das schmale Fenster ab. Ihre Ärmel waren hochgekrempelt, die Hände kneteten energisch und routiniert einen großen, hellen Teigballen.
Wie jeden Morgen …
Er atmete tief ein, fühlte die vertraute Schwere der Monotonie – und eine leise, hartnäckige Sehnsucht nach einer Welt, die nicht aus Mehlstaub, Teig und Gebeten bestand. Nach etwas Größerem. Nach einer Bestimmung jenseits der alten Mühle.
Die Augen fest auf ein frisch gebackenes Fladenbrot gerichtet, das auf einem Holzbrett dampfte, schlich Richard sich näher an den gemauerten Brotofen heran. Doch bevor seine Finger danach greifen konnten, erklang Mutters Stimme hinter ihm: »Wage es nicht, das Brot anzulangen, Junge.«
Sie hatte sich nicht einmal zu ihm umgedreht und walkte weiter im Teigklumpen herum. Ihre Stimme klang streng, doch unterdrückte Belustigung schwang darin mit.
Richard erstarrte mitten in der Bewegung, seine Hand schwebte kurz über dem Brot. Er seufzte, ließ sie sinken und warf seiner Mutter einen resignierten Blick zu. Sie knetete und knetete und blickte noch immer nicht auf.
»Vater wartet schon auf dich. Nach dem Gebet gibt es Gerstenbrei. Mit Apfelstückchen, wenn du Glück hast.«
Zu dieser Jahreszeit mit alten Apfelstückchen, dachte Richard, verzog das Gesicht und schlurfte widerwillig zurück zur Tür.
»Und weck deine Schwester!«, fügte seine Mutter nachdrücklich hinzu.
Er verdrehte die Augen und trat im Vorbeigehen an der Schlafstätte gegen den Bettkasten, auf dem Grete zusammengerollt schlief. Ein missmutiges Grummeln drang aus dem Lager.
»Ich bin ja wach …«, murmelte sie schläfrig und setzte sich langsam auf.
»Das hast du gestern auch gesagt. Da hattest du aber noch Stroh in der Nase, als der Hahn schon krähte.«
»Blöder Sack!«
»Beweg dich, Mehlratte.«
Grete richtete sich auf und streckte sich. Mit beiden Händen fuhr sie heftig durch ihren kurzen Schopf und rieb sich mit den Knöcheln den Schlaf aus den Augen. Nach der gestrigen Arbeit in der Backstube hatte sie wohl vergessen, ihre Beinlinge auszuziehen. Sie stand auf, reffte den Saum ihrer Tunika und band den Gürtel um die Hüfte.
»Bereit, wenn du’s bist«, murmelte sie gähnend.
Gemeinsam schlurften sie in die angrenzende Stube, der große Raum im hinteren Drittel des Hauses, in dem an hohen Feiertagen die Mahlzeiten stattfanden, Besuche empfangen und Gebete abgehalten wurden.
Vater kniete vor dem schlichten Holzkreuz an der Wand. Seine tief murmelnde Stimme erfüllte den Raum mit leisen, ernsten Fürbitten.
»… Herr, gib dem Wasser Kraft, dem Rad Schwung und dem Mahl gut Gang«, raunte er, »Behüte das Korn vor Fäulnis, das Dach vor Regen, und die Hände vor Trägheit …«
Richard und Grete ließen sich wortlos neben ihm auf die Knie sinken und falteten andächtig die Hände. Schweigend senkten sie die Köpfe und schlossen die Augen.
Draußen knarrte das Wasserrad, das Licht kroch langsam durch die kleinen Fenster herein, und der Morgen begann, wie so viele zuvor.
»… und halte Hochmut fern von meinen Kindern … Amen.«
Grete stupfte Richard an. Er sah ihr unterdrücktes Schmunzeln aus dem Augenwinkel. Ächzend stemmte sich Vater in den Stand.
»Betet, Kinder«, brummte er.
Grete warf Richard einen schiefen Blick zu. Er schielte zurück, mit dem Ausdruck eines Hungernden, der an nichts als das Frühstück denken konnte.
Vaters Schritte verklangen, nachdem er die Küche betreten hatte.
Richards Magen knurrte. Laut.
Grete prustete und schlug sich die Hand vor den Mund. Dennoch entwich ihr ein gepresster, kaum unterdrückter Kicherer.
Richards Augen weiteten sich erschrocken. Jetzt grummelte es auch aus Gretes Bauch, ein gluckerndes Geräusch wie von einem leeren Wasserschlauch.
»Gnade uns!«, wisperte sie keuchend und presste sich die Hand an den Bauchnabel.
Sie lachten beide. Leise, aber unüberhörbar.
»Ruhe jetzt!«, schallte es aus der Küche, wo Vater hantierte. Er hatte es natürlich gehört.
Während Grete sich Tränchen aus den Augenwinkeln wischte, sammelte sich Richard für seine eigene Fürbitte. Er senkte den Blick und faltete die Hände.
»Herr im Himmel … schenk uns heute ein volles Maß an Gerstenbrei … und wenn es dein Wille ist, vielleicht ein Stück Fladenbrot mit Rinde, warm vom Ofen, das innen noch dampft. Und keine getrockneten Pflaumen. Bitte, bitte, keine Prumen. Amen.«
Grete japste und verbarg ihr Grinsen hinter der Hand. »Amen«, keuchte sie.
Die beiden erhoben sich, streckten kurz die Beine und schlurften gemeinsam in die Küche. Der Geruch von warmem Brot und geröstetem Mehl war inzwischen noch kräftiger geworden, und die Hitze der Feuerstelle trieb die feuchte Kühle des Morgens aus den Steinen.
Auf dem Tisch warteten vier Schalen Gerstenbrei, aus denen Dampf stieg und in deren Oberflächen kleine Apfelstückchen glänzten. Ein hölzerner Krug mit Ziegenmilch, vier Tonbecher und ein Brett mit einigen Brotfladen vom Vortag standen bereit. Vater saß auf der Bank, die Ellbogen auf den Tisch gestützt, und harrte dem Mahl. Mutter war am Herd und rührte mit einem langen Holzspatel im restlichen Brei herum.
Es war in aller Herrgottsfrühe; selbst die Vögel hatten sich noch nicht ganz erhoben, und nur wenige Frühaufsteher ließen sich vernehmen. Das leise Tschilpen eines Rotkehlchens, irgendwo in der Hecke beim Holzstapel. Eine Amsel stimmte zögerlich ihr erstes Lied an, flötend, als wolle sie sich rückversichern, ob der Tag wirklich schon begonnen hatte.
Auf knarrenden Stuhlbeinen zog Richard seinen Stammplatz unter dem Tisch hervor und setzte sich. Grete schlüpfte neben Vater auf die Bank. Der zweite Stuhl war für Mutter, die ebenfalls Platz nahm.
Bevor einer das Holzlöffelchen zur Schale führte, falteten sie die Hände.
Vater murmelte: »Herr, segne dieses Mahl. Dank für deine Gaben. Gib Kraft für unsere Arbeit und bleib bei uns in Mühe und Mangel. Amen.«
»Amen«, sprachen alle drei.
Dann langten sie zu. Richard warf sich beinahe über seine Schale und begann zu essen, als hätte er seit Tagen nichts bekommen.
»Nicht so gierig, Junge«, mahnte Vater.
»Er ist im Wachstum«, sagte Mutter, ohne von ihrem Brei aufzublicken.
»Dann wächst er aus der Mühle raus, wenn das so weitergeht«, brummte Vater und schüttelte mit gespielter Skepsis den Kopf. Er war ein strenger, hart arbeitender Mann. Aber er liebte seine Kinder. Mitunter auch etwas zu sehr, wie Mutter nicht müde wurde, zu sagen.
Grete stocherte mit dem Löffel im Brei herum und pustete über die Oberfläche. Dann seufzte sie zufrieden. »Keine einzige Pflaume!«
»Ein Wunder!«, antwortete Richard kauend.
»Du, Marta. Musst du nicht noch die Festlaibe für den Abt backen?«, fragte Vater zwischen zwei Bissen.
»Morgen erst. Heut sind’s zwei Dutzend Brote. Für die Brüder aus Pantaleon, den Vogt und drei für den Küster von Niederembt. Wenn ich noch Zeit habe, mach ich den Buchtelteig für morgen fertig.«
»Hm«, machte Vater nur. »Ich dachte …«
»Ich weiß, was du dachtest. Ich weiß aber auch, was im Kalender steht.«
Sie sah kurz auf und wackelte mit dem Löffel in der Luft, als würde sie ihm Prügel androhen.
Er hob beschwichtigend die Hand. »Schon gut.«
Eine Weile klapperte nur Essbesteck gegen Holz und schlürfende Geräusche erfüllten den Raum.
Dann lehnte Vater sich zurück und wischte sich mit dem Handrücken den Mund. »Heute kommt der Müller aus Oberembt. Ich will sehen, ob wir den Mahlsatz tauschen können und da bei uns das Rad zu langsam läuft, brauch ich die Kammzähne ersetzt. Richard, dabei hilfst du mir. Und danach bringst du neues Korn hinauf.«
Richard nickte.
»Und du, Grete, hilfst deiner Mutter. Wehe, es kommt einer der Laibe zu spät aus dem Ofen. Der Vogt wird’s merken.«
Mutter schnaubte. »Der merkt das nicht. Der zählt nur seine Silberstücke.«
»Trotzdem.« Vater blickte sie an.
»Lass uns nur machen«, sagte Grete. »Wir wissen schon, wie’s backen geht, Vater.«
Für einen Moment sagte niemand etwas. Das dürftige Tageslicht, das durch die Fensterluke fiel, war milchig. Staubpartikel tanzten träge im Schein.
Dann schlug Vater mit flachen Händen auf die Tischplatte und drückte sich hoch.
»Gott gibt das Korn. Wir mahlen es«, sagte er. »Er gibt den Morgen. Wir die Mühe. Auf die Füße, Sohn!«
Wieder knatterte es, als Richard sich sitzend vom Tisch abstieß, um aufzustehen.
Ein neuer Tag in der Mühle begann.
•••
»Es war ein Morgen wie viele, Michael … und doch erinnerte ich mich später oft an ihn.
Die Wärme des Ofens. Der Brei. Der Duft nach Teig. Der gleichmäßige Takt des Mühlrades.
Grete. Mutter. Vater. Alles war gut.«
3. Kapitel: Des Müllers Sohn
Die Sonne war im Laufe eines überaus anstrengenden Morgens über das Dach gestiegen und ließ feuchten Dunst über dem Mühlgraben aufleuchten. Als Richard an ein paar Hühnern vorbeiging, gackerten sie missmutig und liefen vor ihm davon.
In der Scheune roch es nach altem Heu, Staub und Schimmel. Er hob eine Plane beiseite und starrte auf die Kornsäcke. Sie lagen da seit September des letzten Jahres und wirkten eher wie grob verschnürte Hinkelsteine, schwer wie die Sünde.
»Na los!«, murmelte er zu sich selbst. »Harte Arbeit gegen Flausen im Kopf …«
Er wuchtete den ersten Sack hoch und legte ihn sich auf die Schulter. Das Gewicht drückte ihm sofort die Luft aus der Lunge. Der Sack war leicht feucht an der Unterseite, vermutlich vom nächtlichen Tau, und presste einen kalten Fleck durch die Maschen seiner verschwitzten Tunika. Während er sich Schritt für Schritt zur Mühle zurückkämpfte, dachte er an den Morgen zurück: Der Müller aus Oberempt war wie immer zu früh und auch zu laut zur Reparaturunterstützung angerückt. Er hatte mit seiner bärigen Stimme über den Hof gebrüllt und mit seinem ausladenden Gebaren das ganze Mühlenhaus in Beschlag genommen. Drei neue Kammzähne fürs große Mühlrad hatte er gebracht – und natürlich einen Sack Sprüche gleich dazu. Vater hatte mitgelacht und Richard zur Kurbel geschickt und die alte Welle drehen lassen, bis das Antriebswasser gestaut war und das Holzrad stand. Dann hatte die eigentliche Arbeit begonnen: morsche Zähne raus, neue rein. Holz war gesplittert und Schweiß war getropft. Als der letzte Zapfen endlich saß, hatte der Oberempter ihm anerkennend auf die Schulter gedroschen, Vater ein knappes Lob gesprochen, und Richard war stolz gewesen. Kurz jedenfalls. Er hatte sich gerade den Schweiß von der Stirn gewischt, da hatte Vater ihn auch schon zum Kornholen geschickt.
Und nun stapfte er stöhnend und schwer beladen zwischen Mühle und Scheune hin und her. Quer über den Hof zur hölzernen Treppe zur Mahlkammer, die unter seinem Schritt knarrte und ächzte. Jede bewältigte Stufe zog in den Oberschenkeln und brachte seinen Rücken zum Protestieren.
Oben angekommen, ließ er den Sack neben dem Trichter zu Boden stürzen. Staub wirbelte auf, er hustete, rieb sich die Augen. Kurz lehnte er sich mit beiden Händen auf die Knie und rang nach Luft.
Dann ging er wieder nach unten. Und wieder hinauf. Und wieder hinab.
Der dritte Sack rutschte ihm fast von der Schulter. Richard fing ihn ab, fühlte ein schmerzhaftes Ziehen im Rücken, fluchte leise und biss die Zähne zusammen. Er keuchte. Das Herz wummerte in seiner Brust und seine Armmuskeln zitterten.
Auf Beinen wie aus Brei schleppte er den vierten Sack Korn durch den Hof. Sämtlicher Schweiß schien versiegt zu sein. Die fadenscheinige Tunika klebte an seinem Oberkörper und rieb wunde Stellen unter seine Achseln. Ein dumpfes Pochen in den Ohren ließ ihn stoppen. Für einen Moment glaubte er, es sei die Anstrengung, die an seinen Knochen rüttelte. Er ließ den Sack zu Boden gleiten, stützte die Hände in die Hüften und sog Atem ein. Dann richtete er sich auf, drückte den Rücken durch und stocherte mit dem Finger im Ohr.
Das Pochen blieb.
Dabei lag der Hof still. Also nicht still. Das tat ein Mühlhof nie. Wie immer war das Rauschen des Mühlgrabens zu hören, das Rappeln und Klackern aus dem jüngst reparierten Getriebe, das Schaufeln und Platschen der Mühlradpfannen. Richard hob den Kopf und sah über den Hof zum gegenüberliegenden Bachufer. Im Gegensatz zur Seite, auf der er stand, wo der Lehmboden festgestampft und mit Steinen eingefasst war, zeigte sich das Ufer auf der anderen wild und ungezähmt – mit Weiden, Haselsträuchern und jungen Erlen. Die Zweige wirkten noch kahl, nur hier und da hing altes, bräunlich zerfressenes Laub zwischen dem dichten Geäst. Erste Kätzchen glänzten silbern im feuchten Licht des Morgens.
Richard legte den Kopf zur Seite und lauschte.
Aus dem Geäst hinter der Uferböschung kam es: das Pochen. Und just steigerte es sich zum lauten Klopfen.
Rumpelnder als jedes Wagenrad, schwerer als das Stampfen eines Ochsen.
Pferde. Große. Hufe auf dem festen Boden des Weges, der den Bachlauf säumte. Dazu das Scheppern von Kettenzeug, das Klirren von Ringen, das Schnaufen starker Tiere.
Richard trat einen Schritt näher zur hüfthohen Mauer der Uferbegrenzung. Er legte die Hände auf die rauen Steine und beugte sich vor.
Dann hörte er die Stimme über das Pochen der Hufe und den ganzen anderen Radau.
»Sagt, ist es noch weit, Bruder Hagen?« Es klang nach einem älteren Mann, der sich wohlfein artikulierte.
Richard lief zum Rand der Radkammer, stellte den Fuß auf eine geneigte Steinplatte und kletterte auf das schräge Mauerwerk, das das Mühlrad hielt. Seine Hände fanden Halt am nassen Stein, er zog sich hoch.
»Weit … was ist schon weit, Bruder Eckhardt, hm?«, erwiderte eine weniger kontrollierte Stimme, die aber ebenfalls nach älterem Mann klang. »Gemessen an dem Weg hinter uns, ist’s eine Ewigkeit. Gemessen an dem, der vor uns liegt, ist’s bloß ein Klacks.«
Richard stand oben auf dem Mauersims. Unter ihm, knapp unterhalb seiner Knie, lief die Oberkante des Mühlrades vorbei. Wasser klatschte über die Schaufeln, spritzte gegen seine Beinlinge.
Er reckte sich, stellte sich auf die Zehenspitzen.
Jenseits des Grabens schimmerte etwas durch das Geäst. Weiß und schwarz. Grau und braun. Stoff. Rüstung. Pferdeleiber.
Die Geräusche kamen näher, wurden klarer. Jetzt erkannte er die, die sie verursachten.
Es war ein Tross. Fünf hohe Herren auf edlen Streitrössern und ihre Begleiter. Es waren … Ritter! Sie ritten auf der Straße hinter dem Ufer entlang. Ihre Knappen und Pagen folgten ihnen mit einigen schwer beladenen Packpferden. Richard reckte und streckte sich. Das Weiß, das er gesehen hatte, gehörte zu den Wappenröcken der Gerüsteten. Über ihren Kettenhemden trugen sie lange Surcots aus grobem, staubbedecktem Leinen – weiß wie Kalk.
Einer der Ritter lehnte sich im Sattel zurück und winkte einem Pagen, der eines der Packpferde zu Fuß am Zügel führte. Das Tier hinkte und war deutlich zurückgefallen. Auf der Brust des Ritters prangte ein schwarzes Kreuz. Es war kein Wappen, das den kunterbunten der Turnierritter glich, die Richard als kleiner Bub auf dem Markt vor Köln einmal gesehen hatte. Das Signet war groß, es reichte von der Kehle bis zum Schwertgurt, von einer Seite der Brust zur anderen. Dabei war es so schlicht gehalten, wie das Foltergerät, an das der Herr einst geschlagen worden war. Der Ritter wedelte ungeduldig mit der Hand. Der Page stapfte schneller und zog das Packpferd hinter sich her.
Doch Richard hatte nur Augen für das Kreuz.
Für das Weiß und das Schwarz.
Für das, was es bedeutete.
Das … das … waren … Kreuzritter! Was … wollten die denn hier … in diesem Kaff am Ende des Weges, das ihr Ziel sein musste?
»Also, wie weit ist es noch zu diesem Schmied, Hagen?«, brummte die tiefe dabei raue Stimme, die er zuerst gehört hatte.
»Ach, werter Eckhardt …« Der andere Mann schnaufte und holte hörbar Luft, die er stöhnend entließ. »Weit … was ist schon weit … hm?«
Richard hob eine Hand. Er wollte dem Tross winken.
Und dabei rutschte er beinahe von der Mauer.
Sein Fuß schlitterte auf nassem Stein, das Wasser des Rads spritzte ihm ins Gesicht.
Mit beiden Armen in der Luft rudernd kämpfte er um Balance. Wenn er jetzt zwischen die Schaufeln stürzte …
Ein schöner Tod, dachte er.
Ernsthaft. Zwischen Schaufeln und Mühlwasser.
Ersäuft und erschlagen.
Ein Müllerssohn, der es besser wissen müsste.
Im Dorf würden sich nicht wenige auf die Schenkel schlagen, wenn jemand vom Tod des Dämels berichtete.
Seine Fingerspitzen fanden das Mauerwerk hinter sich. Er lehnte sich zurück und stützte sich ab. Einen Moment noch zögerte er, doch da unter seinen Sohlen nichts mehr glitschte und flutschte, erlaubte er sich einen tiefen Atemzug.
Puh!
Kaum hatte sich sein Körper entspannt, meldete sich sein Herz mit aufgeregtem Schlag zurück.
Kreuzritter waren gekommen!
Und sie wollten zum Schmied im Dorf!
Kreuzritter!
Hier!
Aber wie lange würden sie bleiben?
Richard konnte kaum atmen.
Er musste Vater davon erzählen! Vielleicht würde er erlauben, dass Richard sie sich anschauen durfte?!
•••
Der Geruch von Gerstenmus, Ziegenkäse und altem Rauch zog durch den Raum. Mutter zog die hölzerne Kelle ein letztes Mal durch den Topf und füllte den Brei in die Schalen. Das Feuer im Herd flackerte, flüssiges Harz zischte an einem halb verkohlten Holzscheit. Die Glut roch würzig, fast süßlich.
Richard hatte versucht, Vater von dem Rittertross zu erzählen. Mehrfach. Doch der hatte den ganzen Tag über kein Ohr gehabt. Beim Korntragen, beim Kehren, beim Sackbinden und Verladen – jedes Mal nur ein brummiges ›Später‹ oder ein schroffes ›Das mahlt sich nicht von allein, Junge!‹
Aber jetzt war es Abend! Und jetzt – jetzt würde er es loswerden!
Die Familie kam an der schmalen Tafel und im Licht der Ölpfanne zusammen. Mutter reichte das Brot, Grete blies vorsichtig über ihre dampfende Schale. Vater murmelte den Tischsegen, kurz, knapp, mit rauer Stimme.
Richard wippte mit einem Bein und brachte die Bodenbohle zum Knarzen. Er hob den Kopf, den Löffel in der Hand. »Vater … ich muss etwas erzählen.«
Vater kaute, sah nicht auf. »Du hast einen geöffneten Sack fallen lassen?«
»Nein! Es geht um … um den Vormittag. Ich war draußen, beim vierten Sack … und da hab ich sie gesehen. Ritter!«
Grete hielt inne. Ihre Augen wurden groß.
Richard richtete sich auf und wedelte mit dem Löffel herum, als schwinge er ein Schwert. »Kreuzritter, Vater! Sie ritten über den Pfad hinter dem Mühlgraben und am Bach vorbei. Sie hatten das Zeichen auf ihren Wappenröcken, Vater! Das Kreuz! Schwarz auf weiß! Fünf, mit Knappen und Packpferden. Eines war lahm, das Tier, mein ich, nicht der Ritter. Und sie redeten über den Schmied. Unseren Schmied! Sie wollen ins Dorf!«
Einen Moment lang kaute Vater weiter. Dann schluckte er, legte den Löffel ab und wischte sich den Mund mit dem Handrücken. »Das Kreuz, sagst du? Schwarzes Kreuz auf weißem Grund, hm? Der Ordo Teutonicus … Deutschritter … hm …«, murmelte er.
»Was?!«, entfuhr es Richard. »Die … sie … sie …«
Grete kicherte ob der Stotterei ihres Bruders.
»Das sind doch die, die Hospitäler unterhalten!«, brachte Richard den Satz heraus, der zuvor vor lauter Aufregung in seinem Rachen festgesessen hatte. »Echte Kreuzritter, Vater! Nicht nur in Schwur und Schwerte, sondern auch im Dienste an den Bedürftigen!«
Vater schnaufte und warf einen Seitenblick zu seiner Angetrauten. »Und was soll daran besonders sein? Es sind eben Ritter.«
»Es sind Kreuzritter! Mit Schwertern, Helmen, Kettenzeug! Sie kämpfen für den Glauben!«
Vater rümpfte die Nase. »Sie kämpfen für sich. Für Land. Für Macht. Und für die, die sie losschicken. Der Glaube kommt dabei meist zuletzt.«
Mutter schwieg. Grete starrte auf ihren Brei.
Richard fuhr sich durchs Haar. »Aber sie tragen das Zeichen. Das schwarze Kreuz! Das ist der Herr. Das ist … das ist das Gute!«
»Das ist ein Stück Stoff, Junge.« Vater tunkte seinen Löffel ins Mahl. »Ich hab mehr als einen Mann gesehen, der ein heiliges Zeichen trug, Häuser niederbrannte und Kinder erschlug. Glaub nicht alles, was glänzt.«
Richard funkelte seinen Vater an. »Was ist mit mir, hm? Ich soll Korn schleppen und Mühlräder schmieren, bis ich umfall, während die da draußen mit Schwert und Ehre durch die Welt ziehen. Und jetzt darf ich sie mir nicht einmal ansehen?!«
Vater kaute, langsam. Dann sah er auf und fixierte seinen Sohn, als würde er das Gespräch jetzt doch ernst nehmen. »Du bist Müllerssohn. Wozu reicht das wohl? Zum Ritter? Glaubst du, der Herr hat dich für Heldentaten geschaffen? Die Welt braucht weder Ehre noch Schwerter! Sie braucht Mehl und Brot! Und das hier ist dein Platz!« Im Laufe der Rede waren Tonfall und Lautstärke schärfer und lauter geworden. Zum Abschluss schlug Thilo mit der Faust auf den Tisch.
»Aber ich will nicht mahlen! Ich will …«, setzte Richard an.
»Was du willst«, fuhr Vater dazwischen, »zählt nicht! Nicht, solange du unter diesem Dach lebst und das Brot unserer Hände isst!«
»Aber ich …«
»Genug!«
Richards Wangen glühten. Frustriert trat er gegen ein Tischbein.
Das Geschirr klapperte. Grete zuckte zusammen. Mutter hielt inne, ihren Löffel halb in der Luft, halb vor dem Mund.
»Ich hab geschuftet heute«, grollte Richard. »Ich hab die Zähne ersetzt, ich hab das Rad in Gang gesetzt, ich hab Korn geschleppt, bis ich kaum noch stehen konnte. Und ich hab keinen Ton gesagt. Ich hab nur einmal … einmal … etwas gefragt.«
Vater schwieg. Nur der Löffel in seiner Hand kratzte über den Schalenrand, als er ihn langsam drehte.
»Ich bin 20 Jahre alt, Vater!«, setzte Richard an.
»Noch nicht ganz, Junge!«, unterbrach Thilo. »Und du weißt gar nicht, wovon du redest, Sohn.«
»Doch!«, fauchte Richard. »Es ist unser Glaube! Es ist Gottes Werk!«
»Gottes Werk ist, dass du morgen wieder Mehl mahlst.«
»Aber der Deutsche Orden … sie … sie helfen Kranken, sie beschützen Pilger!«
»Und wie viele hast du gesehen, die das tun, hm? Glaubst du, sie kümmern sich um Hungernde, wenn sie im Morgenland Burgen bauen und die Städte der Heiden in Brand setzen?« Vater stützte die Unterarme auf den Tisch, der Löffel zwischen seinen Fingern. »Sie predigen das Kreuz und lassen Mönche auspeitschen, wenn sie widersprechen. Und was ist mit Konstantinopel, Junge? Weißt du, was sie da getan haben? Dein ach so frommer Orden und all die anderen?«
Richard runzelte die Stirn. »Der Vogt hat gesagt, das waren die Franzosen! Und die Venezianer! Vom Deutschritterorden hat er nichts gesagt!«
»Ach, nein? Und wer stand daneben? Wer schwieg? Wer segnete die Schwerter, die Frauen in Klöster trieben und Kinder an die Stadtmauern nagelten? Glaub mir, ich hab mit Mönchen gesprochen, die das Land gesehen haben. Totschlag, Elend, Hunger. Und über allem das weiße Banner mit dem schwarzen Kreuz.«
Grete war bleich geworden. Mutter saß schweigend an ihrem Platz und sandte Richard einen sorgenvollen Blick.
»Ich bin nicht du«, sagte Richard trotzig und mit nassen Augen. Seine Stimme war dünn. »Ich will mehr sehen. Mehr sein.«
Vaters Miene verfinsterte sich. »Dann bete, dass der Herr dir das nimmt«, knurrte er.
»Was?«
»Deinen Hochmut.«
»Thilo!«, fuhr Mutter dazwischen.
Mit entnervtem Blick fuhr er zu ihr herum. »Schweig, Weib!«
Schneller als Richard hätte ›Kreuzfahrer‹ sagen können, schoss seine Mutter aus dem Sitz. »Weib?!« Sie stemmte eine Hand an die Hüfte und hob die andere, als wollte sie eine Runde Ohrfeigen austeilen. Da wohl alle am Tisch die Durchschlagskraft von Martas Schellen kannten, zuckten sie alle unwillkürlich zusammen. Mit Erleichterung stellte Richard fest, dass allein Vater im Brennglas ihres Zornes kauerte. »Sag das nicht noch mal, Gatte! Nicht, wenn du dich aufregst. Und erst recht nicht, wenn ich danebenstehe!«
Thilo blinzelte. Langsam öffnete sich sein Mund. Doch bevor er etwas erwidern konnte, steckte sie ihm einen Zeigefinger unter die Nase.
»Hast du vergessen, dass auch du einmal wild warst? Neugierig? Dass du selbst Fragen gestellt hast, die keine Mühle beantworten konnte?«
»Nein, aber …«
»Kein Aber!«, sagte sie. »Vielleicht ist dir auch entfallen, dass morgen frisches Brot zum Vogt muss. In aller Früh.«
Vater gab ein brummendes Geräusch von sich.
»Ich kann es nicht ausliefern«, fuhr Mutter fort. »Ich hab den Buchtelteig zu verarbeiten. Allein für Grete ist’s zu schwer. Und du, Thilo, du musst Korn vom Gutshof beim Kloster holen, sonst mahlen die Steine bloß noch sich selbst.«
»Ich weiß, Frau«, raunte Vater.
»Einer muss jedenfalls gehen. Die Laibe müssen bis Mittag im Dorf sein. Besser in aller Früh. Und ich denke, unser Sohn kann das tun.«
Richard horchte auf und sah zu ihr. Sie zwinkerte ihm zu.
»Aber ich begleite ihn!«, rief Grete. »Ich kann vielleicht nicht alles tragen, aber doch so einiges! Ich schwör’s!«
Bruder und Schwester sahen mit geweiteten Augen zu ihrem Vater.
Stille.
Wasser tropfte.
Holz knackte.
Thilo hob den Kopf. Er bedachte seine Angetraute mit gerunzelter Stirn und hochgezogenen Augenbrauen und sah dabei aus, als wollte er sie fragen, ob sie ihn für dämlich hielt.
Mutter lächelte bloß mit einem Mundwinkel und nickte.
Er schnaufte und schüttelte den Kopf. »Nach dem Morgengebet«, brummte er und wedelte mit dem Löffel. »Und es wird ein gutes Gebet! Nicht schnell, schnell!«
Richard strahlte. Am liebsten wäre er aufgesprungen und hätte Vater und Mutter mit all der Liebe erdrückt, die er in seiner Brust spürte. Aber sie lächelte ihn nur an und deutete mit einem Kopfnicken auf den Ascheeimer.
Er grinste über das ganze Gesicht und sprang auf. Er würde die Feuerstelle so sauber fegen wie noch nie zuvor.
Und morgen früh würde er ins Dorf gehen und die Ritter sehen!
Morgen früh!
4. Kapitel: Vom Rittertum träumen
Die Nacht war still, bis auf die Geräusche, die Hof, umliegender Wald und Mühle erzeugten. Doch die webten wie so oft einen vertrauten Kokon um die fleißigen Menschen, die sonst am Ende eines arbeitsreichen Tages in sofortigen Schlummer gefallen wären.
Aber nicht in dieser ganz speziellen Nacht, in der die Erwachsenen miteinander tuschelten und diskutierten, ob die Idee, den jugendlichen Nachwuchs am nächsten Morgen ins Dorf zu schicken, gut oder fatal gewesen war. Und besagter Nachwuchs vor freudiger Erwartung des kommenden Tages keine Ruhe fand.
So lag Richard im Bettkasten unter dem niedrigen Dach, dessen Holzbalken so alt und vertraut waren, dass er ihre Maserung selbst in der Finsternis hätte nachzeichnen können. Das Strohlager unter ihm raschelte leise, und die grobe Wolldecke über seinem Körper kratzte. Aber er nahm es kaum wahr. Er konnte nicht schlafen. Seine Gedanken waren so wild, dass sie sich kaum greifen ließen. Immer wieder sprangen sie zwischen der Mühle und den Rittern hin und her. Von schweren Kornsäcken und Splittern in den Händen zum weißen Stoff der Wappenröcke, dem schwarzen Kreuz darauf. Vom Knarren und Klappern von Stockgetriebe und Kammrad, zum Hufschlag der Streitrösser. Seine Finger fuhren unruhig über den rauen Rand der Decke oder rieben unter seiner Nase, wo sich in unregelmäßigen Abständen, jedoch unentwegt, ein Juckreiz einstellte.
Neben ihm lag Grete. Ihr Atem ging ruhig und gleichmäßig, so wie er es tat, wenn sie fest schlief. Oder so tat, als ob. Aber Richard konnte die angespannte Energie seiner Schwester spüren. Sie glich der, die ihn selbst geißelte und um den Schlaf brachte.
»Grete?«, flüsterte er.
Einen Moment blieb es still. Dann drehte sie sich auf dem Strohlager, und ihre Stimme kam kaum hörbar zurück: »Hm?«
»Kannst du auch nicht schlafen?«
»Wie denn?«, wisperte sie.
Richard grinste in die Dunkelheit. Er wusste genau, was sie meinte. »Ich dachte, Vater würde aus dem Sitz fahren«, murmelte er.
»Gottes Werk ist, dass du morgen wieder Mehl mahlst«, äffte Grete ihren Erzeuger nach.
»Sonst Totschlag, Elend, Hunger«, machte Richard mit. Er gab sich Mühe, den warnenden Tonfall zu überzeichnen, und wackelte mit dem Kopf dabei, dass das Stroh raschelte. Beide versuchten vergeblich, ihr Lachen zu unterdrücken, bis es schließlich gedämpft aus ihnen herausplatzte und die angespannte Stille der Nacht durchbrach.
»Aber im Ernst«, sagte Richard schließlich, als ihr Kichern verklungen war. »Glaubst du, Vater meint, was er sagt? Über die Ritter?«
Grete war kurz still. »Ich weiß es nicht. Aber kannst du dir das vorstellen? Es sind doch die Kreuzritter! Sie kämpfen fürs Christentum.«
»Ja, genau. Das habe ich auch gedacht.«
»Sollen die nicht fromme Recken sein?«
»Ja«, hauchte Richard. »Eine Bruderschaft, vereint im Glauben, das Himmelreich zu erringen …«
»Bei Vater klang das anders«, murmelte Grete.
»Aber warum?«, fragte Richard. Er richtete die Frage eher an sich selbst, aber seine Schwester antwortete dennoch.
»Seine Worte waren hart, das stimmt … Aber … aber ich glaube, er hat … Angst.«
»Vater? Angst? Wovor denn?«
Grete überlegte einen Moment und es war, als könnte er ein Getriebe in ihrem Schädel rattern hören, das dem der Mühle gar nicht unähnlich war.
»Davor, dass er recht hat«, flüsterte sie schließlich. »Dass die Ritter doch nicht so sind, wie du denkst. Er will dich schützen … denke ich.«
Richard schnaubte leise. »Ich brauche keinen Schutz. Ich weiß genau, was ich will.«
»Und was wäre das?«, fragte Grete vorsichtig.
Richard starrte nach oben in die Dunkelheit. »Mehr«, murmelte er. »Ein Leben, das nicht zwischen Mühlsteinen endet. Ich will etwas bedeuten, Grete. Ich will nicht nur Mehl mahlen und Brot backen. Ich will … kämpfen. Nicht um des Kampfes willen, sondern für etwas Gutes.«
»Aber was, wenn Vater recht hat?«, flüsterte sie unsicher. »Was, wenn diese Ritter gar nicht kämpfen, um zu helfen? Wenn sie … nur kämpfen, um sich selbst zu helfen?«
Obwohl Grete es im Dunkeln nicht sehen konnte, schüttelte Richard den Kopf. »Dann werde ich eben anders sein«, raunte er entschlossen. »Ein Ritter, der wirklich für etwas Gutes kämpft. Einer wie … William Marshal.«
Grete kicherte wieder. »William Marshal? Der große Ritter aus den Geschichten, die der alte Mattes so gern erzählt? Der unter König Henry II. und seinem Sohn Richard Löwenherz diente, und der nie einen Kampf verlor und alle beschützte?«
»Genau der«, flüsterte Richard. »Aber ich … ich werde noch besser.«
»Du?«, stichelte Grete. »Besser als William Marshal?« Er konnte hören, wie sie sich eine Hand auf den Mund presste, um ein lauteres Auflachen zu unterdrücken.
Richard boxte sie leicht in die Schulter, und sie kicherten zusammen. »Natürlich!«, sagte er. »Ich bin viel schneller und viel stärker … und viel, viel schöner!«
»Dümmer vielleicht«, sagte Grete grinsend. »Und sturer.«
»Du wirst schon sehen«, sagte Richard. »Eines Tages werde ich einen Wappenrock tragen. Weiß, mit einem Kreuz darauf. Dann wirst du es bereuen, mich verspottet zu haben.«
Grete kicherte noch ein wenig, bevor ihre Stimme leiser und ernsthafter wurde. »Ich würde dich nie verspotten. Ich weiß doch, dass du das wirklich meinst.«
»Tu ich auch«, murmelte Richard. »Das kann nicht alles sein, Grete. Mehl mahlen und Brot backen. Das kann doch einfach nicht alles gewesen sein …«
»Ich … ich weiß es nicht …«, wisperte sie.
Ich aber, dachte er und ballte die Fäuste um den Saum der Decke. Ich aber.
Eine Weile schwiegen beide. Richard hörte, wie Gretes Atem langsam ruhiger wurde. Bald schlief sie tatsächlich.
Doch Richard ließen die Gedanken nicht los. Sie trieben ihn weiter umher, wie herausgebrochene Kammzähne auf einem schnellen Fluss. Er starrte in die Dunkelheit, malte sich ein Leben in Kette und Platte aus, stellte sich die fernen Länder vor, die er als Kreuzfahrer zu sehen bekäme, und wühlte in seinen Erinnerungen, um jedem Wort vom alten Klosterbruder Mattes erneut zu lauschen. Mit einem Mal fand er sich wieder, wie er letzten Sommer auf dem Rand des Dorfbrunnens gehockt und den Berichten des Mönches gelauscht hatte, die er den Kindern zum Besten gegeben hatte.
›Und da zogen sie gen Jerusalem, gehüllt in den weißen Mantel des Herrn, mit dem Kreuze auf ihrer Brust, dass selbst die Sonne achtungsvoll erstrahlte.‹ Bruder Mattes’ Stimme hatte gezittert vor Ehrfurcht. Richard erinnerte sich nun ganz deutlich. ›Sie marschierten nicht – sie beteten sich voran. Den Rosenkranz in der einen und das Schwert der Gerechten in der anderen Hand. Gebete auf den Lippen und das Evangelium im Herzen. Und als sie die Tore Akkons erreichten, da öffnete sich der Himmel, und das Licht Gottes fiel auf sie herab, segnete sie in ihrem Bestreben. Nicht ihre Stärke verhalf ihnen zum Sieg. Sondern ihr Glaube! Denn der Herr führt und leitet jene, die ihm ergeben dienen. Hingabe, Kinder! Hingabe ebnet den Weg!‹
Im sanften Brabbeln der erinnerten Worte übermannte Richard irgendwann doch die Erschöpfung.
Und dann träumte er.
Im Traum steckte er in einer glänzenden Plattenrüstung, die heller strahlte als das Morgenlicht. Die Rüstung passte ihm wie angegossen, schwer und kalt und zugleich auf unerklärliche Weise beruhigend. Das Gewicht auf seinen Schultern gab ihm das Gefühl, endlich der zu sein, der er sein sollte. Endlich dort zu sein, wo er hingehörte. Er war … richtig.
Vor ihm auf einem Hügel stand eine gewaltige Gestalt, ein Mann mit erhobenem Schwert. Richard wusste sofort, wer es war: William Marshal, der größte Ritter aller Zeiten, unbesiegbar, gerecht, und tapfer. Das Licht hinter ihm war gleißend hell, fast blendend, warf scharfe Striche auf die harten Kanten der Silhouette des Helden.
Marshal blickte ihn an und nickte langsam. Dann deutete er mit seinem Schwert auf eine finstere Ebene unterhalb des Hügels. Dort warteten Schattenwesen, Kreaturen, die kreischten und klagten, verzweifelt und wütend zugleich. Sie streckten die Klauen nach ihm aus, schrien und tobten und zeigten Zähne, die wie schwarze Dolche aussahen.
Richard trat vor, hob seinen Schild mit dem schwarzen Kreuz darauf und zog das Schwert. »Für Recht und Ordnung!«, rief er. »Für das Licht!«
Aber die Schatten ließen sich nicht beeindrucken. Mit einem einzigen gemeinsamen Aufschrei hetzten sie in tobender Woge heran und erstürmten den Hügel wie eine schwarze, zeternde Woge. Sie stürzten sich auf ihn, rissen und zerrten an seinen Armen, an seiner Rüstung, an seinem Schild. Marshal stand unbewegt und blickte traurig auf ihn hinab, ohne ihm zu helfen.
»Kämpfe oder stirb!«, schien sein Blick zu sagen.
Er erwachte keuchend, nass von kaltem Schweiß. Neben ihm schnarchte Grete leise, ohne zu wissen, welche Schlacht er gerade verloren hatte. Sein Herz klopfte wild, während draußen im Dunkeln das Wasserrad gleichmäßig und beruhigend plätscherte, unbeeindruckt von seinen Träumen.
Er ließ sich wieder zurück ins Lager sinken, lauschte dem Wummern seines Herzens, dem Rauschen seines Blutes zwischen den Ohren und starrte in die Dunkelheit. Ganz langsam sog er Atem ein und spürte das Zittern in Hals und Brust.
Dann schloss er die Augen, faltete die Hände zusammen und betete.
5. Kapitel: Pferdeäpfel und Fäuste
Der Himmel über dem Mühlenhof war noch grau und fahl, als Richard und Grete nach einer Nacht mit wenig Schlaf aufbrachen. Dunst hing wie Watte zwischen den Bäumen und zog sich in langen, trägen Schwaden durch die Büsche und über den ausgetretenen Lehmweg. Raureif belagerte jedes Blatt und jeden Zweig. Die Luft war klamm und kalt, sodass die Geschwister die radförmigen Schulterüberwürfe aus rauer Wolle mit den kratzenden Gugeln übergeworfen hatten.
Der Handkarren, den Richard hinter sich herzog, rumpelte unrhythmisch über den buckligen Pfad, der sich von der Mühle durch das umgebende Wäldchen bis hinunter zur breiteren Landstraße wand. Die Räder waren ungleich groß und der Wagen knarzte, krachte und klapperte mit jedem Schritt, als wolle er sich lautstark über die morgendliche Reise beschweren. Auf der Ladefläche lagen ordentlich gestapelte Brote, die Marta gebacken hatte, in Leinentücher gewickelt.
Richard zerrte mit grimmigem Eifer an dem störrischen Karren, während Grete vor ihm mit leichterem Schritt ging, einige der duftenden Laibe in einem Tuch eingeschlagen, das sie wie einen kostbaren Schatz vor ihrem Bauch hielt. Zwischendurch legte sie muntere Hüpfsprünge ein.
»Beeil dich, Brüderchen!«, rief sie mit heller, ungeduldiger Stimme über die Schulter. »Wir wollen doch die Ritter nicht verpassen!«
»Leicht gesagt, wenn man nicht den verfluchten Karren über diesen Buckelpfad zerren muss!«, knurrte er und stemmte sich gegen das störrische Gefährt.
Grete blieb stehen und wartete auf ihn, drehte sich dann mit blitzenden Augen zu ihm herum. »Na komm schon! Wo ist der starke Ritter, von dem du immer träumst?« Sie grinste frech und wirbelte herum. »William Marshal hätte so einen Karren locker hinter sich hergezogen. Und zwar mit einer Hand!«
Richard schnaubte, teils verärgert, teils amüsiert. »William Marshal hatte sicher auch keine Schwester, die ihn dauernd mit ihrem Gerede hätte nerven können.«
Grete kicherte kurz und lief wieder voraus. Der Pfad verbreiterte sich und traf endlich auf die Landstraße. Sie verlief geradlinig und deutlich ebener als der Pfad durch den Wald, und Richard atmete erleichtert auf, als der Griff des Handkarrens nicht mehr bei jeder Unebenheit in seinen Händen herumzuckte wie ein störrischer Aal aus Hartholz.
»Ist nicht mehr weit!«, rief Grete und zeigte nach vorne, wo zwischen Morgennebel, wogenden Feldern und einzelnen Baumgruppen das kleine Dorf allmählich sichtbar wurde. Der zarte Schemen eines Kirchturms und der Giebel des höchsten Hauses ragten zaghaft aus dem grauen Schleier des Nebels hervor. »Da ist es schon!«
Richard blieb kurz stehen und betrachtete die Siedlung, die zum Grundbesitz des Klosters St. Pantaleon gehörte, auch wenn die Mönche sich selten blicken ließen. Für eine Wehrmauer oder einen Palisadenwall war sie zu unbedeutend. Das Dorf lag abseits der großen Handelswege, verborgen zwischen Feldern und Wäldern, zu klein, um für Kaufleute oder Kriegsherren von Interesse zu sein. Ein paar einfache Holzzäune zogen sich zwar zwischen den Höfen entlang, und hier und da sah man ein windschiefes Stallgebäude oder einen Heuschober, von brusthoher Umzäunung umgeben. Aber das war nur Flickwerk aus Holzlatten, Dornengestrüpp und Weidengeflecht – gerade gut genug, um Schweine drinzuhalten, nicht um Räuber abzuwehren. Der Vogt hatte zwar einmal von einer Umfriedung gesprochen, doch angesichts der horrenden Kosten und Mühen waren diesbezügliche Pläne nie umgesetzt worden.
Richard war schon oft dort gewesen, aber heute wirkte es anders. Heute war es nicht einfach nur das Dorf des mürrischen Vogts und seiner Bewohner. Heute war es das Dorf, in dem Ritter übernachtet hatten. Echte Ritter!
Und gleich würde er sie sehen!
»Beeilen wir uns«, sagte er und zog den Wagen entschlossen weiter.
Grete sprang an seine Seite und lachte leise. »Jetzt kommst du plötzlich in Fahrt!«
»Natürlich!«, sagte er lächelnd. »Schließlich wollen wir die Kreuzritter nicht warten lassen!«
Der Karren knarzte und rumpelte, während die beiden Geschwister mit flinken, nun doch beschwingten Schritten dem Dorf entgegeneilten.
Die Morgensonne durchstrahlte den Himmel inzwischen mit ihrem blassen Gelb, aber ihr Licht kämpfte noch gegen den zähen Nebel, der über den Feldern hing wie ein Tuch aus kaltem Atem.
Das Dorf lag in einer flachen Senke, halb verborgen hinter Streuobstwiesen und Hecken, als hätte es sich schlafend unter dem Dunst verkrochen. Die strohgedeckten Dächer der kleinen Häuser wirkten aus der Entfernung wie Hügel aus Lehm und Stroh. Holzstapel, Wassertröge, Zäune – alles war von einem feinen Raureif überzogen, der wie Glasstaub in der aufgehenden Sonne glitzerte. Ein schmaler Kirchturm ragte aus der Mitte der Siedlung, schiefergedeckt, schief und wettergegerbt. Sein schlichtes Kreuz an der Spitze zeichnete sich kaum gegen das trübe Licht ab. Dennoch läutete gerade in diesem Moment die kleine Glocke, dumpf und blechern.
»Das Haus des Vogts.« Grete hob die Hand über die Augen und zeigte geradeaus.
Richard trat neben sie, blinzelte und nickte.
»Da sind sie bestimmt untergebracht«, sagte sie ehrfürchtig. »Wo sonst?«
Er sagte nichts, aber sein Herz schlug schneller. Das Haus des Vogts war das einzige mit einem gemauerten Fundament, das einzige mit zwei Schornsteinen, das einzige mit richtigen Fenstern. Und ganz bestimmt das einzige im Dorf, in dem ein echter Ritter übernachten würde.
»Glaubst du, sie schlafen noch?«, fragte Grete leise.
»Kreuzritter schlafen nicht«, murmelte Richard. »Die beten. Oder üben. Oder schreiben Briefe an Könige.«
Sie grinste. »Oder schnarchen wie Eber und furzen in die Strohsäcke.«
»Du hast eine besondere Art, hohe Herrschaften zu würdigen«, sagte Richard trocken.
»Aber ich will sie trotzdem sehen. Alle. Rüstungen, Schwerter, Helme, Pferde …«
Er nickte stumm. Vor seinen Augen entstand das Bild eines Ritters, wie aus seinem Traum. Schnaufend schüttelte er den Kopf und packte den Griff fester. Nun stand er kurz davor, Kämpen des Kreuzes wahrhaftig sehen zu können, und verlor sich in seinen Träumen. Verdammt noch eins!
Mit einem Ruck zog er am Karren. Als der wieder rollte, verfiel Grete erneut in ihren albernen Hüpferlauf. Wie ein kleiner Grashüpfer sprang sie vor ihm die Lehmstraße entlang.
Sie passierten die ersten Häuser am Dorfrand. Ein Hund bellte. Ein Fensterladen knarrte. Ein Hahn krähte. Und in der Ferne – schwer zu sagen, ob wirklich oder nur im Herzen – war Klirren von Metall zu hören, das einen Jungen aus der Mühle glauben lassen konnte, dass es Träumen manchmal doch gelang, in die echte Welt zu schwappen.
Das Dorf war bereits erwacht.
Hier und da stieg Rauch aus niedrigen Kaminen, kräuselte sich träge in den Morgenhimmel und vermischte sich mit den Nebelschwaden, die über den strohgedeckten Dächern schwebten. Zwischen Häuschen aus Lehm und Holz und windschiefen Schuppen scharrten Hühner im feuchten Boden, ein Hund bellte lustlos und irgendwo schimpfte eine raue Männerstimme über nasses Brennholz.
Richard zog den knarzenden Karren langsam hinter sich her. Grete hielt sich dicht neben ihm und drückte die in Leinentücher eingewickelten Brote wie eine wertvolle Last an ihre Brust. Ihre Blicke wanderten neugierig und erwartungsvoll umher und irgendwie waren sie ein wenig enttäuscht, dass keine Fanfaren erschollen oder bunte Banner im Wind flatterten, wie sie es sich bei den Gedanken daran, dass Ritter im Dorf waren, vorgestellt hatten. Der Weg führte sie weiter an den niedrigen Häusern mit schiefen Türen und spärlichen Fenstern vorbei, hin zu dem einzigen Gebäude, das aus zwei Stockwerken bestand. Es war das größte Gebäude des Dorfes, lag direkt am Brunnen- und Marktplatz und gehörte dem Vogt. Selbst der Turm der kleinen Kirche gegenüber konnte den Dachgiebel nur knapp überragen. Es war ein festes Haus, erbaut aus grauen Feldsteinen mit schmalen Fenstern, hinter denen noch kein Licht brannte. Zwei kleine Türmchen rahmten den Eingang, und an einem dünnen Holzstab über der Tür hing ein verblasstes Wappen. Neben dem Haus lag eine offene Stallung, ein langer Unterstand mit tief herabgezogenem Strohdach, dessen Balken vom Alter schwarz und an einigen Stellen von Flechten überwuchert waren.
Als sie näher kamen, sog Richard die Luft durch die Nase ein. Der Geruch, den er wahrnahm, war erdig und irgendwie saftig. Nach Heu, altem Leder und Mist.
Im Halbschatten der offenen Remise standen sie: die Pferde der Kreuzritter. Gewaltige Streitrösser, groß und kraftvoll, mit breiten, muskulösen Hälsen und dicken Flanken.
Nicht die mageren Ackergäule, die man sonst in der Gegend kannte, sondern echte Kriegspferde. Größer als Ochsen, mit kräftigen Schultern und Hinterbacken, dicken Hufen, wuchtigen Hälsen und gekürzten Mähnen und Schweifen. Die Rösser waren ungesattelt und über ihren Rücken lagen schwere Decken gegen die Nachtkühle.
Richard blieb wie angewurzelt stehen. Er vergaß den Karren, vergaß die Brote, vergaß sogar Grete, die bereits zur Tür des Vogts geeilt war, um anzuklopfen.
Die Rösser hielten seinen Blick gefesselt.
Da war eins mit schwarzem Fell, das wie flüssiges Pech glänzte. Ein anderes war dunkelgrau wie Stein, mit hellen Augen. Ein drittes, kastanienbraun und mit weißer Blesse, scharrte ungeduldig mit einem Vorderhuf. Das vierte war fuchsrot und das fünfte hatte nahezu makelloses, weißes Fell mit einigen grauen Tupfern auf den Hinterbacken.
Richard trat langsam näher. Die Größe der Tiere war einschüchternd, beinahe unwirklich. Noch nie hatte er solche Kraft aus solcher Nähe gesehen.