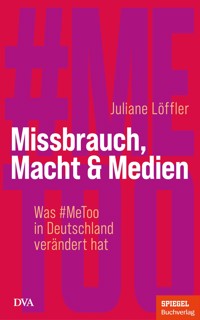
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was sich 7 Jahre nach #MeToo in Deutschland verändert hat
Die preisgekrönte Journalistin Juliane Löffler führt uns hinter die Kulissen ihrer investigativen Arbeit: Sie erklärt, wie Recherchen über Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt ablaufen und was es bedeutet, sich mit Vorwürfen gegen oftmals mächtige Männer an die Öffentlichkeit zu wagen. Dabei wird klar, wie viel Mut Betroffene und Journalist:innen immer wieder aufbringen müssen und wie schwer es ist, gesellschaftliche Backlashs und hartnäckige Narrative von Schuld und Scham zu überwinden. Auf Basis zahlreicher Fälle und Interviews mit Betroffenen und Expert:innen offenbart Löffler die dahinterliegenden Strukturen. Sie zeigt, wie MeToo seit 2017 zu einer globalen Bewegung wurde, unseren gesellschaftlichen Diskurs verändert und ein neues Bewusstsein geschaffen hat. Doch ihre Analyse beleuchtet auch die Risiken von MeToo und verdeutlicht zugleich, wieso Systeme von Machtmissbrauch in Deutschland bis heute fortbestehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Was sich sieben Jahre nach #MeToo in Deutschland verändert hat
Die preisgekrönte Journalistin Juliane Löffler führt uns hinter die Kulissen ihrer investigativen Arbeit: Sie erklärt, wie Recherchen über Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt ablaufen und was es bedeutet, sich mit Vorwürfen gegen oftmals mächtige Männer an die Öffentlichkeit zu wagen. Dabei wird klar, wie viel Mut Betroffene und Journalist:innen immer wieder aufbringen müssen und wie schwer es ist, gesellschaftliche Backlashs und hartnäckige Narrative von Schuld und Scham zu überwinden. Auf Basis zahlreicher Fälle und Interviews mit Betroffenen und Expert:innen offenbart Löffler die dahinterliegenden Strukturen. Sie zeigt, wie MeToo seit 2017 zu einer globalen Bewegung wurde, unseren gesellschaftlichen Diskurs verändert und ein neues Bewusstsein geschaffen hat. Doch ihre Analyse beleuchtet auch die Risiken von MeToo und verdeutlicht zugleich, wieso Systeme von Machtmissbrauch in Deutschland bis heute fortbestehen.
Juliane Löffler wurde 1986 in Frankfurt am Main geboren. Sie studierte Kulturwissenschaften, Spanische Philologie und Deutsch als Fremdsprache an der Universität Potsdam und Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut. Danach arbeitete sie bei der Zeitung der Freitag und war Senior Reporterin bei Buzz-Feed News (später Ippen Investigativ). Seit März 2022 ist Löffler Redakteurin im Ressort Deutschland/Panorama beim SPIEGEL. Sie veröffentlicht seit Jahren zu Themen im Bereich sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch. Vor allem ihre Recherchen zu Ex-Bild-Chef Julian Reichelt erhielten große Aufmerksamkeit. 2021 wurde Juliane Löffler dafür zusammen mit dem Team von Ippen Investigativ vom Medium Magazin als »Journalistin des Jahres« ausgezeichnet. Löffler hat für ihre Arbeiten zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten, u. a. das »Reporters in the Fields«-Stipendium der Robert Bosch Stiftung, den Bert-Donnepp-Preis und den STERN-Preis 2022.
Besuchen Sie uns auf www.dva.de
Juliane Löffler
MISSBRAUCH, MACHT & MEDIEN
WAS #METOO IN DEUTSCHLAND VERÄNDERT HAT
DVA
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 by Deutsche Verlags-Anstalt, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München, und SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-32368-4V001
www.dva.de
INHALT
VORWORT
EINS PROTEST
Von #aufschrei zu #MeToo: Eine neue Bewegung formiert sich analog und digital, um auf ein altes Problem aufmerksam zu machen
ZWEI ERINNERUNG
Wie erhält man mediale Aufmerksamkeit für Berichte über sexualisierte Gewalt und Übergriffe? Die #MeToo-Debatte aus den USA kommt in Deutschland an
DREI GEWALT
Sexualisierte Gewalt, Missbrauch und Übergriffe sind weit verbreitet. Weil Macht gesellschaftlich ungleich verteilt ist, sind bestimmte Gruppen stärker betroffen als andere
VIER MACHTUNDMACHTMISSBRAUCH
Bei sexualisierter Gewalt geht es nicht um Sex – sondern um Macht und Machtmissbrauch. Ein Fall aus dem Wissenschaftsbetrieb zeigt, was damit gemeint ist
FÜNF TRAUMA
Missbrauchserfahrungen verändern Menschen und ihre Erinnerungen. Wie Journalist:innen das bei ihrer Arbeit berücksichtigen
SECHS ÖFFENTLICHKEIT
Die Entscheidung, wann und wie man MeToo-Vorwürfe veröffentlicht, ist für Quellen und für Medien meistens nicht einfach
SIEBEN SCHWEIGEN, SCHULDUNDSCHAM
»Die Frau ist doch selbst schuld« – über ein mächtiges Narrativ, hinter dem ein System steckt, das Menschen zum Verstummen bringt
ACHT RECHTUNDGERECHTIGKEIT
Was ist gerecht? In den Diskussionen über MeToo geht bei dieser Frage einiges durcheinander. Zeit, ein paar Fäden zu entwirren
NEUN BACKLASH
Wie Gegner von MeToo Menschen, die Missbrauchsvorwürfe erheben, und Medien, die darüber berichten, mit gezielten Strategien zum Schweigen zu bringen versuchen
ZEHN MUT
Vorwürfe öffentlich zu äußern, erfordert eine gehörige Portion Courage. Die Influencerin Kayla Shyx erzählt erstmals ausführlich, warum sie sich dafür entschieden hat und welche Folgen es für sie hatte
EPILOG
ANHANG
Dank
Glossar
Ansprechpartner:innen im Notfall
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Triggerwarnung:
In diesem Buch finden sich an mehreren Stellen Schilderungen von Missbrauch und gewaltsamen sexualisierten Übergriffen, sofern sie für die Argumentation relevant erscheinen, insbesondere in den Kapiteln »Gewalt« sowie »Macht und Machtmissbrauch«. Diese können belastend oder retraumatisierend wirken.
»Man kann nicht wissen, wie sehr sich andere Menschen für deine Geschichte interessieren, bis du sie erzählst.«[1]
Megan Twohey und Jodi Kantor
VORWORT
In einer der ersten Wochen des Jahres 2017 hing ich gebannt vor dem Rechner und klickte mich durch Bilder pinkfarbener Menschenmassen. Da liefen Hunderttausende für Frauenrechte durch die Straßen. Sicher, es ging um mehr, um Donald Trump, um Rechte für Minderheiten, um Demokratie, den Kampf gegen Desinformation. Aber dass eine Protestbewegung dieses Ausmaßes angeführt wurde von lauten Frauen, farblich gekennzeichnet durch ihre Symbole, das war neu für mich. Ich war fasziniert. Wo kamen sie auf einmal alle her?
9000 Kilometer entfernt sprachen die Aktivistinnen Krista Suh and Jayna Zweiman über einen Rückzugsort, der friedlich war und Wärme spendete, wo Ideen ohne Angst, verurteilt zu werden, geteilt werden konnten. Wo Zeit war, um durchzuatmen und ernsthafte Gespräche zu führen. Und wo sich Wollgarn stapelte, denn hier war das sogenannte Pussyhat-Projekt entstanden, die pinkfarbenen, handgestrickten Mützen, die für Solidarität und Frauenrechte standen. In dem Strickladen in Los Angeles hatten die Frauen mit zunehmender Sorge beobachtet, wie erfolgreich der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump war, trotz seiner frauenverachtenden Aussagen und Handlungen. Die Pussyhats spielten auf Trumps Worte an, Frauen einfach in den Schritt greifen zu können. Sie waren aber auch der Versuch, sich das Wort Pussy, ein Synonym für die Vulva, zurück anzueignen.
Die Frauen entwarfen ein einfaches Design für die Mützen mit den kleinen spitzen Ecken wie zwei Katzenohren, setzten eine Webseite und einen Instagram-Account auf, informierten andere Strick-Communitys, und das Projekt ging viral. Als am 21. Januar Menschen in Washington, D.C., und später in vielen anderen Städten weltweit demonstrierten, waren die Mützen das zentrale Erkennungsmerkmal der sogenannten Women’s Marches, Frauenmärsche also, von Neuseeland bis Deutschland. Einige der Mützen wurden von den Strickerinnen und Strickern mit kleinen Botschaften versehen, bevor sie per Post an ihre Adressaten gingen. Es ging darin um sexualisierte Gewalt,[1] Frauenrechte, Menschenrechte. Ein Netzwerk entstand, das sich Mut zuflüsterte, Monate bevor das Hashtag #MeToo[2] diese Funktion übernahm.
Ich arbeitete zu der Zeit bei der Wochenzeitung der Freitag und wurde gebeten, den Leitartikel zu schreiben, also den wichtigsten Kommentar der Ausgabe – ein Privileg, das eher Ressortleitern, Herausgebern oder Chefredakteuren und altgedienten Autorinnen und Autoren zustand. Aber unter den Protestierenden aller Geschlechter waren eine Menge jüngerer Frauen, also wollte man offensichtlich hören, was eine jüngere Frau dazu zu sagen hatte. Es war, als hätte man mir ein kleines Stückchen der Macht zugeteilt, die sich da gerade vor aller Augen entfaltete.
Erst später, als das Hashtag #MeToo Fahrt aufnahm und ich recherchierte, statt zu kommentieren, verstand ich wirklich, warum sich da eine so große Masse formierte. Woher die Wut kam, woher die Kraft. Was dahinterstand. Es ging nicht nur um einen sexistischen Spruch eines US-amerikanischen Präsidentschaftskandidaten. Es ging nicht nur um Sexismus[3] und Missbrauch. Es ging um Privilegien, Macht und den Kampf darum, wie diese künftig verteilt werden sollte. Menschen, die missbraucht worden waren, diskriminiert, die ein ganzes Leben lang immer wieder als Menschen zweiter Klasse behandelt worden waren, die gegen ihren Willen angesprochen und angefasst worden waren, gegen ihren Willen bewertet und sexualisiert, gegen ihren Willen beschämt und verletzt: Sie entschieden, gegen all das etwas zu unternehmen, und zwar indem sie überhaupt erst einmal begannen, darüber zu sprechen. Und je mehr Menschen unter dem Hashtag #MeToo von ihren Erfahrungen und Erinnerungen berichteten, umso deutlicher wurde das Ausmaß dessen, was so lange verschwiegen worden war.
Missbrauch existiert überall. Beruflich, privat und oftmals in den Graubereichen dazwischen. Missbrauch existiert im Untersuchungszimmer beim Arzt, in Chefetagen viele Stockwerke über der Stadt, im Niedriglohnsektor, in Universitäten, in der Medienbranche, im Musik-, Tanz-, Literatur- und Modebetrieb, im Film und am Theater, im Sport, in der Gastronomie, bei den Pfadfindern, in der Kirche, auf Campingplätzen, in der Pflege, in Kitas, bei der Polizei, in Anwaltsbüros, zu Hause. Er trifft Kinder, seltener Männer, mehrheitlich Frauen, weiblich gelesene Menschen, Mütter, Alleinstehende, Alte und Junge, Arme und Reiche, Starke und Schwache, Menschen mit viel oder wenig Geld, Menschen mit Villen oder in Notunterkünften, Menschen auf der Flucht, queere Menschen, People of Color, Schwarze Menschen, Menschen mit Behinderung, Mehrheiten, Minderheiten. Er findet in allen politischen und weltanschaulichen Spektren statt, links, rechts und in der Mitte.[4]
#MeToo. Was genau ist damit gemeint? Im allgemeinen Sprachgebrauch wird das Schlagwort im beruflichen Kontext verwendet, wenn etwa ein Chef seine Macht gegenüber ihm unterstellten Frauen missbraucht hat oder mächtige Männer aus dem Kulturbetrieb ihren Einfluss. Es geht um Sicherheit am Arbeitsplatz. Und auch wenn die Grenzen des Sag- und Machbaren ausgelotet werden, spricht man von #MeToo; wenn bestimmt werden soll, wo der Flirt aufhört und der Übergriff beginnt, wann Sex einvernehmlich ist und ab wann es sich um eine Vergewaltigung handelt.
Diese Vorwürfe sind zugleich nur ein Bruchstück dessen, worum es geht. Denn #MeToo bedeutet: »Ich höre, was du erzählst. Ich erkenne mich darin wieder. Auch mir ist so etwas widerfahren.« Deshalb sollte man den Begriff MeToo sehr viel breiter denken. Auch wenn Männer ihre Partnerinnen krankenhausreif prügeln, ist das MeToo. Auch Stalking ist MeToo oder wenn ein Mob sich im Internet organisiert, um Frauen des öffentlichen Lebens mundtot zu machen. Und auch Missbrauch von Kindern fällt darunter. Der Begriff bezeichnet eine große Bandbreite kollektiver Erfahrungen von Übergriffen, Missbrauch und Gewalt, die durch systematische Fehler entstanden und normalisiert worden sind. Diese Normalisierung zu durchbrechen, ist der Antrieb der MeToo-Bewegung, die disruptive Kraft, die sie entfaltet. Es ist eine emanzipative Bewegung, die die Scham und zugeschriebene Mitschuld ablehnt und die Veränderungen und Gerechtigkeit einfordert.
MeToo ist sehr viel mehr als ein Hashtag oder ein Kampagnen-Schlagwort: Es ist eine soziale Bewegung.[5] Menschen auf der ganzen Welt haben ihre Stimme erhoben, vor allem Frauen. Sie leben in unterschiedlichen Ländern, sprechen unterschiedliche Sprachen, beziehen unterschiedliche Gehälter, leben in unterschiedlichen politischen Systemen und kommen aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Und dennoch haben ihre Geschichten viele Gemeinsamkeiten. Es geht um andere Menschen, meist Männer, die sich ihnen gegenüber übergriffig verhalten und die Grenzen ihrer seelischen und körperlichen Selbstbestimmung missachtet haben, die ihre Macht missbraucht haben. Es handelt sich um eine universelle Erfahrung. Oft wird der MeToo-Bewegung vorgeworfen, alles in einen Topf zu werfen, von der blöden Anmache bis zur Vergewaltigung, und damit ungenau und vorverurteilend zu werden. Dabei wird übersehen, dass die Bandbreite dieser Erfahrungen zu ein und demselben System gehört und Menschen, die davon betroffen sind, darüber miteinander verbunden sind.[6]
Aus individuellen Erfahrungen wird ein Kollektiv, es werden Systeme von Opfern und Tätern sichtbar. »Schreiben Sie über das System«, hörte ich immer wieder, auch von mutmaßlich Betroffenen,[7] die sich nicht zitieren lassen wollten. Und natürlich ist das ein Teil von MeToo. Die ersten Enthüllungen über Harvey Weinstein, dessen Verurteilung in New York wegen eines Verfahrensfehlers mittlerweile im Berufungsverfahren aufgehoben wurde, der aber wegen einer Verurteilung in Kalifornien weiter in Haft ist, handelten nicht nur von seinen Verbrechen. Sondern davon, wie er sie über etliche Jahre mithilfe anderer Menschen unter den Teppich gekehrt hatte. Das System aus Geld und Schweigeverträgen war die eigentliche Geschichte.[8] Aber nur über das System zu schreiben, wird nichts verändern. Missbräuchliche Handlungen haben am ehesten Konsequenzen, wenn Namen genannt werden. Es steckt eine ungeheure Kraft in der Präzision, zu sagen oder zu schreiben: Diese Person hat sich gegenüber dieser anderen Person an jenem Tag in diesem Raum mutmaßlich unangemessen verhalten, und das sind die Hinweise darauf, dass es sich so zugetragen haben könnte.
Wenn man nur über Systeme schreibt, ist es einfach für Institutionen und einzelne Personen, sich nicht verantwortlich zu fühlen. Man kann lange Artikel über häusliche Gewalt schreiben, belegt mit Zahlen, Studien und Expert:innen und Frauen, die anonym über Männer berichten, die ebenfalls anonym bleiben. Man wird dafür Zuschriften dankbarer Leserinnen erhalten, in denen sinngemäß steht: »Genauso ist es mir ergangen. Ich habe Angst, meinen Fall öffentlich zu machen, aber danke, dass Sie darüber aufklären.« Mehr passiert in der Regel nicht. Die Zahlen und Fakten über Gewalt und Missstände sind mittlerweile bekannt. Dass ein ganzes Land wochenlang über mutmaßliche Missstände diskutiert, passiert, wenn Namen fallen. Julian Reichelt. Oder Till Lindemann. Oder Jérôme Boateng. Und dann wird es auf einmal konkret: Was soll diese Person getan haben? Stimmt das? Und wenn ja: Ist das okay oder nicht? Braucht es bessere Gesetze oder Regelungen, um etwas zu verändern?
Die mutmaßlichen Übergriffe und Taten, über die berichtet wird, reichen von Machtmissbrauch über verbale Anzüglichkeiten, unangemessen intime Fragen, über Grapschereien, ungewollte Berührungen oder psychische Manipulation bis hin zu Schlägen oder Vergewaltigungen. Es geht um alltägliche Anzüglichkeiten, mal um eine Hand auf der Schulter oder einen Blick auf das Dekolleté, mal um Massenvergewaltigungen. Es geht um Miniröcke und Frauenhäuser, EU-Verordnungen und Strafrecht, Rassismus und reproduktive Rechte. Es geht um Feminismus und Antifeminismus. »My body my choice« gegen »Dann mach doch die Bluse zu«.[9] Es geht um das große Ganze, das Geschlechterverhältnis, die Spannbreite zwischen der Frage, ob jetzt nicht mehr geflirtet werden und wie man das Patriarchat abschaffen kann. Und seit Kurzem geht es auch um Übergriffe im Zusammenhang mit einer toxischen Kultur am Arbeitsplatz.
Die MeToo-Debatte wird auch deshalb so umfassend geführt, weil so viele Menschen das, was diskutiert wird, selbst kennen, weil sie es wiedererkennen. Das Thema betrifft uns alle, als Opfer,[10] Täter, Zuhörer und Zuschauerinnen. Darum ist es so einfach, eine Haltung dazu einzunehmen. MeToo ist politisch, aber immer auch persönlich. Viel hat sich verändert, aber wer den Mund aufmacht, um sich zu wehren, muss bis heute damit rechnen, selbst beschuldigt, beschimpft und beschämt zu werden. MeToo hat die Kraft, ganze Gesellschaften zu verändern. Deshalb hat die Bewegung mächtige Gegner und Gegnerinnen auf den Plan gerufen, die mit diesen Veränderungen nicht einverstanden sind: Journalistinnen und Anwälte, Politiker und Prominente, darunter all diejenigen, die sich zu Unrecht beschuldigt sehen (und so sehen es die allermeisten unter ihnen).
Ich hatte schon länger zu dem Thema gearbeitet, als mich die Recherchen zu Julian Reichelt in die Öffentlichkeit katapultierten. Plötzlich war ich nicht mehr nur Rechercheurin und Triebkraft hinter einer Enthüllung, sondern selbst Gegenstand der Beobachtung. »Ich wünsche dir, dass dein Name niemals auf Twitter trendet«, sagte mir ein Kollege, an den ich mich in dieser Zeit ratsuchend wandte. Diese Tage fühlten sich überwältigend und angsteinflößend an. Ich wusste schon zuvor um die Macht der Presse. Aber es war das erste Mal, dass ich klar und deutlich spürte, welche Kraft Recherche und Journalismus entfalten können – und wie sich Kontrollverlust durch den Medienbetrieb anfühlt.
Was ich in dieser Zeit aber auch verstand: Medienaufmerksamkeit wird unfair verteilt. Was war mit den vielen Personen, denen ich und andere Kolleginnen in der Vergangenheit zugehört hatten und für deren Schicksale sich so wenige Menschen zu interessieren schienen? Ich erinnerte mich an eine Recherche, für die ich mit vielen schwulen Männern gesprochen hatte und in die ich etliche Monate Zeit und Energie gesteckt hatte. Als mich eine Kollegin für eine renommierte journalistische Konferenz einlud, freute ich mich. Ich verkehrte kaum in derart etablierten Kreisen. Es war eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit für die mühsame Recherche und ein Thema zu erhalten, das bisher eher unter dem Radar gelaufen war. Dann folgte eine E-Mail mit einer Absage. Ich war enttäuscht.
Bei der Recherche zu den Machtmissbrauchsvorwürfen um den damaligen Bild-Chef Julian Reichelt fiel mir die Aufmerksamkeit ungefragt zu. Was war, fragte ich mich in den Wochen und Monaten danach, der richtige Umgang mit dem Thema? Musste ich diese neue Reichweite nutzen, um noch viel mehr zu recherchieren? Würde die Öffentlichkeit unseren Quellen[11] weiterhin zuhören, auch wenn es sich um einen weitaus weniger prominenten Fall handelte? Und wie sollte ich all den Menschen, die sich nun an mich wandten, gerecht werden? Zugleich erreichten mich immer wieder und bis heute ähnlich lautende Fragen: »Wie entscheiden Sie, wann etwas veröffentlicht werden kann? Wie stellst du sicher, dass die Quellen nicht lügen? Was hat sich durch MeToo verändert?« In dieser Zeit entstand die Idee, all dies in einem Buch niederzuschreiben.
Auch wenn es bis heute mit vielerlei Tabus belegt ist, über sexualisierte Gewalt zu sprechen, ist es seit MeToo einfacher geworden. Dass Sexismus ein Teil der Gesellschaft ist, ist weitgehend Konsens. Dass sich daran etwas ändern sollte, auch, zumindest in der Theorie. Es gibt mehr Beschwerdestellen und Hilfsangebote, mehr Aufarbeitung von MeToo-Vorwürfen, mehr Verständnis: in Betrieben, aus der Politik, medial. Einige Missverständnisse, wie dass der typische Täter ein fremder Psychopath ist, der wehrlose Frauen in dunklen Straßen angreift, sind dabei, ausgeräumt zu werden. Betroffene und mutmaßlich Betroffene sind selbstbewusster geworden, zunehmend fordern sie mehr Platz, Aufmerksamkeit und Gerechtigkeit in der Öffentlichkeit ein – nicht nur über etablierte Medien, sondern auch selbstständig, über soziale Netzwerke. Auch die Presse nimmt das Thema sehr viel ernster als noch vor einigen Jahren und investiert mehr Recherchekapazitäten. Je lauter und selbstbewusster all diese Stimmen werden, umso rauer wird der Gegenwind. Während MeToo sich als soziale Massenbewegung etabliert hat, sind auch Strukturen entstanden, die dagegenwirken wollen. Denn in großen Zusammenhängen wird Opfern von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch geglaubt. Im Detail aber wird ihnen misstraut.
In den folgenden Kapiteln beschreibe ich, was ich über die Jahre erlebt und gelernt habe, wie MeToo entstanden ist und wie es sich verändert hat, welche Kräfte dahinter wirken. Es geht um Schuld und Scham, Macht und Ohnmacht, um Überlegenheit und Erniedrigung, um Gerechtigkeit und Mut, Gewalt und Backlashs. Es geht um Veröffentlichungen, welche die Kraft haben, Gesellschaften zu transformieren. Und es geht um die vielen Stimmen derjenigen, die sich erhoben haben und teils wieder zum Schweigen gebracht werden sollen. Dies ist kein Enthüllungsbuch voll neuer Details zu vergangenen Recherchen. Es würde den Rahmen sprengen und oftmals dem Schutz der Quellen, den ich zugesichert habe, widersprechen, hier detailliert die Hintergründe vergangener besonders brisanter Veröffentlichungen nachzuzeichnen.
Grundlage dieses Buches sind Erfahrungen, die ich zu einer größeren Erzählung zusammenbinden möchte. Es sind Recherchen, die viele Kolleginnen und Kollegen und gelegentlich auch ich öffentlich gemacht haben, teils gemeinsam. Aber auch solche, die sich bis heute fest verschlossen in meinen Unterlagen befinden, aber mir einen Eindruck vermittelt haben über die Gefahren, Hürden und Chancen der MeToo-Bewegung. Dieses Buch basiert auf Notizen, Audioaufnahmen und Dokumenten vergangener Recherchen und Veröffentlichungen und natürlich auf dem Wissen aus etlichen Artikeln und Büchern von Kolleginnen, Kollegen, Expertinnen und Experten. Mit einigen von ihnen habe ich für dieses Buch gesprochen, sie werden ausführlicher zitiert. Anderes hatte ich aufgeschrieben und wieder verworfen, und wieder anderes werde ich vermutlich nie veröffentlichen können.
Es gehört bei dieser Form von Journalismus zum Tagesgeschäft, die Grenzen des Sag- und Schreibbaren auszuloten, und dennoch ist es jedes Mal eine Gratwanderung. Nur ein Teil von MeToo-Recherchen fließt in einen Text, viele Teile bleiben im Verborgenen. Es gibt viele Menschen, die helfen, diese Grenzen auszuloten, und ohne sie wäre dieses Buch nicht möglich gewesen: Kolleginnen, Chefs, Rechtsabteilungen. Über MeToo zu berichten, kann eine einsame Tätigkeit sein, und zugleich ist es immer Teamarbeit.
Von anderer Seite wird vielleicht argumentiert werden, dieses Buch schlage sich auf die Seite der Betroffenen und mutmaßlich Betroffenen. Ich möchte vorsorglich erwidern: Es gibt die Pflicht zur Objektivität im Journalismus, nicht zur Neutralität. Es gibt die Pflicht, bei den Fakten zu bleiben und sich an die Regeln zu halten, aber nicht die, keine Haltung zu haben. Es gibt die Pflicht, alle Seiten anzuhören und verschiedene Perspektiven zu verstehen, aber keine Pflicht, mit allen Perspektiven zu sympathisieren. Niemand muss Verständnis für gewaltsame Handlungen haben, auch eine Journalistin nicht.
Ich hoffe, dass dieses Buch Verständnis weckt, statt Fronten zu verhärten. Dass es einordnet, statt anzuheizen. Und dass es Denkanstöße bietet, statt Vorurteile zu bestätigen. Ich wünsche Ihnen eine bereichernde Lektüre.
EINS PROTEST
Von #aufschrei zu #MeToo: Eine neue Bewegung formiert sich analog und digital, um auf ein altes Problem aufmerksam zu machen
Wer verstehen will, wie MeToo 2017 zu einer der wichtigsten sozialen Bewegungen unserer Zeit wurde, muss einen Blick in die Vergangenheit werfen. Viele Marker ebneten den Weg, bevor sich die globale Debatte über Sexismus, Übergriffe und sexualisierte Gewalt mit eruptiver Kraft weltweit Bahn brach. MeToo begann nicht in Hollywood und nicht mit den Berichten etablierter Medien über einflussreiche Männer. MeToo begann im Internet und mit einem Gedanken, bei dem es um Empathie ging: »Mir ist so was auch passiert. Me Too. Ich höre dich, ich sehe dich, und ich glaube dir.«[1] So formulierte es die US-amerikanische Aktivistin Tarana Burke, die den Begriff 2006 verwendete, im Schulunterricht und auf Myspace. Ihr Ziel war es, marginalisierten Schwarzen Frauen und Mädchen aus ihrer Community zu helfen, die wie sie selbst sexualisierte Gewalt erlebt hatten.
Über die Jahre waren in unterschiedlichen Ländern mehr oder weniger zufällig Zusammenschlüsse entstanden, die mit vergleichbaren Formeln auf das immer gleiche Problem aufmerksam machten: dass Übergriffe zur Alltagserfahrung von Frauen und Mädchen gehörten und dass über Missbrauchserfahrungen viel zu wenig gesprochen wurde im Verhältnis dazu, wie häufig sie passierten. 2005 fuhr eine Frau mit Anfang 20 namens Thao Nguyen in der New Yorker U-Bahn, als ein Mann sich ihr gegenübersetzte und zu masturbieren begann. Mit ihrer Handykamera machte sie ein Foto von ihm. Dann ging sie zum nächsten Polizeirevier, erzählte sie später, doch erfuhr dort offenbar nur, dass man ihr nicht weiterhelfen könne. Ein Fehler, denn das Verhalten des Mannes war mindestens ordnungswidrig. Und so endete das Foto auf der Titelseite der New York Daily News mit der Titelzeile: »Enthüllt! Mutiges Opfer eines U-Bahn-Exhibitionisten dreht den Spieß um und knipst Bild des perversen Verdächtigen«.[2] Es war der Anlass für eine sehr viel größere Bewegung gegen öffentliche Belästigung, kurz darauf gründete sich die Organisation Hollaback!, übersetzt: Schrei zurück. Und im Internet entstanden unter diesem Schlagwort Blogs, auf denen Menschen Erfahrungen veröffentlichten, welche der von Nguyen ähnelten.
Als 2010 Vergewaltigungsvorwürfe gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange öffentlich wurden, nutzte die schwedische Journalistin Johanna Koljonen den Anlass, eigene Erfahrungen eines mutmaßlichen Missbrauchs öffentlich zu machen. Sie setzte sich anhand persönlicher Erinnerungen mit der Frage auseinander, wo die Grenzen zwischen einer Vergewaltigung und einvernehmlichem Sex verlaufen. Assange bestritt die Vorwürfe damals und auch in den Jahren danach, ein Ermittlungsverfahren in Schweden dazu wurde 2019 wegen mangelnder Beweise eingestellt. Doch Koljonen hatte einen Nerv getroffen, der die schwedische Öffentlichkeit bewegte, und so entstand Ende 2010 in Schweden das Hashtag #prataomdet, übersetzt in etwa »sprich darüber«. Etablierte Medien griffen das Thema auf, es folgten Kolumnenbeiträge, später auch Preise für die Initiatorinnen der Kampagne, mit #talkaboutit eine englischsprachige Version des Hashtags. Schon damals war Beobachter:innen klar, dass sich etwas Neuartiges abzeichnete: Sie sehe etwas Historisches geschehen, zitierte die schwedische Zeitung Svenska Dagbladet eine Medienforscherin.[3]
Im Frühjahr 2012 trendete #ididnotreport auf Twitter. Unter dem Hashtag berichteten vor allem Frauen darüber, warum sie sexuelle Übergriffe in der Vergangenheit nicht gemeldet hätten. Etliche der Tweets sind auf Blogs wie Women’s Views on News dokumentiert, viele kann man bis heute auf X (ehemals Twitter) nachlesen. Weil ich ein Kind war, steht dort. Weil ich dachte, es sei normal. Weil ich niemanden hatte, an den ich mich wenden konnte. Weil ich glaubte, es sei meine Schuld. Weil ich mich schämte. Weil ich Angst hatte, dass mir Rache unterstellt wird. Oder: Weil ich erst später verstand, was geschehen war. In Frankreich waren ähnliche Berichte unter #jenaipasportéplainte (übersetzt: Ich habe keine Anzeige erstattet) zu lesen, auch in Italien und Spanien gab es vergleichbare Einträge. International kamen unzählige solcher Schilderungen zusammen.
Frauenhilfsorganisationen, feministische Zusammenschlüsse oder Aktivistinnen aus unterschiedlichen Ländern hatten diese Internetkampagnen teils lanciert und unterstützt. Sie wollten das Schweigen brechen und der Öffentlichkeit bewusst machen, wie groß das Ausmaß sexualisierter Gewalt wirklich war. Auch in Deutschland wurden etliche Tweets unter dem Hashtag #ichhabnichtangezeigt veröffentlicht. Und auf dem Blog ausopfersicht.wordpress.com häuften sich kritische Berichte über das deutsche Justizsystem – nicht nur über Belästigung im öffentlichen Raum, sondern auch über schwerwiegende Straftaten. Nachzulesen waren dort mutmaßliche Auszüge von Einstellungsbescheiden wie in diesem Beitrag vom 30. Juli 2012: »Sie empfanden die Handlungen des Beschuldigten als abstoßend und verkrampften sich für ihn erkennbar. Dass der Beschuldigte dennoch weiterhin versuchte, den Vaginalverkehr durchzuführen und dabei auch oberflächlich eindringen konnte, stellt jedoch keine gewaltsame Erzwingung dieser sexuellen Handlung dar. Es kann dahingestellt bleiben, ob das Spreizen Ihrer Beine durch den Beschuldigten objektiv eine Gewaltanwendung im Rechtssinne darstellt.«[4]
Im gleichen Jahr gründete die britische Autorin und feministische Publizistin Laura Bates das Everyday Sexism Project: eine Plattform, auf der Frauen aus der ganzen Welt anonym oder mit Klarnamen ihre Erfahrungen von Alltagssexismus veröffentlichen können, bis heute ist die Webseite in mehr als einem Dutzend Sprachen verfügbar. Der Anlass dafür war eine persönliche Erfahrung in London, die Bates so erzählte: Im Bus auf dem Weg nach Hause telefonierte sie mit ihrer Mutter, als ein Mann anfing, ihr Bein zu berühren. »Und weil ich mit meiner Mutter telefonierte, sprach ich aus, was passierte, und sagte: ›Diese Person fasst mich an.‹ Und es hat mich wirklich getroffen, dass niemand in dem Bus etwas getan hat, sie haben alle weggeschaut.«[5] Danach habe sie ihre Freundinnen gefragt, ob sie schon einmal etwas Ähnliches erlebt hätten. Bates stellte fest, dass sie nicht allein war – und dass derartige Übergriffe offenbar so normalisiert waren, dass über sie nicht geredet wurde. Neben der Plattform lancierte Bates Anfang 2013 das Hashtag #ShoutingBack, was man mit »Zurückschreien« übersetzen kann. Dieses entsprach dem wachsenden Zeitgeist von vor allem Frauen, die sich gegen die alltäglichen Übergriffe zur Wehr setzten, statt sie weiter stumm zu ertragen – und die zu entdecken begannen, dass sie am meisten verändern konnten, wenn sie dies öffentlich taten.
Feministinnen aus Deutschland, die sich über Blogs und auf Twitter vernetzten, beobachteten sehr genau, wie sich Hunderte, dann Tausende Stimmen zu Bates’ Aktionen mit eigenen Erfahrungen zu Wort meldeten und die Debatte an Fahrt gewann. Und sie verstanden, genauso wie andere feministische Aktivistinnen wie etwa die US-Feministin Jaclyn Friedman, wie sich digitale Medien erfolgreich nutzen ließen. Auf alltagssexismus.de (mittlerweile nur noch über Internet-Archive verfügbar) sammelten sich nach internationalem Vorbild die Berichte aus dem deutschsprachigen Raum, und etablierte Medien griffen die Themen auf.
SPIEGELONLINE berichtete über das Hashtag #YesAllWomen, das sich im Mai 2014 auf den Amokläufer von Santa Barbara bezog. Dieser tötete durch einen Amoklauf mit einer halbautomatischen Waffe sechs Menschen, verletzte mehr als ein Dutzend weitere und hinterließ ein rund 140-seitiges Manifest voller Frauenhass.[6] Mit dem Hashtag bezogen unzählige Nutzer:innen Stellung zu dem Argument, nicht alle Männer würden derartige Taten begehen – aber durchaus alle Frauen hätten gewalttätiges Verhalten gegen sich zu befürchten.
Auf Tagesschau.de war 2013 nachzulesen, wie sich One Billion Rising in Deutschland etablierte: eine globale Protestform, welche jährlich am Valentinstag darauf aufmerksam machte, dass nach einer UN-Statistik weltweit mehr als eine Milliarde Frauen Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt geworden waren – und dass auch in Deutschland Gewalt gegen Frauen öfter vorkam, als viele dachten.[7]
In der Süddeutschen Zeitung wurde in Anlehnung an das Hashtag #ichhabnichtangezeigt erklärt, warum so viele Vergewaltigungen in Deutschland nie ans Licht kamen. Weil viele Opfer unter anderem aus Scham gar nicht erst zur Polizei gingen, weil sie etwa den Täter gut kannten, weil viele Anzeigen nicht zu einer Anklage vor Gericht führten und Sexualdelikte sehr schwierig zu beweisen waren.[8] Und im Januar 2013 veröffentlichte Annett Meiritz, Journalistin bei SPIEGELONLINE, einen viel beachteten Artikel über ein frauenfeindliches Klima und Sexismus in der Piratenpartei. Darin beschrieb sie, wie männliche Parteimitglieder versucht hatten, sie als Journalistin zu diskreditieren, und als Prostituierte bezeichnet hatten. »Lange dachte ich, dass der Politikbetrieb, wie wir ihn heute in Berlin kennen, nichts mehr mit der Bonner Machowelt zu tun hat«, schrieb Meiritz. »Haben wir nicht eine Bundeskanzlerin? Beschreiben nicht Korrespondentinnen die Euro-Krise? Kümmern sie sich nicht längst um die sogenannten harten Themen, die einst als Domäne der Männer galten?« Im Text schilderte sie anonymisierte Erfahrungen aus ihrer Berufswelt: von einem Bundesminister, der sie zur Begrüßung extrafest an der Taille gepackt habe. Von einer Volontärin, der ein Spitzenpolitiker nach einem Arbeitsessen »Ich vermisse deine Nähe« gesimst habe. Von einem Europaparlamentarier, der ihr im Vorbeigehen eine Visitenkarte in die Hand gedrückt, sein Gesicht nah an sie herangeschoben und gemurmelt habe: Sie könne sich immer melden. Egal, worum es geht. »Passiert alles, noch immer, ist nicht vorbei«, resümierte Meiritz. Und fragte: »Hat sich wirklich so viel geändert?«[9]
Internationale Proteste
Wie bei One Billion Rising beschränkten sich öffentliche Protestformen in dieser Zeit nicht nur auf das Internet. Anfang 2011 hielt der Polizeibeamte Michael Sanguinetti zusammen mit einem Kollegen einen Vortrag über präventive Verbrechensbekämpfung an der Juristischen Fakultät der York Universität in Toronto, Kanada. Sein Rat wurde in den Medien wie folgt zitiert: »Man hat mir gesagt, dass ich das nicht sagen sollte – aber Frauen sollten es vermeiden, sich wie Schlampen zu kleiden, um nicht Opfer von Übergriffen zu werden.«[10] Der Polizist entschuldigte sich später, aber seine Sätze lösten weltweit Proteste aus. Viele Menschen, vor allem Frauen, zogen durch die Straßen, es wurde gesungen, gefeiert, protestiert. Einige trugen Schilder, auf denen sie eigene Missbrauchserfahrungen öffentlich machten, andere pochten auf ihr Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Und wieder andere nahmen das selbsterklärte Ziel der Märsche, sich den Begriff Schlampe wieder anzueignen, wörtlich und kamen in Netzstrümpfen, Stilettos, Unterwäsche oder Badekleidung.[11] Kein noch so kurzer Minirock darf sexuelle Übergriffe rechtfertigen, lautete die Botschaft. Die sogenannten Slutwalks fanden in den großen Metropolen der Welt statt: in New York, London und Melbourne, in Genf und Buenos Aires, in Seoul und Neu-Delhi, in Singapur und Jerusalem.
Auch in Deutschland gingen Menschen auf die Straße. Am 13. August 2011 versammelten sich vor allem Frauen in rund einem Dutzend deutscher Städte, mitorganisiert unter anderem von der Autorin und feministischen Aktivistin Anne Wizorek. Bilder aus der Zeit zeigen junge, selbstbewusste Frauen, welche in diesem Sommer Anfang des Jahrzehnts Sprüche auf ihre teils halb nackten Körper geschrieben hatten oder Plakate in die Höhe hielten mit Slogans wie: »Nein heißt Nein« oder »Mein Arsch gehört mir«.
Nur wenige Jahre später gingen unter dem Slogan »ni una menos« (nicht eine weniger) Hunderttausende Menschen in Lateinamerika auf die Straße. Die 14-jährige Chiara Páez war in Argentinien von ihrem Freund erschlagen worden, weil sie keine Abtreibung vornehmen lassen wollte, wie Medien berichteten. Dieser Vorfall lieferte den Anstoß für Massenproteste gegen die steigenden Zahlen von Femiziden, also Ermordungen von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Seit über einem Jahrzehnt werden in Argentinien jährlich mehr als 250 Femizide registriert, die lateinamerikanische Frauenrechtsbewegung, die damals in Antwort auf diese Entwicklung entstand und auch weitere soziale Themen unter sich vereinte, gilt heute als eine der wirkmächtigsten der Welt.[12] Auch aus Deutschland sind derartige Zahlen bekannt, fast jeden dritten Tag wird hier eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet, ein Umstand, der bis heute aber weder Massenproteste bewirkte noch einen eigenen Straftatbestand darstellt.[13]
Im Dezember 2012 löste die Massenvergewaltigung einer Inderin in Neu-Delhi weltweit Wut und Erschütterung aus. Sechs Männer hatten die Anfang 20-jährige Jyoti Singh derart brutal vergewaltigt und gefoltert, dass sie an ihren inneren Verletzungen starb. Vier von ihnen wurden später zum Tode verurteilt. Auch in Neu-Delhi gingen Menschen auf die Straße, weil es sich nicht um einen Einzelfall handelte. Sondern weil Singhs Ermordung Ausdruck eines Systems war, das Frauen vor derartigen Misshandlungen nicht ausreichend schützte oder diese gar beförderte. Auch in den Jahren danach lösten weitere Gräueltaten immer wieder Proteste in Indien aus, darunter Berichte von durch Dorfräte angeordneten Massenvergewaltigungen minderjähriger Frauen als Form von Bestrafung.
#aufschrei
Sosehr alle diese verschiedenen Aktionen, Bündnisse und Artikel darauf hindeuteten, dass sich vor allem Frauen zunehmend gegen Gewalt und Übergriffe formierten, brauchte es immer wieder konkrete Geschichten und Gesichter, um Medien und die Öffentlichkeit aufzurütteln. In Deutschland geschah das am 24. Januar 2013. An diesem Tag kamen zwei Ereignisse zusammen. Die Social-Media-Strategin Maike Hank (mit der ich in dieser Zeit bei der Zeitung der Freitag zusammenarbeitete) hatte einen Artikel auf dem feministischen Blog kleinerdrei.org veröffentlicht, in dem sie auch von ihren eigenen Belästigungserfahrungen erzählte. Über das Hashtag #ShoutingBack von Laura Bates schrieb sie: »Was hält uns davon ab, dort mitzumachen? (…) Ebenso denkbar wäre es, einen deutschen Hashtag ins Leben zu rufen.«[14]
Kurz nach Mitternacht schrieb Anne Wizorek, eine der Mitgründerinnen des Blogs: »Wir sollten diese Erfahrungen unter einem Hashtag sammeln. Ich schlage #aufschrei vor.«[15] Wizorek arbeitet heute als Publizistin, in einem Gespräch für dieses Buch erinnert sie sich: »Ich wollte an diesem Abend eigentlich gerade schlafen gehen, als ich den Tweet der feministischen Bloggerin Nicole von Horst las. Sie schrieb: ›Der Arzt, der meinen Po tätschelte, nachdem ich wegen eines Selbstmordversuchs im Krankenhaus lag.‹ Das war wie ein Schlag in die Magengrube. Nicole sprach etwas aus, was wir viel zu oft versuchen wegzulächeln. Ich erkannte in ihrem Tweet das Schamgefühl sexueller Grenzüberschreitungen. Und ich dachte an die gesellschaftliche Botschaft an uns, dass so etwas zum Frausein dazugehört und wir kein großes Ding draus machen sollen.« Sie habe sich von Nicoles Mut anstecken lassen, sagte sie mir, und eigene Erfahrungen geteilt. Damit war sie nicht die Einzige. »Am nächsten Tag war meine Timeline voll mit dem Thema, und ich hatte schon Medienanfragen im Postfach.«
Während sich das Hashtag auf Twitter verbreitete, veröffentlichte der Stern den Artikel der Politikredakteurin Laura Himmelreich über den FDP-Politiker Rainer Brüderle, der für die anstehende Bundestagswahl als Spitzenkandidat aufgestellt war. Schon die Ankündigung des Textes kurz zuvor hatte misogyne Kommentare im Internet ausgelöst, Bloggerin von Horst hatte auf den Blogtext bei kleinerdrei und auch die Ankündigung des Stern-Textes mit ihren Tweets reagiert. Nun war er in Gänze erschienen. Eigentlich lautete die Kernfrage des Textes, ob Brüderle für das Amt geeignet war, eine klassische politikjournalistische Frage. Das war für die Autorin mindestens fraglich, denn anhand verschiedener Beispiele zeichnete sie in ihrem Artikel das Bild eines in Klischees verhafteten Mannes, der als Gesicht der Zukunft herhalten solle. Himmelreich berichtete in ihrem Text von einem Abend 2012 in Stuttgart, wo sich gemäß Tradition die FDP zum Feiertag Heilige Drei Könige traf und abends Presse und FDP-Mitglieder an der Bar des Hotels Maritim zusammenkamen. Sie gab folgenden Dialog wieder:
Brüderle möchte wissen, woher ich komme. »München«, antworte ich.
Dort seien die Frauen eigentlich trinkfest, sagt er und blickt skeptisch auf die Cola Light in meiner Hand.
Ich sage ihm, dass ich privat, zum Beispiel auf dem Oktoberfest, durchaus Alkohol trinke. Brüderles Blick wandert auf meinen Busen.
»Sie können ein Dirndl auch ausfüllen.«
Im Laufe unseres Gesprächs greift er nach meiner Hand und küsst sie.
»Ich möchte, dass Sie meine Tanzkarte annehmen.«
»Herr Brüderle«, sage ich, »Sie sind Politiker, ich bin Journalistin.«
»Politiker verfallen doch alle Journalistinnen«, sagt er.
Ich sage: »Ich finde es besser, wir halten das hier professionell.«
»Am Ende sind wir alle nur Menschen.«[16]
Es ist eine Episode in einem langen Porträt über Brüderle, in dem seine politische Kompetenz hinterfragt wird und mehrere Zitate zeigen sollen, wie sehr der Mann aus der Zeit gefallen ist. Darunter, dass er das pralle Euter einer Kuh als »Körbchengröße 90L« bezeichnet haben soll. Oder eine Szene, bei der Brüderle mit dem Gesicht sehr nah an Himmelreich herangekommen sein soll und eine Sprecherin ihn mit einer Entschuldigung an Himmelreich und den Worten »Zeit fürs Bett« aus der Bar weggeführt habe. Aber der Satz mit dem Dirndl war es, der in den kommenden Wochen und Monaten zu einer Art Schlagwort der Sexismus-Debatte wurde.
Himmelreichs Artikel und die zeitgleiche Debatte von Feministinnen auf Twitter leiteten das Wahljahr 2013 mit einem Paukenschlag ein. »Die #aufschrei-Debatte glich einer Intervention, es war die erste große Aktion des neuen Feminismus«, schreibt die Journalistin Stefanie Lohaus.[17] Innerhalb weniger Tage wurden rund 50 000 Tweets unter dem Hashtag verfasst, damals eine rekordverdächtige Menge. Plötzlich waren Sexismus und Übergriffe in Deutschland das Gesprächsthema Nummer eins – medial, politisch, öffentlich und privat. Die Bild-Zeitung druckte ein Bild von Himmelreich und Brüderle auf der Seite eins ab und titelte: »Brüderle und die Reporterin«.[18] Günther Jauch lud zum Thema »Herrenwitz mit Folgen – hat Deutschland ein Sexismus-Problem?« in seine Talksendung ein. Anne Will fragte in der ARD »Sexismus-Aufschrei – hysterisch oder notwendig?«, und bei Maybrit Illner hieß es: »Schote, Zote, Herrenwitz – Ist jetzt Schluss mit lustig?« Denn witzig war all das in der Tat lange für viele gewesen. Etwa für die Fernsehmoderatoren Joko und Klaas, als sie 2012 in ihrer ZDF-Sendung »neoParadise« eine Trau-dich-Wette geschlossen hatten, in der Klaas seinen Kollegen Joko herausforderte, einer Messehostess an Brüste (»Moppelklampen«) und Po zu fassen. Die Berührungen wurden laut ZDF nur angedeutet, Joko und der Frau war all das offenbar gleichermaßen unangenehm, er lief danach entschuldigend weg, die Frau lächelte gequält. Klaas sagte: »Gott, aber der war das auch so unangenehm. Die stand da wirklich und hat sich richtig entwürdigt gefühlt. Die fährt jetzt gleich nach Hause, und dann wird die schön heulen unter der Dusche, die steht jetzt sechs Stunden lang unter der Dusche.«[19] Die ganze Aktion fasst rückblickend den damaligen Wissenstand zu dem Thema treffend zusammen. Sexualisierte Übergriffe, so die Annahme, waren etwas, worüber die Öffentlichkeit gern lachte.
Nach #aufschrei wurde diese These auf den Prüfstand gestellt, allerdings wurden längst nicht nur die vermeintlich humorlosen Feministinnen dazu befragt. Um eine mediale Plattform zu erhalten, schien es, brauchte es keine Expertise zu dem Thema – es reichte die Bereitschaft, über persönliche Erfahrungen und die eigene Sicht auf Dinge öffentlich zu plaudern, Teil des Geschlechterverhältnisses war schließlich jede und jeder. Vielfach ging es um Ängste, Wut, Gefühle und Meinungen, wenig um Fakten und fachliche Informationen.[20] Zugleich wurden weiterhin etliche teils anonyme Berichte über Missbrauchserfahrungen in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Über die Hand des einen Kollegen damals, den Spruch dieses Vorgesetzten, das unangenehme Familientreffen mit diesem bestimmten Onkel, die toxische Beziehung[21] mit diesem einen Ex-Partner, über die Erzählungen einer Nachbarin, eines besten Freundes, einer Arbeitskollegin, an all das wurde sich nun wieder erinnert. Und so formierten sich unterschiedlichste Haltungen und Meinungen aus einem dichten Geflecht aus persönlicher Nähe und Betroffenheit.
Musste die Debatte über Grenzüberschreitungen, Übergriffe und Missbrauch persönlich geführt werden, um Aufmerksamkeit zu erhalten? »Aus feministischer Perspektive finde ich: Keine betroffene Person sexualisierter Gewalt hat die Verpflichtung, sich so verletzlich und angreifbar zu machen«, sagte mir Anne Wizorek im Gespräch für dieses Buch. »Heutzutage kennen wir die ganzen Zahlen zu sexualisierter Gewalt, die sind omnipräsenter als damals. Und trotzdem verstehen wir erst über eine persönliche Erzählung, was das eigentlich konkret für eine einzelne Person bedeutet. Es ist ein schwieriger Spagat.«
FDP-Politiker sahen den Artikel des Stern als Tabubruch und als den Versuch, ihre Partei zu beschädigen, die Redaktion aber stand zu ihrer Berichterstattung. Etliche Kommentare wurden seinerzeit geschrieben, schon damals gab es gespaltene Lager: auf der einen Seite Wut und Unverständnis über sexistisches Verhalten. Auf der anderen Seite Vorwürfe eines »Opfer-Diskurses«.[22] Frauen sollten sich nicht als Betroffene stilisieren lassen, sondern wehren; man müsse aufpassen, den Empörern nicht zu viel Terrain zu überlassen; man solle über echte Belästigung am Arbeitsplatz diskutieren statt über Rainer Brüderle; man dürfe charmante Äußerungen nicht als Sexismus verunglimpfen. Und dann immer wieder die Frage: ob Männer jetzt Frauen keine Komplimente mehr machen dürfen oder ihnen gar »Sippenhaft« drohe.[23]
Bundespräsident Joachim Gauck schaltete sich in die Debatte ein und bezeichnete die Sexismus-Vorwürfe gegen Rainer Brüderle als »Tugendfuror«. Mit Sicherheit gebe es in der Frauenfrage noch einiges zu tun, so Gauck. »Aber eine besonders gravierende, flächendeckende Fehlhaltung von Männern gegenüber Frauen kann ich hierzulande nicht erkennen.«[24] Eine Gruppe jüngerer, vor allem über das Internet vernetzter Aktivistinnen und Initiatorinnen des Hashtags reagierte mit einem offenen Brief an den Bundespräsidenten: »Wir vermissen in Ihren Äußerungen vor allem Feingefühl und Respekt gegenüber all den Frauen, die sexistische Erfahrungen gemacht haben«, schrieben sie. Das Wort Tugendfuror werde verwendet, um die Wut von Frauen lächerlich zu machen, er bediene damit jahrhundertealte Stereotype über Frauen.[25] Kurz darauf sagte Gauck, er halte eine Debatte über Sexismus für notwendig, auch in Deutschland gebe es noch Benachteiligung, Diskriminierung und alltäglichen Sexismus. Hatte zu Beginn von #aufschrei noch die Frage zur Diskussion gestanden, ob Alltagssexismus überhaupt ein ernst zu nehmendes Problem war, wuchs langsam das Verständnis dafür, dass womöglich etwas im Argen lag.
ZWEI ERINNERUNG
Wie erhält man mediale Aufmerksamkeit für Berichte über sexualisiere Gewalt und Übergriffe? Die #MeToo-Debatte aus den USA kommt in Deutschland an
Es ist rückblickend interessant, zu beobachten, welche Fragen die #aufschrei-Debatte bestimmten und welche nur am Rande verhandelt wurden. Gab es Sexismus? Wie sah er aus, und wenn ja: Wie schlimm war er überhaupt? Durfte man jetzt nicht mehr flirten? War es nicht unfair, Männer derart zu verunsichern? War das Ganze nicht ein bisschen überzogen? Und bitte: Profitierten Frauen nicht schließlich davon, wenn sie ihre Reize einsetzten? Weniger diskutiert wurden die Aspekte, die zuvor in sozialen Netzwerken oder von feministischen Kreisen, Frauenhilfsorganisationen und Fachberatungsstellen angesprochen worden waren: Inwiefern war Sexismus der Nährboden für ein sehr viel größeres Problem? Warum wurden Übergriffe oder auch Vergewaltigungen so selten angezeigt? Wer war davon betroffen? Warum wurden Täter so selten bestraft? Was trieb die Täter an? War das Strafrecht noch zeitgemäß? Wer war dafür verantwortlich, dass das Tabu, über all diese Missstände öffentlich zu sprechen, so wirkmächtig werden konnte? An wie vielen Orten fand noch immer Missbrauch statt, ohne dass die Verantwortlichen konkret benannt wurden? Und warum schienen all diese Fragen nur so wenige Menschen zu interessieren?





























