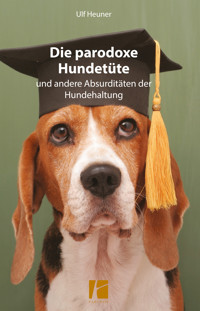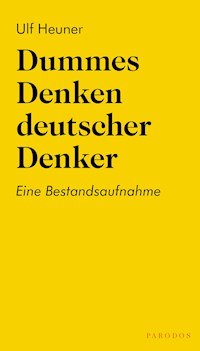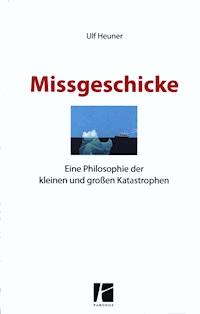
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: heptagon
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Glück erlangt längst nicht jeder Mensch. Dem Missgeschick kann jedoch keiner entkommen. Ulf Heuner geht dem Missgeschick philosophisch auf den Grund. Dabei werden sowohl die kleinen alltäglichen als auch die großen menschlichen Katastrophen in den Blick genommen. Das Buch stellt eine überarbeitete Neuauflage des 2007 bei Klett-Cotta unter dem Titel Patzer, Pannen, Missgeschicke. Das erste Überlebenshilfebuch erschienenen Werkes dar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulf Heuner
Missgeschicke
Eine Philosophie der kleinen und großen Katastrophen
© Parodos Verlag Berlin 2013
Ulf Heuner, Dr. phil., Studium der Philosophie, Theater- und Medienwissenschaft in Erlangen und Berlin, 1999 Promotion in Leipzig mit einer Arbeit zum griechischen Theater (J.B. Metzler 2001), Lehraufträge in Berlin, Bochum und Leipzig. Ulf Heuner arbeitet als Verleger, Lektor und Autor in Berlin. Bei Parodos bereits erschienen: Klassische Texte zur Tragik (2006), Klassische Texte zum Raum (3. Aufl. 2008), Wer herrscht im Theater und Fernsehen? (2008).
Ein ganz normaler Arbeitstag – Einstieg ins Missgeschick
10 Uhr morgens auf der Baustelle einer neuen Wohnsiedlung im Speckgürtel Berlins: Drei Küchenmonteure und vier studentische Hilfskräfte warten seit zwei Stunden vergebens auf einen LKW. Er hat Bauteile für 25 Küchen geladen, die heute noch auf die einzelnen Wohnungen verteilt werden müssen. Der Chef der Truppe telefoniert nervös zum dritten Mal; der LKW-Fahrer steht im Stau, kurz vor Berlin.
Jede Minute kostet den Chef Geld. Als er die Wohnungen vorab in Augenschein nimmt, bekommt er erste Schweißausbrüche. In der Hälfte der Wohnungen arbeiten noch die Maler; in zehn Küchen fehlen die Wand- und Bodenfliesen. Eine Abmessung der Wasser- und Stromanschlüsse ergibt, dass alle zu tief angebracht sind. Man hat sich bei der Montage stur nach den Bauplänen gerichtet, ohne den fehlenden Fliesenbelag zu berücksichtigen. Mit dem Bauleiter, den Elektrikern und Wasserinstallateuren kommt es zu lautstarken Auseinandersetzungen, die zu keiner Lösung der Frage führen, wer für die unverzügliche Fehlerbeseitigung aufzukommen habe.
Da endlich trifft der LKW ein. Die Männer beginnen mit dem Abladen. Der Polier macht sie freundlicherweise darauf aufmerksam, dass die Aufzüge, die bereits fertiggestellt, aber noch nicht vom TÜV abgenommen sind, nicht für den Transport benutzt werden dürfen. Zudem könnten sie beschädigt werden. Also dürfen die Männer die Küchen bis in den sechsten Stock tragen. Da bleiben einige Schrammen und Macken im Treppenhaus nicht aus, das die Maler bereits vor den Räumen tapeziert und gestrichen haben. Der Malermeister beschwert sich beim Bauleiter über die Küchenmonteure, während dieser noch mit deren Chef über die falschen Anschlüsse debattiert. Die hitzige Diskussion endet damit, dass der Küchenbauchef den Bauleiter und den Malermeister zum Mittagessen einlädt. Er erwartet sich davon etwas Entgegenkommen. Unaufhaltsam vergeht Stunde um Stunde.
Unterdessen schleppen die Studenten weiter. Die Monteure beginnen nach dem Mittagessen mit der Montage der ersten Küchen. Schnell stellt sich heraus, dass man beim Verteilen der Küchen rechts und links vertauscht hat: Auf jedem Stockwerk müssen also die Küchen zwischen beiden Wohnungen ausgetauscht werden.
Jetzt hat auch der Chef etwas Zeit gefunden, die erste Küche zu montieren. Nachdem die unteren Schränke aufgestellt und ausgerichtet worden sind, stellt er fest, dass sich die Kühlschranktür am linken Rand der Küchenzeile nicht richtig öffnen lässt. Denn direkt daneben ist ein Heizungskörper installiert. Beim Ausmessen der Küche durch einen Werksmonteur war er offensichtlich noch nicht vorhanden gewesen. Der Küchenbauchef nimmt sich vor, dies zu ignorieren, schneidet aber dann eine Arbeitsplatte spiegelverkehrt zu. Diese kann jetzt nur noch entsorgt werden. Wütend will er die Platte auf den Boden werfen. Sie rutscht ihm aus den Händen und landet auf dem großen Zeh seines rechten Fußes ...
Ein ganz normaler Arbeitstag voller Katastrophen und Missgeschicke, den ich selbst so als studentische Aushilfskraft erlebt habe. In meinem Studium beschäftigte ich mich damals zeitgleich intensiv mit der griechischen Tragödie und stellte irgendwann fest, dass Tragödie und Küchenbau viel gemeinsam haben: Am Anfang handeln alle mit den besten Absichten und am Ende sind alle tot oder todunglücklich. Und Letztere fragen sich: Wie konnte das passieren? Was ist da schief gegangen?
Die Antwort erscheint zunächst einfach: Murphys Gesetz hat wieder zugeschlagen: Was schief gehen kann, das geht auch schief. Und jeder weiß: Selbst bei den besten Absichten wird es wieder und wieder passieren. Missgeschicke scheinen unvermeidlich zu sein. Was im einen Fall lediglich einen unerfreulichen Arbeitstag bedeutet, führt in anderen Fällen zum Verlust des Fußballweltmeistertitels, zu einer großen Schiffskatastrophe oder zum Zusammenbruch ganzer Staatengebilde.
Murphys Gesetz gleicht in der sozialen Welt der Menschen dem Gravitationsgesetz in der Physik: Es gilt universal. Doch warum muss das so sein? Warum muss schief gehen, was schief gehen kann? Warum sind Katastrophen, Pannen und Missgeschicke für jeden von uns unvermeidlich? Wenn wir uns gerade mal wieder die frisch gewaschene und gebügelte Hose mit Marmelade bekleckert haben, können wir das ja im ersten Moment immer gar nicht glauben: »Das darf doch nicht wahr sein! Wie ist das denn jetzt schon wieder passiert?« Als hätte uns jemand einen Streich gespielt. Oder sind wir doch ganz allein »schuld«? Ist die Marmelade etwa vom Messer gerutscht, weil wir einfach »unkonzentriert« waren, weil unser Gehirn anderweitig beschäftigt war und einen Moment die falschen Signale an unsere Hand gab? Oder lagen hier etwa, wie Sigmund Freud sagen würde, »unbewusste Absichten« zu Grunde? Aber welche? Hat sich vielleicht unser Körper gegen uns verschworen und seinen Anspruch auf Autonomie zur Geltung gebracht? Oder gar die Marmelade selbst als tückisches Objekt, das sich im Zusammenspiel mit den physikalischen Trägheitskräften zu unserem Herrn aufspielen will? Sind bei Missgeschicken wie falsch montierten Elektroanschlüssen nicht eigentlich immer die anderen schuld? Muss nicht immer alles schief gehen, weil wir in unserem raum-zeitlichen Kosmos zwangsläufig immer zu spät kommen? Vielleicht sind ja in vielen Fällen alle genannten Faktoren zugleich beteiligt, was die Phänomene des Missgeschicks und Schiefgehens für uns so undurchschaubar, sie fast zu etwas Magischem macht. Diese Magie der Missgeschicke soll philosophisch hinterfragt werden.
In einem ersten Schritt wird geklärt, was überhaupt ein Missgeschick ist, was wir unter Patzer und Pannen verstehen und inwiefern diese Phänomene sich z.B. von Pech und dummen Fehlern unterscheiden. Auch wird der Geschichte von Murphys Gesetz und dessen paradoxer Gestalt auf den Grund gegangen werden.
Dann soll das Rätsel gelöst werden, warum immer alles schief geht und Missgeschicke kaum vermeidbar sind. So nebensächlich manche Missgeschicke erscheinen mögen, wird es vielleicht überraschen, dass man bei der Spurensuche schnell auf grundlegende Bedingungen bzw. Konstanten des Lebens stößt, die in unterschiedlicher Weise Missgeschicke zu verantworten haben: z.B. unsere (Un)Fähigkeit zu denken, unser (un)kontrollierbarer Körper, Raum und Zeit, die uns umgebenden Gegenstände, mit denen wir alltäglich hantieren, und nicht zuletzt der Mitmensch, der allzu häufig als Erstes zum Problem wird.
Bei jedem einzelnen Missgeschick spielen meist mehrere Bedingungen eine Rolle. Diese Zusammenhänge sollen aufgezeigt werden. Ich möchte meine Gedanken an einer Fülle von Beispielen illustrieren und werde einige meiner peinlichsten Missgeschicke offenlegen. Aber diese Beispiele haben nicht nur anekdotischen Charakter, sondern sollen deutlich machen, dass an Missgeschicken mehr dran ist, als man vielleicht zunächst denkt, dass man anhand der kleinen Misslichkeiten des Alltags die großen Fragen des Lebens diskutieren kann bzw. dass die Frage nach den Missgeschicken eine dieser großen Fragen sein kann, an der sich die Tragikomik des menschlichen Daseins demonstrieren lässt.
Missgeschicke bereichern unser Leben, vor allem die Missgeschicke der anderen. Mit einigen Überlegungen zur Ästhetik des Missgeschicks, zum Verhältnis von Missgeschick und Komik und zur Frage, warum wir so gern über Missgeschicke (anderer) lachen, sollen die positiven Aspekte des Missgeschicks herausgestellt werden. Missgeschicke bereichern aber nicht nur unser Leben, sondern können uns buchstäblich richtig reich machen. Dazu gilt es, seine Missgeschicke zu meistern. Wem dies gelingt, der kann mitunter in die Geschichte eingehen. Es ist allerdings ein schmaler Grat zwischen den souveränen Meistern des Missgeschicks und den »Meistern«, die als besonders große Tollpatsche von einem Fettnäpfchen ins andere treten. Dies wird an einigen Beispielen aus Politik, Wissenschaft und Showbusiness deutlich gemacht und im abschließenden Kapitel in der Schilderung des Mauerfalls als historisches Meistermissgeschick noch einmal im Detail vor Augen geführt.
Die besondere Tragikomik des Missgeschicks ist eine Erfahrung, die wir mit allen Menschen teilen. Glück erlangt längst nicht jeder Mensch, aber dem Missgeschick kann keiner entgehen – selbst ein vom Glück gesegneter Mensch wie Franz Beckenbauer nicht, der ausgerechnet in seinem Abschiedsspiel noch eines seiner berühmten Eigentore schoss.
1. Was ist ein Missgeschick?
Was schief gehen kann ... Murphys Gesetz
Die Überlieferungsgeschichte von Murphys Gesetz ist selbst nicht ganz frei von Missgeschicken. Name und Formulierung des Gesetzes als Murphy’s Law haben ihren historischen Ursprung auf der amerikanischen Edwards Air Force Base. Auf deren Homepage1 kann man lesen, dass es dort im Jahr 1949 ein Projekt gab, in dem Versuche zu Verzögerungskräften unternommen wurden, die bei Unfällen auf den Menschen einwirken. An den Versuchen war der Ingenieur Edward A. Murphy beteiligt. Nachdem einem Techniker wiederholt ein Fehler unterlaufen war, soll Murphy über ihn gesagt haben: If there is any way to do it wrong, he’ll find it. Wenn es eine Möglichkeit gibt, etwas falsch zu machen, er wird sie finden.
Diesen Ausspruch Murphys nahm der Projektmanager in eine Liste von Regeln zu den Versuchen auf und nannte ihn Murphy’s Law. Ein Arzt der Air Force begründete dann in einer Pressekonferenz die guten Resultate eines Sicherheitsberichts zu dem Projekt mit dem festen Glauben an Murphy’s Law. Daraus resultiere, so der Arzt weiter, die Notwendigkeit, alles zu versuchen, um Murphy’s Law zu vermeiden oder zu umgehen. Von da an trat das Gesetz seinen Siegeszug um die Welt an. Allerdings wurde Murphy’s Law bereits in der verallgemeinerten Form bekannt, die nicht nur für Techniker, sondern für uns alle gilt: Whatever can go wrong, will go wrong. Was schief gehen kann, wird schief gehen.
So wird die Geschichte auf der Homepage der Air-Base erzählt. Etwas anderes berichtet jedoch Lawrence J. Peter in seinem Buch Schlimmer geht’s immer. Der Autor gilt als der Entdecker des nach ihm benannten Peter-Prinzips: »In einer Hierarchie neigt jeder Beschäftigte dazu, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen.«2 In einem persönlichen Gespräch Peters mit Murphy klärte dieser ihn darüber auf, dass er sein Gesetz ursprünglich ganz anders formuliert hatte: »Wenn es zwei oder mehr Möglichkeiten gibt, etwas zu tun, und wenn eine dieser Möglichkeiten zu einer Katastrophe führt, dann wird sich irgendjemand für genau diese Möglichkeit entscheiden.«3 Das allgemeinere Gesetz, das Murphys Namen trägt und um die Welt ging, ist meines Erachtens interessanter, weil es weitaus mehr Fälle von Missgeschicken umfasst als die Denkfehler eines Einzelnen, der vor einer bestimmten Handlungsentscheidung steht. Anders ausgedrückt: Murphys Gesetz gilt universal für jeden von uns und kann unendlich viele Anwendungen finden.
Die Techniker auf der Air Base verhielten sich widersinnig oder paradox. Sie versuchten, alles zu tun, um Murphys Gesetz zu entgehen. Aber das Gesetz besagt doch gerade, dass genau dies nicht möglich ist. Wenn wirklich alles schief geht, was schief gehen kann, helfen alle Vorkehrungen und Sicherheitskontrollen nichts.
Alles, was schief gehen kann, geht irgendwann einmal schief – Murphys paradoxes Gesetz
Wenn das Gesetz tatsächlich in dieser strengen und absoluten Form gültig wäre, müsste die gesamte Menschheit innerhalb kürzester Zeit untergehen. Wir brächen uns auf der Stelle das Genick, führen mit dem Auto sofort gegen die nächste Wand, Atomkraftwerke würden dauernd explodieren, Flugzeuge immer abstürzen.
Die richtige Formulierung des Gesetzes lautet daher: Alles, was schief gehen kann, geht irgendwann einmal schief.
In Murphys Gesetz steckt ein Paradox. Dieses Paradox kann man schon unserer alltäglichen Sprechweise entnehmen. Wenn wir sagen, dass etwas schief geht, heißt dies, dass etwas misslungen ist, und zwar etwas, das durchaus hätte gelingen können oder das machbar gewesen wäre. Es geht hier also nicht um ein Scheitern an großen Aufgaben und Lebensentwürfen, denen man vielleicht schlicht nicht gewachsen war, sondern nur solche Handlungen gehen schief, die im Bereich unserer Kompetenz liegen und die wir normalerweise ohne Probleme ausführen können. Schief geht immer etwas, das nicht immer schief geht. Wenn sich ein Mensch zum Beispiel sein Leben lang vornimmt, ein Buch zu schreiben, aber immer nur davon redet, ohne eine Zeile zu Papier zu bringen, dann ist er gescheitert, aber es ist nichts schief gegangen. Wenn allerdings jemand ein Manuskript fertiggestellt hat, dieses aber auf dem Weg zum Verlag in der U-Bahn versehentlich liegen lässt, dann ist etwas schief gegangen. Und der vergessliche Autor wird sich fragen: »Wie konnte das nur passieren, was ist da schief gegangen?« Damit fragt er allerdings nach Gründen, die nicht allein in seiner Person liegen, für die er nicht allein verantwortlich ist. Murphys Gesetz bedeutet nun eine Steigerung dieser Entlastung. Es weist das Misslingen als objektive Notwendigkeit aus und die Gründe für das Misslingen der Handlung scheinen außerhalb unserer Verantwortlichkeit zu liegen. Irgendwann musste es eben einmal schief gehen; wir können also nichts dafür. Das objektive Naturgesetz verlangte es. Das Paradox in Murphys Gesetz liegt darin, dass wir uns einerseits mit ihm von der Verantwortung freisprechen, andererseits nur etwas schief gehen kann, an dem Menschen in irgendeiner Weise beteiligt sind und »Verantwortung« tragen. Wenn etwas schief geht, ist das somit in jedem Fall nicht allein die Schuld des daran beteiligten Menschen. Für etwas, das schief geht, gilt immer verminderte Schuldfähigkeit. Der wahrhaft Schuldige muss noch gefunden werden.
Feine Unterschiede: Patzer, Panne, Katastrophe, Missgeschick und Ungeschick
Eine ähnliche Paradoxie wie mit dem Ausdruck »schief gehen« ist auch mit dem Wort Missgeschick verbunden, das ich grundsätzlich als das entsprechende Substantiv zur Verbform »schief gehen« behandele. Ursprünglich war Missgeschick ein Synonym für Unglück. Heute sprechen wir von Missgeschicken jedoch in der Regel bei missglückten Handlungen oder misslichen Ereignissen, die kein großes Unglück darstellen, sondern eher kleine Ärgerlichkeiten. Mit dem Wort ist etwas Missliches verbunden, das uns geschickt wurde und das offensichtlich von außen kommt. Aber wer hat es uns geschickt? Das ist die Frage, der ich in den nächsten Kapiteln auf den Grund gehen möchte. Allerdings sagen wir ja auch: »Da ist mir ein Missgeschick passiert.« Damit bringen wir unsere Verantwortlichkeit wieder ins Spiel. Uns ist dieses Missgeschick passiert oder widerfahren. Solch ein Satz hat jedoch gleichzeitig etwas Entschuldigendes. Das heißt, für Missgeschicke gilt das Gleiche wie für Dinge, die schief gehen. Wir sind nicht richtig schuldig, aber auch nicht ganz schuldlos.
»Missgeschicke« und »schief gehen« sind in ihrer Bedeutung jedoch nicht vollkommen deckungsgleich. Vielmehr bilden die Missgeschicke eine Untermenge der Handlungen, die schief gehen. Immer wenn einem ein Missgeschick widerfährt, kann man wohl auch sagen: Da ist etwas schief gegangen. Aber nicht immer, wenn etwas schief gegangen ist, liegt ein Missgeschick vor. Zum Beispiel ist bei dem gescheiterten Ausbau der Autorennstrecke Nürburgring zu einem großen Erlebnis- und Freizeitpark aus der Sicht der Planer wohl einiges schief gegangen. Gleichwohl spricht man hier nicht von einem Missgeschick, sondern eher von Ungeschick.
Von Missgeschicken spricht man in erster Linie bei missglückten Handlungen einzelner Personen, während man bei misslichen Ereignissen, für die mehrere Personen »verantwortlich« sind, eher sagt: »Da ist etwas schief gegangen.« Ähnlich verhält es sich wohl bei den Begriffen Patzer und Panne. Ein Patzer ist als Unterbegriff von Missgeschick zu fassen. Von einem Patzer spricht man häufig bei Missgeschicken, die uns vor anderen widerfahren, die einen peinlichen Charakter haben und einen reibungslosen Ablauf stören. Wenn sich z.B. ein Fernsehmoderator oder ein Nachrichtensprecher verspricht, nennt man dies einen Patzer. Auch zu den peinlichen Versprechern, den sogenannten »Freud’schen«, die uns im Alltag widerfahren, sagen wir oft: »Oh, Patzer!« (Auf die »Freud’schen Versprecher« gehe ich noch ausführlich und kritisch ein.) Ein Synonym für »Patzer« ist das schöne lateinische Wort Lapsus. Patzer oder Lapsus nennt man vor allem Missgeschicke, die uns bei einer bewusst ausgeführten Handlung widerfahren, bei etwas, das wir auf jeden Fall richtig machen wollen. Als der Fußballtorwart Oliver Kahn im Weltmeisterschaftsfinale 2002 bei einem relativ leichten Schuss des Brasilianers Rivaldo den Ball nicht festhalten konnte und so das erste Tor des Gegners ermöglichte, war dies ein fataler Patzer, während dem Spieler, dem kurz vor der selben WM im Bad die Rasierwasserflasche auf den Zeh fiel und diesen so verletzte, dass der Spieler die Weltmeisterschaft verpasste, einfach ein blödes Missgeschick widerfuhr.
Bei Pannen handelt es dagegen um unfreiwillige Störungen von vorgegebenen Abläufen, an denen in der Regel mehrere Personen beteiligt sind: wenn z.B. in einer Fernsehsendung der Ton ausfällt, der falsche Film eingespielt wird etc. Häufig geht es bei Pannen um das Zusammenspiel von Technik und Menschen. Die klassische Autopanne ist allerding nicht unbedingt ein Thema für dieses Buch, wenn z.B. nur ein technischer Defekt aufgrund von Verschleiß vorliegt. Ist dagegen das Missgeschick eines Mechanikers der Grund für die Panne, dann ist diese auch hier von Interesse.
Eine Katastrophe umfasst in meiner Terminologie alle beschriebenen Phänomene wie Missgeschicke, Patzer oder Pannen, gilt also ähnlich wie schief gehen für alle Fälle. Dabei behandele ich nur Katastrophen, an denen Menschen beteiligt sind. Reine Naturkatastrophen sind nicht Thema dieses Buchs. Wenn ein von Menschen geführtes Schiff einen Eisberg rammt, ist dies für mich hier interessant, rammt dagegen ein Eisberg ein Schiff, dann eher nicht. Wobei es kaum noch reine Naturkatastrophen gibt. Eine sog. Naturkatastrophe wie ein Erdbeben oder eine Überflutung wirkt sich ja oft nur im Zusammenhang mit menschlichen Handlungen bzw. Erzeugnissen katastrophal für Menschen aus, wenn z.B. Häuser zu nahe an Flüsse gebaut oder in bekannten Erdbebengebieten nicht erdbebensichere Gebäude errichtet worden sind.
Aber ich möchte in diesem Buch nicht immer in analytischer Trennschärfe zwischen allen Bedeutungsnuancen der genannten Begriffe unterscheiden. Ich werde mich zunächst den schief gegangenen Unternehmungen widmen, für die mehrere Menschen zugleich verantwortlich und nicht verantwortlich sind, bevor ich zu den persönlichen Missgeschicken einzelner übergehe.
Pech gehabt, aber nicht schief gegangen
Ich hatte schon gesagt, dass nur schief gehen kann, was grundsätzlich möglich ist. Ein Missgeschick widerfährt uns bei einer Handlung, die wir normalerweise beherrschen, ohne groß darüber nachzudenken. Das heißt, Missgeschicke haben nichts mit Inkompetenz zu tun. Einem Schulkind, das an einer Rechenaufgabe scheitert, widerfährt kein Missgeschick. Es ist einfach noch nicht kompetent genug. Jemandem, der zum ersten Mal allein an einem Computer sitzt und die Festplatte löscht, passiert nach meiner Definition ebenfalls kein Missgeschick. Löscht allerdings ein Computerfachmann ohne Absicht die Festplatte, kann man von einem Missgeschick sprechen. Persönlich scheitern kann man an Aufgaben, denen man nicht gewachsen ist, für die man nicht genügend Kompetenz mitbringt. Persönliche Missgeschicke setzen ein gewisses Maß an Kompetenz voraus. Sie passieren, obwohl sie aufgrund der Kompetenz eigentlich nicht hätten passieren dürfen und obwohl wir es eigentlich besser wissen und können.
Aus diesen Überlegungen ergeben sich Einschränkungen der Gültigkeit von Murphys Gesetz. Unter Missgeschicken verstehen wir in der Regel missglückte Handlungen, die keinen großen Schaden anrichten. Missgeschicke können unter Umständen jedoch auch großes Unglück und Katastrophen hervorrufen. Aber nicht alle Arten Unglück oder Katastrophen sind mit Murphys Gesetz verbunden, sondern eben nur solche, an denen Menschen unmittelbar oder mittelbar als Handelnde beteiligt sind. Bei Naturkatastrophen zum Beispiel geht nichts schief, sondern sie brechen herein. Murphys Gesetz greift hier nicht, es sei denn, Menschen können mittelbar für die Katastrophen mitverantwortlich gemacht werden, wenn zum Beispiel Flussbegradigungen Überschwemmungskatastrophen begünstigen. Auch Krankheiten fallen normalerweise nicht unter Murphys Gesetz, es sei denn, man infiziert sich etwa als Arzt auf ungeschickte Weise. Landet man jedoch als Patient auf dem Operationstisch, tritt Murphys Gesetz sofort in Kraft.
Die Verantwortung der Menschen muss noch greifbar sein. Stürzt ein sehr altes Haus ein, fällt dieses Ereignis nicht unbedingt unter Murphys Gesetz. Die Menschen, die das Haus gebaut haben, können nicht für seinen Zusammenbruch verantwortlich gemacht werden. Der Zusammenbruch erfolgte gemäß dem physikalischen Gesetz der Entropie. Kümmert man sich nicht um Dinge, die Menschen einmal hergestellt oder gebaut haben, gibt man sie dem natürlichen Verfallsprozess preis. Dass Dinge zerfallen, dass Gebrauchsgegenstände irgendwann kaputt gehen, hat nichts mit Murphys Gesetz zu tun. Stürzt ein Haus jedoch unmittelbar nach Fertigstellung ein, ist offensichtlich etwas schief gegangen.
Die Grenzen der Gültigkeit von Murphys Gesetz sind fließend. Manche Einschränkungen, die ich mache, haben rein systematische Gründe. So möchte ich zum Beispiel auch folgende besonderen Fälle ausklammern:
1. Ein Mann entschließt sich, einen Spaziergang zu machen. Kaum hat er das Haus verlassen, fängt es an zu regen. Er kehrt noch einmal zurück, um einen Schirm zu holen. In dem Moment, in dem er den Schirm im Freien aufspannt, hört es auf zu regnen. Er faltet den Schirm wieder zusammen. Da trifft ihn ein Vogelschiss auf den Kopf.
Man könnte auf den ersten Blick sagen, hier ist eine Menge schief gegangen. Gleichwohl liegt hier kein Missgeschick vor: Regen und Vogelschisse sind Unannehmlichkeiten, die nicht in der Verantwortlichkeit von Menschen liegen. Aber man kann sich wirkungsvoll vor ihnen schützen. Gegen Regen kann man sich wappnen, indem man immer einen Schirm oder Regenkleidung mit sich führt. Gegen Vogelschisse, indem man ständig mit aufgespanntem Schirm herumläuft. Dies ist jedoch unpraktisch. Vogelschisse sind daher einfach hinzunehmen, wenn man nicht den ganzen Tag zu Hause bleiben möchte. Hier gilt nicht Murphys Gesetz, sondern eine verwandte Regel im wörtlichen Sinne: Shit happens. Im Deutschen würde man vielleicht auch sagen: »Dumm gelaufen!« Aber eben nicht schief gegangen.
2. An einem wunderschönen sonnigen Frühlingstag ließ ich mein Auto in der Waschanlage einer Tankstelle waschen. Danach stellte ich es neben einem der Münzstaubsauger ab, um auch im Innern etwas sauber zu machen. Plötzlich schob sich am ansonsten strahlend blauen Himmel eine kleine dunkle Regenwolke über die Tankstelle und entlud sich in einem kurzen, kräftigen Platzregen. Dummerweise stand mein Wagen unter einem Baum, dessen klebrige Blüten nur darauf gewartet hatten, vom Regen gelöst zu werden und sich auf meinem frisch gewaschenen Wagen niederzulassen. Die kleine Regenwolke war die einzige, die sich in dieser Woche in Berlin hat blicken lassen. Ich kam mir vor wie der melancholische Esel I-Ah in den von Walt Disney verfilmten Winnie-Pooh-Geschichten, der oft von einer kleinen Regenwolke begleitet wird. Auch von Donald Duck gibt es solche Bilder. Wer immer von einer kleinen Regenwolke begleitet wird, erleidet kein Missgeschick, sondern hat einfach Pech. Doch notorische Pechvögel wie I-Ah oder Donald Duck sind nicht Thema dieses Buches. »Pech« ist kein Kriterium für Patzer, Pannen, Missgeschicke und Murphys Gesetz. An manchen Leuten scheint das Pech zu kleben, während andere wahre Glückskinder sind. Aber von Missgeschicken sind alle Menschen betroffen, auch die Gustav Gansens dieser Welt.
3. Wer durch die afrikanische Steppe wandert, kein Wasser mitgenommen hat und, durch Anstrengung und Durst entkräftet, von Löwen gerissen wird, ist ebenfalls nicht von Murphys Gesetz betroffen, sondern schlicht von Dummheit. Diese ist auch kein Kriterium für Murphys Gesetz, das schlaue wie dumme Leute trifft. Die Dummheit ist das Thema des bereits zitierten Peter-Prinzips. Wäre der Wanderer jedoch zuvor mit einem Flugzeug notgelandet und würde beim Angriff eines Löwen diesen mit Pistolenschüssen verscheuchen, dabei aber versehentlich seine Trinkflasche durchlöchern, sähe der Fall anders aus.
Missgeschicke haben also nichts mit Dummheit oder Pech zu tun, und wenn etwas schief geht, dann war das nicht (allein) unsere Schuld. Aber wessen dann? Ich denke, mit der ersten Antwort können wir alle zufrieden sein: Schuld sind natürlich immer die anderen.
2. Wir sind nicht allein … und der Mitmensch wird schnell zum Problem
Es gibt Lebewesen, die nach ihrer Geburt sofort in der Lage sind, selbstständig zu leben. Der Mensch gehört nicht dazu. Wir sind nicht einmal fähig, uns selbstständig fortzubewegen, wie viele der mit uns verwandten Säugetiere. Dann könnten wir gleich unserem schlimmsten »Feind« davonlaufen, dem wir von Anfang an ausgeliefert sind: dem Mitmenschen. Der erste Mensch, der sich unser nach der Geburt bemächtigt, ist meistens nicht die Mutter, sondern die Hebamme. Lässt sie uns aus Unachtsamkeit auf den Betonfußboden des Kreißsaals fallen, sieht unsere Zukunft schon anders aus als eine Minute zuvor.
»Die Hölle, das sind die anderen«
Die Hebamme übergibt uns dann unseren Eltern. Dabei kann auch einiges schief gehen. Die Geschichten von vertauschten Säuglingen sind legendär. Denn es ist entscheidend, wem wir da übergeben werden. Für die nächsten Jahre sind wir auf Gedeih und Verderb unseren Eltern oder Pflegepersonen ausgeliefert. Eltern wissen allerdings, dass dies auch andersherum gilt. Das Wohl und Wehe des heranwachsenden Kindes hängt nicht allein von der Liebe und Erziehungskompetenz der Eltern ab, sondern auch von ihrem materiellen Wohlstand und gesellschaftlichen Status. Ungeachtet der formalen Chancengleichheit in Bildung und Beruf ist dies von entscheidender Bedeutung für den späteren Lebensweg. Mit diesem Umstand erklärte Jean-Paul Sartre 1965 in einem Interview mit dem Playboy seinen berühmten Satz »Die Hölle, das sind die anderen«, der aus seinem Drama »Geschlossene Gesellschaft« stammt:
»›Die Hölle, das sind die anderen‹ – insofern, als man sich von Geburt an in einer Situation, in die man geworfen wurde, befindet, einer Situation, die einen zwingt, sich unterzuordnen. Sie können als Sohn eines Reichen oder eines Algeriers oder eines Arztes oder eines Amerikaners zur Welt kommen. Von Anfang an ist Ihre Zukunft vorgezeichnet, eine Zukunft, die andere für Sie geschaffen haben; die anderen haben Sie zwar nicht direkt geschaffen, aber Sie sind Teil einer Gesellschaftsordnung, die aus Ihnen macht, was Sie sind.«4
Bei unserer Zeugung werden die Weichen für unseren Lebensweg durch die anderen, also in der Regel unsere Eltern, gestellt. Bereits die Vereinigung von Samen- und Eizelle steht unter der Geltung von Murphys Gesetz. Wir können unerwünscht gezeugt werden, weil ein Mann und eine Frau sich nicht beherrschen konnten oder ein Kondom geplatzt ist. Wir können zugleich mit fünf Geschwistern im Reagenzglas gezeugt werden, weil sich ein Fortpflanzungsmediziner nicht beherrschen konnte. Welche Frau und welcher Mann uns als biologische Eltern zeugen, hat nicht nur Folgen für unser materielles Wohlergehen. Hier werden auch die Weichen gestellt für unser Aussehen, unseren Charakter, unsere Gesundheit, unsere Intelligenz.
Niemand kommt als Einsiedler auf die Welt. Wir werden als gesellschaftliche Wesen geboren. Für die ersten Jahre unseres Lebens sind wir unmittelbar auf die Fürsorge der anderen angewiesen. Das heißt, in den ersten Jahren nach unserer Zeugung sind die anderen dafür verantwortlich, wenn etwas mit uns schief geht. Mit der Entwicklung unserer geistigen und körperlichen Fähigkeiten geht dann immer mehr Verantwortung auf uns selbst über.
Auch wenn wir uns als Erwachsene entschließen, den anderen den Rücken zu kehren, bleiben wir an sie gebunden. Denn ihnen verdanken wir, dass wir erwachsen geworden sind und in die Lage versetzt wurden, uns von ihnen loszusagen. Die Philosophin Hannah Arendt meint in ihrem Buch Vita activa: »Es gibt kein menschliches Leben, auch nicht das Leben des Einsiedlers in der Wüste, das nicht, sofern es überhaupt etwas tut, in einer Welt lebt, die direkt oder indirekt von der Anwesenheit anderer Menschen zeugt.«5 Selbst, wenn es einem Einsiedler gelänge, vollkommen ohne Beziehung zur »Zivilisation« zu leben, nähme er diese gleichwohl mit in sein Refugium. Seine gesellschaftliche Erziehung und Prägung kann er nicht auslöschen. Ein Leben als vollkommen autarker Einsiedler wäre auch, wenn überhaupt möglich, nur wenigen vergönnt. Die Erde böte gar nicht genug Platz, jedem das Leben des Einsiedlers zu gewähren. So müssen sich die meisten von uns wohl oder übel damit abfinden, ein Leben gemeinsam mit den anderen zu führen.
Die anderen, verharmlosend auch Mitmenschen genannt, bleiben damit lebenslang eine Gefahr für uns. Sartres Satz Die Hölle, das sind die anderen versteht jeder, der Nachbarn oder Verwandte hat, sofort auch ohne weitere Erläuterung des Autors. Der Mitmensch wird schnell zum Feind. Er will uns belügen, betrügen, bestehlen, verletzen, ermorden oder einfach nur auf die Nerven fallen. Murphys Gesetz gilt dabei jedoch weniger für die Opfer als für die Täter. Wenn wir Opfer eines Verbrechens werden, hat das nichts mit »schief gehen« zu tun. Denn niemand ist dafür verantwortlich, Opfer eines Verbrechens zu werden, auch wenn viele Täter dies gern so sehen. Murphys Gesetz gilt vielmehr für die Täter, die für ihre Handlungen verantwortlich sind.
Dass bei Verbrechen einiges schief gehen kann, zeigt der tägliche Blick in die Zeitungen. Der Täter muss immer damit rechnen, dass das Opfer sich nicht wie ein Opfer verhält. Anschaulich wird dies in dem Film Home Alone (dt.: Kevin – Allein zu Haus (1990) demonstriert, in dem zwei Einbrecher immer wieder in Fallen tappen, die ihnen der zwölfjährige Kevin gestellt hat. Aber auch die Komplizen stellen eine Bedrohung dar. In dem Film Quick Change (dt.:Ein verrückt genialer Coup, 1990) mit Bill Murray gelingt dem Protagonisten Grimm zusammen mit seiner Freundin und einem Freund ein perfekter Banküberfall. Grimm überfällt als Clown verkleidet die Bank und nimmt die Angestellten und Kunden, unter die sich seine Komplizen gemischt haben, als Geiseln. Nachdem die Bank von der Polizei umstellt worden ist, gelingt den dreien die Flucht, indem sie sich als Geiseln ausgeben, die freigelassen wurden. So perfekt der Bankraub ablief, so katastrophal verläuft die anschließende Flucht. Während Grimm von einer öffentlichen Telefonzelle aus dem Einsatzleiter der Polizei neue Forderungen stellt, betätigt der Komplize versehentlich die Hupe des Fluchtfahrzeugs. Dadurch verrät er, dass sie sich nicht mehr in der Bank aufhalten. Mit diesem Missgeschick beginnt eine Odyssee durch New York zum Flughafen, auf der sich ihnen immer wieder Menschen in den Weg stellen (Straßenarbeiter, die den Weg zum Flughafen nicht kennen; andere Ganoven, die sie selbst bedrohen; ein Taxifahrer, der kein Englisch versteht; ein Busfahrer, der kein Wechselgeld hat etc.). Das Happy End ist allerdings garantiert, weil für die Polizisten ebenfalls Murphys Gesetz gilt. Des einen Missgeschick ist des anderen Glück. Es können allerdings auch beide Seiten verlieren.
Eine ähnliche Odyssee erleidet Paul Hackett in Martin Scorseses Film After Hours (dt.: Die Zeit nach Mitternacht, 1985), dem ultimativen Film zu Murphys Gesetz in menschlichen Beziehungen. Die komplexe Handlung dieses Films soll kurz skizziert werden6