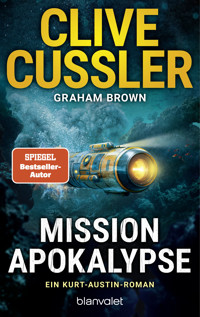
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Kurt-Austin-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Eine künstliche Intelligenz, angeblich geklonte Menschen und ein mysteriöser Kult bedrohen die Welt – der neuste Band der SPIEGEL-Bestsellerserie um Kurt Austin.
Unzählige Wale sterben auf mysteriöse Weise im Indischen Ozean. Kurt Austin untersucht den Vorfall und stößt dabei auf ein noch größeres Rätsel, als jemand sämtliche Befunde stiehlt. Wer will verhindern, dass das Ereignis erforscht wird? Und warum? Die Spur führt zu einem geheimnisvollen Kult, dessen Mitglieder davon überzeugt sind, geklont worden zu sein. Sie sehen sich als den nächsten Schritt der Evolution. Doch das Geschehen wird noch verwirrender, als ein geheimnisvoller Code an die NUMA-Zentrale gesendet wird. Will jemand Kurt und seinem Team helfen? Oder sie in eine Falle locken ...?
Kurt Austin ist der beste Mann für Unterwassereinsätze der amerikanischen Meeresbehörde NUMA. Doch auch die Abenteuer der anderen Helden aus der Welt der NUMA sollten sie nicht verpassen! Kennen Sie bereits den Juan-Cabrillo-Roman »Tödlicher Schwarm« oder das Dirk-Pitt-Abenteuer »Der Schatten des Korsen«?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Unzählige Wale sterben auf mysteriöse Weise im Indischen Ozean. Kurt Austin untersucht den Vorfall und stößt dabei auf ein noch größeres Rätsel, als jemand sämtliche Befunde stiehlt. Wer will verhindern, dass das Ereignis erforscht wird? Und warum? Die Spur führt zu einem geheimnisvollen Kult, dessen Mitglieder davon überzeugt sind, geklont worden zu sein. Sie sehen sich als den nächsten Schritt der Evolution. Doch das Geschehen wird noch verwirrender, als ein geheimnisvoller Code an die NUMA-Zentrale gesendet wird. Will jemand Kurt und seinem Team helfen? Oder sie in eine Falle locken …?
Autoren
Seit er 1973 seinen ersten Helden Dirk Pitt erfand, ist jeder Roman von Clive Cussler ein »New York Times«-Bestseller. Auch auf der deutschen SPIEGEL-Bestsellerliste ist jeder seiner Romane vertreten. 1979 gründete er die reale NUMA, um das maritime Erbe durch die Entdeckung, Erforschung und Konservierung von Schiffswracks zu bewahren. Er lebte bis zu seinem Tod im Jahr 2020 in der Wüste von Arizona und in den Bergen Colorados.
Der leidenschaftliche Pilot Graham Brown hält Abschlüsse in Aeronautik und Rechtswissenschaften. In den USA gilt er bereits als der neue Shootingstar des intelligenten Thrillers in der Tradition von Michael Crichton. Wie keinem zweiten Autor gelingt es Graham Brown, verblüffende wissenschaftliche Aspekte mit rasanter Nonstop-Action zu einem unwiderstehlichen Hochspannungscocktail zu vermischen.
Die Kurt-Austin-Romane bei Blanvalet
1. Tödliche Beute
2. Brennendes Wasser
3. Das Todeswrack
4. Killeralgen
5. Packeis
6. Höllenschlund
7. Flammendes Eis
8. Eiskalte Brandung
9. Teufelstor
10. Höllensturm
11. Codename Tartarus
12. Todeshandel
13. Das Osiris-Komplott
14. Projekt Nighthawk
15. Die zweite Sintflut
16. Das Jericho-Programm
17. Geheimfracht Pharao
18. Die Antarktis-Verschwörung
19. Gefährliche Allianz
20. Operation Kondor
21. Mission Apokalypse
Weitere Bände in Vorbereitung
Clive Cussler & Graham Brown
Mission Apokalypse
Ein Kurt-Austin-Roman
Deutsch von Wolfgang Thon
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »Desolation Code (KA 21)« bei G.P. Putnam’s Sons, New York.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright der Originalausgabe © 2024 by Sandecker RLLLP
By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613
New York, NY 10176 – 0187 USA
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Joern Rauser
Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Max Meinzold, stock.adobe.com (Наталья Босяк, dam, Tunatura, 敏治 荒川, Supernova, Mikhail Ulyannikov, Quardia Inc., Aro, Pavel Karchevskii, divedog, wildlife, ead72) und shutterstock.com (Sergey Orlov)
HK · Herstellung: DiMo · BüYi
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 9783641331214
www.blanvalet.de
Handelnde Personen
National Underwater and Marine Agency (Numa)
Kurt Austin – Direktor der Abteilung für Spezialprojekte und Sonderaufgaben, außerdem Bergungsexperte und begeisterter Segelsportler.
Joe Zavala – Stellvertretender Direktor für Spezialprojekte und Sonderaufgaben, Hubschrauberpilot und technisches Genie.
Rudi Gunn – Stellvertretender Direktor der NUMA, Absolvent der Naval Academy, leitet die meisten Routine-Operationen der NUMA.
Hiram Yaeger – Direktor für Informationstechnologie bei der NUMA. Computerexperte und genialer Designer von Hochleistungsrechnern.
Gamay Trout – Leitende Meeresbiologin der NUMA und Scripps-Absolventin, verheiratet mit Paul.
Paul Trout – Chefgeologe der NUMA und ebenfalls Absolvent des Scripps Institute, verheiratet mit Gamay.
La Réunion
Marcel Lacourt – Amtierender Präfekt (Gouverneur) auf La Réunion.
Chantel Lacourt – Doktorandin und Meeresbiologin, Marcels Nichte.
Île de L’Est
Ezra Vaughn – Guru für künstliche Intelligenz, besessen von der Idee der Verschmelzung menschlicher und maschineller Intelligenz.
Kellen Blakes (Der Wächter) – Ehemaliger Söldner, jetzt zuständig für die Sicherheit und die Aufrechterhaltung der Ordnung auf Vaughns Privatinsel.
Priya Kashmir – Ehemaliges Mitglied der NUMA, Computerexpertin, erforscht Methoden der Wirbelsäulenregeneration für Gelähmte.
Kai – Anführerin der Widerstandsgruppe, die gegen Vaughn kämpft.
Zech – Mitglied von Kais Widerstandsgruppe.
Die Graue Hexe – Eine mythische Figur, auf deren Hilfe und Schutz der Widerstand vertraut.
Indien
Virat Sharma – Eigentümer eines großen Abwrackunternehmens und einer Bergungswerft am Strand von Alang.
Fünf – Überlebendes Mitglied einer Gruppe, die sich an Bord der Soufrière geschlichen hat.
Mv Akeso
Elena Pascal – Ehemalige NUMA-Ärztin, die jetzt an Bord des Lazarettschiffs Akeso arbeitet.
Marjorie Livorno – Kapitänin der Akeso.
Orte
La Réunion – Französische Insel im Indischen Ozean, etwa fünfhundert Meilen östlich von Madagaskar.
Alang – Langer, flacher Strand an der Westküste Indiens, an dem sich die größte Abwrackwerft der Welt befindet.
Île de l’Est – Östlichste Insel der Seychellen-Inselkette, eine von nur zwei Vulkaninseln der Gruppe; beherbergte einst ein geothermisches Energieprojekt; heute im Besitz und unter Kontrolle von Ezra Vaughn.
Prolog
Die Insel
Ein in zerfetzte Lumpen gekleideter Mann sprintete Hals über Kopf durch einen tropischen Regenwald. Schweißgebadet und mit nackten Füßen bahnte er sich auf dem unebenen Boden den Weg durch die breiten grünen Blätter des Dickichts. Immer weiter hinauf, einem Gipfel entgegen, den er nicht sehen konnte, von dem er aber glaubte, dass er ihn erreichen würde.
Als er einen weniger zugewucherten Pfad fand, blieb er in der Nähe eines dichten, mit bunten Blüten übersäten Busches stehen. Als er um Atem rang, hob und senkte sich seine Brust heftig. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und schlug sich klatschend in den Nacken, da ein Blutsauger auf seiner Haut gelandet war. Als er die Hand wieder wegzog, sah er sein eigenes Blut, das die Tätowierung auf seinem Hals jetzt zum Teil verschmierte. Sie zeigte Zahlen und Buchstaben in einer seltsamen, codeähnlichen Anordnung. Die letzten beiden Ziffern waren eine von den anderen Symbolen abgesetzte Eins und eine Null. Aus diesem Grund wurde er Deci genannt.
Deci wischte sich das Blut an seinen Lumpen ab und blickte suchend zurück ins Unterholz. Die anderen waren hinter ihm zurückgefallen. »Kommt schon!«, rief er. »Weiter!«
Eine Gruppe von jüngeren Männern tauchte aus dem Grün auf. Ihre Hautfarbe und die Gesichtszüge ähnelten ihm und sich untereinander so sehr, dass es schwer war, sie zu unterscheiden. Ihre Kleidung war genauso zerlumpt und schmutzig wie seine, und die Angst stand ihnen allen ins Gesicht geschrieben.
Sie drängten sich durch das Blattwerk und sahen ihn an. »Bist du wirklich sicher, dass dies hier der richtige Weg ist?«
Sicher war er sich zwar nicht, aber man hatte ihm gesagt, dass er einen Pfad finden werde. Und hier war er. Er deutete auf den Weg. »Hoch zum Gipfel. Beeilt euch!«
»Und dann?«, fragte einer der jüngeren Männer.
»Flucht«, erwiderte er. »Freiheit.«
Bei den jüngeren Männern verfingen seine Worte nicht. Eher wirkten sie verwirrt. Doch lautes Hundegebell rüttelte sie aus ihrer Betäubung auf. Die Jäger kamen näher. Sie hatten ihre Fährte aufgenommen, und jetzt bestand keine Chance mehr, dass die Hunde sie noch verloren. Nicht, wo sich so viele der Verfolgten durch das Dickicht drängten und dabei wie Lasttiere schwitzten.
»Los, los, los!«, rief Deci.
Die Jungen liefen weiter. Am Ende folgte ihnen ein anderer Mann, der etwa so alt war wie ihr Anführer. Er blieb stehen und hockte sich in der Nähe des Busches hin. Auf den ersten Blick sahen die beiden Männer fast identisch aus, aber Decis eingefallene Augen, seine hohlen Wangen und sein verängstigtes Gesicht offenbarten, wie unterschiedlich sich ihre Leben entwickelt hatten.
»Bruder«, sagte der zweite Mann. »Sie haben uns eingeholt. Wir sollten umkehren, bevor es zu spät ist.«
»Es ist längst schon zu spät«, antwortete Deci. »Unsere einzige Hoffnung liegt vor uns.«
»Die Klippen? Was sollen wir denn dort? Runterspringen?«
»Es wird sich schon ein Weg auftun«, betonte der Anführer. »Sie hat es uns versprochen.«
Ein irritierter Ausdruck flog über das Gesicht des zweiten Mannes. »Aber niemand hat sie je gesehen. Sie ist nur ein Flüstern in unseren Köpfen.«
»Das hier hat sie uns geschenkt«, beharrte Deci und griff nach einer massiven Halskette, die auf seiner Brust lag. Sie war klobig und schwer und bestand aus elektronischen Teilen und Batterien. Er trug sie, als wäre sie ein Talisman von großer Macht.
»Das da kann aber keine Kugeln abwehren«, erwiderte der andere Mann, »oder einen Hund daran hindern zuzubeißen. Blindes Vertrauen ist nur etwas für Narren.«
»Dann kehr doch um!«, entgegnete Deci. »Aber ich werde nicht zulassen, dass sie den Jüngeren dasselbe antun, was sie uns angetan haben.«
Die beiden Männer starrten sich eine ganze Weile an. Sie führten diesen Streit nicht zum ersten Mal. Das Patt endete erst, als weiter unten ein Schuss knallte. Beide Männer zuckten zusammen und duckten sich. Dann drehten sie sich gleichzeitig um und sprinteten mit bloßen, blutigen Füßen den Pfad hinauf.
»Ich hoffe, du hast recht«, keuchte der zweite Mann im Laufen. »Oder das hier ist die einzige Freiheit, die wir je erfahren werden.«
Die beiden rannten weiter den Pfad hinauf, ohne auf die Spuren zu achten, die sie im Dreck hinterließen, oder einen Blick auf ihre blutigen Fußabdrücke auf dem steilen Felsen zu werfen. Als sie die letzte Barriere aus widerspenstigem Unterholz hinter sich gelassen hatten und ins Freie gelangten, fanden sie sich auf einer felsigen Klippe hoch über dem Meer wieder. Inzwischen stand die Sonne tief am Horizont, die Wellen des Meeres schimmerten bronzefarben und grau. Eine kühle Brise trocknete den Schweiß von ihrer Haut, während das Rauschen der Wellen von unten heraufschallte.
Die jungen Männer starrten die goldene Scheibe an.
»Ich kann unendlich weit sehen«, sagte einer.
»Wie geht es jetzt weiter?«, wollte ein anderer wissen.
Der Anführer sah sich um. Er entdeckte nirgendwo ein Zeichen von Rettung. Keine Spur von Hilfe. Sollten sie tatsächlich springen?
Er trat an den Rand der Klippe und blickte hinunter. Zweihundert Fuß unter ihm bildeten Hunderte von Felsen eine zerklüftete Uferlinie. Sie ragten zu weit aus dem Fuß der Klippe ins Meer hinein, als dass die Jungen das Wasser erreichen könnten. Selbst wenn sie weit genug springen und die Wasserlinie erreichen könnten, würden sie beim Aufprall in den Untiefen und den Felsen zerschmettert.
Deci trat von der Kante zurück und erschauderte. Er hatte sie in ihr Verderben geführt. Plötzlich wünschte er sich, nicht der Anführer zu sein. Und noch mehr wünschte er, er hätte die Nachricht nie erhalten und auch die Halskette nicht bekommen. Doch dann sah er etwas, das ihm Hoffnung einflößte. Ein verknotetes Seil war an der Seite der Klippe verankert worden. Es reichte dreißig Fuß hinab, und sein Ende war beschwert. Es schien, als endete das Seil vor einer Öffnung in der Felsflanke. Das war ein Ausweg. Und ihm war ein Ausweg versprochen worden.
Er hatte keine Erfahrung in solchen Dingen, aber den Nachteil, der sich daraus ergab, erkannte er schnell: Wenn er es sehen konnte, sahen ihre Jäger es genauso.
Er nahm die Halskette ab und schob sie seinem Bruder über den Kopf. »Steig hinunter.«
Der andere Mann blickte auf das Seil und die Felsen weit unter ihm.
Er schüttelte den Kopf.
»Geh«, beharrte Deci. »Führ du sie an.«
»Nein«, erwiderte der Mann. »Du führst sie. Ich habe keinen Glauben.«
Deci packte seinen Bruder am Arm und zog ihn an den Rand der Klippe. Er ergriff das Seil und zog daran, um die Festigkeit zu testen. Dann legte er es in die Hände seines Bruders. »Sie hat uns einen Ausweg versprochen. Das hier ist er. Und jetzt geh!«
*
Eine halbe Meile hinter der Gruppe von Flüchtlingen schob sich ein hochgewachsener Mann mit Glatze und schmalen Falkenaugen durch den Dschungel. Offenbar fand der Kaukasier Gefallen an der Jagd. Er trug eine Kakihose und eine Safariweste, hatte zwei Gürtel mit Pistolen umgeschnallt und hielt eine Pumpgun in den Händen.
Auf der Insel war er als der Wächter bekannt, früher in seinem Leben war er Großwildjäger gewesen, der Trail Boss in einigen der härtesten Gegenden der Welt – und für jeden, der in harter Währung zahlte, arbeitete er auch als Söldner.
Jetzt, als die Hunde die Fährte der Flüchtigen aufnahmen und wütend an den Leinen zerrten, grinste er. Und er lachte lauthals, als die Hundeführer Mühe hatten, mit den Tieren Schritt zu halten und sich mit Macheten durch das Dickicht hackten.
»Bringt sie zur Strecke!«, knurrte der Wächter mit einem fast dement wirkenden Entzücken. »Wenn euch auch nur ein einziger Mann entkommt, werdet ihr die für sie vorgesehene Strafe erleiden.«
Falls seine Männer noch mehr Motivation gebraucht hätten, diese Drohung hätte gewiss ihren Zweck erfüllt. Sie stürmten weiter, kletterten höher und bewegten sich schneller, während sich das Unterholz immer mehr ausdünnte. Schon bald folgten sie blutigen, verwischten Fußabdrücken, die von nackten, blutigen Füßen hinterlassen worden waren. So war die Spur leicht zu verfolgen, trotzdem fragte sich der Wächter, aus welchem Grund sie ausgerechnet diesen Weg gewählt hatten.
Frühere Ausbrecher waren immer auf die andere Seite der Insel geflohen, um in der felsigen, vulkanischen Einöde zu überleben. Diese Männer hier hatten jedoch einen anderen Weg eingeschlagen. Einen, der sie von der trennenden Mauer mit ihrem Stacheldraht und den Kameras fernhielt.
Seltsam, dachte er, aber letztlich war es nicht weiter wichtig. Schon bald würden sie zwischen den Hunden und den Klippen in der Falle sitzen.
Die Hunde kläfften noch wilder. Sie witterten ihre Beute bereits.
»Lasst sie von der Leine!«, rief der Wächter.
Die Hundeführer machten die Hunde los, und die schossen sofort vorwärts. Sie stürmten den Pfad hinauf und verschwanden aus dem Blickfeld. Es war ein tödliches Rudel, das sich nur durch wenige Gene von den Wölfen unterschied, von denen sie abstammten. Der Wächter beschleunigte sein Tempo, begierig darauf, die Tiere bei der Arbeit zu beobachten. Als er eine kleine Lichtung erreichte, liefen die Tiere im Kreis und schnupperten auf dem Boden. Schließlich hoben sie ihre Schnauzen und heulten in den Himmel. Die Spur hörte zwar an dieser Stelle auf, aber niemand war zu sehen. Ein Ast knarrte hinter ihm, und der Wächter fuhr herum. Gerade noch sah er die Gestalt, die sich auf ihn stürzte. Der barfüßige Mann prallte gegen ihn, warf ihn zu Boden und rollte sich sofort weg. Beide Männer sprangen auf, und die Hunde wirbelten herum, als wollten sie sich auf den Angreifer stürzen.
»Bleibt!«, blaffte der Wächter gebieterisch. Die Hunde setzten sich auf die Hinterhand und rührten sich nicht.
Der Wächter richtete die Schrotflinte auf den schmutzigen, blutenden Mann. »Wo sind die anderen?«, fragte er. »Rede, und ich lasse Gnade walten.« Der Flüchtling war abgemagert. Die Kleidung hing ihm in zerfetzten Lumpen vom Leib. Sich wochenlang im Busch durchzuschlagen, forderte seinen Tribut von einem Menschen. Nervös trat er zurück und schaute von einer Seite zur anderen. Aus dem Bund seiner abgenutzten Hose zog er ein selbst gebasteltes Messer. Allerdings war es nicht mehr als ein dicker Stofffetzen, der um einen geschärften Feuerstein gewickelt war. »Du hast dir eine Waffe gebastelt«, bemerkte der Wächter. »Interessant. Wir haben dir das nicht beigebracht. Vielleicht lernt ihr Ratten doch schneller, als man uns gesagt hat.«
Der Wächter warf die Schrotflinte beiseite und ließ sich von einem seiner Männer eine Machete geben. »Mal sehen, wie gut du damit umgehen kannst.«
Er trat vor, aber Deci warf ihm eine Handvoll Dreck ins Gesicht. Überrascht von dem Angriff, blinzelte der Wächter, und seine Augen brannten schmerzhaft, als er mit der Machete zuschlug.
Die Spitze der Klinge streifte Decis Brust und hinterließ eine blutige Spur, aber die Wunde schien nur oberflächlich zu sein. In den Räumen hatte er schon Schlimmeres ertragen müssen.
Er warf einen kurzen Blick auf das Blut auf seiner Brust und tat es mit einem Schulterzucken ab. Dann schlurfte er in einem Halbkreis nach rechts und wieder zurück, hielt das Messer erst in Richtung des Wächters und richtete es dann auf den nächsten seiner Männer.
»Zerbrich dir ihretwegen nicht den Kopf, Junge«, sagte der Wächter. »Komm, bring mir das spitze Stöckchen.«
Als hätte er auf das Kommando gewartet, griff Deci an und schlug mit dem Messer nach dem Hals des Wächters. Das mochte zwar ein kühner Versuch sein, doch der Wächter hatte schon sein ganzes Leben lang gekämpft. Er trat rasch zur Seite und lehnte sich zurück, um dem Messerhieb auszuweichen, dann konterte er mit einem Hieb der Machete.
Die schwere Klinge grub sich tief in Decis Arm. Dieses Mal heulte er vor Schmerz auf, stolperte zurück und starrte auf die klaffende Wunde in seinem Fleisch. Er konnte die Sehnen darin erkennen, und Blut strömte aus dem klaffenden Schnitt.
»Das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird«, warnte ihn der Wächter. »Jetzt wirf deine Waffe weg, und ich gebe dir ein Versprechen. Das Versprechen, dass du zu uns gehörst.«
Nichts hätte Decis Wut mehr entfachen können. Mit hasserfülltem Gesicht stürzte er sich erneut auf seinen Feind, riss seinen verwundeten Arm als Schild hoch und rammte das primitive Messer in den Bauch des Wächters. Es gelang ihm zwar, die Safariweste zu durchbohren und etwas Blut zu vergießen, aber dann stieß ihn sein Widersacher zur Seite und schlug mit der Machete wuchtig zu.
Decis Hand wurde am Gelenk abgetrennt, und er fiel auf die Knie. Dann krabbelte er weg, wich wie ein geprügeltes Tier zurück.
Der Wächter hatte das Spiel satt und sah zu den Hunden hinüber. »Mord!«, rief er. Das war der Befehl zum Angriff.
Zwei der Hunde sprangen vor und stürzten sich, ohne zu zögern, auf Deci. Sie erwischten ihn fast gleichzeitig, und bei ihrem Aufprall rollte er sich über den Boden. Dann rollte er sich weiter, wie es schien, absichtlich, und im nächsten Moment verschwanden Deci und die Hunde über die Kante der Klippe.
Die Männer hörten lautes Bellen und Jaulen, als die Tiere in die Tiefe stürzten. Und dann – plötzliche Stille. Eine unheimliche Ruhe breitete sich auf der Lichtung aus. Die Männer schienen nicht genau zu wissen, was sie jetzt tun sollten.
Der Wächter trat an den Rand der Klippe und blickte hinunter. Deci und die Hunde lagen zerschmettert ein paar Meter voneinander entfernt auf den Felsen. Um die Aufschlagstelle herum hatte sich ein Kreis aus Blutspritzern gebildet.
Als der Wächter die Szenerie betrachtete, dämmerte ihm, dass Deci sich geopfert hatte. Mehr noch, offenbar hatte er einen komplexen Plan ersonnen und sich eine Waffe gebastelt. Dann hatte er eine Mini-Revolte angeführt und sich entschieden, für ein Konzept zu sterben, das er unmöglich verstehen konnte: Freiheit.
Sie lernten Dinge, die man ihnen nicht beigebracht hatte. Und zwar schneller, als irgendjemand hätte erwarten können. Das musste er melden.
»Ausschwärmen!«, fuhr der Wächter seine Männer an. »Findet die anderen. Sucht in den Bäumen und im Gebüsch. Schaut unter jeden verdammten Stein. Irgendwo hier müssen sie sein.«
So angetrieben stürmten die Männer und die überlebenden Hunde in das tropische Dickicht hinein, eifrig bemüht, eine frische Spur zu finden.
Der Wächter blieb noch am Rande der Klippen stehen. Er war nach wie vor von Decis Entscheidung beeindruckt, kämpfen zu wollen. Dann blickte er auf den Ozean. Sonnenlicht drang durch eine Wolkenbank am Horizont. Die Strahlen leuchteten in dem scharfen Kontrast zwischen Hell und Dunkel. Etwas anderes gab es hier gar nicht zu sehen. Keine Schiffe, kein Land, nichts als dieses endlose, von der Sonne vergoldete Meer.
Unwillkürlich fragte er sich, wohin sie wohl hatten fliehen wollen. Die Insel, die Räume, der Wächter und die Versorger – das war doch alles, was sie kannten, alles, was sie je gesehen haben konnten.
Dann schoss ihm der Gedanke durch den Kopf, wie ihre primitiven Hirne wohl reagieren würden, wenn sie tatsächlich das Geflecht aus Komplexität, Chaos und Wahnsinn erreichten, das die Menschheit Zivilisation nannte. Wahrscheinlich, vermutete er, würden sie sich wünschen, sie hätten es nie gesehen.
Ein Heulen und Bellen kam aus dem Dickicht und unterbrach seine Tagträumerei. Der Wächter wandte sich wieder seiner Aufgabe zu. Er kehrte dem Meer den Rücken und ging den Pfad hinab, erfreut, dass die Jagd fortgesetzt wurde.
1
La Réunion, Südindischer Ozean
Die Insel Réunion – oder La Réunion, wie die Einheimischen sie nannten – lag in den Tropen, fünfhundert Meilen östlich von Madagaskar und fast zweitausend Meilen südlich von Saudi-Arabien. Sie war eine französische Provinz und ein Naturparadies, so dramatisch und schön wie die berühmte Insel Tahiti. Hier gab es atemberaubende Vulkangipfel, satte grüne Regenwälder und glatte schwarze Sandstrände aus erodierter Lava, die von den Wellen zu Staub zermahlen wurde.
Trotz der Anmutung einer menschenleeren tropischen Insel war La Réunion die Heimat von fast einer Million französischsprachiger Bürger. Jeden Monat zog sie Zehntausende von Touristen an und, wie einige behaupteten, fast ebenso viele Haie.
Aufgrund ihrer Lage fungierte La Réunion als eine Art Rastplatz auf einer ozeanischen Route, die die Gewässer Australiens mit denen Südafrikas verband. Meeresbiologen nannten diese Route den »Shark Highway«, da sie stark von Weißen Haien, Bullenhaien, Makos und Hammerhaien frequentiert wurde. Infolgedessen war die kleine französische Insel im Indischen Ozean zur Welthauptstadt der Haiangriffe geworden, die jedes Jahr Dutzende von Todesopfern forderten.
Die Regierung von La Réunion war über den Spitznamen ihrer Insel nicht besonders glücklich und ergriff entsprechende Maßnahmen: Sie spannte Netze um bestimmte Strände, die sie in der Folge vom Meer abschirmten, und erließ außerhalb der Schutzzonen strenge Bade- und Surfverbote. Das Programm führte zu einem drastischen Rückgang der Angriffe und gipfelte schließlich in einem ganzen Jahr ohne Todesopfer.
Zwar war dies ein überwältigender Erfolg, doch niemand glaubte wirklich, dass die im Meer lebenden Raubtiere ganz verschwunden waren. Niemand … außer einem Amerikaner namens Kurt Austin.
Austin war ein großer Mann um die vierzig, schlank, aber mit breiten Schultern. Er war Direktor der Abteilung für Spezialprojekte einer Regierungsbehörde in den USA, der NUMA (National Underwater and Marine Agency), die weltweit wissenschaftliche Forschungen durchführte, versunkene Schiffe aufspürte und mit anderen Nationen zusammenarbeitete, wenn es um Angelegenheiten der Meere ging.
In Kooperation mit der Universität von La Réunion hatten Austin und sein Kollege Joe Zavala bereits die letzten sechs Wochen in und auf den Gewässern um La Réunion verbracht, um dort Studien über die Haipopulation durchzuführen. Seltsamerweise hatten sie aber Schwierigkeiten, überhaupt auf Haie zu treffen, darum fuhren sie auf der Suche nach signifikanten Exemplaren zum Markieren immer weiter aufs Meer hinaus.
Köder hatten die Haie nicht anlocken können, ebenso wenig abgespielte Geräusche von zappelnden Fischen. Selbst Eimer mit Blut und ein im Meer treibender Thunfischkadaver, auf den sie gestoßen waren, hatte lediglich das Interesse von ein paar Jungtieren geweckt. Es war, als hätte der Rastplatz die Pforten dicht gemacht und als wären alle erwachsenen Haie der Gemeinde weitergezogen.
Es war eine rätselhafte Entdeckung, mit der Kurt Austin noch rang, als er in der Hauptabflughalle des Flughafens Roland Garros stand und auf die Ankunft des Jumbojets wartete, der ihn und Joe wieder von der Insel und diesem Geheimnis wegbringen sollte. Hätten in Washington nicht andere Verpflichtungen auf sie gewartet, hätte Austin die Heimreise abgesagt und wäre geblieben, um weitere Antworten zu suchen.
Ein Tippen auf seine Schulter riss ihn aus seinen Gedanken. Als er sich umdrehte, stand jedoch niemand direkt hinter ihm. Er sah nur einen kleinen Teleskopstab, aus dem vier harkenartige Finger herausragten. Sein bester Freund Joe Zavala saß an einem erhöhten Tisch und hatte ein fettes Club-Sandwich und eine Portion Pommes frites vor sich stehen.
Nachdem er Kurts Aufmerksamkeit erregt hatte, schob Joe den Rückenkratzer aus Aluminium wieder zusammen und ließ ihn in seiner Tasche verschwinden. Kurt erinnerte sich, dass Joe das Gerät am Tag ihrer Ankunft für fünf Dollar an einem Kiosk gekauft hatte. »Ich kann gar nicht glauben, dass du mit diesem Ding durch die Sicherheitskontrolle gekommen bist.«
»Dieses Ding«, konterte Joe, »ist ein äußerst nützliches Werkzeug. Es hat mein Leben in jeder Hinsicht einfacher gemacht. Ich musste noch nicht mal aufstehen, um dich zu belästigen.«
»Ich weiß nicht, ob ich das wirklich ein nützliches Ding nennen würde.«
Joe hatte kurzes dunkles Haar, dunkelbraune Augen und eine kräftige Statur. Und ein ständiges Lächeln auf dem Gesicht, als wäre das Leben, ob gut oder schlecht, immer schön. Er deutete auf den Teller vor ihm. »Möchtest du einen Bissen von diesem Sandwich?«, fragte er. »Regel Nummer eins auf Reisen: Lass niemals eine Mahlzeit aus; du weißt nicht, wann du wieder Gelegenheit zum Essen bekommst.«
Leicht erstaunt schüttelte Austin den Kopf. Joe war zehn Jahre jünger als er und einige Zentimeter kleiner, aber er sah immer noch wie der Mittelgewichtsboxer aus seiner Zeit bei der Navy aus. Irgendwie schien er den ganzen Tag zu essen und kein einziges Pfund zuzunehmen.
»Ich bin sicher, dass wir im Flugzeug etwas zu essen bekommen«, erwiderte Kurt. »Außerdem hat nicht jeder deinen beneidenswerten, überaktiven Stoffwechsel. Wir sind jetzt seit sechs Wochen hier, und ich kann mich an keinen Moment erinnern, in dem du nicht gegessen hättest.«
»Das ist ja auch der Schlüssel«, sagte Joe. »Eine konstante Versorgung mit Nahrung hält das Energieniveau hoch und verbrennt mehr Kalorien.«
Kurt war sich zwar keineswegs sicher, ob das wissenschaftlich haltbar war, da aber sein Handy surrte, widersprach er nicht.
Er nahm das Handy aus der Tasche, tippte den Code ein und blickte auf das Display. Es zeigte einen Text, die Nachricht enthielt aber weder Namen noch E-Mail-Adresse noch eine Telefonnummer.
Der Zyniker in ihm deklarierte diese Nachricht sofort als Spam. Hätte es sich bei seinem Telefon um ein handelsübliches Gerät gehandelt, wäre das auch naheliegend gewesen. Seine Freunde beschwerten sich ständig über Robo- Anrufe und Phishing-SMS und die endlose Zahl attraktiver ausländischer Frauen, die angeblich Zeit mit ihnen verbringen wollten. Aber Kurts Telefon war ein ihm von der NUMA zur Verfügung gestelltes Gerät, das speziell dafür entwickelt worden war, solche Fallstricke zu vermeiden. Die gesamte Kommunikation von und zu dem Telefon lief über die NUMA-Satelliten und ein hochsicheres Computersystem in Washington, D.C., das es eigentlich vor solchen Spams schützen sollte.
Als Kurt die Nachricht studierte, bemerkte er noch etwas anderes Seltsames. Es gab nicht nur keinen Hinweis darauf, wer der Absender sein könnte, sondern die Nachricht war zunächst auch unvollständig. Er beobachtete, wie nach und nach Buchstaben auftauchten, als würden sie extrem langsam eingegeben. Und nachdem der letzte Buchstabe erschienen war, klang die Nachricht immer noch kryptisch.
Ich habe sie zu Ihnen geschickt … Suchen Sie sie … Ihr Schicksal liegt in Ihren Händen …
Das war auf keinen Fall Spam. Zum Beispiel gab es keinen Link zum Anklicken, keine Aufforderung zu antworten, kein Angebot irgendeiner Art. Nur diese seltsamen Sätze und eine lange Reihe von Zahlen und Buchstaben, die wie ein Passwort oder der Produktcode für ein Computerprogramm aussahen.
Was die ganze Sache noch seltsamer machte, war, dass die Nachricht vor seinen Augen wieder verschwand. Er suchte sofort in verschiedenen Programmen und Anwendungen nach ihr, fand aber keinerlei Eintrag.
Joe sah ihn an und bemerkte Kurts Irritation. »Was ist denn los? Kannst du das heutige Wordle nicht entziffern?«
»Nein«, sagte Kurt. »Das Telefon scheint einen Geist in sich zu haben. Hast du auch irgendwelche merkwürdigen Nachrichten bekommen?«
Joe schüttelte den Kopf.
»Ich muss unsere Technik-Gurus anrufen«, sagte Kurt. »Irgendetwas Seltsames geht hier vor.«
Noch bevor er den Anruf machen konnte, wurde er von einem Tumult an der Sicherheitskontrolle abgelenkt. Drei Polizisten und zwei Männer in Anzügen stürmten in das Gebäude, bahnten sich einen Weg durch die Schlangen der Wartenden und drängten sich dann an den Kontrolleuren vorbei. Jetzt waren sie auf der Abflug-Seite des Terminals und marschierten durch die kleine Zahl der Passagiere direkt auf Kurt und Joe zu.
»Entschuldigung!« Die Polizisten schoben die Leute zur Seite. »Entschuldigen Sie, bitte machen Sie Platz.«
Kurt steckte das Handy weg, als sich die Männer ihnen näherten. »Es geht bestimmt um deinen Rückenkratzer.«
Die drei uniformierten Polizisten trafen zuerst ein und flankierten Kurt und Joe, als wollten sie sie daran hindern wegzulaufen. Die Männer in den Anzügen erreichten sie nur Sekunden später. Der erste der beiden war vielleicht sechzig Jahre alt. Er hatte lockiges graues Haar und trug einen weißen Leinenanzug. Er schwitzte und war sichtlich erschöpft. Er wartete und wischte sich den Schweiß von der Stirn, bevor er sprach.
»Sind Sie Kurt Austin?«
Joe wandte sich ab und nahm einen Bissen von seinem Sandwich. »Darauf würde ich nicht antworten«, nuschelte er mit vollem Mund.
»Das bin ich.« Kurt ignorierte ihn. »Und das ist Joe Zavala, mein Partner.«
»Echt jetzt?« Joe drehte sich um. »Du konntest mich wohl nicht aus dieser Sache rauslassen, was?«
Kurt grinste über Joes gespielte Frustration.
»Sie beide arbeiten für die NUMA«, fuhr der Mann in dem weißen Anzug fort. »Die US-Behörde für Meeresbiologie?«
Na ja, das lasse ich so mal durchgehen, dachte Kurt. »Richtig«, antwortete er. »Was können wir für Sie tun?«
»Mein Name ist Marcel Lacourt«, sagte der Mann. »Ich bin hier auf La Réunion der Präfekt. Ihr Amerikaner würdet das den Gouverneur der Insel nennen. Ich bitte offiziell um Ihre Hilfe.«
»Wobei?«, fragte Kurt misstrauisch.
»Es hat eine Massenstrandung von Walen auf der anderen Seite der Insel gegeben«, erklärte Lacourt. »Mir wurde gesagt, dass eine große Anzahl anderer Meerestiere ebenfalls in der Bucht und in der Nähe der Küste auftreten. Noch mehr Wale. Und Schwärme anderer Fische. Im Augenblick ist Hochwasser, aber das wird sich bald ändern. Die freiwilligen Helfer befürchten, dass weitere Tiere in der Nacht stranden werden.«
Es war bereits später Nachmittag. »Wie viele Wale?«
»Einer ist sehr groß, die anderen sind etwas kleiner«, erwiderte Lacourt. »Ich muss Ihnen sagen, dass so etwas hier normalerweise nicht vorkommt. Wir haben Haie. Wir haben Whalewatching. Aber wir hatten noch nie eine solche Massenstrandung dieser großartigen Kreaturen. Auf so etwas sind wir weder vorbereitet noch wissen wir überhaupt, wie wir damit umgehen sollen. Wir hoffen, dass Sie uns helfen können.«
Mehr musste er nicht sagen. Während Joe den letzten Teil des Sandwiches verschlang, schnappte sich Kurt seinen Rucksack vom Sitz und nickte Richtung Ausgang. Der Rückflug würde warten müssen.
»Gehen wir«, sagte er. »Pläne machen wir unterwegs.«
2
Mit Polizeieskorte dauerte die Fahrt vom Flughafen zum Strand fünfzehn Minuten. Auf dem Weg dorthin gab Austin dem Präfekten Anweisungen und erstellte eine vorläufige Liste von Ausrüstungsgegenständen, die hilfreich sein würden. »Wir brauchen Bagger, die bis zum Wasser hinunterfahren können. Zweihundertfünfzig-Liter-Fässer, sowie Rigips- oder Metallplatten, mit denen wir einen breiten Graben auskleiden können, und dazu leere, leicht zu transportierende Autobahnbarrieren aus Kunststoff. Wir sind auf der Straße unterwegs zum Flughafen an einer Reihe von Barrieren vorbeigekommen.«
Lacourt schien die Liste der Anforderungen zu überraschen, aber er enthielt sich eines Kommentars. »Sonst noch etwas?«
»Feuerwehrfahrzeuge, die die Hauptwasserleitung anzapfen können.« Lacourt hörte aufmerksam zu und notierte alles auf einem kleinen Block, dann holte er sein Smartphone heraus und begann, SMS an Personen zu versenden, die auf Anweisungen warteten. Als sich der Polizeikonvoi durch die Menge der Schaulustigen am Strand schlängelte, war bereits Hilfe aus verschiedenen Richtungen unterwegs.
Kurt stieg aus dem Auto, kaum dass es ausgerollt war. Ein Blick sagte ihm, dass sie jede Hilfe brauchen würden, die sie bekommen konnten. Er stand auf der Küstenstraße, dreißig Meter oberhalb des Strandes, und sah bereits Dutzende gestrandeter Wale. In ihrer Mitte lag ein ausgewachsener Pottwal.
Weiter draußen wimmelte es in der Bucht von Meeresbewohnern. Das Wasser schäumte weiß, als die Tiere in Panik umherstoben, miteinander kollidierten und wie wild umherschossen. Trotz der weiten Bucht schien keines der Tiere daran interessiert zu sein, aufs Meer hinauszuschwimmen.
So etwas hatte Kurt noch nie gesehen.
Joe war ebenso verblüfft. »Sind sie gefangen?«, fragte er Lacourt. »Existiert da draußen ein Riff oder eine Sandbank?«
»Nein«, erwiderte der Inselpräfekt. »Auf dieser Seite gibt es keine Korallen, nur ein stetiges Gefälle ins tiefere Wasser.«
»Vielleicht versuchen sie, zu ihrem Anführer zu gelangen«, spekulierte Joe. »Bei Walstrandungen – wenn es um mehrere Tiere geht – handelt es sich oft um eine Walherde, die in einer Gruppe unterwegs ist, also um eine große Familie. Wenn der Anführer verwirrt wird und strandet, versuchen die anderen vielleicht, ihn zu retten, oder sie folgen ihm ins Verderben. Das kommt bei Grindwalen bedauerlich häufig vor.«
Kurt hatte schon dasselbe gedacht, aber als er die Tiere am Strand betrachtete, stellte er fest, dass es sich bei ihnen nicht um eine einheitliche Art handelte. Der Pottwal war ein Einzelgänger. Ein Paar junger Buckelwale weiter unten war vielleicht zusammen unterwegs, und es gab auch Grindwale und mehrere Schweinswale. Aber selbst diese bildeten nur eine willkürliche Mischung aus verschiedenen Arten. Darunter befand sich auch ein Brillenschweinswal mit einer schwarz-weißen Färbung, die der eines Orkas ähnelte.
»Das ist keine Familienherde«, erklärte Kurt.
Joe nickte. Sie waren zwar keine Meeresbiologen, wussten aber genug, um zu erkennen, dass dies keine gewöhnliche Strandung sein konnte.
Doch ob gewöhnlich oder nicht, sie mussten die Tiere vom Strand wegbringen und einen Weg finden, diejenigen im seichten Wasser davon abzuhalten, ebenfalls an den Strand zu schwimmen.
Kurt ging zum Strand hinunter. Die anderen folgten ihm. »Welches Tier ist zuerst angekommen?«
»Der Große in der Mitte«, antwortete einer der Polizisten. »Er wurde vor einer Stunde im seichten Wasser gesichtet.«
Der Pottwal lag auf der Seite, sein Maul stand seltsam schräg offen. Sein ungeheures Gewicht verformte seine sonst so majestätische Form. Freiwillige Helfer überschütteten ihn mit Wasser aus Eimern, ansonsten konnten sie nur herumstehen und zusehen.
»Den müssen wir zuerst wegschaffen«, erklärte Kurt.
»Sind Sie sicher, dass Sie nicht lieber mit den kleineren anfangen wollen?«, erkundigte sich Lacourt.
Kurt hatte den Vorschlag aufgrund einer Vermutung geäußert. »Ich habe einfach den Verdacht, dass die anderen dem ersten an den Strand gefolgt sein könnten. Wenn wir ihn also zurück ins offene Wasser bringen können, folgen sie ihm möglicherweise auch, wenn er die Bucht verlässt, und wir können uns anschließend um die Rettung der kleineren kümmern.« Er wandte sich an Joe. »Wie sieht es mit der Tide aus?«
Joe hatte auf dem Weg hierher die Gezeiten- und Wellenbedingungen überprüft. »Das Hochwasser kommt in etwa vierzig Minuten.«
»Viel Zeit ist das nicht«, meinte der Polizist.
»Mehr haben wir aber nicht«, erwiderte Kurt. »Entweder schaffen wir den Pottwal in vierzig Minuten vom Strand weg, oder er sieht das Meer nie wieder.«
Sie erreichten den feuchten Teil des Strandes, nur wenige Meter von der Schnauze des Wals entfernt. Kurt sah dem Tier in die Augen. Er hatte das Gefühl, dass es ihre Hilfe wollte. Wahrscheinlich bildete er sich das nur ein, aber es konnte nicht schaden zu glauben, dass ein Säugetier die beruhigende Anwesenheit eines anderen imstande war zu spüren.
Kurt trat von dem Wal weg und versammelte eine Gruppe von Freiwilligen um sich. Dazu gehörten der Chief der Feuerwehr und ein Vorarbeiter der Baufirma, der mit einem Bagger gekommen war. Er versicherte, dass ein weiterer hierher unterwegs sei.
Nachdem Lacourt alle kurz vorgestellt hatte, übernahm Kurt das Reden. Er ließ sich auf ein Knie nieder und zeichnete ein Diagramm in den nassen Sand. »Das ist die Wasserlinie«, sagte er und zeichnete eine horizontale Linie. »Das ist der Wal«, fügte er hinzu und legte einen Stock aus Treibholz hin, um das gestrandete Tier zu markieren. »Die Bagger müssen zwei Kanäle graben.« Mit den Fingern zeichnete er zwei diagonale Linien, die von der Brandungszone zu einer Stelle oberhalb des Wals führten. »Einen hier und einen hier.«
»Sie wollen nicht unter oder hinter dem Wal graben?«, fragte der Vorarbeiter, der einen Schutzhelm trug.
»Man kommt nicht wirklich unter das Tier«, erwiderte Kurt. »Es würde dann nur tiefer in den Sand sinken. Als würde man mit den Reifen im Schlamm wühlen. Es wäre zwar hilfreich, den Sand hinter dem Wal auszubaggern, aber das sollte man sich noch für den Schluss aufheben, denn das Meer wird den Kanal fast so schnell wieder füllen, wie man ihn ausgräbt.«
»Okay«, sagte der Mann. »Ich werde das meinen Leuten sagen.«
»Die Fässer werden mit einem Sattelschlepper angeliefert«, kündigte Lacourt an. »Was sollen wir damit machen?«
»Wie viele Fässer sind es?«
»Ein paar Dutzend. Sie stammen von dem Highway-Projekt.«
Kurt nahm einige Kieselsteine und legte sie um die Vorderseite des Holzstücks, das den Kopf des Wals darstellte. »Stellen Sie sie hier auf«, begann er und wandte sich dann an den Chief der Feuerwehr. »Füllen Sie sie bis oben hin mit Wasser und trommeln Sie ein paar starke Freiwillige zusammen, die bereit sind, sie umzukippen, wenn es so weit ist.«
»Ich glaube, ich weiß, was Sie vorhaben!« Der Chief stand auf. »Wir sind bereit.«
»Eins noch«, sagte Kurt, bevor der Mann ging. »Wie hoch ist der Wasserdruck in der Leitung?«
»Am Hydranten haben wir 20 psi, aber wenn wir es durch den Lkw leiten, können wir ihn auf 50 psi erhöhen.«
Das klang hilfreich. »Ist das okay für Sie, wenn Sie den Schlauch im Sand vergraben und die Düse unter den Wal bringen?«
Der Chief schob seinen Helm zurück. »›Okay‹ ist nicht gerade das Wort, das ich verwenden würde, aber wenn Sie denken, dass es hilft, werden wir es versuchen. Was haben Sie vor?«
»Ich möchte im richtigen Moment Schlamm unter dem Wal erzeugen«, sagte Kurt. »Das größte Problem beim Bewegen dieses Lebewesens ist, dass sich der Sand unter ihm zusammenpresst. Das erzeugt eine Menge Reibung. Wasser lässt sich jedoch nicht zusammendrücken. Wenn wir den Sand damit übersättigen können, wird es einfacher sein, den Koloss zu bewegen. Das ist in etwa so, als würde man über Schaumstoff statt über grobes Sandpapier gleiten.«
Der Chief nickte. »Ich lasse von meinen mutigsten Jungs einen Graben ausheben. Wie nah sollen wir heran?«
»So nah wie möglich und so tief wie möglich in den Sand«, instruierte ihn Kurt. »Platzieren Sie die Düse direkt unter dem Tier, wenn Sie können.«
»Was ist mit seinen Zähnen?«
Im offenen Maul des Wals waren gebogene, sieben Zentimeter lange Zähne zu sehen.
»Solange Sie Ihren Arm nicht in sein Maul stecken, sollte alles in Ordnung sein«, sagte Kurt. »Andererseits, wenn einer Ihrer Jungs keinen Fischgeruch ausstehen kann, würde ich ihn lieber im Truck lassen. Wale haben einen furchtbaren Atem.«
»Gut zu wissen«, sagte der Chief lachend und ging die Böschung hinauf, wo die Feuerwehrfahrzeuge geparkt waren.
Als er außer Hörweite war, meldete sich eine der Freiwilligen zu Wort, eine junge Frau, die zum Fachbereich Meeresbiologie der Universität gehörte. »Ich möchte nicht des Teufels Advokatin spielen«, sagte sie. »Aber wie Sie schon bemerkt haben, der Sand ist porös. Das heißt, das ganze Wasser, das Sie auf den Strand pumpen, wird einfach nach unten sinken und sich horizontal ausbreiten.«
Sie hatte rabenschwarzes Haar, dunkle Augen und eine blasse, fast alabasterfarbene Haut. Ihre vollen Lippen waren dunkelrot, ohne dass auch nur ein Hauch von Lippenstift oder Lippgloss nachhelfen musste. Sie starrte Kurt mit hochgezogenen Augenbrauen an und verschränkte die Arme, als sie auf seine Antwort wartete.
»Das ist ein gutes Argument, Ms …«
»Chantel Lacourt«, antwortete sie, ohne dass sich ihre fragenden Brauen auch nur um einen Millimeter bewegten.
Ein fast komischer Ausdruck erschien auf Kurts Gesicht. »Sie sind die Tochter des Gouverneurs?« Wenn er doch nur ein Pirat wäre, der um Begnadigung bat.
»Sie ist meine Nichte«, sagte Lacourt. »Und ich bin der Präfekt, nicht der Gouverneur.«
Sowohl Kurt als auch Chantel lachten darüber, aber der Präfekt schien den Witz nicht zu verstehen. Kurt blickte wieder zu Chantel, die immer noch auf seine Antwort wartete. »Das Wasser wird nicht allzu weit sinken, weil die Flut den Sand unter der Oberfläche bereits gesättigt hat. Und was die seitliche Ausbreitung angeht – da kommt das Blech ins Spiel.«
Auf der Suche nach etwas, das das Blech darstellen könnte, zückte Kurt seine Brieftasche und nahm Kreditkarten und andere Plastikdokumente heraus. Er steckte sie schräg in den Sand und drückte sie unter den Stock-Wal.
»Wir rammen die Platten in den Sand und achten darauf, dass jede Platte die nächste überlappt.« Sein Führerschein und ein Bibliotheksausweis bildeten die letzten Glieder der Rutsche. Er schob eine Handvoll Sand hinter sie, um sie zu sichern. »Wir lassen von den Bulldozern dahinter Sand aufschütten …«
»… und bauen eine Rutsche, die das ganze Wasser auffängt«, führte sie seinen Gedanken zu Ende. Ihre Brauen senkten sich, und sie nickte zustimmend. »Aber wird das genügen, um den Wal wieder aufs Meer hinauszuschwemmen?«
»›Schwemmen‹ ist ein bisschen optimistisch«, entgegnete Kurt. »Aber mit etwas Glück und einem kräftigen Zug von einem der Boote sollten wir in der Lage sein, diesen großen Burschen in die Bucht zu ziehen. Von dort aus können wir ihn dann in tieferes Wasser schleppen.«
»Sie«, sagte Chantel.
»Wie bitte?«
»Der Wal ist ein Weibchen«, informierte ihn Chantel. »Und das ist auch ganz gut so. Wäre er ein Männchen, wöge er mindestens zehn Tonnen mehr.«
Kurt lächelte. »Tun Sie mir einen Gefallen«, bat er sie dann. »Kümmern Sie sich um die Platzierung dieser Bleche. Ich habe nicht genug Plastikkarten dabei, um es noch einmal zu erklären.«
»Das erledige ich für Sie«, versprach sie. »Ich kann Leute sehr gut herumkommandieren. Das liegt bei uns in der Familie.«
Sie entfernte sich und ging zu der Palette mit den Blechen und Rigipsplatten. Nur Lacourt und Joe blieben zurück.
»Sie macht immer Schwierigkeiten«, beschwerte sich der Präfekt. »Fragen über Fragen, bis sie alles wirklich verstanden hat. Sie war schon als Kind so.«
»Es gibt Schlimmeres«, erwiderte Kurt und wechselte dann das Thema. »Wir brauchen ein paar Boote. Haben Sie irgendeine Idee?«
»Es gibt einen Jachthafen nicht weit von hier, ein paar Meilen die Straße hinauf«, antwortete Lacourt. »Ich bin sicher, dass wir dort etwas für Sie finden.«
»Nehmen Sie Joe mit. Er weiß, was wir benötigen.«
3
In den nächsten zwanzig Minuten war Kurt praktisch überall. Er beaufsichtigte das Aufstellen der Fässer, das Ausheben der Gräben, das Abstützen der Wellblechplatten. Er kroch sogar neben den Wal, um beim Ausheben der schmalen Rinne unter dem Tier zu helfen, die für die Feuerlöschschläuche verwendet werden sollte.
Mit dem Fortschreiten der Arbeiten wuchs die Zuschauermenge. Inzwischen hatte sich die Nachricht auf der ganzen Insel verbreitet, und sowohl Touristen als auch Einheimische kamen in Scharen.
Auf diese Unruhe um ihn herum reagierte der Pottwal mit schnalzenden Geräuschen. Und er schlug mit dem Schwanz auf das Wasser, sodass jeder, der ihm zu nahekam, vollkommen durchnässt wurde. Weiter hinten gaben die Delfine und Schweinswale ängstliche Rufe von sich, während sich die Buckelwale in der flachen Brandung wälzten und hilflos mit ihren langen Brustflossen wedelten. Die Situation wurde immer bedrohlicher, aber sie waren fast so weit, dass sie endlich handeln konnten.
Nachdem das letzte Fass gefüllt, die Wellblechplatten durch Sandbermen gesichert und die Hochdruckschläuche angebracht waren, war alles bereit. Alles außer Joe.
Kurt suchte die Bucht erfolglos ab, dann nahm er ein Funkgerät und rief ihn. »Hier wird es allmählich dunkel, Amigo. Sag mir, dass du in der Nähe bist.«
Untermalt von dem rauschenden Wind drang Joes Stimme durch das Funkgerät. »Ich komme jeden Augenblick um die Spitze.«
Joe fuhr von Norden her in die Bucht ein. Er stand am Bug eines Kabinenkreuzers, der sich durch die Brandung wälzte. Hinter ihm folgte ein kleiner Hafenschlepper. Sein geringer Tiefgang und seine starken Motoren eigneten sich für das, was sie brauchten, ausgesprochen gut. Ein drittes Boot in Joes Flottille schien ein Gleitschirmschlepper zu sein. Noch eine gute Wahl, befand Kurt, denn dessen Skipper war es zweifellos gewohnt, am Strand zu fahren, um Kunden aufzunehmen und abzusetzen.
Als sich die Flotte dem Ufer näherte, drehten die beiden Motorboote stark ab, und der Schlepper blieb in der Mitte. Er verlangsamte bis zum Stillstand, wendete und fuhr dann die letzten hundert Meter rückwärts. Als er sich dem Strand näherte, warf eines der Besatzungsmitglieder eine Leine ans Ufer. Kurt tauchte in die Brandung, um sie zu bergen. Er schwamm zurück zum Strand, grub seine Füße ein und zog die Leine auf den Sand.
Das dünne Metallkabel war mit einem dicken Tau verbunden. Mithilfe der Freiwilligen zog Kurt das Tau ein und war schon versucht, es um den Wal zu schlingen.
Bei der kleinsten Berührung zuckte das Tier jedoch abwehrend mit dem Schwanz und hätte Kurt fast durch die Luft geschleudert, aber er hatte damit gerechnet und war rechtzeitig zur Seite gesprungen.
»Jetzt komm schon!«, rief er. »Ich dachte, wir hätten einen Deal.«
Der Wal schnippte noch einmal mit der Fluke und schlug sie dann klatschend auf das Wasser. Der Knall war beinahe ohrenbetäubend.
Kurt wartete, bis er sie wieder hob, und zog dann hastig die Leine unter den Flossen hindurch. Als er die andere Seite des angeschlagenen Tieres erreichte, schloss er den Karabinerhaken am Ende des Seils über das dicke Tau.
Erneut knallte die Fluke auf die Brandung und schleuderte eine Fontäne aus Wasser und Gischt auf Kurt. Die folgende Welle warf ihn um, was ihn aber nicht daran hinderte, die Leine straff zu ziehen. Nun lag sie sicher um den Schwanz des Tieres.
Als er an den Strand kletterte, warteten dort bereits Lacourt, Chantel und der Vormann des Bautrupps. Der Chief der Feuerwehr stand weiter oben am Strand mit einem Funkgerät in der Hand.
»Alle bereit?«, fragte Kurt.
Der Vormann nickte. Die diagonalen Gräben waren fertig. Die Bagger standen jetzt im Wasser und versuchten, eine Rinne hinter dem Wal auszubaggern.
»Die Paneele sind an ihrem Platz«, informierte ihn Chantel. »Befestigt und einsatzbereit.«
Kurt sah, dass die Oberseiten der Platten tatsächlich wie seine Kreditkarten aus dem Boden ragten. Drei Meter hohe Sandhügel stützten sie von hinten ab. »Ausgezeichnet, genauso, wie ich es wollte.«
Kurt schnappte sich das Funkgerät und meldete sich bei der Feuerwehr. »Chief?«
»Wir sind bereit, die Fässer auszugießen und das Wasser aufzudrehen.«
Die Schläuche der Feuerwehrwagen waren unter fünf Fuß Sand begraben und so nah wie möglich an die Seiten des Wals geschoben worden. Die Besatzungen hatten die freiliegenden Teile der Leitungen weiter oben mit Sand aufgeschüttet, in der Hoffnung, dass die Hochdruckschläuche nicht aus dem Sand herausgedrückt würden.
»Ventile öffnen, etwa ein Viertel«, befahl Kurt. »Warten Sie auf mein Signal, und geben Sie dann volle Leistung.«
Der Chief nickte und gab seinen Männern an den Pumpen der Feuerwehrwagen über Funk Bescheid. Die Ventile wurden um ein Viertel geöffnet. Die Schläuche bogen sich und zuckten wild unter dem Sand, als sie sich mit Wasser füllten. Die Sandhügel, die sie unten hielten, bewegten sich zwar etwas unter dem Druck, aber sie hielten die Schläuche unter sich. Kurt wertete das als Sieg.
Er funkte Joe an. »Wisst ihr Jungs auf dem Schlepper, dass ihr fest, aber langsam ziehen müsst? Es kommt nicht besonders gut, wenn wir dem Wal die Fluke abreißen, während wir versuchen, ihn zu retten.«
»Ich habe es ihnen dreimal eingeschärft«, betonte Joe. »Aber versprechen kann ich nichts. Das ist für alle eine Premiere.«
Dagegen konnte Kurt nichts einwenden. »Dann los. Versucht, nicht mit dem Wal zusammenzustoßen oder auf dem Strand aufzulaufen.«
Mit Joe am Ruder setzte sich der Kabinenkreuzer in Bewegung. Sekunden später folgte das Gleitschirmschleppboot seinem Beispiel. Sie fuhren in die Bucht hinaus und kehrten dann um, um mit zunehmender Geschwindigkeit auf den Strand zuzusteuern. Als sie näherkamen, bemerkte Kurt, dass sich ihre Rümpfe etwas hoben, aber sowohl Joe als auch der andere Skipper drosselten die Leistung, um zu verhindern, dass die Boote über das Wasser glitten. Ihr Ziel war, so viel Wasser wie möglich zu verdrängen.
Kurt sah zu und wartete, hob dann langsam die Hand und ballte schließlich die Faust, als wollte er das Startsignal für ein Rennen geben. »Jetzt!«
Die Feuerwehrleute drehten die Druckventile voll auf, und aus den unter dem Sand vergrabenen Hochdruckschläuchen schoss das Wasser. Um den Wal herum bildete sich eine Schaumschicht, während sich das Wasser auf dem Strand ausbreitete. Gleichzeitig stemmten sich die Freiwilligen im Halbkreis gegen die Fässer und kippten sie um. Sie fielen in rascher Folge und schickten Tausende Liter Wasser in den Graben, gerade als Joe und sein Kollege sich im Gleitboot der Untiefe näherten.
Noch in letzter Sekunde schwenkten sie mit ihren Booten scharf um, wie Eishockeyspieler, die unvermittelt stoppten. Dieses Manöver schickte zwei starke Wellen Meerwasser in die diagonalen Gräben. Das Wasser stieg und ergoss sich in einem Schwall in den Graben, wo es sich mit dem Wasser aus den umgestürzten Fässern und den Schläuchen vereinte.
In den nächsten fünf oder sechs Sekunden wurde der fünfzig Fuß lange Wal von einem Wasserbad umspült. Der Schlepper zog in diesem Moment an, und der Sand unter dem Wal war nun eine Mischung aus losen Partikeln, Schaum und nicht komprimierbarem Wasser. Das riesige Tier wurde rückwärts in die Bucht gezogen, wie ein neu in Dienst gestelltes Schiff, das über die Helling ins Wasser rutschte.
Alles schien reibungslos zu verlaufen, bis sich einer der Hochdruckschläuche aus dem Sand löste und wie eine wütende Riesenschlange herausbrach.
Als die Feuerwehrleute den Wasserzufluss zum Schlauch unterbrachen, trat sofort ein zweites Problem auf. Der sich windende Wal hatte sich mit seiner Brustflosse in einer der Wellblechplatten verfangen. Er blieb an ihr hängen und schleifte sie weiter durch den Sand.
Kurt stürzte zu dem Wal und trat die Platte los. Das Tier rutschte noch ein Stück weiter, das Wasser schwappte aber bereits an ihm vorbei. Kurt erkannte, dass der Kopf des Wals immer noch auf dem Sand lag.
»Weiter ziehen!«, schrie er und gestikulierte zu dem Kapitän des Schleppers hinüber.
Die Motoren des Bootes heulten auf. Die Leine zog sich straff, doch die Gefahr, das Tier zu verletzen, wurde zu groß, da die Seile bereits in den Schwanz einzuschneiden begannen.
Plötzlich waren die Feuerwehrleute an Kurts Seite. Sie hielten den Schlauch fest, der sich aus dem Sand gelöst hatte. Nachdem sie Kurt aus dem Weg gedrängt hatten, richteten sie die Düse wieder auf den Strand aus und öffneten das Ventil.
Der Wasserstrahl spülte allmählich den Sand unter dem Kopf des Wals weg. Ohne weiter nachzudenken, stemmte sich Kurt gegen seine flache Nase, grub seine Füße in den Sand und drückte mit aller Kraft gegen das Tier.
Natürlich war das absurd, schließlich wog der Wal fünfzig Tonnen. Genauso gut hätte er versuchen können, einen Kipplaster mit angezogener Handbremse zu schieben. Andererseits wurde der Wal von einem Schlepper gezogen und war bereits fast vollständig im Wasser.
Als er sich anstrengte, um das Tier zurück ins Meer zu treiben, schlossen sich ihm auch Chantel und ihr Onkel sowie mehrere andere Freiwillige an. Plötzlich befreite sich der Wal vom Sand, rutschte rückwärts und glitt dann in die Bucht hinaus. Die Gruppe fiel vorwärts in die Brandung.
Kurt stand schnell auf und half Chantel und dem Präfekten auf die Beine. »Ich muss raus, um ihn von dem Seil zu befreien. Die Freiwilligen sollen dasselbe mit den anderen Walen machen. Und sorgt für Licht hier unten. Das wird eine lange Nacht.«
Chantel und ihr Onkel waren nahezu euphorisch. Sie rannten an den Strand. Die erfolgreiche Rettung hatte ihnen einen Adrenalinschub verpasst, der sie glauben ließ, sie könnten die ganze Nacht durcharbeiten.
Kurt kehrte ihnen den Rücken zu, sprang wieder in die Brandung und schwamm zu dem Kajütboot. Als er die Heckleiter hochkletterte, erwarteten ihn schon die Besitzer des Bootes. Sie halfen ihm an Deck und reichten ihm ein Glas Champagner. Sie hielten selbst Flöten mit dem sprudelnden Getränk in der Hand.
»Danke, dass wir Ihr Boot benutzen durften«, sagte Kurt und ließ sich in einen Sitz fallen, während Joe das Boot wendete und dem davonfahrenden Schlepper folgte.
»Ich freue mich, dass ich Ihnen helfen konnte«, erwiderte die Frau. »Ich habe das Meer schon immer geliebt.«
»Das war aufregend und Furcht einflößend zugleich«, verkündete der Mann und hob sein Glas. »Was passiert als Nächstes?«
»Wir folgen dem Schlepper in tiefere Gewässer und schneiden den Wal dort frei.«
»Hoffentlich ohne dass wir zerschmettert werden«, fügte Joe vom Kommandostuhl aus hinzu.
4
Während sich Kurt auf die Bank setzte, gab Joe Gas und lenkte den Kajütkreuzer vom Strand weg. Der Schlepper bewegte sich langsam, aber stetig auf das offene Wasser vor der Bucht zu.
Bisher hatte sich die Walkuh nicht gewehrt. Sie schien sich damit zufrieden zu geben, wieder im Meer zu sein.
Zu stranden und auf dem Sand zu liegen, war hart für Wale. Ihre Körper hatten sich so entwickelt, um den Auftrieb des Wassers nutzen zu können. Strandeten sie, wurden sie allmählich durch ihr eigenes Gewicht erdrückt. Sie konnten kaum atmen, und ihre inneren Organe wurden zerquetscht. Ohne das kühlende Wasser um sie herum überhitzten sie sich innerlich, trockneten schnell aus und bekamen schließlich einen Sonnenbrand.
Ein Sprühstoß aus dem Blasloch deutete darauf hin, dass das Tier seine Lungen füllte und seinen Körper wieder mit Sauerstoff versorgte.
»Wie weit willst du ihn hinausschleppen?«, erkundigte sich Joe.
»Mir wurde übrigens gesagt, dass es sich um eine Walkuh handelt«, gab Kurt zurück. »Lass uns mindestens eine ganze Meile rausfahren. Vielleicht ist sie so verwirrt, dass sie noch ihre Meinung ändert – und ich will nicht, dass sie zum Ufer zurückschwimmt.«
Über Funk rief Joe den Schlepper und schlug vor, nach Süden abzudrehen, wo die Strömung ihnen helfen würde. Die Wende verlief langsam und reibungslos, aber die Walkuh schien die Veränderung zu spüren. Sie schwang ihren großen rechteckigen Kopf hin und her.
»Wie aufregend.« Der Skipper schenkte mehr Champagner ein. »Ich hoffe nur, dass sie uns nicht rammt wie Moby Dick.«
»Das hoffe ich auch«, sagte Kurt und wandte sich wieder an Joe. »Du konntest wohl kein nüchternes Paar finden, um mit ihm einen Deal zu machen?«
Joe verdrehte die Augen. »Ich habe einen Fremden gebeten, mir sein Boot zu überlassen, und gleichzeitig zugegeben, dass die Möglichkeit besteht, dass es von einem fünfzig Tonnen schweren Wal zertrümmert wird. Versuch du mal, ein solches Geschäft ohne Alkohol abzuschließen.«
Kurt lachte. »Okay, das sehe ich ein.«
Joe fuhr mit dem Boot ein wenig näher heran. Der Pottwal schwang immer noch seinen Schädel hin und her, hob ihn aus dem Wasser und ließ ihn heruntersausen. Das Wasser, das aus seinem Maul strömte, war von blutrotem Schaum durchsetzt. Aus dem Schwanz, wo sich das Seil in seine Haut eingegraben hatte, kam noch mehr Blut, aber diese Wunden würden sehr schnell heilen.
Je unruhiger die Walkuh wurde und je weiter die Dämmerung sich über das Meer legte, desto klarer wurde Kurt, dass ihnen die Zeit davonlief. Den Wal zu befreien, war schon gefährlich genug gewesen, auch ohne es in der Dunkelheit vielleicht noch einmal versuchen zu müssen.
»Funk den Schlepperkapitän an«, sagte er zu Joe. »Sag ihm, er soll abschalten, mit der Strömung treiben und die Leinen loslassen. Es wird Zeit, die Wal-Lady freizulassen.«
Joe funkte dem Skipper des Schleppers, während Kurt zum Heck des Bootes ging und sich einen Bootshaken schnappte. Er überprüfte dessen Gewicht und Länge. Wenn alles nach Plan verlief, musste er ihn nur in die Leine einhaken und die Schlaufe weiter aufziehen, damit sich der Wal aus der Schlinge befreien und davonschwimmen konnte.
Ihnen gegenüber schaltete der Schlepper in den Leerlauf, und die Leine wurde schlaff.
Zum Glück reagierte das Tier nicht. »Geh näher ran«, befahl Kurt Joe.
Joe manövrierte sich in die Nähe der Fluke.
»Noch ein bisschen näher«, sagte Kurt.
Joe gab kurz Gas und nahm es dann wieder zurück, während er das Steuerrad in die andere Richtung drehte. Mit dem Schwung und dem harten Schlag des Ruders drehte sich der Bug weg, während das Heck noch näher an das Tier heranschwang.
Kurt streckte den Bootshaken aus und griff nach dem Seil. Er zog langsam daran und vergrößerte damit die Schlaufe. Der Wal hob seinen Schwanz, als wolle er helfen, ließ ihn dann aber langsam wieder sinken, ein träges Flattern, das nur das Wasser aufwirbelte und den Kajütkreuzer wegschob.
Joe manövrierte das Boot zurück, und Kurt zog wieder an dem Seil. »Vorwärts, aber langsam.«
Joe gab Gas, und der Kabinenkreuzer begann, sich von dem großen Tier zu entfernen. Die Schlaufe war jetzt groß genug für die Fluke, doch der Wal weigerte sich, sie aus dem Seil zu ziehen.
»Sie ist noch nicht wirklich bei Kräften«, stellte Joe fest.
»Fahr einen Bogen hinter sie«, schlug Kurt vor. »Wir ziehen das Seil vom Schwanz, und sie kann loslegen, sobald sie bereit ist.«
Joe steuerte das Boot vorsichtig um den sich behäbig hebenden und senkenden Schwanz herum. Sie befanden sich direkt hinter dem Tier, als ein graues, torpedoförmiges Objekt unter dem Boot hinwegraste und versuchte, in die blutende Fluke zu beißen.
»Haie!«, schrie Joe.
Ausgerechnet jetzt müssen sie auftauchen.
Eigentlich war es keine Überraschung. In Not geratene Meeresbewohner zogen die Haie an wie Odysseus’ Sirenen. Das Blut im Wasser versetzte sie in einen regelrechten Rausch. Und das war in diesem Augenblick in Hülle und Fülle vorhanden.
Die Walkuh reagierte instinktiv. Sie schwang ihren Schwanz heftig zur Seite und schlug dann damit hoch und runter. Das Seil zog sich wieder straff, und der Bootshaken wurde Kurt aus den Händen gerissen. Zwar griff er hastig danach, doch der Haken verschwand in der Tiefe, als die Fluke des Wals mit lautem Krachen auf die Oberfläche klatschte und eine Wasserfontäne aufstieg.
Zwei weitere Haie glitten heran, drehten aber ab, bevor sie auch nur versuchten zuzubeißen.
Dann näherte sich ein anderer Hai und riss ein Stück aus dem ruhenden Schwanz. Kurt sah nur Zähne und einen weißen Bauch aufblitzen, als der Hai einen Halbkreis aus Fleisch aus der Fluke riss und wieder abtauchte.
Joe gab Gas und wendete das Boot, als die Fluke erneut auf dem Wasser aufschlug und den nächsten Wasserschwall in ihre Richtung schickte.
Kurt hielt sich am Heck fest, um nicht ins Meer zu fallen. Er blinzelte und suchte durch den Schaum hindurch nach dem Seil. Es saß immer noch fest um den Schwanz.
»Dreh neben ihr bei!«, rief er. »Macht nichts, wenn du gegen sie stößt.«
»Du hast doch nicht wirklich vor, das zu tun, was ich vermute?«, fragte Joe.
»Beeil dich.«
Joe brachte das Boot wieder längsseits der sich windenden Kreatur und stieß gegen die Flanke des Tieres, als wäre es ein hölzerner Steg. Hinter ihm sprang Kurt über den Heckspiegel auf den Rücken des Wals. Die Besitzer des Kabinenkreuzers und die Männer auf dem Schlepper beobachteten ihn ungläubig, aber in Wirklichkeit war dieser Ort keineswegs so gefährlich, wie es aussah. Hier konnten ihn die Haie nicht erwischen, und auch der Wal war nicht imstande, seine Schwanzflosse weit genug zu biegen, um ihn zu treffen. Allerdings konnte er ihn wie ein wilder Stier beim Rodeo abwerfen. Kurt hielt sich an der Außenseite des Seils fest und setzte sich breitbeinig auf den Schwanz der Walkuh, um nach der Öse des Seils zu suchen. Könnte er sie lösen, wäre alles gut. Mittlerweile war es allerdings so dunkel geworden, dass er kaum noch etwas sah.
»Ich brauche mehr Licht!«, rief er.
Die Scheinwerfer am Heck des Schleppers flammten auf. Als das Licht auf das Wasser traf, funkelte die Oberfläche von tausend kleinen Spritzern auf. Die Lichtstrahlen wurden für eine Sekunde gedämpft, als würden sie von einer Wolke verdeckt. Kurt wurde von fliegenden Objekten getroffen, als wäre er in einer Höhle voller wütender Fledermäuse gefangen.
Bei dieser Störung reagierte der Pottwal heftig, und Kurt wurde ins Meer geschleudert. Jetzt war er gleich doppelt gefährdet. Ein Schlag mit der Fluke würde ihn zerschmettern, und ein tödlicher Biss von einem der Haie bedeutete einen langsameren und schmerzhafteren Tod. Auf beide Todesarten konnte er gut verzichten.
Er stieß gegen die Walkuh, deren gummiartige Haut sowohl weich als auch unnachgiebig war. Sie hatte sich wieder beruhigt. Ganz offensichtlich hatte sie ihre volle Kraft noch immer nicht wiedererlangt. Er stieß sich von dem Tier ab, öffnete die Augen im Salzwasser und hoffte, den verschwommenen Umriss des Seils zu sehen, bevor er das schreckliche Maul eines großen Hais entdeckte.
Seine Hand streifte das Seil, bevor er es sah. Er packte es und stieß es an die Oberfläche, wo er sich mit dem Messer an die Arbeit machte und die gereepten Fasern durchsägte. Die gezackte Klinge schaffte es schnell, den Hanf zu durchtrennen, und in fünfzehn Sekunden hatte er ihn sauber durchgeschnitten.
Als das größere Stück abfiel, schob Kurt das kürzere Stück zurück zum Wal. Es rutschte durch die Öse, die Schlaufe öffnete sich, und das Seil versank in der Tiefe.
Kurt drehte sich um und schwamm zum Kabinenkreuzer zurück, getrieben von der Furcht, ihn könnte jeden Augenblick ein Hai aufs Korn nehmen. Er erreichte das Boot und kletterte in Rekordzeit die Leiter hinauf. Auf dem Deck brach er zusammen und war froh, beide Beine aus dem Wasser gezogen zu haben.
»Sie bewegt sich!«, rief Joe.
Kurt stand auf und schaute über die Reling. Der Pottwal hatte tatsächlich begonnen, seinen Schwanz regelmäßiger zu heben und zu senken. Statt sich zu verteidigen, versuchte er, in einem bestimmten Rhythmus zu stoßen. Eine weitere Gischtfontäne kam aus dem Blasloch, als er ausatmete und einen neuen, tiefen Atemzug nahm. Als seine Lungen gefüllt waren, tauchte das Tier mit seinem großen Kopf ab und schien sich mit einem letzten Schlag der Fluke zu verabschieden, während es unter Wasser verschwand.
Joe grinste von Ohr zu Ohr. »Einen abgeseilt, bleiben noch zehn.«
Kurt lehnte sich erschöpft gegen den Heckspiegel. Er blickte zu dem Eignerpaar des Bootes. »Jetzt nehme ich gern einen Drink.«





























