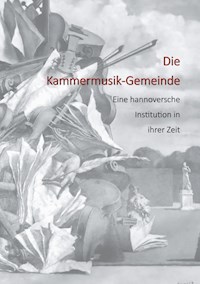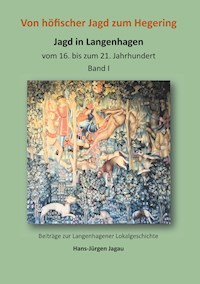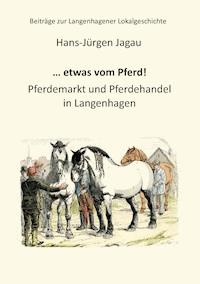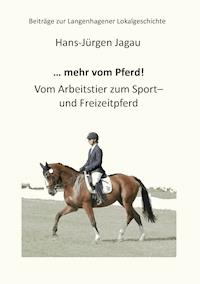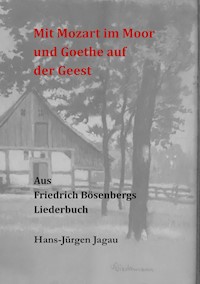
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Was ist schon eine Sammlung von Liedern, die jemand 1867 handschriftlich in einem Schulheft notierte? Auf den ersten Blick nur vergilbter, alter Kram. Näher betrachtet offenbart sich ein wertvolles Zeugnis schwindender Volkskultur. Es finden sich viele Belege für enge Verbindungen zur heute als Hochkultur gepflegten Kunst. Deshalb gehören Mozart und Goethe gewiss mit auf den Titel dieses Buches. Friedrich Bösenberg, der bäuerliche Sammler der enthaltenen Lieder, war noch nicht in die heute oft strenge Scheidung zwischen ernster und Unterhaltungsmusik verstrickt. Er notierte das, was in seinen Augen gut war. Und es war gut.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist der Liedertafel Kaltenweide – dem ältesten bestehenden Verein in Langenhagen – gewidmet
Mein Dank gilt Therese Reinecke und den Mädchen in der Küche meiner Großeltern, denn ihrem Gesang folgte ich bereits als Kleinkind. Wichtig war zudem Johannes Thienes, der mit voller Stimme bei uns im Kuhstall Kunstlieder wie Volkslieder sang. Durch ihn lernte ich noch in Kindertagen den „Erlkönig“ kennen. Auch Goethes „Faust“ wusste er zu rezitieren. Stellvertretend für die Herren der Liedertafel nenne ich meinen schon verstorbenen Freund Fritz Engelke sowie deren jetzigen Vorsitzenden Reinhard Brendel.
Inhaltsverzeichnis
Vergangenes
Eröffnung
Zum Inhalt des Liederbuchs
Nachtrag – Verlage für Liederhefte
Namensverzeichnis
Vergangenes
Es ist ruhig, aber nicht ganz still. Spatzen tschilpen auf dem Hof, andere Vögel singen so zeitig im Jahr noch nicht. Im Stall schlagen Kühe ab und zu mit dem Schwanz gegen ihre Flanken oder klirren mit der Kette. Bei den Schweinen herrscht Mittagsruhe. Das Paar Ackergäule steht im ledrig ratschenden Geschirr an der Krippe und prustet in die letzten Haferkörner. Gleich geht es wieder aufs Feld mit einem knarrenden Leiterwagen voll Stallmist. Am zugehörigen Haufen scharren einige Hühner. Ihr Hahn hält zu dieser Stunde den Schnabel. In der Küche klappert Geschirr im Waschzuber. Alle Stunden klingt die kleine Glocke der Dorfkirche von fern über die breite Feldmark. Auf der Chaussee mit dem sandigen Sommerweg neben ihrer grob gepflasterten Fahrbahn rumpelt kein Wagen.
Das Bauernhaus, in dem Friedrich Bösenberg 1867 wohnte. (Foto: H.-J. Jagau)
Im Jahr 1867 gibt es im Dorf Langenhagen keine Eisenbahn, die kommt erst 1890. Das Automobil ist nicht erfunden, geschweige denn das Flugzeug. Es gibt keine sonstigen Einrichtungen, die heute für ihren Lärm verrufen sind. Nur in den Schmieden konnte lauter Hammerschlag erklingen.
Wer Musik hören wollte, musste singen, ein Instrument spielen oder sonntags in der Kirche der Orgel lauschen. Man hätte auch in das vor fünfzehn Jahren erbaute „Königliche Hoftheater“ in Hannover gehen können. Diese Lustbarkeit gehörte aber nicht zu den Freizeitvergnügen eines damaligen Bauern.
Eröffnung
Vor einiger Zeit erhielt das Stadtarchiv Langenhagen ein handschriftlich gefülltes Heft, das „Liederbuch für Friedrich Bösenberg“. Es war überwiegend in bester Schönschrift geschrieben worden. Ob Friedrich Bösenberg, der im 19. Jahrhundert lebte, es selbst verfasste oder jemand anderes die Feder führte, kann man heute nicht mehr mit Gewissheit feststellen. Es gibt einige Abschnitte mit abweichender Handschrift, zudem wurde 1889 ein Nachtrag eingefügt.
Das Büchlein enthält die Texte von 52 Liedern. Noten dazu waren nicht erforderlich, weil alle Lieder damals gängiges, allgemein bekanntes Liedgut waren. Dies nach meiner Einschätzung wertvolle kulturgeschichtliche Dokument ist Anlass der nachfolgenden Überlegungen.
Hat das Heft wirklich großen Wert? Geneigte Leserinnen und Leser finden hier viele Belege dafür. Einen Hinweis liefert schon die Tatsache, dass Bösenbergs Nachkommen es nicht beim gelegentlichen Aufräumen weggeworfen haben. Sie hatten wohl Respekt vor dem handschriftlichen Dokument des Vorfahren, auch wenn sie es, aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht selbst benutzten. Vermutlich konnten es spätere Generationen wegen der ungewohnten Sütterlin-Schrift nicht mehr lesen.
Jeder, der es heute in der Hand hält, wird die anfangs sorgfältige Schrift mit Stahlfeder und Eichen-Gallustinte bewundern. Der Titel erscheint schulmäßig in vorwiegend lateinischen Buchstaben auf vorgezeichneten Linien. Im Text wurde nicht immer so sauber gearbeitet. Die Rubrizierung im „Register“ gelang freihändig so einigermaßen. Das erste Dutzend der Lieder zeigt noch ausgesprochene Schönschrift. Die lässt im weiteren Text wiederholt zu wünschen übrig. Der Schreiber strich Fehler durch, schrieb Vergessenes dazwischen und verstieß durchaus gegen die damaligen Anforderungen in der Schule.
Es gibt Passagen, die von einer anderen Hand stammen. So weicht das abschließend aufgenommene Scharnhorstlied stark vom übrigen Text ab. Obgleich der Schreiber ein Schulheft seiner Zeit für die Aufzeichnung nutzte, kann es nicht Ergebnis des Unterrichts sein. Dafür finden sich zu viele Lieder mit nicht „jugendfreiem“ Inhalt.
Nach über 150 Jahren ist das Heft nicht zerlesen und kaum beschädigt. Anscheinend diente es nicht oft beim Singen. Ohnehin ist auswendig Gelerntes eine bessere Grundlage für den Gesang. Die Kenntnis von Noten als Schrift für die Melodien fehlte dem Inhaber des Heftes sicherlich. Man findet keine Ansätze dazu. Verweise auf bekannte Melodien fehlen weitgehend.
Haben die Lieder im „Liederbuch“ für heutige Menschen einen Wert? Gesungen werden sie kaum noch, obgleich man auf Platten oder neuerdings „Youtube“ Interpretationen finden kann. Die Bezeichnung „Volkslied“ und die Zugehörigkeit zur Volksmusik ist für heute sehr zweifelhaft, denn die meisten Lieder gehören nicht mehr in unsere Zeit.
Der kulturelle Anspruch der jeweiligen Texte ist höchst unterschiedlich. Neben Dichtungen mit hohem, die Zeiten überdauerndem Wert enthält Bösenbergs „Liederbuch“ recht mäßige Texte. Weitgehend bekannte Autoren wie Joseph von Eichendorff, Clemens Brentano stehen auf der einen Seite, Johann Friedrich August Kazner und Heinrich Wagner auf der anderen. Auch die Komponisten der Lieder unterscheiden sich sehr in ihrer Bedeutung. Zwischen Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Maria von Weber, Friedrich Silcher und Friedrich Heinrich Himmel dehnt sich ein weites Feld. Die meisten Urheber von Text und Melodien sind unbekannt. In diesen Fällen ist langjährige mündliche Überlieferung anzunehmen. Die bekannten Verfasserinnen und Verfasser lieferten Kunstprodukte der Schriftkultur als Ausgangspunkt für das spätere Volkslied. Zwanzig Urheber von Texten und sechzehn Komponisten finden wir im Heft. Frauen sind bei Text und Komposition nur je einmal vertreten.
Wie wichtig war das Singen für die bäuerliche Bevölkerung im damaligen Langenhagen? Diese Frage ist am ehesten assoziativ zu beantworten. In den Jahren um Bösenbergs Niederschrift erhielt Gesang eine von Sängerorganisationen definierte Bedeutung. Der 1862 gegründete „Deutsche Sängerbund“ hatte die „Ausbildung und Veredelung des volkstümlichen deutschen Männergesangs“ zum Ziel. Man wollte die nationale Zusammengehörigkeit stärken und der Einigkeit des Vaterlandes zuarbeiten. Das „Liederbuch enthält dazu passende Lieder.
Unbestritten ist die kulturelle Bedeutung des Singens, denn gemeinsames Singen erhöht das Gefühl zugehörig zu sein. Über die Texte werden passende Werte und Haltungen vermittelt. Singende wählen sie als Ausdruck eigener Vorstellungen aus. Der Gesang kann nach außen wirken, aber auch ein internes Ritual sein, etwa bei den Gesängen von Fußballfans. Gemeinsames Singen erfüllt immer soziale Funktionen. Individuelles Singen weckt und reguliert Emotionen, belebt persönliche Erinnerungen und verweist auf Strukturen, Ordnungen und Lebenserfahrungen. Diese Funktionen des Singens von Liedern galten damals, sie gelten noch heute. Die Sammlung im „Liederbuch für Friedrich Bösenberg“ vermittelt daher Einblick in seine kulturelle Identität.
Das Lochamer Liederbuch um 1460 (wikipedia - gemeinfrei)
Gelehrte streiten sich, ob zuerst die Sprache als Kulturgut vorhanden war, oder ob es doch der Gesang gewesen sei. Nun, wenn man unsere biologisch nächsten Verwandten, die Primaten, als Beispiel für frühe Kulturstufen des Menschen heranzieht, dürfte es der Ruf gewesen sein, der immer kommunikativen Zwecken dient. Er kann nach menschlichen Vorstellungen melodiös sein, was man als Gesang deutet, er kann ebenso als Signal aufgefasst werden, was dann in Richtung Sprache weist. Sprechen und Singen werden sich im Verlauf der Entwicklung der Gattung Mensch gleichermaßen entfaltet haben. Musikinstrumente gehören so neben Waffen und Werkzeugen zu den frühesten Artefakten.
Schriftzeugnisse gibt es seit Jahrtausenden. Aufzeichnungen, die Gesänge belegen, sind dagegen späteren Zeitaltern vorbehalten. Das gilt besonders für Lieder, die von einfachen Leuten gesungen wurden. Ihre Überlieferung erfolgte vorwiegend mündlich. Text wie Melodie wurden beim gemeinsamen Singen angeeignet und auswendig gelernt. Etwas anders verhielt es sich bei religiösen Gesängen. So wurde in der weiteren Entwicklung der Reformation dem Gesang der Gemeinde immer mehr Bedeutung beigemessen. Evangelische Christen kennen die Liedbeiträge von Martin Luther.
Aber schon aus vorreformatorischer Zeit sind erste Aufzeichnungen von Liedern ohne religiösen Hintergrund bekannt. Darunter das oben gezeigte „Lochamer Liederbuch“, das vorwiegend Lieder enthält, die zum patrizischem Leben passen. Zu deren Verfassern zählt z. B. der bekannte Ritter Oswald von Wolkenstein (um 1377 – 1445) aus Südtirol. Einige ähnliche handschriftliche Aufzeichnungen aus dem 15. Jahrhundert sind erhalten geblieben.
Auch der einfache Bauer nebst Familie und Gesinde sang in dieser Zeit. Die Lieder wurden jedoch kaum schriftlich festgehalten und so fixiert überliefert. Gleichwohl sind Texte und Melodien mündlich ziemlich korrekt weitergegeben worden. Ein Beleg dafür findet sich auch in den Aufzeichnungen von Friedrich Bösenberg. Es ist der Text des Liedes Nummer 9 „Ich stand auf hohen Bergen“, das in einer Version bereits im Antwerpener Liederbuch aus dem Jahr 1544 verzeichnet ist.
Etwas früher (1535) druckte die Offizin Christian Egenolf in Frankfurt die Notenund Texthefte unter dem Titel „Gassenhawerlin und Reuterliedlin“ mit den vier Stimmen: Tenor, Bassus, Altus und Diskantus. Sie waren also für Knaben- und Männerstimmen gedacht. Noch früher (1512, 1513) druckte man Bücher mit überwiegend geistlichen Liedern in Augsburg, Mainz und Köln.
Das erste Lied „Entlaubet ist der Walde“E in Engenolfs Druck ist sehr alt. Das Lochamer Liederbuch enthält einen ähnlichen Titel mit verwandten Textteilen. Dort ist allerdings nicht vom schwarz/braunen Mädelein die Rede. Es geht vielmehr um schwarz-graue Farbe, die dem abschiednehmenden Sänger in den Sinn kommt, weil er „Sie“ verlassen muss.
Das braun-schwarze bzw. schwarz-braune Mädchen nahm seinen Weg aus dem Engenolfschen Buch bis zum ersten Lied in Friedrich Bösenbergs Aufzeichnung „OO Straßburg“. Nach dem Grimm‘schen Wörterbuch bezeichnet das Adjektiv schwarzbraun eine dunkelbraune Farbe. Diese galt besonders für Leute niederen Standes, die sich viel im Freien aufhalten. Es gibt zahlreiche Verweise zu anderen Volksliedern, so etwa „Schwarzbraun ist die Haselnuss“, „Mein Mädchen hat einen Rosenmund“ oder von Ludwig Uhland übermittelt: „Er (der Jäger) zog sein netz wol übern strauch, da sprang ein schwarzbraunes meidel herausz.“
Faksimile des Liederbuchs aus der Offizin Chr. Engenolf „Gassenhawerlin und Reuterliedlin“
Für Menschen aus dem Bauernstand kamen gedruckte Bücher eher nicht infrage. Sie griffen auf Flugschriften mit Liedertexten oder mündliche Überlieferungen zurück, die sie dann gelegentlich in Hefte eintrugen. Liedflugschriften wurden in sehr großer Zahl aufgelegt. Die umfangreichste Sammlung ist digitalisiert in der VDLied-Datenbank erschlossen. Dabei ist das Zentrum für populäre Kultur und Musik (früher Deutsches Volksliedarchiv) maßgeblich beteiligt. Dort wurden bisher etwa 17.000 Lieder dokumentiert. Verständlich, dass dieser Bestand nicht recht übersichtlich ist, da es viele abweichende Fassungen von Liedern gibt. Allein das Lied Nummer 2 im Bösenbergs Aufzeichnung ist dort in über 30 Versionen aus gedruckten Flugblättern des 19. Jahrhunderts vertreten.
Das „Liederbuch“ ist kein Einzelfall. Johann Herman Middendorf, ein Bauernsohn aus dem Artland1, notierte zwischen 1785 und 1792 rund 60 Lieder in seinem Heft: „Ein Lied Buch vor schöne Lieder“. Er trug sie zwischen seinem 15. und 22. Lebensjahr ein. Danach werden andere Aufgaben vorrangig geworden sein, denn ein Bauer hat nicht viel Freizeit. Selbstverständlich befasst sich die Forschung mit diesem kulturellen Erbe. Unter dem Titel „Erlebte Lieder“ analysierte Eva Kimminich handschriftliche Liederaufzeichnungen des 19. Jahrhunderts. Sie nutzte dabei 65 Liederbücher aus dem Nachlass des Sammlers Louis Pinck, der in Saargemünd in Elsass-Lothringen zuhause war. Obgleich dieser Raum weit von Langenhagen entfernt ist, gibt es dennoch ähnliche Lieder hier wie dort. Die mündliche Überlieferung reichte offensichtlich weit. Es wird kein Zufall sein, dass es sich dabei oft um erotisch „aufgeladene“ Texte handelte, denn die bewegten junge Leute ganz besonders.
Das Deutsche Volksliederarchiv enthält noch mehr Material, immerhin 240 Handschriften. Viele Autorinnen und Autoren haben sich mit Volksliedern und ihrer Geschichte befasst, am umfangreichten wohl Prof. Dr. Holzapfel2. Seine Publikationen informieren sehr weiträumig über Volkslieder und ihre Herkunft. Viele Aussagen in diesem Text beruhen auf seinen Forschungen. Die Hauptsammeltätigkeit gehört jedoch zum 19. Jahrhundert. Verschiedene Interessierte sammelten Volkslieder und publizierten ihre Sammlungen. 1847 wurde das Allgemeine deutsche Lieder-Lexikon in vier Bänden herausgegeben. Von 1805 bis 1808 veröffentlichten Achim von Arnim und Clemens Brentano „Des Knaben Wunderhorn“. Kritische Zeitgenossen bemängelten, dass diese Lieder zuweilen stärker „dichterisch“ überarbeitet wurden. Eine Kritik, die man generell bei derartigen Sammlungen anwenden muss, weil die Sammler zu gerne glättend, richtigstellend eingreifen. Wie der „Volksmund“ seine Lieder singt und wiedergibt, kann man in den Originalschreibweisen des Liederbuchs von Friedrich Bösenberg vorfinden.
Foto © H.-P.Haack (gemeinfrei)
Bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts veröffentlichte Pastor Zacharias Becker Schriften zur Bildung lesender Bauern. Sie sollten sich nach dem „Noth und Hülfsbüchlein“ am Beispiel des von Becker erfundenen Musterdorfes Mildheim orientieren. Zusätzlich sorgte er 1798 mit dem „Mildheimer Liederbuch“ für ihre Erbauung. Die Lieder seien „Gesammelt für Freunde erlaubter Fröhlichkeit und ächter Tugend, die den Kopf nicht hänget.“. Ob jedoch Lieder wie „Liebe Küh! Im Stalle/ steht ihr traurig alle.“ oder „Rauft, rauft, rauft! / Ihr Bursch‘ und Mädchen allzumal/ den schönen Flachs im grünen Tal.“ jemals wirklich gesungen wurden, steht dahin.
Die um 1840 in zahlreichen Lieferungen erscheinende „Sammlung auserlesener Gesänge für vier Männerstimmen“ „Orpheus“ kostete je Heft zwar nur 4 Groschen, eine überlieferte Aufstellung der Kosten belegt aber, dass das Gesamtwerk nicht billig zu haben war. Schon der Erwerb aller Hefte kostete 16 Gulden und 12 Groschen. Buchbinden, Durchschuss mit weißem Papier für die Partitur, gedrucktes Register ließen die Gesamtkosten auf 27 Gulden 15 Groschen anschwellen. Diese Summe übertraf die baren Jahreseinnahmen eines Lehrers in Langenhagen. In € umgerechnet ergibt sich ein Äquivalent von 362,00 €. Das wäre auch heute ein sehr teures Buch.
Der sehr umfangreiche Band „Deutsche Volkslieder“ aus dem Jahr 1838 beginnt mit drei Versionen des Liedes „O Straßburg“, das auch in Bösenbergs Aufzeichnung an erster Stelle steht. Eine später abgedruckte Version ersetzt einfach die Ortsbezeichnung. Nun lautet das Lied „O Hameln“ was das Versmaß ziemlich stört. Bei weiteren Liedern wurden ebenfalls mehrere z. T. regionale Fassungen aufgenommen.
Nur durch diese Aufspaltungen, Veränderungen und kreative Weiterentwicklungen ist die überlieferte Fülle an Volksliedern erklärbar. Thematisch behandeln sie dagegen überschaubare Gebiete. Vor allem: Liebe, Abschied, Soldatenschicksal. So verhält es sich auch in den Aufzeichnungen in Bösenbergs Liederbuch. Es enthält dreißig Liebeslieder, neunzehn Abschiedslieder, elf Soldatenlieder und zwei Moritaten. Bei den drei erstgenannten Themen gibt es gelegentlich Überschneidungen. Eine oberflächliche Überschau zeigt ähnliche Verhältnisse in den gedruckten Büchern.
1841 gab J. J. Algier das „Universal-Liederbuch – Weltlicher Liederschatz für Deutschlands Gesangsfreunde“ mit mehr als 1600 „auserlesenen“ Liedern in Reutlingen heraus. Dieses Werk ist nur ein Beispiel für die überall veröffentlichen Liedersammlungen. In diesem Geschäft war Hoffman von Fallersleben sehr wichtig. Er veröffentlichte ab 1841 die verschiedensten Sammlungen, darunter „Unsere Volksthümlichen Lieder“. Zu seiner Zeit wurde die Zahl solcher Sammlungen bereits unüberschaubar. Auch beim Militär wurde gesungen. Deshalb erschienen viele Sammlungen mit Soldatenliedern, z. B. ein „Preußisches Militair-Liederbuch“ im Jahr 1846. Von den vielfältigen Quellen nenne ich weitere im Hauptteil.
Doch nun zum Eigentlichen. Was bewegte Menschen über die Zeiten zu handschriftlichen Aufzeichnungen von Liedern? An erster Stelle ist das selbst gesungene Lied eine Möglichkeit, persönlichen Empfindungen Ausdruck zu verleihen. Darin stecken die Aussagen des Textes wie die der Melodie. Dann kommt eine soziale Qualität hinzu, die einerseits in der gesungenen Mitteilung an andere zu finden ist, andererseits die Gemeinschaft der singenden Personen im Chor begründet und aus dieser erwächst. Diese Gründe können noch ohne schriftliche Texte oder Notenblätter auskommen. Schriftliches wird erst dann notwendig, wenn es als Gedächtnisstütze dient oder eine Form der Aneignung ist, etwa in einer Sammlung. Die wurde dann nach Gegebenheiten zusammengetragen. Sie kann besonderen Interessen oder Vorlieben folgen, sie kann aber auch bloß ein Mittel sein, sich in einem Chor über die Lieder zu verständigen. In jedem Fall wurden Lieder aus der Fülle der Quellen ausgewählt. Kriterien dafür können die dem jeweiligen Lied zugemessenen Eigenschaften sein, die entweder persönlichen Vorlieben, bestimmten Konventionen oder gewünschten Werten entsprechen. Forscher zeichneten zudem Volkslieder auf, um sie für die Nachwelt zu sichern. Sie haben also schon im 19. Jahrhundert befürchtet, dass diese Lieder bald nicht mehr gesungen werden.
In jedem Fall erlaubt die nähere Erkundung des Liederbuchs für Friedrich Bösenberg etwas von kulturellen Zusammenhängen zu erkennen, die einen Menschen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bewegten. Neben längst vergessenen Texten und Melodien hatte er auch Beispiele aus der heute noch wohlbekannten, vielfach hochgeschätzten „Hochkultur“ aufgenommen. Kulturelle Bezüge zu Goethe, Mozart, bedeutenden Romantikern und anderen namhaften Quellen weisen auf Gespür für deren Werke hin, das damalige Bildungsbürger sicher nicht bei einem Bauern aus Langenhagen erwartet hätten. Herablassender Hochmut war und ist gewiss fehl am Platz. Denn diese einfache Schreibkladde ist wahrhaftiges Kulturgut. Zu begutachten wäre sie nach Matthias Claudius‘ Abendlied vom Ende des 18. Jahrhunderts: „So sind wohl manche Sachen, / die wir getrost belachen, / weil unsre Augen sie nicht sehn.“
In der Küche meiner Großeltern waren neben der Haushälterin ein oder zwei „Mädchen“ mit dort anfallenden Arbeiten beschäftigt. Sie sangen dabei oft gemeinsam. Natürlich ohne Textbuch als Hilfe, denn sie kannten die Lieder. Wenn es am Text fehlen sollte, wurde die Melodie gesummt oder das fehlende Textstück durch etwas eigenes, möglichst gleich klingendes ersetzt. Das ging dann so wie Axel Hacke über das eben genannte, schöne Lied „Der Mond ist aufgegangen“ berichtete. Die Frauen kamen allerdings nicht in die Verlegenheit „… der weiße Nebel wunderbar“ durch „… der weiße Neger Wumbaba“ zu ersetzen. Auch beim Text des Liedes „Oh, wie ist es kalt geworden“ irrten sie sich nicht. Dieses Lied nach dem Gedicht „Sehnsucht nach dem Frühling“ des Hoffmann von Fallersleben wurde nämlich vor dem ersten Weltkrieg im Unterricht der Grundschule auswendig gelernt3.
Bei solchem Gesang – je nach Stimmung fröhlich, besinnlich oder auch mal traurig – genügt das so gelernte Repertoire. Will man in einem Chor singen, ist dagegen Übereinkunft hinsichtlich der Texte und Melodien nötig. Ohne Zugriff auf gedruckte Liederbücher, muss man zumindest die Texte aufschreiben. Da wurde sicher diktiert oder aus einer Vorlage abgeschrieben.
In Langenhagen ist für das Jahr 1867 noch kein Chor nachgewiesen. Gleichwohl wurden im 19. Jahrhundert überall Gesangsvereine gegründet. Solche Gründungen folgten einem Zug der Zeit. In Berlin hatte Carl Friedrich Christian Fasch 1791 die Singakademie gegründet, die Goethes Freund Carl Friedrich Zelter über lange Zeit prägen sollte. Er organisierte 1809 die erste Liedertafel in Deutschland.
Dem Berliner Vorbild folgten bald weitere Vereinigungen. In den Jahren zwischen 1815 und 1842 wurden Liedertafeln in Leipzig, Frankfurt a. d. Oder, Hamburg, Danzig, Potsdam, Mainz, Neustadt a. d. Aisch, Kiel und Würzburg gegründet (Reihenfolge nach Gründungsjahr). Diese Männerchöre pflegten das aus den Befreiungskriegen (1813 – 1815) erwachsene vaterländische Liedgut. Einige Beispiele dazu enthält auch das Liederbuch Friedrich Bösenbergs. Da diese Lieder häufig im Sinne der Revolution von 1848 wirken konnten, wurden die Vereine in deren Folge von Mächten der Restauration bzw. Reaktion unterdrückt. Sie verschwanden aus der kulturellen Landschaft.4 Nach knapp fünf Jahren Pause wurden wieder mehr Gesangsvereine und Liedertafeln gegründet. In Hannover trat bereits 1851 die Liedertafel „Frohsinn“ hervor, deren Titel verdeutlichte, dass man keine politischen Absichten hatte. 1854 wurde der in Hannover bekannte Schulmeister und Sänger
Wilhelm Bünte5 deren Leiter. Er hatte auch eine Beziehung zu Langenhagen, denn er besuchte 1844 – 1847 die Präparandenanstalt6 des Kantors Grove in Langenhagen.
Die Beziehung von Chorleitern zum Schuldienst war in früheren Zeiten sehr eng, denn Musikunterricht, speziell in Form des gemeinsamen Singens, nahm breiten Raum in den Stundentafeln ein. Neben den gebräuchlichen Kirchenliedern gehörten auch volkstümliche Lieder zum Lehrplan. In Langenhagen mussten die Knaben unter Leitung ihres Lehrers bei Beerdigungen und anderen Anlässen singen. Dafür gab es ein von den Hinterbliebenen zu zahlendes Entgelt. Die Leidtragenden konnten je nach Kassenlage zwischen sechs oder zwölf Sängern wählen. In jedem Fall muss man von besser geübten Stimmen ausgehen, als es bei dem heutigen – oft fehlenden – und meist stärker auf Instrumentalmusik oder Hörerfahrungen konzentrierten Musikunterricht der Fall ist. Friedrich Bösenberg hatte in seiner Schulzeit sicher reichlich Gelegenheit unter Anleitung des Lehrers und Kantors Grove zu singen und Lieder zu erlernen. Seine Aufzeichnungen, die 1867 begannen, stehen in keinem erkennbaren Zusammenhang zu einem Gesangverein.
Für Langenhagen ist die Liedertafel Kaltenweide als erster Gesangverein maßgeblich. In ihrem Gründungsjahr 1875 kamen zwölf Männer im Kaltenweider Gasthaus des Wirts und Bauern Heinrich Höhne zusammen, um den Verein zu gründen. Sie trafen sich zukünftig regelmäßig beim Gesang in Höhnes Wirtshaus. Dass sie dabei die Stimmbänder mit Bier feucht hielten, darf als gesichert gelten. Dieser älteste Verein in der Stadt Langenhagen hat trotz vieler Schwierigkeiten bis heute überlebt. Allerdings fehlt sangesfreudiger Nachwuchs zunehmend. Unsere Kultur ändert sich eben.
(Postkarte Sammlung Jagau)