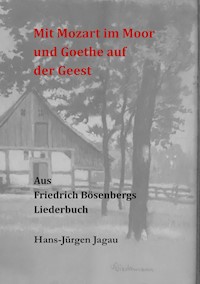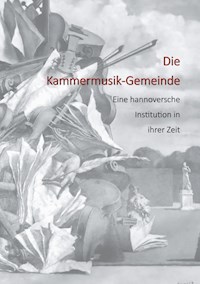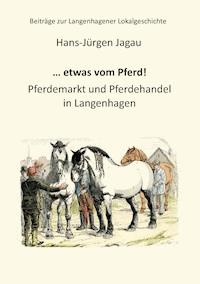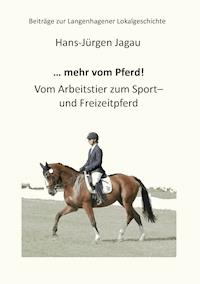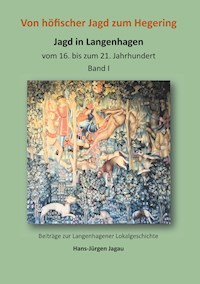
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Gebiet des alten Amts Langenhagen, das sich zu großen Teilen mit dem heutigen Stadtgebiet deckt, war lange Zeit höfisches Jagdgebiet. Die Jagd gebührte dem Landesherrn und wurde von dessen Beamten verwaltet. Die zogen gerne ihren Nutzen daraus. Jagdlich war das Amt Langenhagen wegen vieler Hasen und Rebhühner sehr gefragt. Teilweise langjährige Streitigkeiten und die zugehörigen Verhandlungen wegen der Jagdberechtigung und speziell wegen der Jagdgrenzen geben Einblick in Jagd und Rechtsprechung. Grenzverletzungen waren oft Folge der langen üblichen Hetzjagd mit Hunden. Sie geschahen aber auch, weil die eindringenden Jäger ein Jagdrecht für sich behaupteten. Die Frage, was, wie und wo gejagt wurde, führt unmittelbar zu heutigen Problemstellungen. Ereignisse bei Wilderei und Grenzübertritten sind zum Glück weitgehend Vergangenheit. Die in allen Fällen sichtbaren menschlichen Wesenszüge bleiben aktuell.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch
Jäger erzählen bekanntlich gern von der Jagd. Ihre Zuhörer bemerken dabei gewisse Freiheiten. Derartige schöne, spannende und womöglich unmittelbar selbst erlebte Geschichten sind beliebt - ungeachtet ihrer zweifelhaften Wahrheit. Ein Körnchen dieser Qualität mag immerhin auch bei abwegig erscheinenden Ereignissen enthalten sein. Darum rankende Geschichten firmieren oft als „Jägerlatein“, weil deren Inhalt den staunenden und dieses Lateins nicht mächtigen Hörern teilweise unfassbar erscheint.
Der Historiker versucht dagegen, fernliegenden und oft nur gering dokumentierten Ereignissen möglichst wahrheitsgemäß „auf die Spur zu kommen“ (Ein Sprachbild, das, wie so viele, der Jägersprache entlehnt ist.). Trotz vieler Publikationen ist das Feld der Jagdgeschichte nicht umfassend abgegrast. Speziell zu den Verhältnissen in Niedersachsen gibt es relativ wenig. Immerhin erschien 2006 unter dem Titel „Jagd in der Lüneburger Heide“ ein Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung im Bomann-Museum-Celle. Wie allgemein üblich, wurden in Celle vor allem ältere historische Gegebenheiten erfasst. Auch da ist die Fülle des Materials kaum übersehbar. Will man die Verhältnisse bis heute beschreiben, ist eine gehörige Auswahl mit möglichst wenig eingeschränktem Blick erforderlich.
Im Zusammenhang dieser Reihe befasse ich mich vorrangig mit knapp 500 Jahren Geschichte speziell im Raum der Calenberger Vogtei bzw. des späteren Amts Langenhagen sowie der heutigen Stadt gleichen Namens. Gelegentlich erlauben die hiesigen Quellen einen Blick auf allgemeinere Jagdgeschichte. Insgesamt scheint mir die Geschichte der Jagd für und an diesem Ort keineswegs belanglos. War doch das Gebiet des alten Amts Langenhagen, das sich zu großen Teilen mit dem heutigen Stadtgebiet deckt, lange Zeit höfisches Jagdgebiet.
Mit der höfischen Jagd waren die Einwohner des Amts Langenhagen keineswegs zufrieden. Ihre Gegenwehr gegen einige Jagddienste belegt die Haltung unserer Vorfahren in dieser Hinsicht. Erst recht lassen die Streitigkeiten und zugehörigen Verhandlungen wegen der Jagdgrenzen vielerlei Schlüsse zu.
Die Frage, was, wie und wo gejagt wurde, führt unmittelbar zu heutigen Problemstellungen. Zudem hatten Aufsichtspersonen regelmäßig mit Leuten zu tun, die sich um bestehende Verbote nicht kümmerten und dem Wild notgedrungen oder aus Jagdleidenschaft nachstellten. Was sich bei Wilderei und Grenzübertritten zutrug, ist zum Glück weitgehend Vergangenheit. Die in allen Fällen sichtbaren menschlichen Wesenszüge sind jedoch immer noch aktuell.
Höfische Jagd im 17. Jahrhundert
Inhaltsverzeichnis
Grenzenlose Jagd in der Vorzeit?
Das Jagdrecht – „Jagdgerechtigkeit“
Begrenzte Jagd für die Vögte in Langenhagen
Streit um Jagdgrenzen mit der Altstadt Hannover
Weitere Jagdstreitigkeiten
Jagd ohne jede Grenze -Wilddieberei
Dokumentation
Bildnachweis
Quellen
Grenzenlose Jagd in der Vorzeit?
Die frühesten Zeugnisse der Jagd in Langenhagen stammen aus der Steinzeit. Das zeigen einige, wenige Funde aus der Wietzeaue. Vor etwa 10.000 Jahren löste die noch jetzt andauernde wärmere Phase des Klimas die letzte Periode der Eiszeit ab. Schon frühere Vereisungen wurden durch mehr oder weniger lange Zwischenzeiten abgelöst, in denen es teilweise deutlich wärmer war. Bereits in diesen Interglazialen waren steinzeitliche Menschen in Niedersachsen auf der Jagd.
Die spärlich vorhandenen, aber zum Teil hochbedeutenden Funde von steinzeitlichen Jagdwaffen in Niedersachsen stehen in der Regel im Zusammenhang mit Seen oder Wasserläufen. Das ist einerseits aus Gründen erfolgreicher Jagd zu erklären, denn Wild muss zum Wasser um dort zu trinken oder es zieht zum Wasser, wenn es hart verfolgt wird bzw. sich schwer verletzt zurückzieht. Andererseits erhalten sich Funde erlegter Wildtiere nur dort, wo sie unter Luftabschluss rasch konserviert werden. Man muss also davon ausgehen, dass Funde wie der 1948 ergrabene Jagdspieß von Lehringen oder die erst vor kurzem entdeckten paläolithischen Speere von Schöningen außerordentlich selten sind. Zufällige Funde einzelner Steinwerkzeuge werden in der Regel nicht weiter wissenschaftlich bearbeitet, weil Finder entweder die Bedeutung des Artefakts nicht erkennen oder das auf dem Acker entdeckte Steinbeil zu Hause auf den Kaminsims legen.
In Langenhagen sind die Funde auch nur dem Zufall zu verdanken, dass man vor dem Ausbaggern der Wietzeseen noch einmal die dort bekannten Meiler und Eisenverhüttungsplätze erforschen und dokumentieren wollte. Vom Herbst 1969 bis zum Frühjahr 1970 erforschte Archäologen mittelalterliche Verhüttungsplätze und Holzkohlen-Meiler in der Wietzeaue zwischen Langenhagen und Isernhagen. Dabei fand man nördlich des Reuterdamms zwischen Isernhagen HB im Osten und Langenhagen, Krähenwinkel sowie Kaltenweide im Westen steinzeitliche Flintgeräte und andere Einzelstücke.i Sie waren durch Pflügen an die Oberfläche gebracht worden.
Blick zum noch heute als Düne erkennbaren Kiebitzberg (Foto Jagau 2018)
Die Mehrzahl der Gegenstände lag auf Geländekuppen. So auch auf dem nur schwach über das Niveau erhobenen Kiebitzberg, einer Düne vom Ende der Saaleeiszeit (vor etwa 130.000 Jahren). Das Bild zeigt den losen Flugsand der alten Düne, in dem Tiere ihre Spuren tief auf dem frisch bestellten Acker abdrückten.
Anhöhen in den über Jahrtausende sumpfigen Wietzeauen waren als Lagerplatz streifender Jäger vorteilhaft, weil sie Überblick versprachen und trockenen Untergrund für das Lager boten.
Am Bild vom Fund Nr. 14 (Kernstück) kann man die Bearbeitungsspuren durch Abschlagen gut erkennen. Daneben ist eine Messerklinge (etwa 5 cm lang) abgebildet (Nr. 16). Da derartige Artefakte nicht sicher datiert werden können, steht nur fest, dass steinzeitliche Jäger die Wietzeaue als Jagdgebiet nutzten. Nördlich der Bahnlinie fand man auf der Isernhagener Seite der Aue ein Steinbeil (Jungsteinzeit) sowie einen Schleifstein (römische Kaiserzeit), die zeitlich zugeordnet werden konnten.
Funde aus der Steinzeit sind relativ selten. Das sollte jedoch nicht über die jagdliche Aktivität der steinzeitlichen Jäger während der verschiedenen Phasen der Eiszeiten täuschen. Sie durchzogen weite Streifgebiete auf der Suche nach geeigneter Beute. Wie bei allen Jägervölkern bestimmte ihr Jagdwild den Alltag. Sie konnten deshalb nicht sesshaft sein, weil dann das Wild bald im Raum um die Behausung verschwunden wäre. Höhlen standen im hiesigen Raum nicht zur Verfügung, also mussten leichte, schnell zu fertigende Unterstände als Wohnung dienen. Größere Zelte aus Tierhäuten wären denkbar, sind aber wegen zu hohen Gewichts erst durch Nutzung von Lasttieren „tragbar“. Decken1 oder Felle werden die Steinzeitjäger an erster Stelle für ihre Bekleidung genutzt haben. Vermutlich kommt die inzwischen auch vergangene Lebensweise der Menschen in den nördlichsten Breiten der Erde ihrem Leben noch am nächsten. Fleisch und damit die Jagd dürfte eine ganz wichtige Rolle in ihrem Lebensunterhalt eingenommen haben. Sicher haben die Menschen auch Wildfrüchte – soweit vorhanden – gesammelt und verzehrt. Ob vor Tausenden von Jahren schon Techniken der Konservierung genutzt wurden, ist unbekannt. Man darf sich – wie gerade Erkenntnisse neuerer Zeit zeigen – die Menschen der Vorzeit jedoch nicht zu primitiv vorstellen. Was die Jagd betrifft, dürften sie heutigen Jägern - von der Ausrüstung einmal abgesehen – hoch überlegen gewesen sein. Die damaligen Waffen wie Jagdspeere sowie Pfeil und Bogen erforderten große Nähe zum Wild um wirksam zu sein. Zudem gehörten Kraft, Geschicklichkeit und im Falle wehrhafter Beute auch Mut zur erfolgreichen Jagd.
Wir wissen zwar nicht, was die vorzeitlichen Jäger im Wietzetal erbeuteten und wie sie dies taten, weil am Kiebitzberg keine Tierknochen gefunden werden konnten. Rotwild, Rehe und Wildpferde wären geeignete Beute. Auch kleinere Tiere wurden wahrscheinlich erlegt. Entscheidend war dabei das ökonomische Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag. Die auf dem Kiebitzberg gefundenen Werkzeuge aus Feuerstein kamen erst nach der Jagd beim Häuten und Zerlegen des Wildes zum Einsatz.
Wie weit die Jagd in der Steinzeit grenzenlos frei war, ist mangels Beweisen nicht zu ermessen. Man kann aber davon ausgehen, dass die wenigen Menschengruppen, die damals riesige Streifgebiete nutzten, einander nicht in die Quere kamen. Grenzen gab es für sie nur durch natürliche Hindernisse, das Vorkommen der Beutetiere und ihre eigenen jagdlichen Fähigkeiten. Grenzstreit wird erst entstanden sein, wenn die einen glaubten, durch andere um ihren Lebensunterhalt gebracht zu werden. In dem Falle dürften sie Jagdwaffen als Kriegswaffen gebraucht haben.
1 Jägersprache für Häute von Rot-, Dam- und Rehwild sowie Rentieren.
Das Jagdrecht – „Jagdgerechtigkeit“
In ältester Zeit war die Jagd nur durch die vorhandene Beute und die Fähigkeiten der streifenden Jäger begrenzt. Sesshafte Menschen sahen später „ihr Land“ auf dem sie wohnten und arbeiteten als natürliches Jagdgebiet an. Die Jagd war frei sofern man nicht dem Nachbarn ins „Gehege kam“. Das Jagdrecht war mit dem Grundbesitz verbunden. Jagen konnten natürlich auch andere Jäger, sofern sie sich nicht erwischen ließen. Im Laufe des Mittelalters entzogen die jeweiligen Herrschaften Grundbesitz und Jagdrecht dem „gemeinen Mann“ mehr und mehr. In der frühen Neuzeit waren die Verhältnisse geklärt: Feld, Wiese, Wald und Jagd gehörten dem Landesherrn bzw. adeligen Grundherren. Ihr Jagdvergnügen war wie der wichtige Nachschub für die Küche durch strenge Grenzen geschützt.
Petrarca Meister (16. Jh): Jagd auf Hirsch, Bär und Schwarzwild in einem geschlossenen Hagen
Begrenzte Jagd für die Vögte in Langenhagen
Dokumente über die Jagd in der Amtsvogtei Langenhagen gehören mit zu den ältesten überlieferten Quellen der Ortsgeschichte. Daran erkennen wir die Bedeutung der Jagd und des Jagdrechts in alter Zeit. Im 16. Jahrhundert war der landesherrliche Anspruch auf die Jagd in seinem Territorium längst durchgesetzt. Das betraf besonders die sogenannte „Hohe Jagd“ auf Hirsche, Kahlwild und Wildschweine beiderlei Geschlechts. Es war aber keineswegs so, dass alle übrigen Wildtiere dann für den ortsansässigen Adel verfügbar waren. Bauern hatten zu dieser Zeit im Grundsatz kein Jagdrecht, sondern allenfalls die Pflicht, bei herrschaftlichen Jagden in verschiedenen Formen zu dienen. Dafür kannten sie sich in der Feldmark aus. Sie wussten, wo der Hase seinen Pass hatte. Weil die Amtsvogtei Langenhagen nördlicher Nachbar der Stadt Hannover war, spielten die dortigen Bürger ebenfalls eine Rolle, wenn es um das hiesige Jagdrecht ging.
Die früheste Quelle ist das alte „Höltingsgerichts-Protokoll“ii aus dem Jahr 1528, das ohne näheren Zusammenhang mit den sonstigen Teilen der Gerichtsverhandlung auch Vorschriften für die Jagd im nördlichen Langenhagen enthält. Diese Vorschriften wurden dem Dokument allerdings erst später zugefügt. Eine genaue Datierung dieses Teils ist daher nicht möglich. Das überlieferte Protokoll wurde 1574 ab- und umgeschrieben, die darin enthaltenen Teile sind daher auf jeden Fall älter. Ähnliche, zum Teil wortgleiche Bestimmungen der Jagdgrenzen findet man auch in anderen Akten aus dem 16. Jahrhundert. Das ist ein Zeichen für ihre Bedeutung im Rahmen diverser Grenzstreitigkeiten.
Seite mit dem untenstehenden Text aus dem Protokoll
Es magk auch der Vogt zum Langenhagen, wan er den obabgezeigten Hagen jagen will, die Hunde zu lössen haben, in der Landwehr, so vom Langenhagen nach dem Borgkweddelschen Bollwege gehet, im Masper Hege, Twenger Hege, und ahn der Eickhorst bey dem Bissendorffer Schlaggen, und seine Suche, die Landwehr und Morbruch endtlang und seinen Umbzugk zu Ende der Netze bey dem Ulenbringke nehmen, und stracks nach dem aufgeworffenen Erdhauffen auf dem Mittel der Nattelweges Heide, ahn demselbigen Uffworff, soll er stehn bleiben seine Hunde umbelocken, und jene nicht weitter volgen, sondern stracks widder nach dem Hagen, in der Sondersriede sich wenden und ziehen, Gleichergestald mag der Calenbergische Jeger, auf den jetztangezogenen und berürten Staden (Stätten) seine Hunde auch lössen
Bei dieser Grenzbeschreibung wurde vornehmlich geklärt, wo der jeweilige Jäger die Hetzhunde vom Strick lösen durfte. Außerdem wurde anhand von Grenzzeichen wie Erdhaufen, Wegen, Grenzstellen (Bissendorfer Schlag[baum]) oder Flurbezeichnungen festgelegt, welches Gebiet bejagt werden durfte.
Jagdgebiet der Vögte im 16. Jh. Aufn. Google Earth 2016
Nach dieser Grenzbeschreibung durften Jäger des Fürstentums Calenberg sowie die „Vögte zum Langenhagen“ weit über die Grenze des Fürstentums hinaus im Tal der Wietze jagen. Das konnte den Nachbarn zu Bissendorf nicht gerade gefallen. Ein etwas späteres Dokument aus dem Jahr 1538 gibt guten Einblick in die damaligen Verhältnisse:
Der Voigte zum Langenhagen Jagtgerechtigkeit im Lüneburger Lande undt uff der Grentze.iii Extract aus der Transaction, so zwischen des Hertzogen v. Lüneb. u. Braunschw. Abgeordneten in Ao. 1538 uffgerichtet:
Und derweill dann die Vögte zum Langenhagen undt Bißendorff einen Rehehagen2 in der Sandersriede zu jagen haben, so soll an Mangell des Hagens alleine Rehepfande und keine gröbere und stargkere Netze gestellet und gebraucht werden. Waß sich auch des Jagens und Hagens halber beyderseits zugetragen, soll aus und abe [?] undt alle Ungnade gefallen sein. Eß sollen aber beiderseits der Fürsten Voigte undt Unterthanen sich bey Vermeidung schwehrer Straffe undt Ungnade hinfürter deß Schießens nach hohem Wilt und Rehe enthalten und sich des keineswegs vor sich zu gebrauchen oder anderen zu thun gestatten.
Zugegeben, das damalige Deutsch ist nicht leicht verständlich. Außerdem ist der handschriftliche Text nicht vollkommen lesbar. Wir sehen aber sofort, dass es zwischen Abgeordneten der beiden Herzogtümer Braunschweig und Lüneburg eine „Transaktion“ also Verhandlungen mit Abschluss einer Vereinbarung gab. Zum Verständnis ist etwas geschichtlicher Hintergrund vonnöten. Die namensgleichen Herzogtümer sind auf die 1269 vollzogene Teilung des ursprünglichen Herzogtums zurückzuführen. Die nachfolgende Geschichte der welfischen Erblande ist wegen weiterer Teilungen wie auch Zusammenlegungen höchst kompliziert und hier nicht weiter zu beachten. Man muss sich allerdings merken, dass der an die Calenberger Amtsvogtei Langenhagen grenzende Lüneburger Teil nicht vollkommen fremdes Gebiet war. Dadurch glaubten Beamte auf beiden Seiten der Grenze immer wieder gern, sie könnten doch durchaus ein Jagdrecht beim Nachbarn ausüben. Das fiel allerdings dem jeweils anderen auf und blieb dann nicht ohne Konflikt. In der Verhandlung des Jahrs 1538 wurde infolgedessen vereinbart:
sollen keine stärkeren Netze als Rehgarn gestellt werden (damit nicht etwa Hirsche oder Wildschweine gefangen werden),
sollen die geschehenen Vorkommnisse nicht mehr beachtet werden,
dürfen die Vögte wie andere Untertanen auf beiden Seiten der Grenze nicht mehr auf Hochwild oder Rehe schießen.
Das Hochwild blieb also eindeutig den beiden Landesherren vorbehalten. Beim Rehwild wurde nur der Schuss verboten, die Hetze mit Hunden und das Stellen von Netzen blieb den Vögten erlaubt. Für diese Jagd nutzte man den genannten „Rehehagen“, den man sich als von Hecken begrenztes Gehege für Rehe vorstellen muss. Lücken zwischen den Hecken konnten bei der Jagd mit Netzen verstellt werden. (s. S. →)
Im 16. Jahrhundert wurde Wild vorwiegend bei der damals allgemein üblichen Hetzjagd von Hunden aufgespürt und in gestellte Netze getrieben. Dort wurde es dann mit „kalten Waffen“ Hirschfänger oder Jagdspieß „abgefangen“. Als jagdliche Schusswaffe brauchte man noch vielfach die Armbrust. Sie wurde erst später mit der weiteren Entwicklung jagdlicher Feuerwaffen obsolet.
Petrarcameister (16. Jahrhundert): Freuden der Jagd: Eingestelltes Jagen in einem Hagen. Die Einläufe wurden durch Netze verschlossen, das Wild kann nicht mehr entkommen und wird mit dem Jagdspieß „abgefangen“.
Bei den erwähnten Verhandlungen wurde auch über eine Wolfsjagd gestritten, die der Vogt aus Langenhagen (Heinrich Lorleberg, Vogt von 1532 – 1554) auf Lüneburger Gebiet gehalten hatte. In dieser Sache schloss man einen Kompromiss, denn in der Regel sollten beide Vögte zukünftig gemeinsam den Wölfen nachstellen. Die Wölfe sollten für die aufwendige Jagd sicher bestätigt sein. In der Urkunde liest sich dies folgendermaßen: