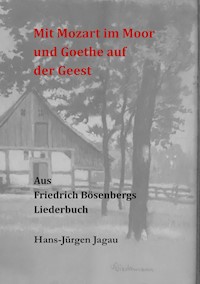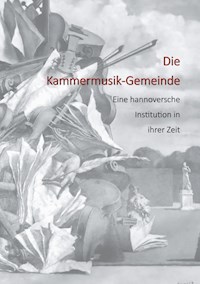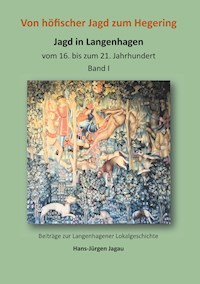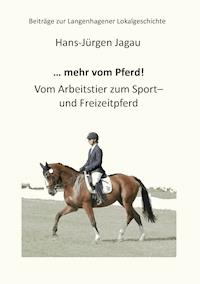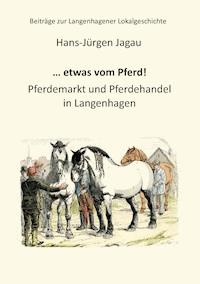
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Beiträge zur Langenhagener Lokalgeschichte
- Sprache: Deutsch
Die Stadt Langenhagen darf sich inzwischen wieder mit einigem Recht als "Pferdestadt" bezeichnen. Dieser Ort und das gleichnamige Amt waren im Verlauf der Geschichte durch den zeitweise sehr ausgedehnten Pferdehandel und namhafte Pferdehändler wohlbekannt. Wie und warum dies so war, zeigt der Autor in diesem Band.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Früh übt sich, wer ein Meister werden will!
Vorwort
Langenhagen darf sich inzwischen wieder mit einigem Recht als „Pferdestadt“ bezeichnen. Im Verlauf der Geschichte waren dieser Ort und das gleichnamige Amt über Pferdehandel und –händler zeitweise wohlbekannt. Wie und warum dies so war, zeige ich in dem Band „… etwas vom Pferd“. Im Folgeband „ … mehr vom Pferd“ kann die Geschichte des Pferdes vom Arbeitstier zum Sport- und Freizeitpferd mit speziellem Blick auf Langenhagen nachgelesen werden.
Benutzte Quellen sind in den Endnoten zu finden. Fußnoten enthalten Erklärungen, die zusätzliche Informationen zum besseren Verständnis des Textes geben.
Viel Freude beim Lesen und Entdecken!
Hans-Jürgen Jagau
Inhaltsverzeichnis
Pferdehandel und Pferdemarkt in Langenhagen
Langenhagener Handel mit Militärpferden
Pferdehandel zur Zeit des Siebenjährigen Kriegs
Pferdehandel zur Zeit der Koalitionskriege
Der Pferdemarkt in Langenhagen
Pferdehändler – Pferdediebe
Pferdehandel und Pferdemarkt in Langenhagen
Das an sich unbedeutende Dorf Langenhagen war über einige Jahrhunderte durch Pferdehandel weit und breit bekannt. So wurde in der sehr umfangreichen „Geographie für alle Stände“ im Jahr 1807 zum Stichwort „Langenhagen“ noch ergänzt: „welches erhebliche Pferdezucht und Pferdehandel unterhält“. Dieses Dorf Langenhagen bestand aus drei Bauerschaften: Krähenwinkel, Kircher Bauerschaft und Langenforth. Es zählte 1807 nur 136 „schatzpflichtige“ Hofstellen“1. Nur diese waren so ertragreich, dass sie überhaupt besteuert werden konnten. Man darf sich Langenhagen damals nicht als wohlhabenden Ort vorstellen. Wie kam es aber dazu, dass hier ein solcher Schwerpunkt des kostspieligen Pferdehandels entstand? Es lag sicher nicht an besonderen Vorteilen, die der Ort bot. Es waren in erster Linie sehr unternehmende Menschen, die enorme Risiken größeren Handels auf sich nahmen. Weniger bedeutende Händler wollten dagegen ein Zubrot durch Verkauf einiger Pferde erwerben.
©Langenhagen Stadtarchiv
Einen Ruf als Platz für Pferde hatte das Dorf schon viel früher erworben. Der preußische König Friedrich Wilhelm wies nämlich 1725 in einem Befehl darauf hin, dass dringend benötigte Pferde in Langenhagen, Celle oder Hamburg zu erhalten wären2. Ihm war nicht verborgen geblieben, dass das 1717 gegründete Dragoner Regiment des Obersten Achaz von der Schulenburg seinerzeit nur über 70 Pferde für 450 Dragoner verfügte. Eigentlich hätten alle beritten sein sollen, denn ohne Pferd ist Dienst in der Kavallerie nicht so recht sinnvoll. Allerdings war Kavallerie wegen der kostspieligen Pferde eine ziemlich teure Truppe. Deshalb war das Schulenburgsche Dragonerregiment keineswegs das einzige, in dem die meisten Dragoner noch zu Fuß gehen mussten. Außerdem gab es in der Nähe augenscheinlich nicht genügend Pferde zu kaufen. Aber es gab ja das Dorf Langenhagen mit seinen Pferdehändlern.
Die früheste Meldung über Pferdehändler in Langenhagen fand ich in Prozessakten wegen Pferdediebstahl aus den Jahren 1618 – 1619. Angeklagt war der aus Scharrel gebürtige Langenhagener Koppelknecht Jost Engelcke. Näheres zu dem Kriminalfall ist weiter unten zu finden. Jost Engelke trieb einen kleinen Pferdehandel mit Engelke Engelken, Jobst Franke und Hans Baumgarten aus Langenhagen, mit denen er die meiste Zeit gereist war. Interessant ist der Blick auf ihre umseitig angezeigten Handelswege. Schon damals waren Orte in Schleswig-Holstein, wie Itzehohe und Kiel, Buxtehude bei Hamburg, Kassel im Hessischen, Uelzen im Lüneburgischen und Keddinghausen in Westfalen Anlaufpunkte dieser Pferdehändler und ihrer Koppelknechte. Es sollte lange Zeit dabei bleiben.
Auf dieser französischen Karte von Basse Saxe [Niedersachsen] aus dem Jahr 1690 sind Reiseziele Langenhagener Pferdehändler vom Anfang des 17. Jahrhunderts eingezeichnet. Kiel lag am weitesten im Norden, Kassel am weitesten im Süden. Holstein war wichtiges Zuchtgebiet. Dort wurden Pferde gekauft.
Andere Namen stehen im „Dorftaxtregister“ (Steuerregister) aus dem Jahr 1652: „Hans Hagemann handelt zu Zeiten mit Pferden, Casper Ehlers handelt zu Zeiten mit Pferden, Daniel Sievers handelt zu Zeiten mit Pferden“. Diese Händler waren Kleinbauern oder weichende Erben auf Meierhöfen. Sie konnten durch den Handel zusätzlich etwas verdienen, denn die Landwirtschaft warf in der Regel nicht viel Bargeld ab. 1665 wurden Christoff Berner aus „Kreyenwinkel“, Daniel Bodenstab, Hans Hagemann und Caspar Eilers [Ehlers] aus der Kircher Bauerschaft in dem Register verzeichnet. Der Pferdehandel des Christoff Leseberg aus Engelbostel „ging ab“ und wurde nicht mehr besteuert. Pferdehändler mussten in der Regel mehr bezahlen als Vollmeier, welche die größten Bauernhöfe besaßen. Der Handel dürfte demnach lukrativ gewesen sein.
Über den Pferdehandel im 15. und 16. Jahrhundert gibt es allgemein nur wenige Nachrichten. Die für den Zeitraum von 1400 bis 1500 dokumentierten Pferdekäufe des Göttinger Rates zeigen, dass der Pferdehandel schon damals sehr weiträumig angelegt war. Hauptorte des Zukaufs waren Lübeck mit über 40 Pferden, Deventer, Stade, Braunschweig Leipzig, Kassel. In Hannover wurden nur 2 Pferde erworben. Langenhagen kam als Handelspartner noch nicht in Frage. Das sollte sich erst im 17. und 18. Jahrhundert ändern.
Über den Markt in Hildesheim gibt das Jahrmarktsprotokollbuch der Stadt Hildesheim stellenweise Auskunft3. Auf dem Johannismarkt 1663 wurden 15 Pferdehändler protokolliert. Darunter Julius Behrens und Hanß Morhoff von Langenhagen (vermutlich eine Wirtschaftsgemeinschaft), Ludecke Baumgarten von Engelbößel [Engelbostel], Tile Körver und Hermann Schmidt von Osterwohle [Osterwald], Cord Ewers, Hans Meyer. Michel Behrens, Cord Hase. Lüdicke Pist, Alpert Kohne, Hanß Schröder, Hinrich Plumhoff, Hinrich Engelking und Hanß Engelking von Osterwohle. Es ist möglich, dass die Erstgenannten aus dem Ort Osterwald in der Region Hannover kamen, die anderen aus dem näher bei Hildesheim gelegenen Osterwald, heute Ortsteil von Salzhemmendorf. Osterwohle – heute Ortsteil von Salzwedel – kommt eher nicht in Betracht, da es zur damaligen Zeit ein adeliges Gut ohne größere Bauernhöfe für die Zucht war. Nur drei Händler stammten aus dem heutigen Langenhagen, man darf man unterstellen, dass die Bedeutung des hiesigen Pferdehandels seinerzeit nicht so überragend war, wie gelegentlich angenommen wurde. Diese Qualität konnte erst deutlich später dem Handel mit Pferden für militärische Zwecke zugemessen werden.
Im Jahr 1686 fielen zwei Händler aus Langenhagen unangenehm auf. Sie hatten die Zeche für Unterkunft und Verpflegung in Hildesheim nicht bezahlt und wurden vom Marktgericht notiert. Aus dieser Marginalie kann man zusätzlich die Information ableiten, dass die Entfernung bis Hildesheim etwa einer Tagesreise entsprach. Die Händler reisten also an einem Tag von Langenhagen zum Markt, übernachteten, erledigten ihre Geschäfte und reisten dann wieder zurück. Bei Pferdetransporten von oder bis nach Itzehoe und Kiel dauerte die Reise dann entsprechend länger und bedeutete damit auch wesentlich höhere Kosten für Ross und Reiter bzw. Koppelknecht.
In der Kopfsteuerliste für das Amt Langenhagen aus dem Jahr 1689 wurden relativ viele Pferdehändler ausgewiesen. Sie waren in der Regel, wie oben angeführt, Besitzer oder Mitbewohner kleinerer Höfe, die sich über den Handel ein Zubrot verschafften. Wenige wohlhabende Rosshändler wurden mit sechs oder im Fall von Jürgen Plinke aus Langenforth sogar acht Reichstalern Kopfsteuer belegt. Damit mussten sie etwa das Doppelte im Vergleich zum einfachen Vollmeier bezahlen. Da die Höhe der Kopfsteuer einen gewissen Bezug zum Einkommen haben sollte, kann man ermessen, dass Händler wie Plinke ganz gut gestellt waren. Von den zwölf im Amt Langenhagen besteuerten Rosshändlern lebten sechs in der Kircher Bauerschaft, wo auch der Pferdemarkt stattfand. Herzog Friedrich Ulrich privilegierte die Langenhagener mit diesem Markt im Jahr 1618. Dazu weiter unten mehr. Langenhagen war damals wohl klein, aber „oho“!
In der ab 1773 von Johann Georg Krünitz veröffentlichten „Oeconomischen Encyclopädie“ wurde Langenhagen auf diese Weise beschrieben: „Langenhagen,eine hannoverische Amts=Vogtey im Fürstenthume Calenberg, wobey ein großes Dorf gleichen Nahmens liegt, welches sich fast 1 Meile in die Länge erstreckt, und aus einer einzigen Reihe gut und zum Theil prächtig gebaueter Bauern=Häuser besteht. Es wohnen daselbst viele Roß=Händler.“ Diese Aussage führte in unserer Zeit zum Irrtum, Langenhagen sei ein reiches Dorf gewesen. Das war, wenn wir dem kenntnisreichen Amtsschreiber Wyneken vertrauen, keineswegs der Fall. Er schrieb in seiner Chronik, die er zur Mitte des 18. Jahrhunderts verfasste, dazu nämlich Folgendes:
„Es können demnach die wenigsten Einwohner allein und bloß vom Ackerbau leben, sie treiben demnach Neben-Gewerbe und zwar erstens
durch das Torf-Moor, deren zwei sind, zu Bothfeld und Kaltenweide. Auf diese Möhre hat ein jeder Einwohner seinen angewiesenen Platz und kann von selbigen die Törffe verkauffen.
Der zweite Nahrungszweig ist der Pferdehandel, wodurch ehemals wegen der vielen reichen Roßhändler in Langenhagen dieses Amt gleichsam berühmt war, welches sich itzo indes leider ganz anders verhält.
Mit diesem Handel können sich nur hauptsächlich die bemittelten unter den Einwohnern abgeben, theils wegen der großen dazu erforderlichen Geld-Anlage, theils wegen der mancherley Nachtheile und risico, so dieser Handel unterworfen ist. Viele unter ihnen haben dann und wann Pferdelieferungen an auswärtige Höfe und absolvieren theils einzeln vor sich, theils in unter sich verbundene Gelegenheit, mit Wegführung der Pferde als Koppelknechte ihr Brodt zu verdienen.
Der dritte Nahrungszweig ist die Branntweinbrennerey, deren hauptsächlich in Engelborstel verschiedene sind, wiewohl imgleich mehrere sich auf den Roßhandel legen.
Diejenigen, so weder Pferdehandel noch Branntweinbrennerey treiben, sind die eigentlichen sogenannten
Torf-Bauern.“
Die wirtschaftlich herausgehobene Bedeutung des Ortes ist allein dem hier betriebenen Pferdehandel zuzuschreiben. Wyneken sah die damit verbundenen Probleme deutlich. Zum Ankauf der Pferde war erhebliches Kapital nötig, das die Händler nicht selbst besaßen, sondern leihen und verzinsen mussten. Diese Einschränkung betraf besonders die angeführten gelegentlichen Lieferungen an „auswärtige Höfe“. Diese durchaus großen Geschäfte waren aber mit entsprechendem Risiko behaftet. Wyneken dürfte das finanzielle Problem der Rosshändler Schaumann und Peters aus dem Jahr 1735 gekannt haben. Dieser bedeutsame Handel wird weiter unten genauer untersucht.
Neben dem für den Ankauf der Pferde nötigen Kapital, muss man auch die Kosten beachten, die durch den Handel über weite Strecken entstanden. Die Koppelknechte beanspruchten ihren Lohn. Die Pferde brauchten Futter und Stall auf den teilweise weiten Wegen zu den Abnehmern. Zudem war es in vergangenen Jahrhunderten keineswegs erlaubt, Pferde auf der gemeinen Weide eines anderen Dorfes grasen zu lassen. Da kamen – wie im zweiten Band beschrieben wird – schon enge Nachbarn „ins kurze Gras“. Futter war in aller Regel knapp und musste unterwegs bar bezahlt werden. Die Reisen zu und von den Märkten bedurften sorgfältiger Vorbereitungen, damit die Händler mit ihren Koppelpferden in den Abständen einer Tagesreise Unterkunft und Futter vorfanden. Einen Hafersack konnte man sicher auf Pferderücken mitnehmen. Das notwendige Raufutter war dagegen in Zeiten ohne Pressballen zu voluminös. Eine Tagesreise mit zusammen gekoppelten Pferden dürfte 40 – 60 km weit geführt haben. Die kürzeste Strecke von Langenhagen nach Kiel beträgt 240 km. Die Reise dorthin war also in vier bis sechs Tagen zu schaffen, wenn man nicht durch schlechte Wege, Zollstellen, Wirtshausbesuche und dergleichen zu sehr aufgehalten wurde. Wollte man die Pferde unterwegs grasen lassen, dauerte die Reise viel länger. Außerdem musste man immer damit rechnen, dass erboste Bauern, die das Gras für ihr eigenes Vieh beanspruchten, diese Pferde kurzweg beschlagnahmten. Eine derartige Streitigkeit, allerdings wegen des Futters für zwei Ochsen, war im 16. Jahrhundert Anlass für die fatale Bauernfehde in Langenhagen.4
Amtsschreiber Wyneken notierte um 1750 in seiner Beschreibung des Amts Langenhagen, dass Langenhagen nicht mehr so wie einst durch reiche Pferdehändler berühmt sei. Das dürfte für die Mitte des 18. Jahrhunderts auch zutreffen. Da jedoch große Kriege kommen sollten, entstand wenige Jahre später großer Bedarf an Pferden, was den Langenhagener Handel erneut zu ungewöhnlicher Blüte brachte.
Langenhagener Handel mit Militärpferden
Pferde hatten über einen sehr langen Zeitraum von der Antike bis zur Neuzeit sehr hohen militärischen Wert. Ohne Bespannung konnten keine größeren Mengen an Nahrung, Futter und Kriegsmaterial auf längeren Strecken schnell transportiert werden. Der Reiter erhob sich nicht nur augenscheinlich wie nominell über das Fußvolk, er war auch in vielen militärischen Belangen deutlich überlegen. So wurde über Jahrhunderte immer wieder großer Wert auf berittene Formationen, die Kavallerie, gelegt. Das im Amt Langenhagen in Garnison liegende Dragoner-Regiment war eine solche Formation. Die Dragonerstraße im früher zum Amt gehörenden Vahrenwald erinnert noch heute daran.
Für Pferdehändler waren Militärpferde oft lukrativ, denn sie waren deutlich teurer als gewöhnliche Ackergäule. Sie sollten dafür jedoch höheren Anforderungen genügen. In vielen Fällen konnte man sie nur schwer in ausreichender Zahl und Güte beschaffen. Zudem war der Handel mit ihnen auch riskant, weil die kenntnisreichen Aufkäufer angebotene Remonten in der Regel sehr kritisch beurteilten. Einige Beispiele zeigen, dass selbst erfahrene Pferdehändler ihre Rosse nicht zum geforderten Preis verkaufen konnten. Sie mussten es dann anderweit versuchen oder die Remonten mit Verlust abgeben.
In dem Ausgang des 18.Jahrhunderts weit verbreiteten Lexikon, dem „Krünitz“, ist zu lesen: „Remonte heißen diejenigen Pferde, welche zum Ersatz des Abganges der im Kriegswesen nöthigen Pferde angeschafft und gebraucht werden. Das Remontiren oder Ergänzen dieses Abganges geschieht bey den europäischen Heeren entweder durch Aufziehen der Pferde in eignen Militärgestüten, oder durch Aufkaufen im In= oder Auslande.“
Diese Remonten sollten ausgewachsene vier- noch besser fünfjährige Pferde sein, was aber aus Mangel an geeigneten Tieren selten der Fall war. Die Züchter hätten in diesem Fall das Pferd vier oder fünf Jahre lang mit erheblichen Kosten füttern und pflegen müssen und wären bei den von den Ankaufs-Kommissionen gebotenen Preisen nicht zurechtgekommen. In Preußen behalf man sich daher mit Remonte-Depots, in denen jüngere Pferde ein bis zwei Jahre lang gehalten, gefüttert und bewegt wurden, so dass sie einen kräftigen Körper bei guter Konstitution entwickeln konnten. Um 1830 bestanden dort sieben Depots. Dort wurden bis zu 800 junge Pferde herangebildet. Um 1900 brauchte man im Deutschen Reich jährlich etwa 11.000 Remonten bei einem Bestand des kaiserlichen Heeres von 98.000 Pferden. Die Reitpferde für Offiziere sowie die Kavallerie waren in der Regel Warmblüter wie ostpreußische Trakehner oder Hannoveraner. Im Dienst verblieben die Pferde etwa 10 Jahre und wurden dann im Alter von 14 oder 15 Jahren wieder verkauft. Sie konnten dann noch eine Weile als Reit- oder Zugpferd ihren Hafer verdienen. Ein Gnadenhof, wie heute üblich, war allerdings nicht ihre letzte Station.
Aus Langenhagener lokalhistorischer Sicht war der Pferdehandel mit Militärpferden besonders bedeutsam. Dazu geben verschiedene Dokumente einen Einblick, der weit über das hinaus geht, was Heimatforscher bisher dazu publiziert haben.