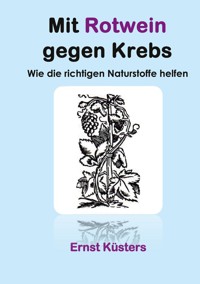
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Für jeden dritten Krebstoten sind Ernährungsfaktoren verantwortlich. Die Aufklärung scheitert, weil die Meinungen über den Nutzen von Pflanzen-Inhaltsstoffen selbst bei Experten auseinander gehen. In der Diskussion wird die Rolle des Rotweins verschleiert, da zwischen Rotwein und Alkohol nicht differenziert wird. Indem der Autor die Grundlagen der Krebsentstehung aufzeigt, gelingt es ihm auf eindrucksvolle Weise darzulegen, wie dieser Prozess mit den Inhaltsstoffen des richtigen Rotweins aufgehalten und bekämpft werden kann. Nicht nur beim Rotwein muss umgedacht werden. Zucker wird als größter Krebsauslöser entlarvt und der Segen von Radikalen bei der Krebsbekämpfung erkannt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Marianne
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kapitel 1: Rotwein ist gesund
Kapitel 2: Medizinalweine
2.1 Zurück ins Mittelalter
2.2 Von gefährlichen und nützlichen Zusatzstoffen
Kapitel 3: Krebsmerkmale
Kapitel 4: Krebs ernährt sich anders
4.1 Warburg-Effekt
4.2 Therapiemöglichkeiten (1. Teil)
4.3 Pentosephosphat-Abbauweg
4.4 Therapiemöglichkeiten (2. Teil)
4.5 Intervallfasten
Kapitel 5: Krebsentstehung
5.1 Bauplan des Lebens
5.2
ras
-Mutationen
5.3
p53
-Mutationen
Kapitel 6: Beide Seiten der Medaille
6.1 Über den Mythos von Radikalen und Vitaminen
6.2 Resveratrol (1.Teil)
6.3 Wertvolle Helfer
Kapitel 7: Wirkstoffe im Rotwein
7.1 Säuren
7.2 Resveratrol (2. Teil)
7.3 Flavonoide
7.4 Glykosilierte Flavonoide
7.5 Methylierte Flavonoide
7.6 Ausgewählte Flavonoide
7.7 Während der Lagerung entstehende Wirkstoffe
Kapitel 8: Darmkrebs
8.1 Entstehung von Darmkrebs
8.2 Warum Darmkrebs keinen Rotwein mag
8.3 Metronomische Chemotherapie
Kapitel 9: Bestandsaufnahme
9.1 Weinsäuren im richtigen Rotwein
9.2 Flavonoide im richtigen Rotwein
9.3 Andere Rotweinkomponenten
9.4 Fazit
Kapitel 10: Ausblick
10.1 Gentechnik
10.2 Neue Cuvées
10.3 Additive
10.4 An- und Abreicherungen
10.5 Weinalterung
10.6 Zurück in die Zukunft
10.7 Werbung für den richtigen Rotwein
Nachlese
Abkürzungsverzeichnis
Referenzen
Einleitung
„Man führt gegen den Wein nur die bösen Taten an, zu denen er verleitet, allein er verleitet auch zu hundert guten, die nicht so bekannt sind.“
Georg Christoph Lichtenberg
Bereits vor 2 500 Jahren wusste der berühmte Arzt der Antike, Hippokrates von Kos: „Der Wein ist ein Ding, in wunderbarer Weise für den Menschen geeignet, vorausgesetzt, dass er bei guter und schlechter Gesundheit in rechtem Maße verwandt wird.“ Diese Weisheit war über Jahrtausende anerkannt. Wein war das Medikament schlechthin. Jedoch führten im letzten Jahrhundert der exzessive Konsum und die Reduzierung des Weines auf Alkohol dazu, Wein die gesundheitsfördernde Wirkung abzusprechen. Das wird hoffentlich bald Geschichte sein. Letztlich wird man an den Fakten nicht vorbeikommen. Selbst das alkoholkritische amerikanische Ministerium für Gesundheit und Landwirtschaft sah sich 1996 veranlasst, moderaten Weinkonsum zu empfehlen: „Der Genuss von ein oder zwei alkoholischen Getränken pro Tag kann für die Gesundheit förderlich sein“ und erneuerte das in der 2020 aktualisierten Richtlinie.1 Das war eine 180-Grad Wendung für eine Behörde, die über Jahrzehnte hinweg einen erbitterten Krieg gegen Alkohol führte. Sie stützt sich auf zahlreiche seriöse Studien, die aufzeigen: Ernährungsfaktoren spielen eine wichtige Rolle bei der Krebsentwicklung, und moderater Weinkonsum wirkt lebensverlängernd und krebshemmend.
Die Kernaussagen des Buches
40 Prozent aller Krebserkrankungen lassen sich laut Aussage des Deutschen Krebsforschungzentrums in Heidelberg (DKFZ) vermeiden. Für den Löwenanteil dieser 40 Prozent sind nach Meinung des DKFZ Rauchen und Übergewicht verantwortlich. Das ist zwar richtig, dennoch eine Verschleierung der Zuckergefahr. Alle Raucher konsumieren Zucker, während Übergewichtige nicht unbedingt rauchen. Der Beitrag des Zuckers zur Krebsentstehung dürfte schon aus diesem Grund deutlich höher ausfallen. Während beim Rauchen anerkannt ist, weshalb es zum Krebs führt, tut man sich da bei Übergewicht schwer. Die Zuckerindustrie leugnet den Zusammenhang zwischen Übergewicht und Kohlenhydrataufnahme, und selbst in der Wissenschaft wird Zucker als Auslöser und Wachstumstreiber von Krebs unterschiedlich bewertet. Die Rolle des Zuckers muss in einem Buch über den richtigen Rotwein zur Krebsprophylaxe und Krebstherapie beleuchtet werden. Aus der Erkenntnis, wie Krebs entsteht und wächst, wird deutlich, wie ihm mit den Inhaltsstoffen des Rotweins beizukommen ist. Der richtige Rotwein, der keinen Zucker enthält, senkt das Krebsrisiko und unterstützt die Krebstherapie.
In Ernährungsempfehlungen der letzten Jahrzehnte lag ein tragischer Denkfehler zugrunde, indem die Bedeutung von Radikalen bei der Krebsbekämpfung nicht erkannt wurde. Freie Radikale wurden als Krebsauslöser gebrandmarkt, die es mit Vitaminen und Antioxidantien zu bekämpfen galt. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Um es mit den Worten von Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu sagen: „Es war ein gigantischer kollektiver Irrtum. In der Krebsforschung wiederholt sich immer wieder, dass nichts so einfach ist, wie es scheint. Nur ungern erinnert man sich heute an die damalige Naivität.“2 Nobelpreisträger James Watson geht noch weiter, indem er Antioxidantien für die meisten Krebstoten verantwortlich macht. Radikale sind die wahren Helfer im Kampf gegen Krebs. Deshalb ist die Rolle der Polyphenole im Rotwein weitaus subtiler als bislang angenommen. Viele Polyphenole entpuppen sich dabei als Chamäleon. In gesunden Zellen unterdrücken sie als Antioxidantien Radikale, während sie in Krebszellen als Prooxidantien gezielt Radikale erzeugen und Krebszellen vernichten.
Die krebshemmenden Eigenschaften von Rotweinen beschränken sich nicht auf das Vorliegen von Polyphenolen. Dadurch würde man die Bedeutung der Weinsäuren, insbesondere der Phenolsäuren, unterschlagen. Weitere relevante Wirkstoffklassen kommen hinzu. Das Potenzial des richtigen Rotweins bei der Krebsbekämpfung zeichnet sich gerade durch den synergistischen Mix verschiedener Wirkstoffe aus, die auf unterschiedlichen Wegen gemeinsam gegen Krebs vorgehen. Die systematische Auswertung zeigt, dass die Wirkstoffe nicht in allen Rotweinen in vergleichbaren Mengen vorliegen. Die Unterschiede sind beachtlich und werden in diesem Buch herausgestellt. Interessanterweise findet man in PIWI-Rotweinen, das sind Weine aus pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, potente Wirkstoffe, die in normalen Rotweinen nicht vorkommen. Diese Wirkstoffe beruhen auf Kreuzungen mit Wildreben. Sie liegen vor allem in Rebsorten vor, in deren Stammbaum die asiatische Wildrebe vitis amurensis auftaucht. Letztere wird seit Jahrhunderten in Asien und in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) zur Behandlung von Krebs eingesetzt.
Der Weinanbau wird sich aufgrund des Klimawandels in den nächsten Jahren verändern. Vermehrt wird man Rebsorten brauchen, die neben der Anpassung an das Klima auch ökologischen Anforderungen Rechnung tragen. Das ist die Chance, widerstandsfähige Rebsorten zu integrieren, die nachweislich einen gesundheitsfördernden Beitrag leisten.
Der richtige Rotwein
Was wäre nun der richtige Rotwein gegen Krebs? Das hängt von der Ausgangssituation ab. Sucht man einen Wein zur Prävention, um Krebs zu vermeiden, oder im Falle einer Krebserkrankung einen Wein, der zur Stabilisierung und Verzögerung des Krankheitsverlaufs führt? Gibt es Rotwein, der Krebs heilen könnte? Letzteres ist möglich. Wie später ausgeführt wird, verfügt ein Rotwein über ein Chemotherapeutikum in ausreichender Menge! Und Krebs ist nicht gleich Krebs. So wie jede Krebserkrankung eine spezielle Therapie erfordert, stellen sich anderweitige Anforderungen an den jeweiligen Rotwein. Aktuelle Studien belegen, dass viele Inhaltsstoffe des Rotweins die Erfolgsaussichten bestehender Krebstherapien deutlich verbessern. Das wirft die Frage auf, ob Rotwein nicht eine sinnvolle Co-Medikation bei Krebs ist. Ohne auf alle Fragen schon hier zu antworten, muss gesagt werden, dass es den einen Rotwein, der alles vermag, nicht geben wird. Das ist nicht schlimm. Das große Spektrum der Inhaltsstoffe lässt es zu, durch Manipulation der Verhältnisse und Konzentrationen die richtigen Rotweine für jede Frage zu komponieren. Leider wird Rotwein in der Krebsforschung nicht beachtet. Das liegt zum einen daran, dass es nicht gelingen dürfte, eine Medikamentenzulassung für Wein zu bekommen. Zum anderen ist mit den nicht mehr zu patentierbaren hilfreichen Inhaltsstoffen kein Geld zu verdienen. In China sieht man das pragmatischer. Dort züchtet man gerade Rebsorten, die einen sechsfach höheren Anteil des Inhaltsstoffs Resveratrol produzieren.
Weingegner mögen sich damit trösten, dass es in diesem Buch zu keiner Empfehlung für einen bestimmten Wein zur Krebsprävention oder zur Selbsttherapie bei Krebs kommt. Allerdings heißt das nicht, dass es den jeweils richtigen Wein nicht gibt. Lassen Sie sich überraschen!
Zum Aufbau des Buches
Dieses Buch grenzt sich von anderen Büchern ab. Es wird nicht auf die Gefahren eines übermäßigen Weinkonsums eingehen. Diese sind unbestritten! Es wird nicht auf die positiven gesundheitsfördernden Aspekte des Rotweins eingehen, etwa bei Herz-Kreislauf-, Koronarund Demenzerkrankungen. Diese sind hinlänglich bekannt! In diesem Buch geht es ausschließlich um Krebserkrankungen und die positiven Beiträge des Rotweins zur Prävention und Therapie. Leider werden diese immer wieder in Frage gestellt. Das erste Kapitel rekapituliert deshalb wichtige Studien, um Klarheit und eine Basis zu schaffen. Bevor sich der Hauptteil des Buches mit den Inhaltsstoffen des Rotweins befasst, wird die Krebsentstehung und das Krebswachstum näher betrachtet: Nur wenn man erkennt, was das Besondere am Krebs ist und weshalb er sich anders ernährt, wird verständlich, wie er mit den Inhaltsstoffen des Rotweins bekämpft werden kann. Zudem hilft es, weitere Krebsrisikofaktoren besser einzuschätzen. Wenn man sieht, wie Krebs sich entwickelt, wird klar, dass sich der Zuckerkonsum und die Skepsis gegenüber Radikalen verändern müssen. Um es klarzustellen: Dieses Buch ist kein Aufruf zur Selbstmedikation. Das wäre töricht.
Die folgende Kurzfassung der zehn Kapitel soll den Buchaufbau und den roten Faden verdeutlichen.
Kapitel 1: Rotwein ist gesund
Die Empfehlung des amerikanischen Gesundheitsministeriums zu moderatem Alkoholkonsum, wurde 1996 ausgesprochen und 2020 erneuert. Dazwischen liegen 14 Jahre, in denen Alkoholgegner nichts unversucht ließen, um die wissenschaftlich fundierte Empfehlung ins Wanken zu bringen. Ihre prominenteste Studie wurde zum Bumerang. Moderate Alkoholkonsumenten haben im Vergleich zu Abstinenzlern ein niedrigeres Sterberisiko, während exzessive Alkoholkonsumenten ein höheres Sterberisiko aufweisen.
Differenziert man zwischen alkoholhaltigen Getränken und Rotwein, fällt das Ergebnis noch eindrücklicher zu Gunsten des Rotweins aus. Hunderte Studien zum Französischen Paradoxon, darunter die Kopenhagen-Studie, bestätigten, dass moderater Rotweinkonsum lebensverlängernd wirkt und das Krebsrisiko senkt. Der Wein ist wieder in der Medizin zurück.
Kapitel 2: Medizinalweine
Die Erkenntnis, dass ein einzelner Wirkstoff selten zum Erfolg führt, hat sich in der Krebsforschung etabliert. Medikamenten-Cocktails werden eingesetzt, deren synergistische Wirkungen weit über die der Einzelwirkstoffe hinausgehen. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Die neuen Krebstherapien kopieren auf faszinierende Weise Medizinalweine, die in der Antike, in den Klöstern des Mittelalters und in der Traditionellen Chinesischen Medizin eingesetzt wurden. Heute lässt sich rekonstruieren, dass Medizinalweine durch das synergistische Zusammenspiel verschiedener Inhaltsstoffe wirkten. Dabei ist der Beitrag des Alkohols vielfältig. Die Analyse zeigt, dass Medizinalweine im Mittelalter durchaus manche Krebserkrankungen verhindern oder heilen konnten.
Kapitel 3: Krebsmerkmale
Wer sich vor Krebs schützen oder diesen heilen möchte, muss wissen, wie Krebs entsteht und warum sich Krebszellen anders ernähren als gesunde Zellen. Man kennt zwar heute über 200 Krebsarten, gleichwohl lassen sich Gemeinsamkeiten finden. Acht Krebsmerkmale treffen für alle Krebsformen zu. Dieses Grundlagenwissen über Krebs bildet die Basis, auf der weltweit nach neuen Präventionsmaßnahmen, Medikamenten und Therapien gesucht wird. Aus der Kenntnis der Krebsmerkmale heraus lassen sich wertvolle Inhaltsstoffe im Rotwein identifizieren, die zur Krebstherapie geeignet sind.
Kapitel 4: Krebs ernährt sich anders
Krebs ernährt sich anders als gesunde Zellen. Diese banale Feststellung, seit fast 100 Jahren bekannt, wurde erst 2011 als das achte und letzte gemeinsame Krebsmerkmal akzeptiert. Der Schlüssel zum Verständnis einer Krebszelle liegt in ihrer Versorgung. Otto Warburg erkannte das bereits 1924. Übermäßiger Zuckerkonsum und Übergewicht führt zu Krebs und beschleunigt sein Wachstum. Dazu wird auf den „Warburg-Effekt“ eingegangen. Dieser Effekt kann erklären, wie Wirkstoffe, die auch im Rotwein vorhanden sind, die Versorgung des Krebses empfindlich stören. Das Krebs sich anders ernährt, gilt es zu nutzen. Die aufgezeigten Möglichkeiten gehen über eine Reduzierung der Zuckermenge weit hinaus.
Kapitel 5: Krebsentstehung
Für ihr Wachstum benötigen Krebszellen sehr viel Eisen. Sie enthalten mitunter tausendmal mehr Eisen als gesunde Zellen. Krebszellen meiden Sauerstoff, damit dieser nicht mit Wasser zu Wasserstoffperoxid reagiert. Denn Wasserstoffperoxid produziert mit Eisen Sauerstoffradikale. Diese Sauerstoffradikale sind es nämlich, die einer Krebszelle schaden und sie in den Zelltod treiben. Deshalb bevorzugen Krebszellen einen besonderen Zuckerabbau, der keinen Sauerstoff benötigt. Dieser Abbau liefert deutlich weniger Energie. Krebszellen kompensieren dieses Manko durch gesteigerten Zuckerkonsum. Dadurch bildet sich das hochtoxische Mutagen Methylglyoxal im Überschuss, das nicht mehr schnell genug entsorgt werden kann. Dieses Mutagen verantwortet die meisten Krebserkrankungen, insbesondere jene mit schlechter Prognose. Zwei Beispiele verdeutlichen das, die Mutationen des schlimmsten Protoonkogens ras und die des wichtigsten Tumorsuppressorgens p53. Die mutierten Gene sind an mehr als der Hälfte aller Krebserkrankungen beteiligt. Bei Darmkrebs sind beide Gene mutiert. Die beste Krebsprävention ist deshalb der Verzicht auf übermäßigen Zuckerkonsum.
Kapitel 6: Beide Seiten der Medaille
Krebszellen mögen keine Radikale, weil sie ihnen schaden. Das sollte man auf sich wirken lassen. Über Jahrzehnte und noch immer wird damit geworben, Krebs mit Antioxidantien zu bekämpfen. Das Gegenteil tritt jedoch ein: Die Antioxidantien vernichten die Radikale und dem Krebs geht es danach besser als zuvor. Die Polyphenole von Obst, Gemüse und Rotwein, oft unreflektiert mit der Etikette „Antioxidans“ versehen, werden genauer unter die Lupe genommen. Überraschenderweise stellt sich in vielen Fällen heraus, dass ein Strukturmerkmal oder die Dosis darüber entscheidet, ob ein Polyphenol als Antioxidans oder im Gegenteil als Prooxidans auftritt. Dazu genauer betrachtet wird das im Rotwein vorhandene Resveratrol. Resveratrol wirkt in gesunden Zellen als Antioxidans und vernichtet Radikale. In Krebszellen hingegen produziert Resveratrol unablässig Sauerstoffradikale, die der Krebszelle schaden. Auf beeindruckende Weise ergibt sich ein wissenschaftlich belegter Synergismus von Resveratrol mit Chemotherapeutika, deren Wirkung ebenfalls über die Bildung von Radikalen verläuft.
Kapitel 7: Wirkstoffe im Rotwein
Viele Bücher zum Thema Wein und Gesundheit beschränken die Wirkung des Rotweins auf das Vorliegen von Polyphenolen, um die Vorteile bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erklären. Im gleichen Fahrwasser segeln zahlreiche Werke, die erklären wollen, warum Polyphenole erfolgreich Krebs bekämpfen. Fälschlicherweise werden sie auf ihre Wirkung als Radikalfänger reduziert. Dem Rotwein wird man damit nicht gerecht. Wein hat nicht nur Polyphenole zu bieten, und die Polyphenole mehr als nur ihre Fähigkeit als Anti- oder Prooxidans. Die Inhaltsstoffe des Rotweins werden deshalb differenzierter untersucht und bewertet.
In der Weintraube bilden sich aus Glukose zuerst die Weinsäuren und während der phenolischen Reife die Flavonide. Der Gehalt an Säuren ist im Rotwein fünf- bis zehnmal größer als der Gehalt an Flavonoiden. Die Wirkung der Säuren (kurzkettige Fettsäuren und Phenolsäuren) wird oft unterschätzt. Phenolsäuren besitzen verschiedene Wirkmechanismen, um Krebszellen anzugreifen. Alle Hydroxyzimtsäuren bilden beispielsweise Radikale, für die Darmkrebs besonders anfällig ist.
Auch Flavonoide bieten einiges auf. Sie hindern Krebszellen daran, Zucker aufzunehmen und stören auf vielfältige Weise deren Stoffwechsel. Ihr größter Beitrag ist die synergistische Unterstützung anderer Wirkstoffe. Sie machen es Krebszellen unmöglich, Medikamente zu entsorgen. Medikamentenresistenzen können so vermieden werden.
Flavonoide zeigen in unterschiedlichen Rotweinen erhebliche Diskrepanzen im Gehalt, sowie in der Zusammensetzung. Während im Merlot Malvidin-Verbindungen dominieren, übernehmen das im Nebbiolo Peonidin-Verbindungen. In einigen pilzwiderstandsresistente Rebsorten (PIWIs) liegen krebshemmende Flavonoide vor, die in normalen Rotweinen nicht vorkommen. Während der längeren Lagerzeit der Rotweine, für die Reife des Weines unabdingbar, entstehen weitere wichtige Helfer im Kampf gegen Krebs. Damit können die gleichen Flavonoide aus Obst und Gemüse nicht aufwarten.
Kapitel 8: Darmkrebs
Aus der Fülle positiver Befunde mit Flavonoiden stechen die Ergebnisse bei Darmkrebs hervor. Das liegt in erster Linie an unseren Darmbakterien. Sie bauen die im Rotwein reichlich vorhandenen Anthocyane zu Phenolsäuren ab, die ihre Wirkung direkt im Darm entfalten. Zusätzlich werden bereits im Wein vorhandene Phenolsäuren durch die im Darm gebildeten Phenolsäuren verstärkt.
Darmkrebs ist die dritthäufigste Krebserkrankung weltweit. Die Stadien seiner Entstehung und Entwicklung sind sehr gut bekannt. Neben der genetischen Veranlagung, die nur in wenigen Fällen zum Tragen kommt, spielen äußere Faktoren eine ungemein wichtigere Rolle. Experten halten diese äußeren Faktoren, wie Ernährung und Lebensstil, verantwortlich für 55 Prozent der Erkrankungen. Durch gezielte Ernährung könnte die Hälfte aller Darmkrebsfälle vermieden werden. Rotwein hat hier das Potenzial zum „game changer“.
Kapitel 9: Bestandsaufnahme
Die krebshemmende Wirkung der meisten Inhaltsstoffe des Rotweins ist gut dokumentiert. Ob sie in allen Rotweinen in ausreichenden Mengen vorkommen, wird abschließend beantwortet. Große Datenmengen in öffentlich zugänglichen Datenbanken sind hier von unschätzbarem Vorteil. Es bestehen beachtliche Unterschiede zwischen den Rotweinen. Beispielsweise findet man durchschnittlich drei Milligramm Resveratrol pro Liter. Es gibt jedoch viele Rotweine, die kein Resveratrol enthalten, aber auch Spitzenreiter mit 30 Milligramm pro Liter, einer therapeutisch wirksamen Menge. Ähnliches gilt für weitere Inhaltsstoffe. Die Analyse zeigt zudem, dass es nicht nur auf die Rebsorte ankommt. Die Lagerung und Zusatzstoffe spielen eine wichtige Rolle, was sich in spezifischen Inhaltsstoffen zu erkennen gibt. Trends und Hinweise erleichtern es, den für sich persönlich richtigen Rotwein zu finden.
Kapitel 10: Ausblick
Rotwein wird keine Zulassung als Krebsmedikament bekommen: zu komplex, instabil und vor allem zu billig. Andererseits ist das eine Chance. Durch neue oder veränderte Rebsorten sowie dem Einsatz neuer Techniken lassen sich wertvolle Inhaltsstoffe weiter anreichern. Durch Legalisierung neuer Zusatzstoffe könnten weitere Verbesserungen erzielt werden. Es wäre denkbar, Kunstweine mit optimierter Zusammensetzung zu schaffen. Viele Inhaltsstoffe des Rotweins sind als unbedenkliche Nahrungsergänzungsmittel zugelassen und unterliegen keiner Mengenbegrenzung.
Anmerkung des Autors
Ein Buch über Chemie ohne Reaktionsgleichungen ist für einen Chemiker eine Herausforderung. Ich habe mit einer Ausnahme auf solche verzichtet, weil die Hauptaussagen auch ohne Kenntnis der Gleichungen verständlich sind. Die Ausnahme beleuchtet das unterschiedliche Verhalten von Resveratrol in normalen Zellen und in Krebszellen. Dieses herauszustellen ist mir besonders wichtig, da es einen der größten Irrtümer in der Krebstherapie entlarvt, den unreflektierten Einsatz von Antioxidantien. Es ist zudem unumgänglich, wichtige Proteine beim Namen zu nennen. Diese werden in der Literatur, zur Vermeidung langer wissenschaftlicher Namen, abgekürzt. Es sind Kurznamen, die Sie nicht abschrecken sollten. Jedem Kapitel sind ein Basissatz sowie ein Aphorismus von Georg Christoph Lichtenberg (1742 – 1799) vorangestellt. Letztere sind Lebensweisheiten in konzentrierter Form und kommen damit einem guten Rotwein sehr nahe. Sollte das Buch nicht den erwünschten Zuspruch finden, werde ich mich mit Lichtenberg trösten: „Ich mag immer den Mann lieber, der schreibt daß es Mode werden kann, als den der so schreibt wie es Mode ist.“
Kapitel 1: Rotwein ist gesund
In dem wir sehen, dass die gesundheitsfördernden Beiträge von Rotwein bei Krebs oftmals durch Fehlinterpretationen, fehlerhaftes Studiendesign oder Lobbyismus unterschlagen werden.
„Die gefährlichsten Unwahrheiten sind Wahrheiten, mäßig entstellt.“
Georg Christoph Lichtenberg
Die positiven Auswirkungen eines moderaten Weinkonsums wurden in den letzten Jahrzehnten immer wieder bestätigt. Dennoch berät das EU-Parlament aktuell darüber, ob künftig Weinflaschen mit Schockbildern etikettiert werden sollen, um auf die Gefahr hinzuweisen, dass Krebs durch übermäßigen Alkoholkonsum verursacht werden kann. Das muss, wie die Adjektive moderat und übermäßig und die Differenzierung zwischen Wein und Alkohol belegen, kein Widerspruch sein. Allerdings zeigt die Diskussion im EU-Parlament, wie Zahlen und Argumente konstruiert werden, um die jeweilige Sicht der Dinge zu untermauern. Einige Abgeordnete stützen sich auf einen Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der in Europa schätzungsweise 10 Prozent der Krebsfälle bei Männern und 3 Prozent der Krebsfälle bei Frauen auf Alkohol zurückführt.1 Andere Abgeordnete hingegen verweisen darauf, dass 2 Prozent der Krebsfälle durch übermäßigen Alkoholkonsum verursacht werden.“2
Was ist nun richtig, 10 Prozent durch Alkohol oder 2 Prozent durch übermäßigen Alkoholkonsum? Beide Aussagen können nicht gleichzeitig richtig sein. Das Dilemma der Abgeordneten ist verständlich. In der wissenschaftlichen Literatur gibt es tausende Studien dazu, deren Resultate auf den ersten Blick unvereinbar erscheinen. Meistens lassen sich vermeintliche Widersprüche durch das Studiendesign aufklären, was dann nicht im gleichen Maße kommuniziert wird. Erschwerend kommt hinzu, dass die öffentliche Meinung nicht durch die Fachliteratur bestimmt wird, sondern durch Berichte in den Medien. Diese fühlen sich jedoch nicht unbedingt der objektiven Berichterstattung verpflichtet. Die Angst vor Krebsauslösern oder die Hoffnung auf vermeintliche Wundermittel lassen sich besser vermarkten.
Angesichts Tausender Verkehrstote pro Jahr, durch Alkohol verursacht, sind die Bemühungen, den Alkoholkonsum zu diskreditieren, verständlich. Aber die Gleichsetzung von Alkohol und Wein ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht akzeptabel. Die gesundheitlichen Vorteile eines moderaten Weinkonsums dürfen nicht in Frage gestellt werden, weil manche Menschen verantwortungslos handeln. Die Verzerrung von Studien, das gezielte Auslassen wichtiger Details, sowie die Aufstellung falscher Behauptungen und unzulässiger Interpretationen sind nicht entschuldbar. Deshalb werden in diesem Kapitel einige wichtige Studien und die Reaktionen darauf rekapituliert. Sie zeigen, wie schwierig es mitunter ist, den Überblick zu behalten.
Das Französische Paradoxon
Englischen Epidemiologen fiel in den 1960-er Jahren auf, dass in Frankreich die Sterblichkeit im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 40 bis 50 Prozent niedriger als im Vereinigten Königreich war. Das wurde damals jedoch als französische Unfähigkeit, den Tod durch Herzinfarkt diagnostizieren zu können oder zu wollen, abgetan. Mit dieser Mär war nach Auswertung der sogenannten MONICA-Studie (MONItoring CArdiovascular disease) Schluss. Die Studie der WHO analysierte zwischen 1976 und 2002 über 10 Millionen Patientendaten aus 21 Ländern. Sie bestätigte die tatsächlich niedrigere Sterblichkeit in Frankreich.
Der Umstand, dem Rotwein seine heutige Renaissance in der Medizin verdankt, liegt erneut in Frankreich und wurde als Französisches Paradoxon bekannt. Am 17. November 1991 behauptete der französische Professor Serge Renaud in der populären Fernsehsendung „60 minutes“ des amerikanischen Fernsehsenders CBS: Der regelmäßige Weinkonsum seiner Landsleute sei dafür verantwortlich, dass Franzosen, trotz eines hohen Pro-Kopf-Verzehrs an tierischen Fetten, weniger Herzinfarkte erlitten als Einwohner anderer westlicher Länder. Das zeigte Wirkung. 1992 stieg der Rotweinkonsum der Amerikaner um 39 Prozent an, nachdem er vorher jährlich um knapp fünf Prozent gefallen war!3
In der Tat zeigten Renauds Befunde, dass die für andere Länder geltende positive Korrelation zwischen der Aufnahme tierischer Fette und der kardiovaskulären Sterblichkeit in Frankreich um 50 Prozent reduziert ist. Wurden allerdings Daten berücksichtigt, die den Weinkonsum in allen Ländern mit einbezogen, war kein Unterschied mehr zu erkennen (siehe Abbildung 1.1). Daraus folgt, dass nicht der Verzehr von tierischen Fetten für eine hohe, sondern der Weinkonsum für eine niedrigere Sterblichkeit verantwortlich ist. Die Aussage wird seitdem mit dem Begriff „Französisches Paradoxon“ verbunden.
Abbildung 1.1: Beschreibung des Französischen Paradoxons: Zusammenhang zwischen Tod durch Herzinfarkt und dem täglichen Weinkonsum in verschiedenen europäischen Ländern (Abbildung modifiziert nach Ref.4)
Das Französische Paradoxon, wie es Renaud formulierte, ist somit nicht paradox. Er beging den häufig gemachten Fehler, aus einer Korrelation eine Ursache anstelle einer Arbeitshypothese abzuleiten. Es wäre nicht notwendig gewesen, die unbewiesene und mittlerweile widerlegte Behauptung, dass Fettkonsum für Herzinfarkte verantwortlich ist, in die These einzuführen. Ohnehin ist Renaud nicht der geistige Vater des Französischen Paradoxons, sondern 1819 der irische Arzt Dr. Samuel Black. Black fiel bereits vor über 200 Jahren die außergewöhnlich große Diskrepanz bei Herzinfarkttoten in Irland und Frankreich auf. Allerdings war er so klug, sich bezüglich der Ursache nicht konkret festzulegen. Er formulierte weitaus vorsichtiger und vermutete das Resultat allgemein als Folge „französischer Gebräuche (womit er die französische Küche gemeint haben dürfte), der Art zu leben, des Klimas und geringerem Stress“.5
An Versuchen, diese „ketzerische Theorie“ in Frage zu stellen, mangelte es nicht. Stets wurde jedoch die Gültigkeit des Paradoxons festgestellt. Alle Studien kommen zum gleichen Ergebnis. Moderate Alkoholkonsumenten haben ein niedrigeres Sterberisiko im Vergleich zu Abstinenzlern, während exzessive Alkoholkonsumenten ein höheres Sterberisiko haben. Eine Aufschlüsselung ergab zudem, dass Weinkonsum die Gefäße signifikant besser schützt als Bier oder Spirituosen. Der Weinkonsum erzeugt offensichtlich zusätzliche Wirkungen, die durch spezifische nicht-alkoholische Inhaltsstoffe vermittelt werden.6 Diesen Befunden konnte sich selbst das amerikanische Ministerium für Gesundheit und Landwirtschaft nicht verschließen.
Wo ist jedoch die Grenze zwischen moderatem und exzessivem Alkoholkonsum? Für Frauen wird sie mit 25 Gramm Alkohol pro Tag angegeben und damit unter dem Grenzwert für Männer, der bei 40 Gramm Alkohol pro Tag liegt.7 Diese Werte sind Näherungswerte und nicht exakt berechnet. Es gibt Gründe anzunehmen, dass sie nach unten korrigiert wurden, um auf der sicheren Seite zu sein. Damit war eine wichtige Bastion für ein generelles Alkoholverbot gefallen.
Die Kopenhagen-Studie
Am 19. September 2000 erschien in den Annals of Internal Medicine die Auswertung einer dänischen Studie8, die unter dem Synonym „Copenhagen City Heart Study“ beträchtliche Aufmerksamkeit erregte. Die Trinkgewohnheiten von 13 000 Männer und Frauen zwischen 30 und 79 Jahren wurden über zwölf Jahre hinweg untersucht. Dabei unterschied man zwischen Wein-, Bier-, Spirituosenkonsum und Abstinenz. Innerhalb des langen Untersuchungszeitraums verstarb ein Drittel der Teilnehmer. Somit konnte man gesicherte Aussagen über den Einfluss der Getränke auf die gesundheitliche Entwicklung der Beteiligten tätigen.
Es zeigte sich, dass die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit bei Weinkonsum um 60 Prozent und bei Bierkonsum um 28 Prozent niedriger als bei Abstinenzlern war. Zum gleichen Ergebnis kamen bereits frühere Studien. Betrachtet man allerdings die Gesamtsterblichkeit, die in starkem Maße durch Krebserkrankungen dominiert ist, ergab sich für die Weinkonsumenten eine Erniedrigung des Risikos um 50 Prozent, während Bierkonsum keinen Einfluss auf die Gesamtsterblichkeit hatte. Dieses Resultat unterstützt die Hypothese, dass im Falle der Herz-Kreislauf-Erkrankungen primär der Alkohol für die Senkung des Risikos verantwortlich ist und für die Senkung des Krebsrisikos zusätzliche Weininhaltsstoffe benötigt werden. Dementsprechend formulierten die Ärzte der Studie zusammenfassend: „Weinkonsum kann einen positiven Effekt auf die Gesamtmortalität haben, der zu jenem von Alkohol additiv ist. Dieser Effekt führt zu einer Reduzierung der Todesfälle durch Herzkrankheiten und Krebs.“
Der Einfluss von Nahrungsmitteln auf das Krebsrisiko
Laut Zeitungsberichten kann Rotwein krebshemmend wirken und ihr Leben verlängern, oder krebsauslösend ihr Leben verkürzen. Schlagzeilen dieser Art berufen sich stets auf Studien und lassen den unvoreingenommenen Leser ratlos zurück. Was stimmt nun? Beide Aussagen widersprechen sich. Oder doch nicht? Das folgende Beispiel macht auf grundlegende Fehler in der Berichterstattung aufmerksam. Sehr oft ist die Datenlage in der wissenschaftlichen Literatur eindeutig und wird erst durch die Medien, gewollt oder ungewollt, in die eine oder andere Richtung verschoben. So geschah es 2013 bei der Untersuchung von Nahrungsmitteln auf ein mögliches Krebsrisiko.
Damals veröffentlichten amerikanische Wissenschaftler unter dem Titel „Is all we eat associated with cancer?“9 eine Metaanalyse, die die Ergebnisse von 216 Studien aus den Jahren von 1976 bis 2011 auswertete. Unter einer Metaanalyse versteht man ein statistisches Verfahren, um die Ergebnisse verschiedener Studien mit derselben Fragestellung quantitativ zusammenzufassen und zu bewerten. Die Resultate einer Metaanalyse sind wertvoller und aussagekräftiger, da sehr viele Studien miteinander verglichen und vermeintliche Widersprüche leichter erkennbar werden. In der genannten Metaanalyse wurden zwanzig Nahrungsmittel identifiziert und ihr jeweiliges relatives Risiko bestimmt, Krebs zu hemmen oder auszulösen. Abbildung 1.2 gibt die Ergebnisse wieder. Jeder einzelne Punkt ist das Resultat einer einzelnen Studie. Die Werte auf der waagrechten Achse sind wie folgt zu verstehen. Ein Wert von 1 bedeutet keinen Effekt bei Verzehr des Lebensmittels. Ein Wert von 2 heißt doppeltes Risiko; ein Wert von 0,5 halbiert das relative Risiko an Krebs zu erkranken.
Abbildung 1.2: Einfluss unterschiedlicher Nahrungsmittel auf das relative Krebsrisiko. (Abbildung aus Ref.9, farbliche Umrandungen vom Autor eingefügt)
Die Autoren bewerten die Ergebnisse vorsichtig, erkennen aber klare Trends. So ist offensichtlich, dass der Einfluss der Nahrungsmittel, Krebs zu fördern größer ist als Krebs zu hemmen. Dass dieses auf den ersten Blick nicht gleich erkannt wird, ist der logarithmischen Darstellung geschuldet. Bei linearer Darstellung wären die Punkte rechts von der 1 zehnmal weiter nach rechts verschoben und auf dem Blatt nicht mehr zu sehen. Ohne bereits hier auf die Gründe einzugehen, findet man für die Nahrungsmittel eine beachtliche Streuung. Es gibt Nahrungsmittel, die in der Metaanalyse mehrheitlich einen krebshemmenden Einfluss zeigen. Hierzu gehören Zwiebeln, Oliven, Zitronen und Karotten (in der Abbildung grün umrandet). Zu den Nahrungsmitteln, die mehrheitlich Krebs fördern, gehören Zucker, Salz, Kartoffeln, Schweinefleisch, Käse, Brot und Rindfleisch (in der Abbildung rot umrandet). Das Ergebnis der Metaanalyse wurde im American Journal of Clinical Nutrition veröffentlicht und ist aus diesem Grund nur wenigen Fachleuten bekannt. Wie wurde das Ergebnis aber in den Medien dargestellt?
Die Gesundheitsreporterin Julia Belluz, die die Metaanalyse zwei Jahre später einem größeren Leserkreis nahebrachte, kommt zu einer völlig anderen Interpretation als die Wissenschaftler. Ihrer Meinung nach ist der Einfluss der Nahrungsmittel nicht eindeutig. Für sie halten sich „für und wider“ die Waagschale, weshalb man den einzelnen Studien keine größere Bedeutung beimessen sollte. Wie kann es zu einer solchen Diskrepanz kommen? Ganz einfach, indem man in der Abbildung aus der Fachzeitschrift alles weglässt, was die eigene Aussage in Frage stellt. In ihrem Artikel erweckt Belluz den Eindruck, dass es sich bei ihrer Abbildung (Abbildung 1.3) um dieselbe Abbildung handelt, die in der Fachzeitschrift publiziert wurde. Allerdings fällt auf, dass alle in Abbildung 1.2 farblich umrandet aufgeführten Nahrungsmittel entfernt wurden. Lichtenberg lässt grüßen!
Warum wurden gezielt Nahrungsmittel weggelassen, die einen positiven oder negativen Einfluss auf Krebs haben? Warum den krebshemmenden Einfluss von Zwiebeln und Oliven verschweigen? Oder handelt es sich um einen subtilen Versuch, vom Krebsauslöser Zucker abzulenken? Wie dem auch sei, der Bericht wurde von anderen Medien übernommen.10 Das führte in der Öffentlichkeit zum falschen Eindruck, dass Nahrungsmittel keinen großen Einfluss auf Krebsprophylaxe oder Krebsentstehung haben.
Kommen wir zum Fachartikel zurück und zur Rolle des Weins. Wie in Abbildung 1.2 zu erkennen ist, wird dem Wein in drei Studien eine krebsauslösende Rolle zugeschrieben und in sechs Studien eine krebshemmende Eigenschaft bescheinigt.
Abbildung 1.3: Einfluss unterschiedlicher Nahrungsmittel auf das relative Krebsrisiko nach Julia Belluz. Durch Auslassen eindeutiger Resultate (vergleiche mit Abbildung 1.2) wird ein falscher Eindruck erweckt und von wirklichen Krebstreibern abgelenkt. (Abbildung entnommen aus Ref.11, die sich auf Abbildung 1.2 beruft)
Weinbefürworter und Weinkritiker haben somit die Möglichkeit, unreflektiert ihren Standpunkt mit einer Studie zu untermauern. Von dieser Möglichkeit wird allzu gerne Gebrauch gemacht. Das führt dazu, dass wir in den Medien mit einer Fülle widersprüchlicher Meldungen über Wein konfrontiert werden.
Die Rosinenpickerei ist nicht hilfreich, viel wichtiger erscheint die Frage, weshalb es zu dieser Streuung kommt. Spontan fällt auf, dass beim Wein nicht unterschieden wurde. Die krebshemmenden Resultate sind wahrscheinlich auf pharmakologisch wirksame Inhaltsstoffen zurückzuführen, die nicht in allen Weinen in der gleichen Größenordnung vorliegen. Rotweine müssten besser als Weißweine abschneiden. Mit Blick auf Zucker, für den fast nur krebsauslösende Resultate gefunden wurden, drängt sich ein weiterer Zusammenhang auf. Im Wein ist Zucker in unterschiedlichen Mengen enthalten. Höchstwahrscheinlich lassen sich die besten krebshemmenden Resultate mit einem trockenen, praktisch zuckerfreien Rotwein erzielen, während ein weißer Eiswein mit seinen beachtlichen Zuckermengen eher krebsauslösende Befunde verantwortet.
Die in Abbildung 1.2 aufgezeigte Streuung für einzelne Nahrungsmittel ist erklärbar. Es ist nicht die Unfähigkeit der Wissenschaft, reproduzierbare Ergebnisse zu liefern, sondern die zugrundeliegende Komplexität, die eine isolierte Betrachtung eines einzelnen Nahrungsmittels nahezu unmöglich macht. Eine Studie mit einem einzigen Nahrungsmittel über einen längeren Zeitraum ist nicht möglich. Stets müssen die Beiträge der anderen Nahrungsmittel mitberücksichtigt werden.
Mediterrane Ernährung senkt das Krebsrisiko
Moderater Weinkonsum senkt das Krebsrisiko. 2017 bestätigte das eine weitere Metaanalyse, die den Einfluss einer mediterranen Ernährung auf das Krebsrisiko untersuchte. Die Ergebnisse wurden für die Nahrungsmittel heraus gerechnet und offenbarten Beachtliches. Wie in Abbildung 1.4 deutlich zu erkennen ist, senkt moderater Rotweinkonsum das Krebsrisiko um 11 Prozent. Bei den anderen Nahrungsbestandteilen, mit Ausnahme von Fleisch, ist ebenfalls mit einem reduzierten Krebsrisiko zu rechnen. Überraschenderweise kamen alle untersuchten Nahrungsmittel nicht an das gute Ergebnis von Rotwein heran.
Wein ist nicht gleich Wein, die Unterschiede sind bemerkenswert. Selbst die einfache Unterscheidung zwischen weiß und rot trägt dem nicht Rechnung. Rotweine verfügen allgemein über mehr Inhaltsstoffe. Schaut man sich die Inhaltsstoffe etwas genauer an (siehe Kapitel 7), zeigen sich gewaltige Unterschiede zwischen den verschiedenen Rotweinen. Die Kopenhagen-Studie hatte ein reduziertes Krebsrisiko bei moderatem Weinkonsum festgestellt. Es ergab sich ein reduziertes Risiko von 50 Prozent über alle Weine hinweg! Da drängen sich Fragen auf, wie das Ergebnis ausgesehen hätte, wenn nur Rotweinkonsum untersucht worden wäre, oder nur Rotweine, die über eine definierte Menge an Resveratrol verfügen, oder zusätzlich über einige näher zu betrachtende Polyphenole. In Anbetracht der krebshemmenden und krebsbekämpfenden Eigenschaften bestimmter Inhaltsstoffe des Rotweins wäre es nicht überraschend, wenn ein solcher Rotwein ein viel besseres Ergebnis erzielen würde.
Abbildung 1.4: Einfluss unterschiedlicher Nahrungsmittel aus einer mediterranen Ernährung auf das Krebsrisiko. Während man für Fleisch ein erhöhtes Risiko von 4 Prozent ermittelte, senkte Rotwein das Krebsrisiko um 11 Prozent. Die Daten sind Ref.12 entnommen.
Das Ergebnis der Metaanalyse wird dadurch brisant, dass eine Reduzierung der Nahrungsmittel auf ihren Polyphenolgehalt nicht zu diesem Ergebnis gekommen wäre. In den mediterranen Ländern besteht gegenüber den nicht-mediterranen Ländern keine höhere, sondern eine niedrigere Gesamtpolyphenolaufnahme. Zum Vergleich: Im Vereinigten Königreich findet man eine zweifach höhere Flavonoidaufnahme, die hauptsächlich auf den hohen Anteil an Flavanolen beim Teekonsum zurückzuführen ist. In den mediterranen Ländern werden vermehrt Anthocyane und Proanthocyanidine, die im Wein und in Früchten vorkommen, konsumiert. Das unterstreicht die Bedeutung des Rotweins bei der Ernährung. Zum einen kommt es auf den richtigen Mix an Polyphenolen an, zum anderen bewirkt der Alkoholanteil eine bessere Bioverfügbarkeit der Polyphenole. Weingegner behaupten, die positiven Ergebnisse wären nur auf die mediterrane Küche zurückzuführen. Das Gegenteil dürfte der Fall sein. Die Effekte der mediterranen Ernährung werden durch den moderaten Rotweingenuss verstärkt, wenn nicht sogar erst ermöglicht. Das sollte niemand überraschen. Die sinnvolle Kombination aus Wein und Inhaltsstoffen hat sich die Medizin über viele Jahrhunderte zunutze gemacht. Mehr dazu im 2. Kapitel.
Die Lancet-Studie
Die Empfehlung des amerikanischen Ministeriums für Gesundheit und Landwirtschaft für einen moderaten Alkoholkonsum konnte bei den Alkoholgegnern nicht unkommentiert bleiben. Mit einem erheblichen Aufwand untersuchte eine Langzeitstudie 23 Gesundheitsprobleme, angeblich durch Alkohol verursacht, über einen Zeitraum von 1990-2016 an über 600 000 Personen und wertete sie statistisch aus. Die Resultate publizierte 2018 die renommierte Fachzeitschrift The Lancet13 und sorgte für einen erheblichen Medienwirbel. Angeblich stand es im Widerspruch zu den Empfehlungen der Gesundheitsbehörde. Was hatten die Forscher gefunden? Die Ergebnisse zum geringeren Herzinfarktrisiko bei moderatem Weinkonsum wurden nicht in Abrede gestellt. Unter der Hypothese, dass sich die 23 Gesundheitsprobleme auf Alkohol zurückführen lassen, wurde ein Anstieg des relativen Risikos, eines dieser 23 Probleme zu bekommen, von sage und schreibe 0,5 Prozent gefunden. Das nahm man zum Anlass, den moderaten Weinkonsum zu diskreditieren und forderte die Gesundheitsbehörde auf, ihre Empfehlung zu widerrufen. Bei 0,5 Prozent nimmt der Laie irrigerweise an, dass eine von 200 Personen ein Problem bekommt. Dem ist aber nicht so!
Der Medienwirbel um die „Lancet“-Studie war weniger dem Resultat geschuldet als vielmehr der Art der Darstellung, der daraus gezogenen Interpretation und den Schlussfolgerungen. Glücklicherweise ist The Lancet eine Fachzeitschrift, die zwischen einem relativen Risiko und einem absoluten Risiko sehr wohl unterscheidet und deshalb, gemäß ihren Richtlinien, die Daten zum absoluten Risiko einforderte. Den Gutachtern war das offensichtlich entgangen. Diese Zahlen mussten nachgereicht werden und offenbarten Folgendes: Von je 100 000 Personen, die keinen Alkohol konsumierten, hatten 914 im folgenden Jahr eines der 23 Gesundheitsprobleme. Bei 100 000 Personen, die täglich moderat Alkohol tranken, stieg diese Zahl auf 918. Das heißt, der absolute Risikoanstieg war 4 von 100 000 Personen oder 0,004 Prozent! Ein deutlicher Unterschied zu den ursprünglichen 0,5 Prozent!
Im Jahre 2012 rief das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung die Aktion „Unstatistik des Monats“ ins Leben. Dort hinterfragt man jeden Monat jüngst publizierte Zahlen sowie deren Interpretationen. Die Aktion will dazu beitragen, mit Daten und Fakten vernünftig umzugehen, in Zahlen gefasste Abbilder der Wirklichkeit korrekt zu interpretieren und eine immer komplexere Welt sinnvoller zu beschreiben. Jeden Monat wird eine Statistik gewählt, deren Darstellung oder Interpretation mehr als fraglich oder gar falsch ist. Diese zweifelhafte Ehre wurde den Forschern der „Lancet“-Studie im Monat August 2018 zuteil.14 In seiner Begründung schreibt das Institut: „Erstens, ein Drink pro Tag ist wohl ein eher kleines Gesundheitsrisiko, auch weil frühere Studien ein solches nicht immer fanden. Zweitens, die Autoren der „Lancet“-Studie haben ein Grundprinzip transparenter Risikokommunikation nicht beachtet. Und dieser Fall ist im Gesundheitsbereich leider immer noch keine Ausnahme. Mit relativen Risiken kann man eben mehr Angst erzeugen als mit absoluten Risiken.“ Das Leibniz-Institut gibt deshalb eine interessante Empfehlung zur Risikobetrachtung: „Man kann sich auch vergegenwärtigen, dass wir anderswo schwere Risiken in Kauf nehmen, ohne viel darüber nachzudenken. Im Beipackzettel von Aspirin findet man etwa, dass Hirnblutungen und akutes Nierenversagen in weniger als einer von je 10 000 Personen auftreten, die Aspirin einnehmen. Kein Vergleich ist perfekt, aber Vergleiche helfen, die Risiken in eine Perspektive zu setzen.“15
Um die Diskussion über mögliche Nachteile des Weinkonsums zu versachlichen, kann es helfen, die Perspektive zu verändern. Stellt man sich Wein nicht als Genussmittel, sondern als Medikament vor, verflüchtigen sich die meisten Argumente der Weingegner. Von jedem Medikament weiß man, dass es unterhalb eines therapeutischen Fensters nicht wirkt und es oberhalb des Fensters zu unerwünschten Nebenwirkungen bis hin zum Tode kommen kann. Selbst bei korrekter Dosierung sind Abhängigkeit und Suchtgefahr nicht auszuschließen. Wer also Weinkonsum wegen möglicher Überdosierung und Suchtgefahr verbieten möchte, muss sich darüber im Klaren sein, dass er gleiches für alle Medikamente fordern müsste. Ich bin mir sicher, dass die meisten Weingegner so weit nicht gehen würden.
Man könnte es auch deshalb nicht fordern, weil das strikte Verbot von Alkohol Konsequenzen für viele Nahrungsmittel hätte. Diese enthalten oftmals Alkohol, was vielen Konsumenten nicht bewusst ist. In Fruchtsäften findet sich bis zu 0,3 Prozent Alkohol, so viel wie in den meisten „alkoholfreien“ Bieren. Hinzu kommt noch bis zu 0,2 Prozent des giftigen Methanols. Alkohol steckt auch in festen Speisen. Spitzenreiter sind überreife Bananen, mit fast 1,0 Prozent Alkohol, somit ist in fünf Bananen so viel Alkohol wie in einem Glas Bier. Selbst im Brot ist Alkohol in Spuren enthalten. In letzter Konsequenz müsste man auf fast alle pflanzlichen Nahrungsmittel verzichten, wenn man eine strikte Vermeidung von Alkohol anstrebt.
Ebenso muss die naheliegende Frage, die sich aus der „Lancet“-Studie ergibt, beantwortet werden: Wie können 914 von 100 000 Personen alkoholbedingte Gesundheitsprobleme aufweisen, wenn sie nachweislich keinen Alkohol trinken? Entweder beruhten einige der postulierten Gesundheitsprobleme nicht oder nur bedingt auf Alkohol, was bei ihrer Streichung zu einem besseren Ergebnis zugunsten des moderaten Weinkonsums geführt hätte – oder die Abstinenzler hatten den Alkohol an anderer Stelle unbewusst mit der Nahrung aufgenommen.
Kapitel 2: Medizinalweine
In dem wir sehen, dass Wein bereits im Mittelalter als wirksames Medikamentengemisch verordnet wurde.
„Die Medizin sollte nicht nur dem Leben Jahre geben, sondern auch den Jahren Leben.“
Georg Christoph Lichtenberg
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts verordneten Weinärzte regelrechte Weinkuren. In Apotheken wurde Wein auf Rezept ausgegeben. Rheinwein, ein Klassiker unter den ärztlichen Verschreibungen, galt lange Zeit als bestes Heilmittel gegen die meisten Krankheiten. Im Jahre 1753 führte ein Kompendium mit dem Titel „Weinarzt“ Wein-Rezepte für fast alle Krankheiten auf, unter anderem bei Gedächtnisproblemen. Trotz jahrzehntelanger Erforschung der Alzheimer-Erkrankung gibt es heute kein wirksameres Medikament. Somit liest sich die aktuelle Empfehlung, Rotwein zur Linderung bei Alzheimer zu trinken, wie ein Rückgriff auf alte Zeiten.1 Wer sich für die Geschichte des Weins als historisches Medikament interessiert, für den wird sich das lesenswerte, amüsante Buch „Die Wein-Apotheke“ von Elmar M. Lorey lohnen.2 Es enthält einen wunderbaren Rückblick auf eine Zeit, in der, nach Ansicht von Lorey, den meisten Ärzten „der Korkenzieher vertrauter war als das Skalpell“.
Frägt man einen Chemiker und einen Pharmazeuten nach dem Wichtigsten an einem Arzneimittel, wird man nicht immer dieselbe Antwort bekommen. Während der Chemiker dazu neigt, den aktiven Wirkstoff als wichtigsten Bestandteil anzusehen, sieht der Pharmazeut in der Komposition des Wirkstoffs mit den Hilfsstoffen den Schlüssel zum Erfolg. Und beide haben Recht. Ohne aktiven Wirkstoff wird kein Medikament funktionieren. Der beste Wirkstoff nützt jedoch nichts, wenn er vom Körper nicht verarbeitet werden kann. Die Rede ist von der Bioverfügbarkeit eines Arzneimittels. Diese wird erst durch die richtige Auswahl der Hilfsstoffe gewährleistet.
Somit gerät ein wichtiger Hilfsstoff in den Fokus, der nicht nur bei den Ärzten im Mittelalter, sondern noch heute in der modernen Pharmazie zum Zuge kommt – der Alkohol. Viele Wirkstoffe sind wasserunlöslich und können erst durch Auflösung in Alkohol wirksam verabreicht werden. Auf eine Destillation zur Herstellung reinen Alkohols wurde im Mittelalter verzichtet. Der direkte Einsatz von Wein zur Extraktion von Heilkräutern war einfacher und lieferte ein geschmacklich besseres Resultat. Durch diese Medikamentenentwicklung sind Kräuter- und Medizinalweine überliefert, von denen viele ihren Ursprung einem Kloster zu verdanken haben. Der Einsatz des Weins darf allerdings nicht nur auf die lösungsvermittelnde Eigenschaft des Alkohols reduziert werden. Wie an konkreten Beispielen aus dem Mittelalter aufgezeigt wird, ist es gerade die Mischung von Wein und weiteren Zutaten, die eine Wirkung erst ermöglichen.
Bei einigen Ernährungswissenschaftlern liegt die Empfehlung, Wein und mediterrane Ernährung zu kombinieren, ganz im Trend. Weingegner sehen darin einen Trugschluss. Sie glauben, dass Weingenießer eher zur Bildungsschicht gehören und über mehr Geld verfügen. Deshalb könnten sie sich eine ausgewogene und gesündere Ernährung leisten, die für die Gesundheit verantwortlich ist. Dabei wird fälschlicherweise davon ausgegangen, dass man alles, was man verzehrt, auch verwerten kann. Wenn dem so wäre, sähe es für Hilfsstoffe und die Zukunft der Pharmazie schlecht aus. Viele im Rotwein vorkommende Polyphenole sind schlecht wasserlöslich und benötigen einen gewissen Alkoholgehalt und ein saures Milieu, um resorbiert zu werden. Viele wichtige Inhaltsstoffe aus der Nahrung werden durch den gleichzeitigen Weingenuss erst und besser bioverfügbar werden. Die Kopenhagen-Studie (Kapitel 1) zeigte es auf. Zur Wirkung des Alkohols kommt diejenige weiterer Inhaltsstoffe hinzu, weshalb Wein als komplexe Wirkstoffkombination anzusehen ist. Das ist in der Medizin nicht ungewöhnlich.
In der Krebstherapie ist der Einsatz von Wirkstoffkombinationen fast schon die Regel. Der Krieg gegen Krebs lässt sich leichter gewinnen, wenn er an mehreren Fronten gleichzeitig geführt wird. So wird bei bestimmten Tumoren die Kombination der Wirkstoffe cis-Platin, Cyclophosphamid und Etoposid als Team zur gleichen Zeit eingesetzt. Die drei Wirkstoffe verfolgen dasselbe Ziel: die Schädigung der DNA in der Krebszelle während der Wachstumsphase als auch während der Zellteilung. Im Team sind sie ungleich effizienter, da sie das gemeinsame Ziel auf unterschiedlichen Wegen und an unterschiedlichen Orten synchron anstreben. Da zudem die Nebenwirkungen verteilt werden, ist eine höhere Dosierung möglich, was die Heilungschancen weiter erhöht.
Bei der Suche nach potenten Naturwirkstoffen beobachtet man immer wieder, dass isoliert getestete Wirkstoffe nicht das halten, was der Extrakt einer Frucht oder Pflanze versprochen hat. Das ist verständlich, wenn man berücksichtigt, dass im Extrakt Wirkstoffkombinationen und natürliche Adjuvantien vorliegen. Als Paradebeispiel dient der Warnhinweis, bestimmte Medikamente nicht zusammen mit Grapefruitsaft einzunehmen. Grapefruitsaft enthält das Polyphenol Naringenin, das dafür sorgt, dass manche Arzneimittel langsamer abgebaut werden. Viele Beipackzettel warnen davor, ihr Produkt mit Grapefruitsaft einzunehmen, um eine mögliche Überdosierung des Medikamentes zu vermeiden. Auf die naheliegende Idee, weniger Medikament zusammen mit einer definierten Menge an Grapefruitsaft einzunehmen, kommt niemand. Die gleiche Wirkung bei weniger Nebenwirkungen wäre ein Gewinn für den Patienten. Im 7. Kapitel, das die Biosynthese der in Weintrauben vorkommenden Flavonoide betrachtet, wird aufgezeigt, dass alle Flavonoide aus Naringenin entstehen. Naringenin ist in den Weintrauben und im Wein enthalten. Da liegt es nahe, dass viele Wirkstoffe im Wein besser wirken als in isolierter Form. Und Naringenin ist nicht das einzige Adjuvans im Rotwein!
2.1 Zurück ins Mittelalter
Die historischen Beispiele belegen, dass die Idee, dem Wein als effizientes Wirkstoffgemisch den Vorzug zu geben, nicht neu ist. „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“ hatte bereits Aristoteles bemerkt. Das Prinzip lässt sich weit über das Mittelalter hinaus zurückverfolgen. Es wurde zwischenzeitlich vergessen.
Antoniuswein und rotes Weinlaub
Im Mittelalter erkrankten viele Menschen an Mutterkorn-Vergiftungen (Ergotismus), ausgelöst durch die giftigen Bestandteile des Mutterkornpilzes, der auf Roggen wächst. Die betroffenen Menschen hatten das Gefühl, bei lebendigem Leib zu verbrennen und entwickelten halluzinogene Wahnvorstellungen, in denen sie von teuflischen Dämonen verfolgt wurden. Die Vergiftung bewirkte eine Verengung der Arterien, besonders in den Händen und Füssen mit der Folge, dass diese sich schwarz verfärbten und in den meisten Fällen sauber abfielen oder leicht amputieren ließen. Weniger „Glückliche“ verstarben direkt an der Krankheit, schätzungsweise rund 200 000 Menschen im Verlauf von vier Jahrhunderten.
Im Jahr 1089 gründeten Mönche die „Hospitalbruderschaft zum Heiligen Antonius zur Pflege der am Heiligen Feuer Erkrankten“. Diese konnte, trotz unbekannter Ursache der Krankheit, beachtliche Erfolge bei der Heilung erzielen. Wie sah der ganzheitliche Therapieansatz der Mönche aus? Er bestand aus einem geheimen Balsam, einem Wein, der durch Berührung mit einer Reliquie (Armknochen) des heiligen Antonius „verbessert“ wurde, dem sogenannten Antoniuswein und stundenlanger Meditation vor Heiligenbildern in der Kirche zur Vertreibung der Dämonen. Die Korrelation zwischen diesem Therapieansatz und der Heilung ist beachtlich. Jedoch hätte die gleiche Therapie außerhalb der Klostermauern nicht gewirkt. Aus heutiger Sicht wissen wir weshalb. Die Ursache ist in den Essgewohnheiten der Klöster zu finden, die sich in der damaligen Zeit deutlich von denen der Landbevölkerung unterschieden. Im Kloster wurde fast ausschließlich Weißbrot aus Weizenmehl und Wein konsumiert. Damit wurde die schleichende Vergiftung durch den Roggenparasiten unterbrochen, die Arterien durch den Weinkonsum geweitet und die Patienten letztlich geheilt.4
Dabei beschränkt sich die Wirkung des Weins nicht nur auf die arterienweitende Eigenschaft des Alkohols. Durch die Vergiftung werden die Blutgefäße angegriffen und geschwächt. In diesem Stadium lediglich eine Arterienweitung vorzunehmen ist so unsinnig wie einen porösen Fahrradschlauch durch Aufpumpen funktionsfähig machen zu wollen. Besser vitalisiert man zusätzlich die Blutgefäße während der Erweiterung. Hier kommen Inhaltsstoffe im Rotwein ins Spiel, die seit über 100 Jahren ihren Weg in die Apotheken gefunden haben und zur Behandlung chronischer Venenschwäche eingesetzt werden. Die Rede ist von rotem Weinlaub.
Das rote Weinlaub ist eine Arzneidroge aus den Blättern von Rotwein-Reben5





























