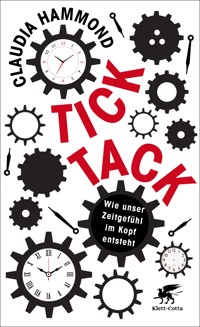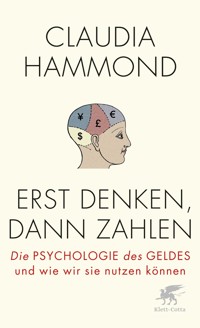10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Auf der Grundlage neuester Forschungsergebnisse aus Psychologie und Neurowissenschaften nimmt uns Claudia Hammond mit auf eine augenöffnende Reise: Sie zeigt, was Freundlichkeit in unserem Leben bewirken kann. Denn Freundlichkeit ist nicht nur der Schlüssel für ein gelungenes Miteinander, sie ist auch unerlässlich für unsere Selbstfürsorge. Kurz gesagt, ein freundliches Miteinander macht glücklich. Mit ihren »sieben Schlüsseln der Freundlichkeit« gibt Hammond uns effektive Strategien an die Hand, um mehr Freundlichkeit und Zugewandtheit in unser Leben zu integrieren – und erklärt, warum die Welt schon jetzt ein freundlicherer Ort ist, als man bei allen schlechten Nachrichten annehmen würde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Auf der Grundlage neuester Forschungsergebnisse aus Psychologie und Neurowissenschaften zeigt Claudia Hammond was Freundlichkeit in unserem Leben bewirken kann, und was echte Freundlichkeit bedeutet. Denn ein freundliches Miteinander ist nicht nur die Grundlage einer funktionierenden Gesellschaft, sie ist auch unerlässlich für unsere Selbstfürsorge. Anhand ihrer »sieben Schlüssel der Freundlichkeit« räumt die Autorin auf mit Mythen – wie dem, dass Freundlichkeit Schwäche bedeutet –, erklärt, warum die Welt schon jetzt ein freundlicherer Ort ist, als wir denken, und zeigt effektive Strategien auf, um mehr Freundlichkeit in unser Leben zu integrieren. Vom richtigen Zuhören, bis zum Lesen als Schlüssel zu mehr Empathie – Claudia Hammond nimmt uns mit auf eine augenöffnende Reise ins Universum der vielleicht schönsten aller urmenschlichen Eigenschaften.
© iBRODIEfoto
Claudia Hammond arbeitet als Rundfunksprecherin bei der BBC und als Dozentin für Psychologie an der Boston University in London. Sie ist Autorin populärwissenschaftlicher Bücher, für die sie den British Psychological Society Book Award erhalten hat. Bei DuMont erschien 2021 ›Die Kunst des Ausruhens‹.
Silvia Morawetz wurde für ihre Übersetzungen mehrfach ausgezeichnet. Gemeinsam mit Theresia Übelhör übersetzte sie für DuMont ›Das Mädchen mit dem Poesiealbum‹ von Bart van Es (2019) sowie ›Die Kunst des Ausruhens‹ von Claudia Hammond (2021).
Theresia Übelhör übersetzt aus dem Englischen und Französischen. Für DuMont hat sie u. a. die Übersetzung des ›Atlas unserer Zeit‹ (2017) vorgelegt.
Claudia Hammond
Miteinander
Wie wir freundlicherzu anderen unduns selbst werden
Aus dem Englischen von Silvia Morawetz und Theresia Übelhör
Von Claudia Hammond ist bei DuMont außerdem erschienen:
Die Kunst des Ausruhens
Die englische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »The Keys to Kindness« bei Canongate, Edinburgh.Copyright © Claudia Hammond, 2022
eBook 2023© 2023 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, KölnAlle Rechte vorbehaltenÜbersetzung: Silvia Morawetz, Theresia Übelhör Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln Satz: Fagott, FfmeBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck ISBN 978-3-8321-8293-9
www.dumont-buchverlag.de
Für Fiona, die immer freundlich ist
Vorwort
Ich wohnte einmal unweit der Londoner Abbey Road. Ab und zu fuhr ich diese Straße entlang und passte immer besonders auf, wenn ich mich einem bestimmten Zebrastreifen näherte. Dieser Fußgängerüberweg befand sich direkt vor den berühmten Abbey Road Studios, wo die Beatles den Großteil ihrer ikonischen Alben aufnahmen, darunter natürlich auch 1969 Abbey Road. Der Grund für meine erhöhte Aufmerksamkeit war, dass sich stets und ständig Tourist*innen auf dem Zebrastreifen befanden – eine Gruppe, von der immer eine Person barfuß war und von der niemand auf den Verkehr achtete –, die das Foto von John, Ringo, Paul und George auf dem Plattencover nachstellen wollten, während eine weitere Person ihre Hommage an die Fab Four fotografisch festhielt.
Gewiss, die Beatles gehören zu den berühmtesten Menschen, die je gelebt haben – gefeiert und bewundert von Millionen –, doch das große Denkmal, das mitten auf der Kreuzung unweit dieses Zebrastreifens steht, würdigt nicht ihre Erfolge. Dieses Denkmal ist circa sechs Meter hoch und aus grauem Stein. Auf einer seiner Plinthen steht die Bronzeskulptur einer Muse, die Harfe spielt. Auf einer anderen befindet sich ein rundes Medaillon aus Kupfer, auf dem das markante Gesicht eines bärtigen Mannes im Profil zu sehen ist. Zwei Laternen auf prachtvollen Pfeilern halten zu beiden Seiten des Denkmals Wache. Wem gebührt so ein nobles Monument? Und aus welchem Grund wurde es errichtet?
Es ist ein Denkmal für den viktorianischen Bildhauer Edward Onslow Ford, dessen Werk bis heute überdauert. Das Wer ist damit geklärt. Ich aber fand das Warum immer besonders ergreifend. Der Grund dafür, dass Onslow Fords auf so eindrucksvolle Weise gedacht wird, ist das »einnehmende Wesen«, das ihn auszeichnete, wodurch er bei seinen Studierenden und bei anderen Bildhauer*innen so beliebt war, dass sie eine erhebliche Summe aufbrachten, von der man ihm nach seinem Tod im Jahre 1901 dieses große Denkmal errichtete. Die im Ford-Archiv in der Henry Moore Foundation aufbewahrten Kondolenzbriefe an seine Witwe bezeugen seine große Freundlichkeit. Die Inschrift auf dem Denkmal lautet: »Errichtet von seinen Freunden und Bewunderern. Dir selbst sei treu.«
Aus der Geschichte von Onslow Ford, dem es offenbar gelang, sich selbst treu zu bleiben, lässt sich einiges lernen. Erstens zeigt sie, dass wir Freundlichkeit durchaus zu schätzen wissen – in außergewöhnlichen Fällen so sehr, dass wir denen, die sie verkörpern, Denkmäler errichten. Zweitens zeigt sie jedoch, dass wir sie vielleicht nicht genug zu schätzen wissen. Verglichen mit den Beatles ist Onslow Fords langfristige Wirkung auf unsere Kultur relativ gering, vermutlich wird er trotz des ihm errichteten Monuments bald weitgehend vergessen sein, wohingegen man sich an die Beatles wohl noch in Jahrzehnten (oder gar Jahrhunderten?) erinnern wird. Genie und Erfolg werden zu Recht verehrt. Ich plädiere mitnichten dafür, weniger viel auf diese Qualitäten zu geben, nur dafür, der schlichteren Tugend der Freundlichkeit mehr Anerkennung zu zollen, wie Onslow Fords Freund*innen es taten.
In diesem Geiste plädiert Miteinander dafür, Freundlichkeit ernster zu nehmen und ihr einen größeren Wert beizumessen. Wir sind freundlicher, als wir manchmal meinen, könnten aber noch freundlicher sein – mit enormem Nutzen für unsere eigene psychische Gesundheit und unser eigenes Wohlergehen ebenso wie für die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Umwelt. Unter Einbeziehung neuester psychologischer Erkenntnisse aus aller Welt und mit Blick auf eine neue, in ihrer Art einmalige Studie werde ich darlegen, dass Freundlichkeit nicht nur anderen hilft, sondern auch uns selbst.
Freundlich zu sein ist allerdings nicht immer leicht. Der derzeitige Zustand der Welt bringt es mit sich, dass wir uns selbst und anderen mit Härte begegnen. In Schulen, Universitäten und am Arbeitsplatz geht es in mancher Hinsicht freundlicher zu als ehedem. Die Zeiten, in denen es jemandem nachgesehen wurde, der eine Schreibmaschine auf einen Kollegen warf (als ich neu in der Nachrichtenredaktion eines Radiosenders war, berichteten ältere Kolleg*innen mir von solchen Vorkommnissen), sind vorbei. Die Zeiten, in denen Kinder mit dem Rohrstock geschlagen wurden, wenn sie ihren Stundenplan vergessen hatten, ebenso. Quer durch die Gesellschaft hindurch stehen persönliche Leistungen und individuelle Erfolge jedoch nach wie vor hoch im Kurs, häufig errungen auf Kosten anderer Menschen und manchmal durch eine Kultivierung von Härte und Rücksichtslosigkeit. Noch immer sind wir anfällig für die Idee, wer freundlich ist, sei schwach, und die schwächere Person ziehe den Kürzeren. Diese Vorstellung werde ich anfechten, gestützt auf umfangreiche Belege dafür, dass wir alle von mehr Kooperation und Mitgefühl profitieren und dass Freundlichkeit und Empathie mit Sicherheit kein Hindernis für Erfolg oder auch nur Anerkennung sind. Im Gegenteil, je mehr Freundlichkeit es gibt, desto mehr wird die Welt davon profitieren.
Ich werde mich auch der kniffeligen Frage widmen, wie sich Freundlichkeit eigentlich definieren lässt.
Wie viele dieser Aussagen treffen beispielsweise auf Sie zu?
– Ich finde es richtig, jeder Person eine Chance zu geben.
– Mir fällt es nicht schwer zu verzeihen.
– Ich teile Dinge mit anderen, die ich lieber für mich behalten möchte.
– Ich habe eine Person mit einer freundlichen Geste überrascht.
– Ich lächle Fremden zu.
– Ich habe etwas getan, was mir schwerfiel, um einer befreundeten Person zu helfen.
Grämen Sie sich nicht, wenn Sie sich nicht mit jeder dieser Aussagen identifizieren können. Sie stehen nur beispielhaft für freundliche Handlungen. Vielleicht neigen Sie eher zu Toleranz und Empathie als dazu, sich lange im Voraus zu überlegen, womit Sie Ihre Freundlichkeit zum Ausdruck bringen können oder wie Sie vermeiden, als unfreundlich zu gelten. Wahrscheinlich trafen all diese Aussagen schon manches Mal auf Sie zu, andere Male jedoch nicht. Sie sind bestimmt ein freundlicher Mensch, nur halt nicht andauernd, und Sie zeigen Ihre Freundlichkeit zu verschiedenen Zeiten auf unterschiedliche Weise.
Sehen Sie, freundlich zu sein ist nicht einfach. Es ist auch nicht stets ein und dasselbe, sondern hat viele Facetten, ist begrifflich schwer zu fassen und wird häufig missverstanden.
Ich habe einmal den Witwer einer herausragenden Wissenschaftlerin vor den Kopf gestoßen, als ich sagte, von den wenigen Malen, die ich seiner Frau begegnet sei, wisse ich, was für ein netter Mensch sie gewesen sei. Von meiner Seite war es als echtes Kompliment gemeint, er aber empfand das Lob als plump und gönnerhaft, als Schmälerung der beruflichen Erfolge seiner Frau. Man kann seine Reaktion nachvollziehen, insbesondere angesichts habitueller Abwertungen der Leistungen von Frauen auf traditionell männlichen Gebieten. Schade war es trotzdem – ein Beispiel dafür, dass Freundlichkeit in unserer Kultur unterschätzt wird. Ich würde gern in einer Welt leben, in der es als das Beste gilt, über eine Person sagen zu können, dass sie freundlich war.
Sieben Schlüssel zur Freundlichkeit
In diesem Buch untersuche ich sieben Wege zur Freundlichkeit, von denen einige für Sie auf der Hand liegen mögen, manche aber auch nicht. Keiner davon ist wichtiger als ein anderer, sie ergeben vielmehr zusammen ein großes Bild von Freundlichkeit in all ihren Facetten, das wir in den Blick nehmen müssen, um die Welt insgesamt freundlicher zu machen.
Im ersten Kapitel betrachte ich zunächst die – häufig unterschätzte – Tatsache, dass es bereits eine ganze Menge Freundlichkeit auf der Welt gibt. Ja, Sie haben richtig gelesen. Das Menschliche überwiegt gegenüber dem Unmenschlichen – wir müssen nur die Augen öffnen und dürfen uns nicht von dem Negativen, das in den Nachrichten und in den sozialen Medien zwangsläufig vorherrscht, täuschen lassen. Im zweiten Kapitel zeige ich, dass Ihre Freundlichkeit gegenüber anderen Ihnen genauso guttut wie der Person, die sie erwiesen bekommt. Genau genommen liegt hier sogar eine Win-win-win-Situation vor – für uns als Individuen, für andere und für die Welt als Ganze. In diesem und im darauffolgenden Kapitel zeige ich, dass Menschen, die freundlich handeln, von ihrer Freundlichkeit profitieren – und kann Sie hoffentlich davon überzeugen, dass daran nichts verkehrt ist und dass die Vorteile, die Sie davon haben, die Bedeutung Ihrer Freundlichkeit für andere nicht schmälern. Dann widme ich mich in einem kleinen Abstecher einem der großen Themen unserer Zeit: den sozialen Medien. In dem »halben« Kapitel »Die sozialen Medien sind voll von Freundlichkeit (okay, nicht voll davon, aber es gibt sie)« erörtere ich, dass, wie viele Beleidigungen und Hass man auf Twitter, Facebook und anderen Plattformen auch antreffen mag, das nur die halbe Geschichte ist – sogar in diesen Haifischbecken gedeihen Freundlichkeit und Positives. Im nächsten ganzen Kapitel widme ich mich ausführlicher der Frage, ob man freundlich und im Leben ein Gewinner sein kann. Es ist hoffentlich kein Spoiler, wenn ich schon jetzt sage, dass die Antwort eindeutig JA lautet. Ich werde zeigen, dass Freundlichkeit weder Laschheit noch Schwäche ist; sie kann sogar unsere verborgene Stärke sein.
Dann schließt sich die schwierige Frage nach dem Wir beim Freundlicher-Sein an: Der fünfte Weg zur Freundlichkeit beschreibt, dass wir uns, um anderen freundlich zu begegnen, die Mühe machen sollten, uns in die Meinungen und Sichtweisen anderer einzufühlen, jedoch auch im richtigen Augenblick. Es gibt eine Zeit und einen Ort für Empathie. Im sechsten Kapitel führe ich aus, dass wir uns nicht auf die zufälligen kleinen guten Taten beschränken müssen, von denen wir so häufig hören. Wir können in puncto Freundlichkeit getrost klotzen. Den meisten von uns wird nie großer Mut abverlangt werden, zum Heroismus fähig sind wir aber alle und können uns gedanklich schon einmal darauf vorbereiten, in einer vermutlich einmaligen Gelegenheit ein Leben zu retten. Sich wahrhaft außergewöhnliche Beispiele von Freundlichkeit vor Augen zu führen kann uns helfen, im Alltag freundlicher zu sein. Das siebte Kapitel bildet insofern eine Ausnahme, als es hier nicht darum geht, freundlich zu anderen, sondern zu uns selbst zu sein. Ich werde darlegen, dass Selbstfürsorge und Mitgefühl mit sich selbst nicht auf direktem Wege zu Selbstgefälligkeit und Egoismus führen, sondern, in maßvollen Dosen angewandt, erheblichen Nutzen für unsere psychische Gesundheit haben. Wir müssen dahin kommen, unsere Schwächen zu akzeptieren und uns selbst mit Sanftheit und Nachsicht zu begegnen, denn das dient unserem Wohlergehen und versetzt uns in die Lage, auch anderen besser zur Seite zu stehen.
Ich fasse die einzelnen Aspekte in einem Rezept für Freundlichkeit zusammen und gebe Tipps, wie man die vielfältigen Ergebnisse der Forschung in die Tat umsetzt, um ein freundlicherer Mensch zu werden und eine freundlichere Welt zu schaffen. Dort können Sie prüfen, welche Anregungen für Ihr Leben taugen. Betrachten Sie sie als Denkanstoß für die Entwicklung eigener Ideen für freundliches Verhalten in Ihrem Alltag.
Das ganze Buch stützt sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse und bewährte Strategien, veröffentlicht in einschlägigen Fachzeitschriften. In den letzten beiden Jahrzehnten haben sich erfahrene Wissenschaftler*innen einer Thematik angenommen, die von der Psychologie und der Neurowissenschaft zuvor vernachlässigt wurde. Ich betone das, weil es ein Leichtes wäre, ein Buch über Freundlichkeit als sentimentales Geschwätz abzutun, ihm mangelnde Präzision vorzuwerfen. Das Gegenteil trifft zu.
Der Freundlichkeitstest
Außerdem gehe ich ausführlich auf aktuelle Erkenntnisse der weltgrößten Studie ihrer Art zu Freundlichkeit ein – auf den Freundlichkeitstest, den ich mit Kolleg*innen der University of Sussex, einer in der Freundlichkeitsforschung führenden Institution, erarbeitet habe. Leiter des Forschungsprojekts war Professor Robert Banerjee, manchmal auch scherzhaft (zumindest von mir) »Professor der Freundlichkeit« genannt. In den von mir moderierten Sendungen und Podcasts der BBC – All in the Mind, ausgestrahlt auf BBC Radio 4, und Health Check, ausgestrahlt vom BBC World Service – habe ich die Studie der Öffentlichkeit vorgestellt.
In diesem Freundlichkeitstest baten wir die Teilnehmenden, online eine Reihe von Fragebögen auszufüllen und Aussagen zu ihrer Persönlichkeit sowie zu ihrer psychischen Gesundheit zu treffen, etwa dazu, wie freundlich sie im Alltag sind oder welchen Anteil eines unerwarteten Geldregens sie eventuell abzugeben bereit wären. Wir waren überwältigt von der Zahl der Personen, die zum Mitmachen bereit waren – 60227 Teilnehmende aus 144 Ländern. Die Analyse dieses bisher einmaligen Datensatzes vermittelt uns ein tieferes Verständnis dafür, wie Freundlichkeit im täglichen Leben aussieht und was uns daran hindert, noch freundlicher zu sein.
Zu Beginn veranschaulichte der Test aufs Schönste, wie viele Ausdrucksformen von Freundlichkeit es überhaupt gibt. Als Antwort auf die Frage, auf welche Weise sie freundlich waren, nannten die Teilnehmenden der Studie eine Fülle von Beispielen. Die Top Five waren jedoch diese:
Die fünf am häufigsten genannten Arten von Freundlichkeit
1. Ich helfe anderen, wenn sie darum bitten.
2. Ich habe nichts dagegen, Freund*innen einen Gefallen zu tun.
3. Ich halte anderen die Tür auf.
4. Ich helfe Fremden, die etwas fallen gelassen haben, ihre Sachen aufzuheben.
5. Ich bin betroffen, wenn andere Menschen weniger Glück haben als ich.
Verblüffend ist, wie alltäglich, ja banal diese Akte der Freundlichkeit sind. Übermäßige Großzügigkeit oder gar Selbstaufopferung ist dafür nicht erforderlich. »Ich habe nichts dagegen, Freund*innen einen Gefallen zu tun«, klingt sogar ein bisschen widerwillig. Doch solche kleinen freundlichen Gesten passieren ständig und oft unbemerkt überall um uns herum. Jede für sich mag ein Tropfen sein, zusammen ergeben sie jedoch einen Ozean. Daher ist es vielleicht nicht überraschend – und trotzdem ermutigend –, was durch die Studie nachgewiesen werden konnte: nämlich dass Freundlichkeit ein alltägliches und weitverbreitetes Phänomen ist. Drei Viertel der Teilnehmenden gaben an, Gefälligkeiten werden ihnen von engen Freund*innen oder von der Familie »sehr oft« oder »fast andauernd« erwiesen. Neunundfünfzig Prozent der Teilnehmenden hatten erst am Vortag einen Akt der Freundlichkeit erlebt, ein Viertel davon sogar in der letzten Stunde.
In dem Fragebogen hatten wir die Testpersonen gebeten, eine Tabelle auszufüllen, mithilfe derer wir ihren Grad an Freundlichkeit bestimmen konnten. Wir mussten uns dabei natürlich darauf verlassen, dass die Teilnehmenden wahrheitsgemäße Angaben zu den Gefallen machten, die sie anderen tun; die Bandbreite der erhaltenen Antworten lässt jedoch darauf schließen, dass Menschen ebenso bereitwillig zugeben, nicht besonders freundlich zu sein, wie es für den umgekehrten Fall zutrifft. Ich glaube also, wir können die Leute beim Wort nehmen und davon ausgehen, dass unser Bewertungssystem ein solides Fundament hat.
Die Ergebnisse sind interessant, vor allem im Hinblick darauf, zu welchen Gruppen die Teilnehmenden gehören, die überdurchschnittlich hohe Werte auf der Freundlichkeitsskala erreichten. Erstens ist die von Frauen und Gläubigen berichtete Anzahl der Gefallen, die sie anderen tun, gegenüber dem Durchschnitt leicht erhöht. Größere Unterschiede lassen sich jedoch auf die jeweilige Persönlichkeit zurückführen. Wer extrovertiert ist, offen für neue Erfahrungen und umgänglich, verhält sich öfter freundlich und erfährt häufiger auch mehr Freundlichkeit. Persönliche Wertmaßstäbe sind ebenfalls ein wichtiger Faktor, noch wichtiger als religiöser Glaube. Diejenigen, die von sich sagen, Nächstenliebe und Universalismus seien für sie wichtige Werte, sind im Durchschnitt freundlicher als diejenigen, für die Leistung und Macht zählen.
Doch keine Angst, wenn Sie ehrgeizig und zurückhaltend sind, reizbar und skeptisch. Das bedeutet nicht, dass Sie in puncto Freundlichkeit automatisch schlecht abschneiden. Unsere Befunde geben Durchschnittswerte für große Gruppen an, es kann also durchaus sein, dass ein mürrischer, introvertierter Mensch, der nach Erfolg strebt und nicht an Gott glaubt, dennoch einen hohen Freundlichkeitswert erzielt. (Vielleicht kennen Sie solche Menschen?) Die Durchschnittswerte liefern trotzdem wertvolle Hinweise dazu, wer, auf Gruppenebene betrachtet, wahrscheinlich freundlich ist.
Wir baten die Teilnehmenden am Freundlichkeitstest auch, Wörter zu nennen, die sie mit Freundlichkeit verbinden. Hier die Top Five:
Top Five der Wörter, die Menschen mit Freundlichkeit verbunden haben
1. Empathie
2. Fürsorglichkeit
3. Helfen
4. Zuvorkommenheit
5. Mitgefühl
Natürlich sind diese Wörter nicht sonderlich überraschend, sie entsprechen sogar ziemlich genau dem Begriff von Freundlichkeit in der einschlägigen Forschung. In der akademischen Welt nehmen Debatten über exakte Terminologie und über Definitionen allerdings stets viel Raum ein. Ja, sogar diejenigen, die sich wissenschaftlich mit Freundlichkeit beschäftigen, finden reichlich Diskussionsstoff, vor allem bei der Frage, was denn nun reine Freundlichkeit ausmacht.
Hier ist der Freundlichkeitstest wieder hilfreich, denn er erlaubt eine Art der Annäherung an den Begriff, die auf »den Menschen« vertraut. Es gehört viel, viel Freundlichkeit dazu, den Mut aufzubringen, einem Gegenüber etwas zu sagen, was für jenes schwer erträglich ist, ihm auf lange Sicht aber hilft. Natürlich ist Freundlichkeit mit persönlichen Opfern verbunden, manchmal sogar mit Schmerz. Es gibt auch Fälle von reiflich erwogenem Altruismus wie zum Beispiel das Spenden einer Niere an eine fremde Person. Und dann ist da die spontane Eingebung, die geistesgegenwärtige, heroische Tat eines einzelnen Augenblicks, wenn unter hohem persönlichen Risiko ein Leben gerettet wird. Doch auch die im Test erfassten ganz alltäglichen Handlungen – die vielen Tausend Tassen Tee, die für andere gekocht wurden, die unzähligen eingelassenen Badewannen, die gemachten Komplimente, die verschickten Dankeskarten, die lächelnden Gesichter in Geschäften, die heruntergefallenen Fahrkarten, die ihren Besitzern zurückgegeben werden – sind nach allgemeiner Auffassung Gesten der Freundlichkeit und sollten als solche gewürdigt werden.
In der Praxis überschneiden sich die verschiedenen Arten von Freundlichkeit oft. Für eine gute Tat kann Mut oder Dankbarkeit ausschlaggebend sein, Verständnis oder Liebe, Fürsorge oder Mitgefühl – oder eine Kombination aller Motive. Fremden gegenüber freundlich zu sein ist in gewissem Sinne immer mit einem Opfer verbunden, bereitet dem, der so handelt, aber auch Freude. Freundlich zu sein kann heißen, dass man erst aktiv wird, wenn sich die Gelegenheit bietet, oder dass man aktiv nach Gelegenheiten sucht, anderen etwas Gutes zu tun – beispielsweise durch ehrenamtliche Arbeit. Manchmal bedeutet Freundlichkeit, den Standpunkt des anderen wahrzunehmen und Verständnis für sein Handeln aufzubringen, ein andermal, dass man sich einmischt und einer anderen Person sagt, dass sie durch ihr Handeln andere verletzt. Manchmal muss man grausam sein, um freundlich zu sein, häufiger aber ist Sanftheit gefragt. Und obwohl es den Anschein hat, als könnten wir nicht freundlich genug sein, gilt das Sprichwort, dass man es auch zu gut mit den Leuten meinen kann. Freundlichkeit rührt nicht daher, dass wir jedem Verhalten mit Nachsicht begegnen oder stets die andere Wange hinhalten.
In diesem Buch betrachte ich freundliches Handeln als etwas, das mit der Absicht geschieht, einer anderen Person Gutes zu tun. Beachten Sie das Wort »Absicht«, denn wir alle erinnern uns gewiss an Situationen, in denen wir es gut meinten, unsere Gefälligkeit aber nicht die gewünschte Wirkung erzielte.
Wir erbaten uns von den Teilnehmenden aber nicht nur Angaben zu Gefallen, die sie anderen getan haben, sondern auch zu Situationen, in denen sie Akte von Freundlichkeit beobachten konnten.
Top Five der Situationen, in denen Menschen freundliches Handeln beobachten
1. Zu Hause
2. In medizinischen Einrichtungen
3. Am Arbeitsplatz
4. Im Grünen
5. In Geschäften
Am seltensten, sagten uns die Teilnehmenden der Studie, erlebten sie Freundlichkeit im Netz, was Sie vielleicht nicht überrascht angesichts von Häme und Hass, die wir aus den sozialen Medien kennen (wenngleich man dort natürlich auch auf Freundlichkeit und Unterstützung trifft – mehr dazu in Kapitel 3 ½). Es überraschte mich jedoch, dass die Teilnehmenden angaben, in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf der Straße kaum einmal Freundlichkeit zu erleben. Der Grund für meine Überraschung ist, dass ich freundliche Gesten, die ich in der Öffentlichkeit beobachte, in einem Tagebuch festhalte und immer wieder beobachte, dass Kinderwagen Treppen hinaufgetragen, Älteren ein Sitzplatz angeboten und Aus-der-Tasche-Gefallenes zurückgegeben wird. (Parallel zu weiteren Ergebnissen des Freundlichkeitstests werde ich übrigens im ganzen Buch auszugsweise aus meinem »Freundlichkeits-Tagebuch« zitieren und lege Ihnen ans Herz, selbst so ein Tagebuch zu führen.)
In unserer Studie baten wir die Teilnehmenden auch, sich an das letzte Mal zu erinnern, als eine Person ihnen und als sie einer Person einen Gefallen getan haben. Ich muss zugeben, dass mir beim Durchklicken vollgeschriebener Fragebögen in der Regel nicht gerade das Herz aufgeht, in diesem Fall jedoch war ich tief bewegt und gebe zu, dass mir gelegentlich sogar Tränen in die Augen traten, als ich durch Tausende von kurzen Einträgen scrollte, in denen jedes Mal ein Moment der Freundlichkeit zwischen zwei Menschen geschildert wurde.
Es ist belegt, dass wir ein warmes Gefühl verspüren, wenn wir nett zu jemandem sind – diese Wärme ist bei Gehirnscans sichtbar, und ich spürte sie bereits körperlich, als ich nur von den vielen freundlichen Gesten las. Ich füge zwischen den einzelnen Kapiteln eine Auswahl aus den uns übermittelten Sätzen ein, um auch Sie an diesem ermutigenden Erlebnis teilhaben zu lassen.
Nehmen ist so gut wie geben
Bevor ich diese Einleitung abschließe, möchte ich noch auf ein Gebiet hinweisen, das beim Nachdenken über Freundlichkeit zuweilen zu kurz kommt. Vielleicht ist es zu offensichtlich und eine Finanzierung deshalb schwerer aufzutreiben, aber die Forschung wendet weniger Zeit für den Nutzen einer guten Tat auf Empfänger*innenseite auf als für den Nutzen auf der Geber*innenseite. Aus eigenem Erleben wissen wir aber, dass sich die Person, der jemand etwas Gutes tut, umsorgt, geschätzt und wahrgenommen fühlt, vor allem verspürt sie jedoch Verbundenheit zu anderen Menschen. Diese Verbindung hat großen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Die psychologische Forschung zeigt, was Freundlichkeit und Empathie für die kindliche Entwicklung bedeuten, für die Beziehungen, die wir in unserem Leben eingehen, und für die Art und Weise, wie wir schwierige Lebenssituationen bewältigen.1 Freundlichkeit hat eine positive Wirkung auf uns. Hier sind nur einige wenige Beispiele:
– Erwachsene und Kinder empfinden ihre Beziehungen als befriedigender, wenn ihre Partner*innen oder Eltern in der Lage sind, Dinge auch von ihrem Standpunkt aus zu betrachten.
– Ebenso haben Menschen, die freundliche Gefühle für die Person hegen, mit der sie zusammen sind, auch in späteren Jahren engere, vertrauensvollere Beziehungen.
– Empathische Menschen neigen weniger dazu, zwanghaft zu grübeln, wenn sie unglücklich über eine Handlung der Person sind, mit der sie ihr Leben teilen. Sie können auch besser verzeihen.
– Sollen Studierende ihre Lehrkräfte bewerten, rangieren für sie Mitgefühl und Rücksichtnahme neunmal höher als fachliche Kompetenz.
– Krebskranke Kinder empfinden subjektiv weniger Schmerz, wenn ihre Eltern einfühlsam auf sie eingehen.2
Es versteht sich zwar von selbst, muss aber trotzdem gesagt werden: Wir mögen es, wenn andere freundlich zu uns sind.
Eine Geschichte von zwei Journalisten
Es ist 20 Jahre oder noch länger her, dass zwei berühmte Journalisten ungefähr zur gleichen Zeit ihren Ausstand gaben. Der eine veranstaltete eine große Party in einem Londoner Club, bei der teurer Wein und schickes Essen kredenzt wurden, alles bezahlt von seinem Arbeitgeber. Hunderte Menschen nahmen teil, darunter alles, was Rang und Namen hatte. In Reden wurden die Großtaten des Journalisten gerühmt, die zahlreich waren, doch in den kleinen Grüppchen, die später überall im Raum standen, tauschten die Gäste Geschichten darüber aus, wie schrecklich dieser Mann als Kollege gewesen war.
Der andere Journalist feierte seinen Abschied in wesentlich bescheidenerem Rahmen. Es gab eine Bar, an der die Getränke selbst bezahlt wurden, und die Gäste beteiligten sich an den Kosten des Buffets. Hohe Tiere waren nicht anwesend, doch obwohl die Feier an einem Samstagabend stattfand, kamen viele Angestellte in den Zwanzigern, Vorzimmerdamen und Reinigungskräfte vorbei, um den Sechzig-plus-Kollegen gut gelaunt in den Ruhestand zu verabschieden. In den Gesprächen des Abends ging es nicht um die beruflichen Großtaten dieses Mannes, sondern darum, was für ein durch und durch netter Mensch er gewesen war.
Ich weiß, welchen Ausstand ich, wenn die Zeit gekommen ist, lieber feiern würde, und ich hoffe, Sie werden sich durch die Lektüre dieses Buchs wünschen, vor allem als freundlicher Mensch im Gedächtnis zu bleiben. Denn wenn es so kommt, werden Sie – als großzügiger und freundlicher Mensch – auf ein glücklicheres und erfüllteres Leben zurückblicken, was übrigens kein Grund dafür ist, nicht auch andere Ziele anzustreben. Sie können ein*e Spitzenjournalist*in sein – sogar ein berühmter Rockstar – und zugleich freundlich zu anderen sein. Freundlichkeit hemmt Sie nicht, sie macht Sie frei.
In einer Zeit hochpolarisierter öffentlicher Meinung, in der sogar der Hashtag #bekind in sozialen Medien gelegentlich als Waffe eingesetzt wird und in der die Welt mit ernsten Bedrohungen konfrontiert ist, mit bewaffneten Konflikten, einer Flüchtlingskrise, dem Klimawandel und künftigen Pandemien, ist engere Kooperation auf globaler, regionaler und lokaler Ebene dringend erforderlich. Und da Angstzustände, Stress und Depressionen zunehmen, müssen wir unser Augenmerk auf persönlicher Ebene stärker auf Mitgefühl und Fürsorglichkeit lenken. Doch bevor dies alles geschehen kann, müssen wir wieder begreifen, welchen Stellenwert Freundlichkeit hat, und sie neu schätzen lernen. Sie hilft uns, Bündnisse mit anderen zu schmieden. Sie sollte in unserem Leben nicht nebensächlich sein, ist sie doch ein Grundzug der menschlichen Natur. Miteinander wird daher hoffentlich einige Rätsel der Freundlichkeit lösen und Mittel und Wege aufzeigen, wie wir alle freundlicher zueinander, zur Welt und zu uns selbst sein können.
Der letzte Gefallen, den mir eine Person getan hat
Der Freundlichkeitstest
Eine Freundin hat mich in einem Post auf Facebook getaggt, in dem es hieß, ich sei der pure Sonnenschein – das hat mich sehr gefreut.
Ich war mit meinem Hund bei einem Hundewettbewerb, und als ich dort Mühe hatte, meinen Pavillon aufzubauen, weil es sehr windig war, eilten mir drei Personen, alles Frauen, zu Hilfe.
Meine erwachsene Tochter hat mir für die Hochzeit meiner Nichte die Fußnägel lackiert.
Mein Mann hat das von unserem neuen Welpen im Flur hinterlassene Pipi beseitigt, obwohl wir ausgemacht hatten, dass ich das tun würde.
Ich konnte zu einer mit Freund*innen vereinbarten Woche Urlaub in Cornwall nicht mitkommen. Sie haben mir von dort eine Tüte mit Leckereien mitgebracht. Schöne Idee.
Meine Freundin hat mich geküsst. Und ich bin wirklich ein ziemliches Ekel.
Mein Vogelhäuschen war kaputtgegangen, und ein Freund hat, ohne einen Ton zu sagen, für mich aus altem Holz ein neues gebaut, es gebeizt und gestrichen.
Eine Freundin hat mir zugehört, als ich ausführlich von einem komplizierten Problem erzählt habe, und hat mir mit Ratschlägen beigestanden.
Jemand hat ein Tor für mich aufgehalten, sodass ich schnell durchlaufen konnte.
1Es gibt mehr Freundlichkeit auf der Welt, als Sie denken
Vor ein paar Jahren stolperte eine Freundin über den Roller, den ihr zwei Jahre alter Sohn auf der Straße liegen gelassen hatte, und schnitt sich dabei so heftig, dass sie aufschrie vor Schmerz. Sie musste sich die Wunde später im Krankenhaus nähen lassen. Ein Passant, ein Erwachsener, eilte ihr zu Hilfe, ihr Sohn jedoch nahm keinerlei Notiz von ihr. Dass sie Schmerzen hatte, interessierte ihn offenbar nicht. Sein Wutanfall ging fast ohne Unterbrechung weiter.
Geschichten dieser Art lassen uns vermuten, Kleinkinder wären egoistische kleine Ungeheuer, wie sehr wir sie auch lieben. Es hat häufig den Anschein, als interessierten sie sich schlicht nur für sich selbst, und es gibt ja auch Belege dafür, dass die Kleinkindzeit der Lebensabschnitt ist, in dem wir am aggressivsten sind und am stärksten zur Gewalt neigen. Mit zunehmendem Alter lässt das aber bald nach, sodass es in der Adoleszenz deutlich friedfertiger zugeht.1 Es hat jedoch einen guten Grund, weshalb Kleinkinder den Schmerz anderer nicht beachten oder sogar selbst verursachen. Wie tausendfach in psychologischen Studien nachgewiesen, tun sich Kinder in diesem frühen Alter schwer, den Standpunkt anderer wahrzunehmen, sogar wenn es sich dabei um die eigene Mutter handelt. Das liegt daran, dass ihr Gehirn noch nicht entwickelt genug ist und ihre kognitiven Fähigkeiten noch beschränkt sind. Es ist nicht ihre Schuld, dass sie auf sich selbst fixiert sind. Wir sollten jedoch auch nicht glauben, dass kleine Kinder völlig unfähig zur Freundlichkeit sind.
Die gar nicht so schrecklichen Kleinen
Gesehen haben wir das alle schon: ein Zweijähriger, der nicht teilen will, sein Spielzeug an die Brust drückt, fest entschlossen, dass kein anderes Kind damit spielen darf. Es dauert seine Zeit, bis Kinder gelernt haben, »schön zu teilen«, ein Charakterzug, den ja nicht einmal alle Erwachsenen besitzen. Etwas sein eigen zu nennen ist ein starkes Gefühl, in der Psychologie bekannt als Besitztumseffekt. Wir möchten an dem festhalten, was uns bereits gehört, sträuben uns, es wegzugeben oder auch nur einzutauschen.
In meinem Buch Mind Over Money habe ich von einigen aufschlussreichen Experimenten berichtet, mit denen sich dieser Effekt messen lässt.2 Geben Sie beispielsweise jemandem einen Kaffeebecher, wohlgemerkt gratis, werden Sie feststellen, dass der Beschenkte den Becher äußerst ungern an Sie zurückverkauft, es sei denn, Sie zahlen ihm dafür mehr als den ursprünglichen Wert, auch wenn er ihn eigentlich umsonst bekam. Haben und nicht mehr hergeben: das ist vielfach unsere Devise.
Wenn es sich schon bei Erwachsenen so verhält, wie ist es dann erst bei Kleinkindern? So schlimm steht es um das Abgeben und Teilen in der Phase nach dem zweiten Lebensjahr aber gar nicht. Zumindest zeigt das eine von Julia Ulber und ihrer damaligen Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig durchgeführte Untersuchung.
Ulber händigte zu Beginn zwei Zweijährigen ein Tütchen Murmeln aus. Den Kindern wurde auch eine verschlossene Box mit einem Loch darin gezeigt – in der Box lag ein Xylophon. Wurde eine Murmel durch das Loch in der Box fallen gelassen, landete sie auf dem Xylophon und erzeugte, wie von den Forschern vorgeführt, ein lautes Klimpern – ein Geräusch, wie kleine Kinder es besonders mögen. Sie meinen, ein solches Szenario könne doch nur in Tränen enden? Die Zahl der Murmeln war schließlich begrenzt, und welches kleine Kind würde nicht alle an sich reißen, um maximales Xylophongeklimper zu erzeugen? Die Ergebnisse waren jedoch ermutigender, als Sie vielleicht glauben. Sicher, in 19 Prozent aller Testpaarungen riss ein Kind alle Murmeln an sich und brachte das andere Kind zum Weinen oder löste Wut in ihm aus. Doch das war nicht die ganze Geschichte und auch nicht die entscheidende Erkenntnis. Denn fast die Hälfte der Zeit teilten die Kinder die Murmeln – und jetzt kommt’s – zu gleichen Teilen unter sich auf.3
Manchen Eltern mag das vorkommen wie der Stoff, aus dem Märchen gemacht sind. Doch die Studie erbrachte nicht nur dieses Ergebnis, es wurde sogar noch viel besser. Als das Experiment mit unfairen Parametern stattfand und ein Kind zu Beginn mehr Murmeln bekam als das andere, gab ein Drittel der Kinder dem anderen, benachteiligten, Kind sogar einige seiner Murmeln ab.
Ein bemerkenswertes Ergebnis. Und doch sind Ulbers Funde keine Ausreißer. Kleinkinder können, wie sich herausstellt, nicht nur freundlich sein, sondern freuen sich auch, wenn sie anderen helfen können – eine Reaktion, die, wie ich mehrfach im Buch erörtern werde, den Akt der Freundlichkeit nicht schmälert, sondern verstärkt.
Stellen Sie sich das nächste Experiment bildlich vor. Ein Wissenschaftler hängt Wäsche auf eine Leine und benutzt dafür Wäscheklammern. Derweil spielt ein kleines Kind, es rollt Murmeln in eine Röhre, was ein lustiges Geräusch erzeugt. Zu gegebener Zeit hat das Kind keine Murmeln und der Wissenschaftler keine Klammern mehr, woraufhin er eine Box vom Fensterbrett nimmt und so tut, als bekäme er den Deckel nicht auf. Das Kind schaut zu. Die Box bleibt auf dem Boden liegen, der Deckel ist noch immer verschlossen. Das Kind, nun ohne Murmeln, die es ablenken, beginnt, die Box zu untersuchen. Es testet den Deckel, den es natürlich – wie geplant – ohne Weiteres abnehmen kann. Darin findet es einen von drei Gegenständen: ein nutzloses Stück Plastik, eine Murmel oder eine Wäscheklammer.
All diese Abläufe sind auf Film festgehalten, damit die Arbeitsgruppe Mimik und Körpersprache der kleinen Testpersonen analysieren kann. Und in dieser Phase des Experiments wird es besonders interessant, denn es gibt eindeutige und messbare Unterschiede in der Reaktion der jeweiligen Kinder, abhängig davon, was sie in der Box vorfanden. War es das nutzlose Stück Plastik, reagierten die Kinder gleichgültig bis enttäuscht. Der Fund einer Murmel machte ein Kind natürlich viel glücklicher. Fanden die Kinder in der Box allerdings die Wäscheklammer, wirkten sie (mit Ausnahme eines Kindes) am zufriedensten. Die Kamerabilder zeigen, wie sie mit stolzgeschwellter Brust und einem Lächeln, noch strahlender als nach dem Fund der Murmel, zu dem Wissenschaftler gehen. Sie sind, das ist deutlich erkennbar, begeistert von einem Fund, der ihnen selbst gar kein besonderes Vergnügen bereitet, dem Erwachsenen, wie sie beobachtet haben, aber beim Aufhängen der Wäsche hilft. Ich gestehe, dies ist eins meiner Lieblingsexperimente in der Kinderpsychologie, da sich hier die noch sehr kleinen Kinder sehr liebenswürdig und unverkennbar freundlich verhalten.4
Kleine Samariter
Entgegen landläufiger Meinung können kleine Kinder freundlich sein, anderen helfen oder mit ihnen teilen. Und sogar in noch jüngeren Jahren sind Kinder erwiesenermaßen bereits fähig zu einer weiteren Art freundlichen Verhaltens – zum Trösten.
Gezeigt hat das eine Studie aus den Neunzigerjahren, durchgeführt von der Psychologin Carolyn Zahn-Waxler am National Institute of Maryland. Sie hat Mütter instruiert, ihren ein bis zwei Jahre alten Kindern vorzuspielen, es ginge ihnen nicht gut, und danach die beobachteten Reaktionen der Kinder festzuhalten. (Stichprobenartig wurden einige Szenen videoüberwacht, um zu verhindern, dass wohlwollende Mütter ihren Kindern übermäßiges Mitgefühl attestierten.) Die Mütter husteten oder rangen zehn Sekunden lang nach Luft. Oder sie täuschten vor, sie hätten sich am Fuß oder am Kopf gestoßen, sagten Au, rieben sich die Stelle oder gaben sich lustlos und saßen zehn Minuten lang seufzend da; oder aber – hochdramatisch! – sie täuschten zehn Sekunden lang vor, zu schluchzen. Ergänzend zu den im Experiment gewonnenen Daten hielten die Mütter auch fest, wie ihre Kinder sich bei ähnlichen Vorkommnissen im Alltag verhielten.
Carolyn Zahn-Waxler und die Mütter suchten Fälle, in denen die Kleinkinder ihre Mütter umarmten, tätschelten oder küssten oder, sofern sie bereits im sprechfähigen Alter waren, etwas Tröstliches oder Mitfühlendes sagten. Alternativ begannen einige Kinder aber auch ihrerseits zu quengeln oder zu schluchzen. Die Studie zeigte, dass über die Hälfte der Kleinkinder, die das erste Lebensjahr bereits überschritten hatten, eine irgendwie geartete freundliche Reaktion erkennen ließen, vornehmlich indem sie ihre Mütter umarmten oder tätschelten. Die Einjährigen ließen bei zehn Prozent der Male, die ihre Mütter traurig waren, Anteilnahme erkennen – kein großer Prozentsatz, aber doch beachtlich. Und hatten die Kinder das zweite Lebensjahr vollendet, reagierten sie in beeindruckenden 49 Prozent der Fälle mit Freundlichkeit.
Welche Schlüsse ziehen wir aus diesen Befunden? Erstens, dass schon Einjährige es verstehen, wenn ihre Mütter traurig sind, und erwiesenermaßen freundlich darauf reagieren können. Freundlichkeit ist allerdings nicht die Standardreaktion von Kindern dieses Alters. Denken Sie an meine Freundin mit der Verletzung nach dem Stolpern über den Roller. Es gab sogar Fälle, bei denen sich die Kleinen über den erkennbaren Kummer ihrer Mütter zu freuen schienen, vor allem wenn sie selbst die Ursache dafür waren. Doch auch das war nicht unbedingt ein Indiz für kindlichen Sadismus, da die gespielte Szene durch Übertreibungen der Mütter, so Zahn-Wexlers Vermutung, auch ins »Komische« gekippt sein konnte.5 Diese Videos, das muss ich zugeben, würde ich wirklich zu gern sehen.
Ein anderer einflussreicher Wissenschaftler, der sich für Altruismus bei Kleinkindern interessiert, ist Michael Tomasello, ebenfalls am Max-Planck-Institut tätig, der an einigen der weiter vorn genannten Studien beteiligt war. Bei einem anderen Experiment stellten er und ein Kollege fest, dass Kinder schon mit anderthalb für die erwachsene Person im Raum eine Schranktür öffnen, wenn sie sehen, dass sie einen Stapel Zeitschriften auf dem Arm trägt und deshalb die Tür nicht selbst öffnen kann.6 Die Kinder tun es sogar, wenn sie zuvor ein lustiges Spiel bekommen haben, das sie für einen Augenblick unterbrechen müssen, um zu helfen. Die kleinen guten Samariter gehen sogar so weit, dass sie über Hindernisse hinwegkrabbeln, die zuvor auf ihrem Weg deponiert worden sind, so entschlossen sind sie, der erwachsenen Person mit der Last auf den Armen behilflich zu sein.
In einem anderen von Tomasello und seinem Team durchgeführten Experiment erhielten kleine Kinder die Aufgabe, mit einer weiteren Person zusammen eine verschlossene Box zu öffnen, und machten die – verblüffende – Feststellung, dass 42 Prozent der Kleinen dabei halfen, wenn diese zweite Person erwachsen war, 75 Prozent jedoch dazu bereit waren, wenn es sich um ein weiteres Kind handelte.7 Kleine Kinder verstehen offenbar nicht nur, dass ein anderes Kind gleichen Alters eher Hilfe benötigt als ein erwachsener Mensch, sondern sie sind auch hilfsbereit, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, die sie bei Erwachsenen eher erhoffen dürfen. Ihre Gehirne sind noch nicht entwickelt genug für die kognitiven Schritte, die für das Erfassen des Begriffs der Reziprozität notwendig sind. Sie sind freundlich, weil sie einfach freundlich sind. Ihre Freundlichkeit ist fest verdrahtet und Teil des Schaltkreises Mensch, behauptet Tomasello. Auf ihn geht auch die Entdeckung zurück, dass sogar Schimpansen, die zwar von Menschen versorgt, jedoch in der Wildnis geboren wurden und die eher für ihre Aggression als für ihre Freundlichkeit bekannt sind, jemandem, den sie noch nie zuvor gesehen haben, einen für ihn unerreichbaren Gegenstand bringen, ohne als Gegenleistung dafür Bananen zu bekommen.
Tomasello bezeichnet Kleinkinder als »spontane Altruisten«. Liebenswürdig, wie sie sind, helfen sie, wenn sie das wollen, jedem. Erst im späteren Alter werden die Kinder wählerischer. Das ist aus evolutionärer Perspektive sinnvoll. Sind wir noch sehr klein, verbringen wir viel mehr Zeit mit unserer eigenen Sippe oder mit anderen Vertrauenspersonen und brauchen deshalb weniger auf der Hut zu sein. Werden wir älter, begegnen wir immer öfter Menschen, die nicht mit uns verwandt sind, und müssen entscheiden, zu wem wir freundlich sind und wem wir vertrauen können.
Kleine Kinder interessieren sich auch kaum dafür, welches Ansehen ihnen Freundlichkeit oder Unfreundlichkeit einträgt. Sie freuen sich natürlich, wenn sie von ihren Eltern gelobt werden, haben aber noch kein über den jeweiligen Augenblick hinausgehendes Verständnis dafür, was andere generell von ihnen halten. Was Anpassung an soziale Normen bedeutet, können sie noch nicht verstehen.
Freundlichkeit wächst mit
Werden Kinder älter, reift ihre Einsicht in Freundlichkeit, und ihre freundlichen Gesten werden überlegter. Gezeigt hat das die Arbeit von John-Tyler Binfet, einem Professor an der University of Columbia und zweifellos selbst ein sehr freundlicher Mensch, zählt zu seinen vielen Erfolgen doch auch die Entwicklung eines Programms namens BARK, das für Building Academic Retention through K9s steht (ein Akronym, das sicher einige gedankliche Anstrengung gekostet hat!). Bei BARK werden Therapiehunde zur Stärkung des Wohlbefindens gestresster Studierender auf dem Campus seiner Universität eingesetzt. Als John-Tyler an »Kindfest« teilnahm, einer von mir im Pandemiejahr 2020 moderierten Video-Konferenz anlässlich des Weltfreundlichkeitstags, saß neben ihm ein herrlicher Begleithund, ein Golden Retriever, der dazu beitrug, dass alle Teilnehmenden sich entspannten und eine großartige Diskussion entstand. Wie auch immer, John-Tylers wissenschaftliche Arbeit zum Thema Freundlichkeit beginnt damit, dass Kinder Bilder dazu zeichnen, wo und wann sie etwas Nettes getan haben, und was das war.8
Seiner Ansicht nach fallen solche Taten in verschiedene Kategorien, physische und inklusive Freundlichkeit etwa, Dinge, die Kinder gedanklich erst durchdringen können, wenn sie etwas älter werden. Auf einem Bild zeigte zum Beispiel ein acht Jahre altes Mädchen, wie sie einer Freundin, die hingefallen war, beim Aufstehen half. Eine Darstellung inklusiver Freundlichkeit zeigte ein weinendes Mädchen und eines, das nach dem Grund fragte. Das eine Mädchen sagt, sie habe niemanden zum Spielen, und das andere sagt: »Da habe ich mit ihr gespielt.« Mich hat auch ein Bild angesprochen, dem man ein weit entwickeltes Verständnis dafür, was eine gute Tat sein kann, entnehmen konnte: Ein Junge hatte sich selbst mit großen Ohren im Unterricht gezeichnet. Ich »helfe meiner Lehrerin und höre zu«, erklärte der Junge dazu.
Als er seine jungen Testpersonen bat, zu zeichnen, wo und inwiefern ihre Lehrer*innen freundlich sind, habe er Bilder erwartet, berichtete Binfet den Konferenzteilnehmern, auf denen Lehrpersonen Süßigkeiten an die Kinder verteilten oder anboten, die Pausenzeit zu verlängern, mit anderen Worten, er habe geglaubt, die Kinder würden an Handlungen denken, die ihnen unmittelbar nützten. Er stellte jedoch beeindruckt fest, dass sie mindestens ebenso oft zeichneten, wie eine Lehrperson einem Mitschüler bei Mathe half. Und als Kinder im Alter von zehn und elf für ihn aufschrieben, was sie unter Freundlichkeit verstehen, definierten sie es als »aufpassen, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt und alle glücklich sind«.
Für die Studie wurden die Kinder auch gebeten, sich für die kommende Woche fünf gute Taten vorzunehmen. Ihre Listen enthielten Dinge, wie dem Nachbarn bei seinen Einkäufen zu helfen und dem Bruder von der Pizza abzugeben. Ein Vorhaben war besonders rührend und sehr genau durchdacht: Der betreffende Junge wollte sich bemühen, vor seinem Freund nicht mehr so oft von seiner Mutter zu sprechen, da die Mutter des Freundes, wie er sagte, im Jahr zuvor gestorben war. Bei einem Kind dieses Alters zeugt das von einem eindrucksvollen Niveau der Selbstbeherrschung und der Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen.9
Wenn es zutrifft, dass Kinder mit dem Älterwerden freundlicher werden, trifft es dann auch zu, dass sie, wenn sie ins Teenageralter kommen, in frühere Verhaltensmuster zurückfallen? Ja, in gewissem Maße. Teenager können ichbezogen und rücksichtslos sein (auch missmutig und einsilbig), das ist jedoch nicht allein ihre Schuld. Zunächst einmal ist es nicht einfach, sich den Weg durch die Pubertät hin zur Eigenständigkeit zu bahnen. Dazu kommt, das zeigt die neurowissenschaftliche Forschung von Professor Sarah-Jayne Blakemore (eine große Verteidigerin von Teenagern, die an der University of Cambridge lehrt), dass ihre noch in der Entwicklung befindlichen Gehirne länger brauchen, um bestimmte Dinge aus der Perspektive anderer zu betrachten.10 Bei der Auswertung einer Befragung dazu, wie eine befreundete Person sich fühlen würde, die nicht zu deiner Party eingeladen ist, stellte Professor Blakemore fest, dass Erwachsene Sachverhalte schneller einschätzen können als Jugendliche und dass sie ihren Verstand effektiver nutzen. Nicht alle Bereiche des Gehirns entwickeln sich beim Heranwachsen gleich schnell, was zu der Annahme führt, dass sich das Belohnungszentrum des Gehirns in der Adoleszenz schneller entwickelt als der präfrontale Kortex, der Teil des Gehirns, der für Selbstkontrolle und planendes Handeln steht. Das könnte erklären, warum Teenager manchmal Entscheidungen treffen, die egoistisch scheinen.
Ungeachtet dessen hat John-Tyler Binfet von der UBC auch Belege dafür gefunden, dass Teenager in puncto freundliches Verhalten keine hoffnungslosen Fälle sind. Genau wie bei den jüngeren Kindern bat er auch 14 und 15 Jahre alte kanadische Schüler*innen, sich fünf gute Taten für eine Woche zu überlegen. Dann ordnete er die gewählten Vorhaben Kategorien zu, beginnend mit dem am häufigsten genannten (zum Beispiel eine weinende Klassenkameradin zur Toilette begleiten), gefolgt von etwas geben (einem anderen Teenager einen Vierteldollar für den Süßigkeitenautomaten zu schenken) bis hin zu respektvoll sein (was, wie ich mit Interesse zur Kenntnis nahm, häufig bedeutete, irgendetwas nicht zu tun – beim Abendessen nicht gierig zu schlingen, ein Geschwister oder eine Freundin nicht zu hänseln).
Interessant fand ich auch, dass es im Hinblick auf die geplanten guten Taten keine großen Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen gab, mit der Ausnahme, dass mehr Jungen sich etwas vornahmen, was mit Respekt zu tun hatte. Nun frage ich mich – vielleicht aus Voreingenommenheit zugunsten meines eigenen Geschlechts –, ob Mädchen einfach davon ausgehen, dass man bestimmte Dinge nicht tut, statt Zurückhaltung als Freundlichkeit aufzufassen. Vielleicht ist das den Jungen gegenüber aber ungerecht. Insgesamt fällt auf, dass die Vorstellungen der Teenager, was als Freundlichkeit gilt, doch sehr differenziert waren – angefangen vom verhassten Einräumen der Spülmaschine, das man den Eltern zuliebe trotzdem tut, bis dazu, dass man einen anderen in einer Diskussion verteidigt, auch wenn man dessen Standpunkt nicht teilt.
Jetzt höre ich schon Teenager-Eltern sagen, alles schön und gut, aber es ist ein RIESEN-Unterschied, ob ein Teenager sagt, er will etwas tun, und ob er es tatsächlich tut. Ob er zum Beispiel die Sachen, die er in seinem Zimmer gerade auf den Boden geworfen hat, auch wirklich aufräumt. Oder wirklich noch vor Mittag aufsteht. Oder überhaupt mal etwas anderes tut, als Computerspiele zu spielen.
Trotzdem möchte ich Teenager noch einmal verteidigen. Bei der Übung schafften es 94 Prozent der Teilnehmenden, wenigstens drei ihrer geplanten fünf Vorhaben durchzuführen, und insgesamt verwirklichten 191 Schüler 943 gute Taten. Angemerkt werden muss jedoch, dass es sich bei den Adressat*innen der Freundlichkeit zehnmal häufiger um Familienangehörige oder befreundete Personen als um Fremde handelte.11
Man darf diese Befunde natürlich nicht überbewerten – die Teenager bearbeiteten schließlich eine ihnen gestellte Aufgabe. Trotzdem kann Binfets Arbeit, wie er selbst sagt, einiges dazu beitragen, die negativsten Stereotype im Zusammenhang mit Teenagern infrage zu stellen. Sie können sehr fürsorglich und aufmerksam sein, wenn sie wollen, das steht fest.
Älter und freundlicher?
Wie wir gesehen haben, können sogar kleine Kinder und Teenager freundlicher sein, als wir meinen. Dennoch nehmen unsere Fähigkeit, freundlich zu sein, und die Tendenz, uns freundlich zu verhalten, mit dem Älterwerden insgesamt erwiesenermaßen zu. Das ist sehr allgemein gesagt, gewiss, und auch wenn einige Studien zeigen, dass ältere Erwachsene im Durchschnitt freundlicher sind als jüngere, messen andere Studien hier keinen Unterschied. Auch beinhalten viele Studien Tests zu finanzieller Großzügigkeit oder zu Gelegenheiten zur Erlangung finanzieller Vorteile durch freundliches Verhalten, was problematisch ist. Sobald Geld eine Rolle spielt, wir uns in einen finanziellen Denkrahmen begeben, werden wir in unseren Entscheidungen beeinflusst.12
Um dieses Problem zu lösen, untersuchte eine neuere Studie, wie viel körperliche Mühe Menschen bereit sind, sich für andere zu machen. Gute Taten verlangen oft physischen Einsatz – ob wir einem Vater oder einer Mutter helfen, einen Kinderwagen die Treppe zum Bahnhof hinaufzutragen, oder einem Fremden nachlaufen, der etwas verloren hat. Dennoch wird diese Art der Freundlichkeit in der Forschung häufig übersehen. Nicht allerdings in einer Studie, die Patricia Lockwood von der University of Birmingham durchgeführt hat.
Hier erhielten die Teilnehmenden einen Kraftmesser, ein Gerät, das man in der Hand hält und drückt, so fest man kann. Je fester und länger eine Person zudrücken konnte, was ganz schön anstrengend ist, desto höher fiel die Belohnung aus, die sie erhielt, manchmal für sich und manchmal für andere. Was fand Professor Lockwoods Team nun heraus?
Kurz und bündig, dass ältere Personen mehr Freundlichkeit an den Tag legten als jüngere. Genauer gesagt, wendeten Personen im Alter zwischen 65 und 84 genauso viel Körperkraft auf, wenn die Belohnung jemand anderem zugutekam, wie bei einer Belohnung für sich selbst. Personen zwischen 18 und 36 taten das nicht.13 Noch genauer, die Gruppe der Jüngeren war bereit, sich ein bisschen für andere anzustrengen, aber nicht zu sehr: Als das Drücken des Kraftmessers schwerer wurde – es gibt sechs Stufen –, gaben die meisten bald auf, wohingegen die Älteren dranblieben. Und nicht nur das. Die Älteren berichteten außerdem, sie hätten mehr innere Wärme gespürt, nachdem sie wie verrückt für andere gedrückt hatten.
(Um Ihrer Frage zuvorzukommen: Die Forschungsgruppe maß vorher den Händedruck aller Teilnehmenden und kalkulierte die jeweiligen Werte mit ein.)
Diese Ergebnisse sind nicht überraschend. Dass jüngere Menschen stärker auf die Durchsetzung ihrer eigenen Interessen bedacht sind, spiegelt lediglich ihre noch prekäre Situation zu Beginn des eigenen Lebens wider. Damit soll nicht gesagt sein, dass jüngere Leute nicht freundlich sind. Im Freundlichkeitstest hatte das Alter nur minimalen Einfluss auf die Zahl der von den Teilnehmenden genannten Gefälligkeiten und nicht annähernd so viel Einfluss wie die Persönlichkeit (vielleicht erinnern Sie sich: Extrovertierte, offene und tendenziell eher umgängliche Menschen schnitten im Durchschnitt besser ab). Ältere spendeten nach eigenen Angaben jedoch mehr für wohltätige Zwecke, und als an der Studie Teilnehmende gefragt wurden, wie viel sie von einem unerwarteten Geldregen von 850 Pfund abgeben würden, nannten Ältere eine geringfügig höhere Summe als Jüngere, unabhängig vom jeweiligen Einkommen.
Als jemand, der irgendwo zwischen nicht mehr ganz jung, aber auch noch nicht alt steht, könnte ich mich demnach also darauf freuen, vielleicht noch freundlicher zu werden. Und in puncto Freundlichkeit habe ich natürlich sowieso einen Vorsprung, gegenüber meinem Mann zum Beispiel, denn ich bin eine Frau, und Frauen sind freundlicher als Männer, stimmt’s?
Nun ja – mehr oder weniger. Studien zeigen, dass Frauen bei Empathie- und Freundlichkeitstests im Durchschnitt besser abschneiden (wie es auch bei unserem Freundlichkeitstest der Fall war). Diese Befunde können jedoch auch auf das Studiendesign und das traditionelle Selbstbild von Männern und Frauen zurückzuführen sein. Kleine Mädchen wurden zum Helfen angehalten – jedenfalls war es so, als ich aufwuchs –, bekamen Puppen zum Kuscheln und Umsorgen geschenkt und wurden fürs Nett- und Liebsein stets gelobt. Jungen hingegen wurden belohnt, wenn sie Stärke und Beharrlichkeit an den Tag legten, zähe kleine Burschen waren. Vielleicht ist es immer noch so. Erst neulich schickte mir jemand ein Bild von Mädchenunterhosen, in deren Bund das Wort »lieb« eingewebt war, während auf den Hosen für Jungen »Hogwards« und »Xbox« stand. Wenn alles gleich bleibt, ist es kein Wunder, dass Frauen tendenziell mehr Empathie zeigen. Möglicherweise stehen Frauen auch mehr unter Druck, in diesen Studien freundlich zu erscheinen, und bemühen sich mehr, erwartungsgemäß zu handeln, wenn man ihnen dabei zusieht, oder aber sie kreuzen bei Studien alle Kästchen an, die besagen, dass sie viel Gutes tun und Geld spenden.