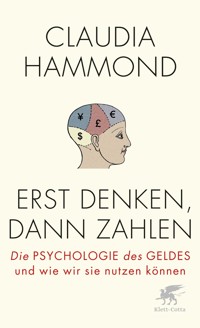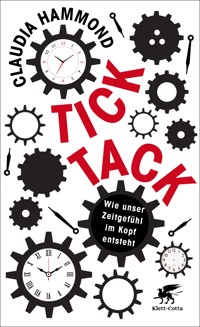
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum führt uns die Zeit so oft hinters Licht, obwohl sie doch genauestens zu messen ist? Claudia Hammond lüftet das Geheimnis der subjektiven Zeitwahrnehmung mit Hilfe aktueller neurowissenschaftlicher Erkenntnisse und spannender Experimente. Und sie zeigt, wie wir mehr aus unserer Zeit machen können. Die Zeit durchtaktet unser Leben sehr fein und genau – und gleichzeitig entzieht sie sich jeder Kontrolle: Während ein schöner Urlaub wie im Flug vergeht, können sich Sekunden endlos dehnen, wenn wir unser Leben in Gefahr sehen. Claudia Hammond nähert sich dem Zeit-Paradox, dem wir alle unterliegen, auf zugleich amüsante und ernsthafte Weise. Wir erfahren von erstaunlichen und nicht ungefährlichen Experimenten, denen sich Forscher und ihre Probanden ausgesetzt haben, um dem Rätsel der Zeitwahrnehmung auf die Spur zu kommen. Psychologie und Hirnforschung liefern wertvolle Erkenntnisse darüber, wie wir unsere individuelle Zeitvorstellung in unserem Kopf erzeugen, jenseits der physikalischen Zeitmessung. Dieses Wissen können wir uns in unserem Lebensalltag zunutze machen: Die Zeit kann unser Freund werden. Der Trick besteht darin, sie an die Leine zu nehmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Claudia Hammond
TICK TACK
Wie unser Zeitgefühl im Kopf entsteht
Aus dem Englischen von Dieter Fuchs
KLETT-COTTA
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel: »Time Warped. Unlocking the Mysteries of Time Perception« im Verlag
Canongate Books Ltd, Edinburgh, London
Published by arrangement with Canongate Books Ltd, 14 High Street, Edinburgh EH1 1TE
© 2012 by Claudia Hammond
Für die deutsche Ausgabe
© 2019 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung mehrerer Abbildungen von
© shutterstock/Mehmet Buma, DniproDD, RTimages
Datenkonvertierung: C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96344-1
E-Book: ISBN 978-3-608-19155-4
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Einführung
1
Die Zeitillusion
Deine Zeit ist meine Zeit
Welche Überraschungen die Zeit bereithält
Wenn man Angst hat, vergeht die Zeit langsamer
Leute, die von Türmen geworfen werden
Kein besonders nettes Experiment
Hyperaktive Zeit
Nach der Zeit tauchen
Fünf Mal täglich über 45 Jahre
Wie man die Zeit anhält
2
Uhren im Gehirn
Eine Elektrifizierung des Gehirns
Der Mann, der dachte, der Arbeitstag sei zu Ende
Der perfekte Schlaf
Emotionale Momente
Der »Oddball-Effekt«
Die Magie der Drei
Mit verbundenen Augen Richtung Abgrund
Misst das Gehirn sich selbst?
Das Projekt Zeit
3
Der Montag ist rot
Die Monate vergehen im Kreis
Das Millenniums-Problem
Geschichtskolorierung
Der
SNARC
-Effekt
Sieht jeder die Zeit räumlich?
Zeit, Raum und Sprache
Wenn Zeit und Raum sich vermischen
Wann ist nochmal das Mittwochsmeeting?
Der Fluss der Zeit
Wenn die Zeit rückwärts verläuft
Sanfter Montag und wütender Freitag
4
Warum die Zeit beim Älterwerden immer schneller vergeht
Das autobiographische Gedächtnis
Total Recall – Totale Erinnerung
Wenn die Zeit schneller wird
Das Leben durchs Teleskop
Nimm zwei Stück pro Tag, und das fünf Jahre lang
Der Vergangenheit den Zeitstempel aufdrücken
Alles hat gewackelt
Eintausend Tage
Der Erinnerungshügel
Erinnerung an Momente, nicht an Tage
Das Urlaubs-Paradox
5
Die Erinnerung an die Zukunft
Zeitreisen in die Zukunft
Weiß Ihr Hund, was nächste Woche sein wird?
Was machen Sie morgen?
Erinnerung an Ereignisse, die niemals stattgefunden haben
Die Selbstmord-Insel
An gar nichts denken
Eine falsche Zukunft
Schlechte Entscheidungen
Fünf Jahre bis zum Stichwort »Ameise«
Ein Marshmallow oder zwei?
Zukunftsorientiertes Denken
Blick zurück und Blick nach vorne
6
Wie man sein Verhältnis zur Zeit ändert
Problem 1: Die Zeit vergeht immer schneller
Problem 2: Wie man die Zeit schneller vergehen lässt
Problem 3: So viel zu tun, so wenig Zeit
Problem 4: Unfähig, vorauszuplanen
Problem 5: Schlechtes Erinnerungsvermögen
Problem 6: Übertriebene Sorge bezüglich der Zukunft
Problem 7: Der Versuch, in der Gegenwart zu leben
Problem 8: Vorhersagen, wie man sich in der Zukunft fühlt
Zum Abschluss
Anmerkungen
Danksagung
Literatur
Der einzige Grund, warum es die Zeit gibt, ist, dass nicht alles gleichzeitig geschieht.
Albert Einstein
Einführung
Wenn Chuck Berry am Rand einer Klippe oder auf einem Berggipfel steht, hat er den Drang, nach unten zu springen. Ist er im Flugzeug, will er sich wahnsinnig gern hinauswerfen. Wir haben es hier allerdings nicht mit dem berühmten Rock’n’Roll-Sänger zu tun, sondern mit Chuck Berry, dem »Kiwi-König des Skydivens und Basejumpings«. Gut möglich, dass Sie ihn schon einmal in einer Werbung für Erfrischungsgetränke gesehen haben. Für die Limonadenmarke Lilt setzte er sich etwa aufs Fahrrad und sprang damit aus dem Hubschrauber – und das gleich zwei Mal. Derzeit wird er von Red Bull gesponsert, aber mit Sicherheit erlebt er mehr als nur einen Koffeinrausch, wenn er mit einem Fallschirm auf dem Rücken Richtung Erde rast und diesen erst im allerletzten Moment öffnet.
Über 30 Jahre macht Chuck Berry solche Absprünge schon, sei es in Form von Skydiving, Hanggliding (Gleitschirmflug), Micro-Light-Flying oder Fallschirmspringen (einmal sogar mit einem speziell präparierten Zelt). Seine Spezialität ist aber das Basejumping. Diese besonders extreme »Extremsportart« ist nach den vier Kategorien fester Objekte benannt, von denen man abspringen kann – Gebäuden, Groß-Antennen, aufgespannten Dingen (Brücken) und der Erde selbst (in der Regel eine Klippe). Seit 1981 gab es dabei mindestens 136 tödliche Unfälle – dieser Sport ist so gefährlich, dass statistisch gesehen einer von 60 Basejumpern umkommt.
Für Chuck ist der Schlüssel zum Überleben, dass er die Kontrolle über sein Denken behält. Bevor er springt, geht er im Geist die Schritte durch, die für die Erreichung seines Ziels nötig sind. Während unsereiner auf dem Dach des K. L. Tower in Kuala Lumpur (siebthöchster freistehender Turm der Welt) im Kopf durchgehen würde, was alles passieren kann – dass einen der Wind in ein anderes Gebäude weht, der Fallschirm zu spät aufgeht und man 400 Meter tiefer bald nichts als einen blutigen Fleck bildet –, überprüft Chuck genau die Windrichtung, bestimmt die exakte Höhe für das Öffnen des Fallschirms und malt sich aus, wie er dann sanft nach unten schwebt und auf dem ausgewählten Punkt eine perfekte Landung hinlegt. Hilfreich ist dabei natürlich auch, dass er sich auf diesen Moment seit Monaten vorbereitet hat.
Mit seiner jahrelangen Erfahrung hätte der Swift-Flug, den Chuck eines Neujahrsmorgens unternahm, eigentlich total unproblematisch sein müssen. Ein Swift ist eine Art Kreuzung aus Flugzeug und Gleitschirm, und wie es heißt, verbindet er das Segelpotenzial eines Gleitschirms mit der Bequemlichkeit, bergab laufen und einfach abheben zu können – es braucht also kein Flugzeug, das einen hinauf in den Himmel bringt. Obendrein kann das Ding so klein zusammengefaltet werden, dass es auf den Dachständer eines Autos passt. Vorne sieht es aus wie ein eleganter Papierflieger mit langen, aerodynamischen Flügeln, wohingegen der Rumpf ganz kurz ist und das Heck komplett fehlt. Für den Pilot gibt es ein kleines Cockpit, das aber nur Kopf, Schultern und Arme umschließt; die Beine ragen unten heraus, damit man den Berghang hinunterrennen kann. Stellen Sie sich Fred Feuerstein vor, wie er zu seinem Steinzeitauto läuft – und dann hinter dem Klippenrand verschwindet und sich in die Lüfte erhebt.
Für seinen Flug mit dem Swift wählte Chuck den Coronet Peak aus, der sich nicht weit von der neuseeländischen Bungeejumping-Hauptstadt Queenstown erhebt. Es war ein herrlicher Sommertag und der Berg zeichnete sich wie in einer Filmkulisse gegen den blauen Himmel ab. Eigentlich die ideale Location, nur dass Chuck die Vorstellung, in dieser gewaltigen Landschaft einfach so herumzusegeln, eher langweilig fand. Etwas Luftakrobatik würde die Sache doch spannender machen. Unter Ausnutzung der Thermik brachte er den Gleitschirm auf eine Höhe von 5500 Fuß, bevor er ihn vornüber kippte und steil nach unten schoss. Der Plan war, den Sturzflug im letzten Moment abzubrechen und erneut in den Himmel aufzusteigen. Kein Problem, richtig?
Falsch. Der gesamte Gleitschirm fing an zu beben und sich wild aufzubäumen, und als gelernter Flugzeugingenieur wusste Chuck genau, was da passierte. Es war das, was in der Flugbranche als »Flattern« bezeichnet wird (wobei der Begriff von einem echten Meister der Untertreibung stammen muss): Die Tragflächen des Flugzeugs biegen sich in rasanter Folge nach oben und nach unten, bis sie sich schließlich selbst totgeschlagen haben.
Innerhalb weniger Sekunden hatten sich beide Flügel komplett vom Rumpf gelöst, und Chuck befand sich im freien Fall. Mit vollem Tempo auf die Erde zuzurasen, machte ihm ansonsten eigentlich Spaß. Aber diesmal gab es nichts, was seinen Fall hätte bremsen, seinen brutalen Aufprall auf der Erde hätte verhindern können. Trotzdem war Chuck auch jetzt in der Lage – sein GPS-Gerät zeigte dem Rettungsteam später an, dass er mit 200 km/h zu Boden raste –, so präzise wie rational zu denken.
Er sah, dass er zwar außerhalb des Cockpits eines flügellosen Gleitschirms hing, mit dem Wrack aber immer noch verbunden war. Seine Gedanken überschlugen sich. Er erinnert sich genau, was ihm damals durch den Kopf ging:
Es muss doch möglich sein, wieder in die Überreste des Gleitschirms hineinzukommen. Warum kann ich nicht einfach ins Cockpit klettern? Das muss doch irgendwie machbar sein. Kann ich mich hochziehen? Müsste eigentlich gehen. Was würde James Bond machen? Komm schon, Alter, mach was! Ich muss etwas tun. Nicht nach unten sehen. Der Boden ist viel zu nahe. Ich habe keine Zeit. Irgendwas muss doch gehen. Das war wohl ein Flattern. Der Hebel! Der Griff für den Rettungsfallschirm. Wenn ich nur diesen Griff erreichen könnte. Der muss noch da sein! Klar ist er noch da. Wie lange falle ich schon? Das dauert ja ewig. Dort sind schon die Hügel. Nicht mehr viel Zeit übrig. Zu windig zum Nachdenken. Das ist die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Na los, mach was! Rette dich! Greif irgendwie nach diesem Notdingens und zieh es raus!
Machen Sie sich klar, dass nach dem, was das GPS-Gerät später anzeigte, dieser innere Monolog, dieser ganze Denkprozess mit seiner präzisen Kalkulation, nur wenige Sekunden dauerte. Für Chuck fühlte er sich aber erheblich länger an. Er wusste, dass er schnell reagieren musste, und dennoch hatte er genügend Zeit – oder sogar ziemlich viel –, um nachzudenken und dann entsprechend zu handeln. Für den Betrachter rasten die Sekunden vorbei. Für Chuck dehnte sich die Situation aber fast ins Unendliche aus. Ein und derselbe Zeitrahmen, aber zwei völlig unterschiedliche Wahrnehmungen des Zeitflusses. Der kurze Blick auf die Ewigkeit, den er am Neujahrstag erhaschte, ist ein gutes, wenngleich extremes Beispiel für das zentrale Thema dieses Buches: die Subjektivität der Zeitwahrnehmung. In einer Situation, wie Chuck sie erlebte, ist die Zeit etwas verstörend Elastisches.
Jeder von uns hat schon Momente erlebt, in denen sich die Zeit irgendwie verzerrt. Wenn wir so wie Chuck um unser Leben fürchten, scheint sie sich zu verlangsamen. Wenn wir glücklich sind, vergeht sie »wie im Flug«. Beim Älterwerden kommt es uns vor, als würde die Zeit immer schneller rasen. Jedes Jahr kommt Weihnachten ein bisschen früher. Aber als Kind wollten die Sommerferien gar nicht mehr aufhören.
In diesem Buch möchte ich der Frage nachgehen, ob diese Ausdehnung und Schrumpfung der Zeit eine Illusion ist oder ob unser Gehirn in diversen Momenten unseres Lebens unterschiedlich mit ihr umgeht, sie anders verarbeitet. Die Zeitwahrnehmung – also die Art und Weise, wie die Zeit subjektiv erlebt wird, wie sie sich für das Individuum jeweils anfühlt –, ist ein so faszinierendes wie gleichermaßen endloses Thema. Die Zeit ist immer für eine Überraschung gut – und wir gewöhnen uns einfach daran, wie sie uns täuscht und hinters Licht führt. Ein schöner Urlaub geht rasend schnell vorbei: Kaum ist man angekommen, muss man auch schon wieder ans Packen denken. Daheim angekommen, fühlt es sich an, als sein man ewig weggewesen. Wie ist es möglich, dass man ein und denselben Urlaub auf so widersprüchliche Art wahrnimmt?
Den Kern des Buches bildet die Vorstellung, dass die Wahrnehmung der Zeit etwas ist, das von unserem Verstand aktiv erzeugt wird. Etliche Faktoren sind an der Konstruktion der Zeitwahrnehmung beteiligt – das Gedächtnis, die Konzentration, unsere aktuelle Verfassung und das Gefühl, dass die Zeit irgendwie mit dem Raum verknüpft ist. Dieser letztgenannte Faktor ermöglicht uns, etwas ganz Außergewöhnliches zu tun – nämlich nach Belieben in der Zeit zu reisen, uns im Geiste nach hinten oder auch nach vorne zu bewegen. Ich konzentriere mich hier auf Psychologie und Hirnforschung und weniger auf die Metaphysik und Poetik der Zeit oder ihre Rolle in Physik und Philosophie – wobei man natürlich oft nicht weiß, wo der eine Bereich endet und der nächste anfängt.
Die Physiker sagen uns, dass die gängige Vorstellung, nach der die Zeit aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft besteht, schlichtweg falsch sei. Die Zeit vergeht nicht, sie ist einfach. John Ellis McTaggart, der sich als Philosoph intensiv mit dem Thema Zeit beschäftigt hat, war so ziemlich der gleichen Meinung,[1] und Varianten dieser Vorstellung finden sich in Religionen wie dem Buddhismus oder dem Hinduismus. Aber das vorliegende Buch handelt nicht von der objektiven Realität der Zeit, sondern von ihrer Wahrnehmung, und ich gehe mal davon aus, dass Sie, genau wie ich, Zeit als etwas im Fluss Befindliches und nicht etwa als etwas Ruhendes oder Stillstehendes wahrnehmen. Ich werde untersuchen, wie der Verstand unsere Empfindung von Zeit erzeugt – also das, was Neurologen und Psychologen als »Mind Time« bezeichnen. Diese Zeit kann nicht von einer externen Uhr gemessen werden, spielt aber bei unserer Wahrnehmung der Außenwelt – der »Realität« – eine zentrale Rolle.
Ich werde ein paar der innovativen Methoden vorstellen, mit denen Forscher im entstehenden Bereich der Zeit-Psychologie das Studium der »Mind Time« betreiben. Sie befragten Leute zum Datum wichtiger Ereignisse, ließen sie auf den Rand von Klippen zugehen und haben sie sogar rücklings von irgendwelchen Gebäuden geworfen. Sie scheuten auch nicht vor Selbstversuchen zurück – verbrachten etwa Monate in einer Eishöhle ohne Tageslicht oder kontrollierten ihr Zeitgefühl mit täglichen Messungen, und das über einen Zeitraum von 45 Jahren. Und dann gibt es noch diejenigen, die ganz unbeabsichtigt wichtige Aspekte der Zeitwahrnehmung erhellt haben, zum Beispiel den Mann, der sich nach einem Motorradunfall die Zukunft nicht mehr vorstellen konnte, oder den BBC-Journalisten, der mehr als drei Monate in Geiselhaft war und keine Ahnung hatte, ob er je wieder freikommen würde.
Die Kombination dieser Erfahrungen mit den neuesten Erkenntnissen der Psycho- und Neuroforschung in aller Welt ermöglicht uns unschätzbare Einblicke in das Wesen der Zeitwahrnehmung. Jeder von uns weiß ein bisschen etwas über die Formbarkeit der Zeit, ohne dass dafür eine Extremerfahrung wie die von Chuck nötig wäre. Psychologen haben die merkwürdigsten Dinge herausgefunden: etwa, dass der Verzehr von Fastfood uns ungeduldig macht;[2] dass Menschen am Ende einer Schlange das Gefühl haben, die Zeit würde sich auf sie zu bewegen, während die weiter vorne denken, sie gingen durch die Zeit hindurch; dass für jemand mit hohem Fieber die Zeit langsamer verstreicht.
Dazu kommt meine eigene Theorie vom »Urlaubs-Paradox«, also dem oben angesprochenen Phänomen, dass die Ferien zwar schnell verstreichen, sich hinterher aber wie eine halbe Ewigkeit anfühlen. Wir betrachten die Zeit ständig auf zweierlei Art und Weise – während wir etwas erleben und außerdem noch im Nachgang. Meist kommen wir mit dieser dualen Sichtweise gut zurecht, nur ist sie auch der Grund für etliche Rätsel der Zeit. Wenn die beiden Wahrnehmungen – die prospektiv-vorausschauende und die retrospektive – nicht übereinstimmen, sorgt die Zeit für Verwirrung.
Ich werde darlegen, was ich über die Art und Weise herausgefunden habe, mit der Menschen die Zeit innerlich visualisieren. Sie werden überrascht sein, wie viele von uns (rund 20 Prozent) die Tage, Monate, Jahre oder sogar Jahrhunderte gedanklich und in exakten Mustern anordnen. Auch wie sie das machen, ist beeindruckend – mit Jahrhunderten, die wie Dominosteine dastehen, oder Jahrzehnten in der Form eines Slinkys. Warum stellen sich manche Menschen die Zeit so vor, und wie wirkt sich das auf ihre Zeitwahrnehmung aus? Außerdem werde ich noch eine Frage behandeln, auf die es keine richtige oder falsche Antwort gibt, zu der wir aber unterschiedlich stehen: Kommt uns die Zukunft entgegen oder bewegen wir uns an einem unendlichen Zeitstrahl entlang in ihre Richtung?
Wir messen die Zeit heute genauer – minutiöser – als je zuvor. Die Caesium-Uhr am US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology geht so genau, dass sie über die nächsten 600 Millionen Jahre hinweg keine einzige Sekunde verlieren oder hinzugewinnen wird. Noch vor ein paar Jahren konnte sie das »nur« für 20 Millionen Jahre. Die Uhr des Geistes ist weniger leicht zu greifen. Sie scheint unsere Zeitwahrnehmung zu beherrschen, existiert aber allem Anschein nach gar nicht. Jahrzehntelang haben Wissenschaftler nach so etwas wie einer inneren Uhr geforscht. Über einen Zeitraum von 24 Stunden regulieren vegetative Rhythmen unsere Körperuhr und koppeln uns über das Sonnenlicht an die Abfolge von Tag und Nacht, aber wir besitzen kein spezielles Organ, das die verstreichenden Sekunden, Minuten oder Stunden registriert. Trotzdem können wir gedanklich die Zeit messen. Wir haben ständig mit unterschiedlichen Zeitpunkten oder Zeiträumen zu tun – vor einer Sekunde, das mittlere Alter, das vergangene Jahrzehnt, die erste Semesterwoche, jedes Weihnachten, zwei Stunden –, mit denen wir im Kopf mühelos herumjonglieren. Währenddessen entwickeln wir ein Langzeitgefühl für die verstreichenden Jahrzehnte, den eigenen Lebenslauf und unsere jeweilige Position in der Weltgeschichte.
Neueste Erkenntnisse der Neurologie liefern jetzt nach und nach Hinweise darauf, wie unser Gehirn die Zeit auch ohne ein speziell dafür vorgesehenes Organ wahrnehmen kann. Im zweiten Kapitel werde ich diese konkurrierenden Theorien unter die Lupe nehmen. Aber vielleicht interessiert Sie ja auch viel mehr, welchen Einfluss die individuelle Zeitwahrnehmung auf Ihr Denken und Ihr Verhalten nimmt. Wenngleich die Zeit laut Kalender nur in eine einzige Richtung geht, springen wir im Kopf ständig von der Vergangenheit in die Zukunft und wieder zurück. Wenn Sie wollen, können Sie dieses Buch genauso lesen. Zwar denke ich, alles in der richtigen Reihenfolge angeordnet zu haben, nur müssen Sie mir dabei keineswegs folgen. Wenn Sie sich je gefragt haben, wie gut Sie bei Entscheidungen sind, die anhand zukünftig vermuteter Gefühle getroffen wurden, bietet sich Kapitel 5 an. Wenn Sie jemals einen Unfall hatten, bei dem für Sie die Zeit stehenblieb, finden Sie die Gründe dafür in Kapitel 1. Wenn Sie wissen wollen, warum die Zeit immer schneller vergeht oder eine Nachrichtenmeldung länger zurückliegt, als Sie dachten, ist vielleicht Kapitel 3 das Richtige für Sie.
Zum Abschluss werde ich zeigen, wie all diese Erkenntnisse für unseren Lebensalltag genutzt werden können. Wir erzeugen die Zeitwahrnehmung in unserem Kopf, deshalb ist es nur logisch, dass wir alles, womit wir nicht klarkommen, auch verändern können – ob wir versuchen, die scheinbar vorbeifliegenden Jahre zu verlangsamen; die Zeit beschleunigen, wenn wir in der Schlange stehen; versuchen, mehr in der Gegenwart zu leben oder herausfinden wollen, wann wir alte Freunde zum letzten Mal gesehen haben. Die Zeit kann ein Freund sein – aber genauso gut auch ein Feind. Der Trick besteht darin, sie an die Leine zu nehmen, sei es zu Hause, bei der Arbeit oder auch im sozialen Umgang, und unser Verhalten dem individuellen Zeitbegriff anzupassen. Die Zeitwahrnehmung ist wichtig, denn sie steht in enger Verbindung mit unserem Denken, unserer Auffassung der Realität. Die Zeit bildet nicht nur den Kern dessen, wie wir unser Leben organisieren, sondern ist auch grundlegend für die Art und Weise, in der wir es erfahren.
Zuletzt noch ein paar Worte zum Begriff »Zeit«. Natürlich wird er in einem Buch über dieses Thema oft verwendet. Würde ich aber dem amazonischen Stamm der Amondawa angehören, hätte ich ein Problem damit. Diese Menschen haben kein Wort für die Zeit, keines für Monat und keines für Jahr. Es gibt dort keinen allgemeingültigen Kalender und keine Uhren. Sie beziehen sich durchaus auf zusammenhängende oder aufeinanderfolgende Ereignisse, aber als ein separates Konzept existiert die Zeit nicht. Im Gegensatz dazu wird das Wort »Zeit« im Englischen öfter als jedes andere Hauptwort verwendet.[3] Das zeigt, wie sehr uns die Zeit fasziniert – und ist der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Aber die Allgegenwart des Begriffs führt auch zu Problemen, denn wir können das Wort Zeit auch die ganze Zeit verwenden. Verstehen Sie, was ich meine? Um also Verwirrung zu vermeiden, werde ich mit manchen Bezeichnungen etwas pingelig umgehen oder auch Fachbegriffe aus der Psychologie bemühen. Zudem gibt es Ausdrücke wie etwa Zukunftsdenken, die ich der Genauigkeit halber ab und an wiederholt verwende. Aber ich hoffe, dass Sie trotzdem bei der Stange bleiben.
Jetzt wollen Sie aber sicher noch wissen, wie das mit Chuck Berry weiterging, unserem Basejumping-Gleitschirm-Piloten, der in der Luft baumelte, dabei auf den Erdboden zuraste und endlos Zeit zu haben schien. Nur werden Sie das leider nicht so schnell erfahren, denn zuvor müssen wir noch ein paar andere Dinge untersuchen. Am Ende des nächsten Kapitels werden wir dann aber unsere Fähigkeit, in der Zeit gedanklich zurückzureisen, gemeinsam nutzen und hören, wie die Sache für Chuck endete.
1
Die Zeitillusion
Als der BBC-Journalist Alan Johnston im von Palästinensern kontrollierten Gazastreifen gefangengehalten wurde, hatte er zwar viel Zeit, aber keinerlei Möglichkeit, diese zu messen. Ohne Armbanduhr, Bücher, Papier oder Bleistift konnte er nur anhand der Lichtstreifen in den Jalousien und des im Zimmer umherwandernden Schattens erraten, wie viel Zeit an jedem der verwünschten Tage vergangen war. Auch die fünf im Islam üblichen Gebetsaufrufe halfen ihm bei der Bestimmung einer ungefähren Tageszeit, nur verlor er schon bald den Überblick über den Kalender und damit das jeweilige Datum. »Anfangs machte ich ganz klischeehaft pro Tag einen Strich an die Tür, aber dann hatte ich Angst, mein Aufpasser könnte die Beschädigung seines Eigentums nicht so gut finden. Er war damals ziemlich schlecht gelaunt, deshalb markierte ich täglich meine Zahnbürste. Trotzdem war es schwer, das jeweilige Datum im Auge zu behalten, und ich verlor rasch jedes Zeitgefühl.«
Schlussendlich verbrachte Alan Johnston fast vier Monate in dieser Wohnung – ohne zu wissen, wie lange er noch eingesperrt sein oder ob er überhaupt wieder lebend herauskommen würde. »Mit einem Mal wird die Zeit etwas Lebendiges, ein erdrückendes Gewicht, das man zu ertragen hat. Sie ist endlos, denn man weiß ja nicht, ob und wann man wieder freigelassen wird. Vor einem liegt ein ganzer Ozean an Zeit, durch den man sich irgendwie den Weg bahnen muss.« Zum Zeitvertreib erfand Alan Psychospielchen. Er überlegte etwa, welches der beste intellektuelle Angriff auf das System der Apartheid sein könnte, oder dachte sich Lyrik und Kurzgeschichten aus. Da er aber nichts davon aufschreiben konnte, wurde das Ganze zu einem Gedächtnistraining: »Wenn du sieben Zeilen miserabler Lyrik gemacht hast, musst du sie im Kopf haben, bevor du die achte entwerfen kannst, aber wenn dann die neunte kommt, weißt du schon nicht mehr, wie die fünfte ging.« Nach und nach entwickelte Alan eine mentale Strategie für die Einschätzung der Stunden, und zwar eine, die sich das Konzept der Zeit selbst zunutze machte – eine Strategie, auf die ich weiter hinten zurückkommen werde.
Zwei Dinge waren es, die Alans Geisel-Dasein bestimmten: die Leute, die ihn gefangenhielten, und die Zeit. In diesem Kapitel werde ich die Bedingungen untersuchen, unter denen sich die Zeit so sehr verzerrt, dass sie – wie von Alan Johnston erlebt – unerträglich langsam wird. Bei ihm, der im abgeschlossenen Zimmer keinerlei Stimulation von außen hatte, verwundert es kaum, dass die Zeit nur schleppend verging, aber ich werde auch andere und wirklich merkwürdige Umstände behandeln, in denen sich die Zeit ausdehnt. Es ist die rätselhafte Flexibilität, die der Zeit ihre Faszination verleiht, aber bevor wir das genauer betrachten, sollten wir darüber nachdenken, warum unsere Fähigkeit, das Verstreichen der Zeit wahrzunehmen, so ungemein wichtig ist, für den Einzelnen ebenso wie für die Gemeinschaft.
Akkurates Timing ist für Kommunikation, Zusammenarbeit und menschliches Miteinander viel grundlegender, als Sie vielleicht vermuten. Klar dürfte sein, dass für eine Handlung, an der zwei oder mehr Personen beteiligt sind, eine Koordination der jeweiligen Zeitpläne vonnöten ist, aber auch etwas so vermeintlich Einfaches wie ein Gespräch zwischen zwei Leuten erfordert ein auf Sekundenbruchteile genaues Timing. Für die Erzeugung und das Verständnis von Sprache brauchen – und besitzen – wir zeitliche Steuerungsmechanismen von weniger als einer Zehntelsekunde. Der klangliche Unterschied zwischen einem »pa« und einem »ba« besteht in der Verzögerung des folgenden Vokals; bei längerer hört man ein »p«, bei kürzerer hingegen ein »b«. Wenn Sie die Finger an den Kehlkopf legen, können Sie spüren, dass sich beim »ba« die Lippen öffnen und gleichzeitig die Stimmbänder schwingen. Beim »pa« vibrieren sie erst später. Dazu braucht es eben ein millisekundengenaues Timing. Aber auch bei Silben sind zeitlicher Abstand oder Timing entscheidend für die Bedeutung der Phrase. Bei Jimi Hendrix’ Liedzeile »Excuse me while I kiss the sky« ist der Bruchteil einer Sekunde schuld an dem berühmten Verhörer »Excuse me while I kiss this guy«. Für die Koordination von Gliedmaßen und Muskulatur sind wir auf millisekundengenaue Einschätzung angewiesen, während das richtige Taxieren von Sekunden uns den Rhythmus in der Musik erkennen, einen Ball richtig treten oder aber beurteilen lässt, ob wir am Flughafen auf dem Laufband oder auf dem festen Boden daneben schneller vorankommen. (Antwort: Das kommt drauf an. Forscher an der Princeton University haben herausgefunden, dass einen das Laufband langsamer macht, weil man darauf meist das Tempo reduziert oder – noch blöder – hinter Leuten festklebt, die beim Betreten des Laufbands stehengeblieben sind. Ein leeres Laufband bringt einen schneller durch den Flughafen als das reine Gehen rechts oder links davon, aber nur, wenn man das Ding nicht zum Ausruhen benutzt.)
Unser Zeitempfinden ist bei weitem nicht perfekt, aber größtenteils kann unser Gehirn das kaschieren und uns eine Welt präsentieren, in der sich die Zeit kompakt und gleichmäßig anfühlt. Ein schlecht synchronisierter Film kommt uns auch insgesamt schlecht vor, wenn wir die Diskrepanz bemerken.
Studien haben gezeigt, dass unser Gehirn höchstens 70 Millisekunden Abstand zwischen Lippenbewegung und entsprechendem Klang zulässt, um eine Gleichzeitigkeit anzuerkennen. Wenn man den Leuten aber sagt, dass beides nicht zusammenpasst, können sie herausfinden, ob die Bilder dem Ton voraus oder hinterher sind. Es ist also nicht so, dass wir eine derartige Diskrepanz nicht erkennen können, sondern dass unser Gehirn bis zu einem entsprechenden Hinweis eine Parallelität von Klang und Anblick annimmt, schließlich sind wir das ja auch so gewöhnt. Manche unserer Sinne sind beim Timing besser als andere: Einen im Morsealphabet geklopften Rhythmus merkt man sich viel leichter als dieselbe Abfolge in geschriebener Form (mit Punkten und Strichen).
Die folgende Sinnestäuschung können Sie bei einer Person Ihrer Wahl ausprobieren.
Finden Sie einen Freiwilligen, nehmen Sie seinen Unterarm und fordern ihn auf wegzuschauen. Klopfen Sie mit einem Stift in schneller Abfolge mehrmals hintereinander auf ein und dieselbe Stelle neben dem Handgelenk, bevor Sie – ohne Unterbrechung und im gleichen Rhythmus – auf einen näher beim Ellbogen liegenden Punkt klopfen. Fragen Sie dann, was Sie soeben getan haben.
Vermutlich wird die Person sagen, Sie hätten vom Handgelenk bis zum Ellbogen in regelmäßigen Abständen auf den Unterarm geklopft. Obwohl Sie die Mitte des Unterarms nicht berührt haben, stellt das Gehirn Folgerungen bezüglich des räumlichen und zeitlichen Abstands der Kontakte an. Wenn Sie das Licht schnell an- und wieder ausmachen, sehen Sie das als Flackern, aber werden Sie dabei noch schneller, erreichen Sie einen Punkt, an dem es beständig zu leuchten scheint; unser Gehirn versucht, das Flackern zu deuten, und macht es zu einem Dauersignal. Wir versehen Ereignisse in der Zeit mit einem Etikett, um ihnen dadurch Sinn zu verleihen.
Seit es Computer gibt, die im Bereich von Millisekunden akkurat arbeiten, können Wissenschaftler viel leichter erforschen, welche Zeitintervalle das Gehirn erkennt und welche nicht. In den 1880er Jahren wollte der österreichische Physiologe Sigmund Exner den kürzesten Zeitraum bestimmen, den ein Mensch zur Wahrnehmung von zwei verschiedenen Geräuschen braucht. Dazu verwendete er ein »Savart-Rad«, also eine rundum mit Zähnen versehene Metallscheibe, die beim Drehen ein lautes Klicken erzeugen. Wenn sich das Rad schnell genug dreht, wird die Geräuschabfolge – analog zum flackernden Licht – als Dauerton wahrgenommen. Exner wollte den Minimalabstand finden, also den Abstand, bei dem Menschen die einzelnen Klicks gerade noch separat hören. Er probierte das Gleiche mit elektrischen Funken und stellte fest, dass unsere Sinne sich drastisch voneinander unterscheiden – beim Betrachten der Funken hatten die Menschen große Probleme mit der Unterscheidung, aber wenn es um Hören ging, konnten zwei Klicks unterschieden werden, zwischen denen nicht mehr als eine Fünfhundertstelsekunde lag.[4]
Das sind erstaunliche Millisekunden-Urteile, wobei unsere Fähigkeiten der Zeitwahrnehmung weit über das hier Geleistete hinausgehen. Das subjektive Erlebnis der Zeit beruht auf der Fähigkeit, die jeweilige Millisekunde, diesen winzigen Moment, in einen Zusammenhang zu stellen. Wie der Philosoph Edmund Husserl in seiner Studie zur Phänomenologie der Zeit schrieb, hören wir ein Lied zwar Note für Note, also nacheinander, aber erst unser Gefühl für die Zukunft und die Vergangenheit – Antizipation und Erinnerung – lässt Noten zum Lied werden.[5] Die Zeitempfindung ist etwas durch und durch Persönliches und fühlt sich an wie ein Teil unseres Bewusstseins, den wir nur schwer in Worte fassen können. Dementsprechend schrieb Augustinus: »Was ist die Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es. Wenn ich es einem erklären will, der danach fragt, weiß ich es nicht.« Und dennoch beziehen wir uns ständig auf Vorstellungen von der Zeit – sechs Monate, letzte Woche oder nächstes Jahr –, und jeder weiß, was damit gemeint ist. Zeit ist also sowohl etwas Persönliches, als auch etwas, das wir mit anderen teilen.
Deine Zeit ist meine Zeit
Jede menschliche Gemeinschaft stellt bezüglich der Zeit Regeln auf, die von ihren Mitgliedern geteilt und verstanden werden. In vielen Teilen der Welt, darunter auch in Europa und den USA, kommt man bei einer Theatervorstellung, die um 19.30 Uhr beginnen soll, bereits früher als auf der Eintrittskarte angegeben, aber wenn eine Party um 19.30 Uhr anfängt, wird allgemein erwartet, dass man etwas später auftaucht. Der Soziologe Eviatar Zerubavel meint, diese sozialen Regeln würden uns die Möglichkeit einer Abschätzung und Bewertung der Zeit an die Hand geben.[6] So gehen wir erfahrungsgemäß davon aus, dass Theaterstücke oder andere abendfüllende Veranstaltungen etwa zwei Stunden dauern, und empfinden alles, was darüber hinausgeht, als schleppend und zäh, wohingegen uns der gleiche Zeitraum viel zu kurz vorkommt, um als Arbeitsvormittag gelten zu können. Wenn wir jemanden zu einem unerwarteten Zeitpunkt treffen, erkennen wir die Person vielleicht nicht einmal. Zivilisationen entwickeln gemeinsame Vorstellungen des richtigen Timings – wie lange man etwa bleiben darf, wenn man als Gast in einem fremden Haus ist, oder wie lange man jemanden kennen sollte, bevor man ihr oder ihm einen Heiratsantrag macht. Ausnahmen davon überraschen uns. Ich weiß noch, wie ich in Ghana einmal mit sechs Männern beim Mittagessen saß, von denen zwei (ein Einheimischer und ein Schotte) uns mit der Aussage überraschten, sie hätten schon beim ersten Date um die Hand der jeweiligen Frau angehalten. (Für alle Neugierigen: Beide Frauen sagten »Ja«, und beide Ehen halten seit über 20 Jahren.)
Routinemäßige Abläufe geben uns ein Gefühl der Sicherheit. Sie sind so wichtig, dass ein Verstoß dagegen das Zeitkonzept einer Person durcheinanderbringen und sich im Extremfall auch verheerend auswirken kann. In Guantanamo war es etwa üblich, Essensausgabe, Schlafenszeit und Verhöre ganz unregelmäßig anzusetzen, was den Drang der Häftlinge, einen Überblick über die Zeit zu haben, unterlief und sie in einen Zustand der Angst versetzte. Auch für Alan Johnston war die genaue Kenntnis des jeweiligen Datums nutzlos, aber dennoch wusste er, dass er den Kalender im Auge behalten musste. Dieser Wunsch nach Vorhersehbarkeit und Kontrolle ist nichts Neues. Im frühen Mittelalter hielten die Benediktiner Vorhersehbarkeit für essentiell für ein gutes und gottgefälliges Leben, deshalb schufen sie eine gemeinsame Routine, indem in regelmäßigem Abstand die Glocken zum Gebet riefen.
Die Zeit bestimmt die Struktur unseres Lebens – wann gearbeitet, wann gegessen und wann gefeiert wird. So wie die Benediktinermönche wussten, wann das nächste Läuten zu erwarten war, formen auch wir das jeweils passende Zeitschema für unser Leben, das dann das vorige, schlagartig veraltete, überschreibt. (Wenn man in der Schule etwa einen neuen Stundenplan bekommt, erinnert man sich nur schwer an den vom letzten Jahr.) Manche Zeitschemata sind vom Wechsel der Jahreszeiten bestimmt, wobei speziell Sommer und Winter hervorstechende Zeitrahmen sind. Andere werden durch unsere Kultur definiert, weshalb mir für den Fall, dass ich zu einem x-beliebigen Zeitpunkt in meiner Straße abgesetzt würde und Uhrzeit, Tag und Monat erraten müsste, eine Kombination aus Natur und Kultur für Hinweise auf alle drei zur Verfügung stünde. Wenn nur vereinzelt Autos fahren, kaum Leute vorbeigehen und der Friseur die Rollläden unten hat, ist vermutlich Sonntag. Temperatur und Anwesenheit oder Abwesenheit von Blättern auf der Platane lassen erkennen, welche Jahreszeit wir haben, und wenn die Sonne scheint, kann ich an ihrem Stand ungefähr ablesen, wie spät es ist.
Die zyklische Natur des Kalenders hilft uns bei der gedanklichen Organisation der Zeit. Wenn man in der Schule ist, gibt der Ferienplan die Struktur des Jahres vor, eine Struktur, die sich nachhaltig auswirken kann (und die so mancher Lehrer nie wieder loswird). Der amerikanische Psychiater John Sharp hat festgestellt, dass sich manche seiner Patienten zum Ende des Sommers hin schlechter fühlen – eine Art Katerreaktion auf den jahrelang erlebten Zwang, bald wieder in die Schule zu müssen. Überraschenderweise ist in der nördlichen Hemisphäre mit ihrem gemäßigten Klima die Selbstmordrate ausgerechnet im Frühjahr höher – als seien die Menschen doppelt enttäuscht, wenn die Verheißungen des Frühlings ein bestehendes Elend eben doch nicht vertreiben.
Die Auswirkungen der Jahreszeit hängen natürlich stark davon ab, wo man jeweils lebt, genau wie der Umgang mit der Zeit. Um dieses Phänomen zu untersuchen, hat der Sozialpsychologe Robert Levine das Lebenstempo in 31 Ländern rund um die Welt verglichen und dabei drei Indikatoren verwendet. Zunächst maß er die Gehgeschwindigkeit zufällig ausgewählter Passanten, die zu Zeiten des morgendlichen Berufsverkehrs in einer Straße mit breiten Trottoirs vorbeimarschierten. Wie schnell bewegten sich diese Menschen? Schaufensterbummler wurden dabei nicht berücksichtigt, weil sie eben bummeln, und die gewählten Straßen waren nicht so überfüllt, dass die Passanten hätten abbremsen müssen. Außerdem wollte Levine die Dauer einer ganz alltäglichen Betätigung vergleichen, deshalb stoppte er die Zeit, die jemand braucht, um in der jeweiligen Landessprache eine Briefmarke zu verlangen, sie zu bezahlen und dann noch das Wechselgeld in Empfang zu nehmen. Zu guter Letzt interessierte ihn, wie viel Wert in jeder betrachteten Kultur auf die Genauigkeit der Zeitmessung gelegt wurde, deshalb überprüfte er in jeder Stadt die Wanduhr von 15 Banken. Durch Kombination dieser Daten erhielt er einen Wert für die jeweilige Gangart des Lebens. Das höchste Tempo herrscht wie zu erwarten in Nordeuropa, Südostasien und den USA, nur waren nicht alle Ergebnisse derart vorhersehbar. Beim Briefmarkenkauf erreichte Costa Rica tatsächlich Platz 13 der Tempo-Charts (was nicht unbedingt dem entspricht, was ich dort am Postschalter erlebt habe, aber eben deshalb gibt es bei so etwas systematische Untersuchungen – und nicht nur Anekdoten). Auch innerhalb eines Landes herrschen mitunter große Unterschiede. Beim Vergleich von 36 US-amerikanischen Großstädten – hier jetzt unter Berücksichtigung aller drei Bereiche – erwies sich Boston als schnellste, während die Heimat des Showbusiness Los Angeles auf dem letzten Platz landete, und zwar aufgrund ihrer extrem entspannten Bankangestellten. New York war naturgemäß als Nummer Eins gesetzt, aber in den 90 Minuten, die sich der Forscher Anfang der 1990er Jahre für die Beobachtung nahm, sah er einen Passanten mit einem Straßenräuber, einen anderen mit einem Taschendieb kämpfen, was vermutlich eine gewisse Verlangsamung generierte.
Zum Zeitpunkt der Studie waren die Länder mit dem höchsten Tempo auch die mit der potentesten Volkswirtschaft. Man muss sich also fragen, was zuerst kommt – bewegen sich die Menschen in aktiven Ökonomien schneller, weil ihnen die Zeit wertvoller vorkommt, oder führt Geschwindigkeit im Alltag zu wirtschaftlichem Erfolg? Zweifellos können Energie und Geschwindigkeit bei manchen Geschäften förderlich sein, aber oft ist der Effekt, den das Arbeitstempo auf eine Vergrößerung des Markts ausübt, doch eher begrenzt. Egal wie schnell Sie Ihre Regenschirme auch herstellen – wenn dort, wo Sie leben, keine Wolke am Himmel ist, verkaufen sie sich nicht. Das Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Bruttoinlandsprodukt muss also eher als bilaterale, also gegenseitige Interaktion betrachtet werden. Geschwindigkeit führt zu einem gewissen wirtschaftlichen Erfolg, aber wirtschaftlicher Erfolg ist auch auf Leute angewiesen, die sich schneller bewegen, während die Gesellschaft als solche stark von der Uhr abhängt.
Welche Überraschungen die Zeit bereithält
Unser Gehirn schafft uns also ein Zeiterlebnis, das sich nicht nur insgesamt rund und geschmeidig anfühlt, sondern das wir auch mit anderen teilen können – was uns ermöglicht, unsere Tätigkeiten zu koordinieren. Trotzdem sorgt die Zeit immer wieder für Überraschungen. Sie ist so faszinierend, weil wir uns offenbar nie daran gewöhnen, dass und wie sie uns hinters Licht führt. Unser ganzes Leben lang scheint sich die Zeit immer wieder zu verzerren. Wir fliegen in eine Zeitzone, die hinter uns liegt, und bilden uns ein, die Zeit zu betrügen und ein paar Stunden unseres Lebens zwei Mal genießen zu können. Fliegen wir in die andere Richtung, fragen wir uns, was mit der verlorenen Zeit geschehen ist. Trotz der längeren Abende, die wir bei der Zeitumstellung im Frühjahr erhalten, haben wir das ungute Gefühl, uns wurde eine Stunde gestohlen. Und wenn im Herbst die Uhr erneut umgestellt wird, sind wir glücklich über die eine Stunde, die unser Wochenende diesmal länger ist. Das »White Night«-Festival im südenglischen Brighton und die parallel dazu konzipierte »Nuit Blanche« im französischen Amiens widmen sich der Frage, wie diese zusätzliche Stunde mitten in der Nacht genutzt werden kann. Alles ist möglich – vom Musikhören im Aquarium bis hin zum Strickkurs in einer Bar. Obwohl wir vom Verstand her wissen, dass diese zusätzliche Stunde nur ein Trick der Uhr ist, haben wir doch das Gefühl, Zeit zu verlieren oder zu gewinnen, was erneut zeigt, dass unser Verhältnis zur Zeit stark auf Illusionen beruht, produziert von unserem eigenen Gehirn.
Im Jahr 1917 führten zwei Wissenschaftler mit den großartigen Namen Boring und Boring ein Experiment durch, bei dem sie schlafende Leute weckten und aufforderten, die Uhrzeit zu schätzen, was die Teilnehmer (auch Herr und Frau Boring selbst) in der Regel bis auf 15 Minuten genau schafften. Nur kann das nicht jeder. Wo die meisten von uns die Zeit für etwas Rätselhaftes halten, ist sie für manche sogar vollkommen unergründlich. Eleanor ist 17 und erzählt mir, dass sie die Zeit nie »kapiert« hat. Sie weiß, dass sie das Verstreichen der Zeit nicht so wie andere Leute beurteilen kann oder wahrnimmt. Wenn sie morgens aufwacht, hat sie – im Gegensatz zu den Testpersonen von Boring und Boring – nicht die geringste Ahnung, wie spät es ist, und das bleibt auch den ganzen Vormittag lang so. Sie spürt einfach nicht, wie die Zeit vergeht. »Bis zum Mittag weiß ich nicht, wie spät es sein könnte, dann kriege ich langsam Hunger. Ich halte ständig Ausschau nach solchen Hinweisen, um zumindest grob zu wissen, wie viel Zeit vergangen ist.« In der Schule, wo Mitschüler und Lehrer in etwa sagen können, wie spät es ist, liegt sie mit ihrer Einschätzung oft mehrere Stunden daneben. Ohne den Blick auf die Uhr weiß sie nicht, ob der Unterricht gerade begonnen hat oder aber bald zu Ende ist. Unabsichtlich lässt sie ihre Mutter am vereinbarten Treffpunkt warten, weil sich die Zeit nicht so anfühlt, als würde sie vergehen – weshalb Eleanor auch vergisst, auf die Uhr zu sehen. Früher mussten unter ihrem Unvermögen nur ihre geduldigen Eltern leiden, aber jetzt, wo es immer wieder Prüfungen gibt, erkennt sie langsam die Probleme, die durch ihre fehlende Zeitwahrnehmung entstehen. Während andere Schüler sich genau einteilen, wie viel Zeit sie für jede Frage haben, erkennt Eleanor nur durch den Blick auf die Uhr, dass sie jetzt besser die nächste Aufgabe angeht. Ihr Fall zeigt deutlich, dass nicht alle Menschen die gleiche Vorstellung von Zeit haben. Eleanor ist außerdem Legasthenikerin, was ihre Probleme bei der Zeitwahrnehmung vielleicht erklären könnte. Zwischen beiden besteht eine hochinteressante Verbindung, auf die ich im Rahmen der Frage, wie das Gehirn die Zeit misst, zurückkommen werde.
Für Eleanor liefert die Zeit also ständig Überraschungen, aber auch für uns kann das hie und da recht irritierend sein. Wenn wir etwa so verwundert wie besorgt feststellen, dass das Wochenende wie im Flug vergangen ist und die Kinder von Freunden schon wieder ein Stück gewachsen sind, oder fast verzweifeln, wenn in der Schlange am Flughafen auch die Zeit stillzustehen scheint. Stellen Sie sich vor, Sie sehen die letzten fünf Minuten eines Fußballspiels – und wie unterschiedlich die Zeit vergeht, je nachdem, ob die von Ihnen favorisierte Mannschaft am Gewinnen oder Verlieren ist. Wenn sie 1:0 zurückliegt, können die fünf Minuten gar nicht lang genug sein. Führt sie aber 1:0, dehnen sich die fünf Minuten ins Endlose, und das gegnerische Team hat viel mehr Torchancen als verdient. Denken Sie an eine Reise und daran, dass der Heimweg immer kürzer zu sein scheint als der Hinweg. Ohne neue Eindrücke, die die Zeit füllen könnten, kommt einem alles bekannt vor. Anders ist es nur, so der amerikanische Philosoph und Psychologe William James, wenn man in den eigenen Fußstapfen zurückgeht, weil man etwas verloren hat. Dann kommt einem der Rückweg endlos vor.
Wenn Kinder älter werden, können sie diese Mysterien der Zeit nach und nach selbst beobachten. Ich habe zwei Brüder befragt, was ihnen am Vergehen der Zeit aufgefallen ist. »Wenn man zwei Minuten lang die Zähne putzen soll, dann kommt einem das lang vor, aber wenn man fernsehen will, sind sie schnell vorbei«, sagte der achtjährige Ethan. Sein zehnjähriger Bruder Jake meinte: »Wenn man im Auto wartet, bis jemand vom Einkaufen zurückkommt, dauert das länger, als wenn man selbst einkaufen geht.« Diese Kinder haben bereits bemerkt, dass Zeit etwas vollkommen Subjektives ist. Unser Zeitempfinden kann auch davon abhängen, wie wir uns körperlich fühlen. Der Psychologe John Bargh gab Menschen Anagramme zum Auflösen und stoppte im Anschluss, wie lange sie für den Weg zum Lift brauchten. Die Hälfte der Testpersonen bekam Begriffe aus dem Alltag zum Lösen, die andere hingegen Wörter, die mehr mit älteren Menschen in Verbindung gebracht werden, etwa »grau« oder »Bingo«. Als Letztere zum Lift gingen, hatten diese zarten Andeutungen des Alters sie so beeinflusst oder »geprimed«, dass ihr Zeitempfinden verändert war und sie sich langsamer bewegten.[7]
Welches sind also die Hauptfaktoren dafür, dass sich die Zeit verzerrt? Der erste sind unsere Emotionen. Eine Stunde beim Zahnarzt fühlt sich anders an als die letzte Stunde vor einer Deadline. Wenn wir Bilder von heiter wirkenden Menschen ansehen, wissen wir ziemlich genau, wie lange wir sie betrachtet haben, aber man zeige uns Leute mit Angst im Gesicht, und schon überschätzen wir die Zeit, die vergangen ist. Wie sehr die Macht der Gefühle unsere Zeitwahrnehmung verzerrt, zeigt sich am besten in einer weit dramatischeren Form – in der Verlangsamung der Zeit beim Kampf ums Überleben. Wenn man wie Chuck Berry vom Himmel fällt und um sein Leben fürchtet, wird die einzelne Minute elastisch, dehnbar und vom Gefühl her so lang wie eine Viertelstunde.
Wenn man Angst hat, vergeht die Zeit langsamer
Alan Johnston wusste schon lange, dass man als ausländischer Journalist Gefahr läuft, in Gaza gekidnappt zu werden. Er hatte diese Möglichkeit gedanklich bereits durchgespielt, noch bevor sie Wirklichkeit wurde. Als es dann soweit war und er einen Mann mit vorgehaltener Pistole aus einem Auto aussteigen sah, dachte er unwillkürlich: »So fühlt es sich also an, wenn man gekidnappt wird, nur stelle ich es mir diesmal nicht bloß vor.« Ab da passierten die Dinge in Zeitlupe. »Man kann fast einen Schritt zurücktreten und sich selbst dabei zusehen«, erzählte er mir.
Ein paar Wochen nach seiner Gefangennahme gaben ihm seine Kidnapper ein Radio. Eines Abends hörte er im BBC World Service eine Meldung, die eine weitere Verlangsamung der Zeit bewirkte. »Sie sagten, ich sei getötet worden.« Er überlegte, ob die PR-Abteilung seiner Kidnapper womöglich übereifrig agiert und diese Meldung zu früh nach draußen gegeben hatte. War es das, was heute Abend auf dem Programm stand? »Wahrscheinlicher war, dass sie mich am Leben lassen wollten, denn so war ich ihnen einfach nützlicher. Aber wenn du im Dunklen liegst und hörst, dass die Nachricht von deinem Tod in die Welt gesendet wird, dann überlegst du dir schon, ob sie das vielleicht wirklich vorhaben. Ob es heute vielleicht soweit ist.« Für Alan war dies die längste Nacht in seiner knapp viermonatigen Gefangenschaft. Die Zeit wurde definitiv langsamer.
Wenn Menschen Angst haben, sie könnten sterben – ob in einer Situation wie der von Alan, in einem abstürzenden Gleitschirm wie Chuck Berry oder bei einem Verkehrsunfall –, dann berichten sie oft, dass das Geschehen viel länger dauerte als in Wahrheit möglich oder tatsächlich der Fall. Irgendwie gelingt es ihnen in den wenigen Sekunden, im Kopf ganz viele Dinge sehr detailliert durchzugehen. Sie denken an die Vergangenheit, stellen Überlegungen zur Zukunft an und durchkämmen gleichzeitig ihr Gedächtnis nach irgendwelchen Informationen, die ihnen vielleicht das Leben retten könnten. Dieses Erlebnis der Zeitentschleunigung durch Angst ist wohlbekannt und ganz normal, und wenn man sich fürchtet, kann sich die Zeit auch in nicht-lebensbedrohlichen Situationen verzerren. Als man Testpersonen mit einer Spinnenphobie sagte, sie sollten 45 Sekunden lang Spinnen betrachten (bewundernswert, dass sie sich auf dieses Experiment überhaupt erst eingelassen haben), überschätzten sie die verstrichene Zeit erheblich. Dasselbe passierte bei Fallschirm-Novizen. Wenn sie anderen dabei zusahen, schätzten sie den Sprung jeweils recht kurz ein. Sobald sie dann selbst an der Reihe waren, schien die Zeit viel langsamer zu vergehen, und sie gaben deutlich mehr Minuten an, als sie tatsächlich in der Luft verbracht hatten.
Leute, die von Türmen geworfen werden
Ist diese Entschleunigung der Zeit eine Einbildung oder verlangsamt sich bei einer befürchteten Lebensgefahr tatsächlich der Prozess, mit dem wir die erlebte Zeit verarbeiten? Wenn das Gehirn im Zustand der Angst die Zeit anders verarbeitet, dann müsste es auch den Anblick von Dingen verarbeiten können, die im Normalzustand zu schnell und demnach nicht wahrnehmbar sind. Um dahingehend Klarheit zu gewinnen, muss man nur Leute in Todesangst versetzen und sie in dem Zustand einen Test machen lassen. Ein gewisser Herr wusste, wie das geht, und war auch bereit, sich gemeinsam mit seinen tapferen Versuchskaninchen selbst ordentlich ins Zeug zu legen (was bei den Forschungen zur Zeitwahrnehmung eine Art roten Faden bildet).
Am Tag des Experiments gab es starken Wind. Ideale Bedingungen also. Für die 23 Freiwilligen, die hoch über einem texanischen Rummelplatz standen, sorgte das in einer ohnehin schon bedenklichen Lage noch für einen Schuss Extra-Furcht. Für das Gelingen dieses Experiments war echte Angst nötig. Der Neurowissenschaftler David Eagleman vom Houstoner Baylor College of Medicine (von ihm stammt auch der Bestseller Fast im Jenseits, der sich mit ausgedachten Geschichten über das Leben nach dem Tod beschäftigt) bat seine Versuchspersonen, von der Kante wegzubleiben, bis sie einer nach dem anderen durch einen zehn Meter hohen Metallkäfig hindurch ganz nach oben klettern konnten. Per Funk erkundigte er sich beim Bodenteam, das sich 50 Meter unter ihnen befand, ob alles in Ordnung sei, und wandte sich dann einer Reihe digitaler Armbanduhren mit großer Anzeige zu. Diese Wahrnehmungs-Chronometer waren so eingestellt, dass sie blitzartig zwischen zwei Displays mit zufällig gewählten Zahlen hin und her wechselten. Sie blinkten so schnell, dass ausschließlich Geflacker zu erkennen war. Eagleman wollte herausfinden, ob die Sinneswahrnehmung der Teilnehmer durch Angst vielleicht so sehr beschleunigt wurde, dass sie die Zahlen, die das Gehirn im Ruhezustand nicht registriert, tatsächlich lesen konnten. Vielleicht wird ja nicht die Zeit langsamer, wenn wir uns fürchten, sondern unser Gehirn schneller.
Eagleman hatte zuvor bereits versucht, die Teilnehmer mit der Achterbahn fahren zu lassen, aber dabei wurden sie einfach nicht ängstlich genug – wenn sie es zum Teil nicht sogar genossen. Drastischere Maßnahmen waren nötig – wie etwa der freie Fall. Eagleman wusste, dass niemand mitmachen würde, wenn er nicht selbst Bereitschaft zur Teilnahme zeigte. Gut angegurtet wurde er nach hinten geworfen (nach vorne war nicht beängstigend genug). Dann machte er es noch einmal. Und noch einmal. Vor dem dritten Versuch hatte er geglaubt, die Angst würde abnehmen – durch die Erfahrung würde sein Gehirn ja sicherlich wissen, dass nichts zu befürchten war. Aber nein, erzählte er mir: »Das war nach wie vor schlimmer als schlimm.« Dann kam die Reihe an einen jungen Mann namens Jesse Kallus. Genau wie vor ihm Eagleman wurde auch Jesse von der Turmspitze geworfen, und als man ihn unten dann sicher auffing, hatte seine Höchstgeschwindigkeit 100 km/h betragen.
Jeder der Teilnehmer berichtete später, die Zeit hätte sich vollkommen verlangsamt angefühlt. Durch den Fall dehnte sich jede einzelne dieser furchtbaren Sekunden ins Unendliche. Das erste Element des Versuchs hatte also funktioniert – der gewünschte Effekt einer subjektiven Zeitausdehnung war eingetreten. Aber die Zahlen auf dem Display flackerten viel zu schnell, als dass das Gehirn sie hätte identifizieren können. David Eagleman konnte zeigen, dass die Zeit weder langsamer wird, wenn wir uns fürchten, noch dass die Verarbeitung im Gehirn sich beschleunigt. Was sich verändert, ist unsere Wahrnehmung der Zeit – unsere »Mind Time«.
Aber wie geschieht das? Es ist wahr, dass sich durch Angst starke Erinnerungen im Gehirn einprägen, und tatsächlich ist das Gedächtnis – wie im Verlauf dieses Buchs klar werden wird – einer der Hauptfaktoren bei der Zeitverzerrung. Wenn man Leuten ein Video mit einem Bankraub zeigt, der gerade mal 30 Sekunden gedauert hat, behaupten sie zwei Tage später, die Aktion sei fünf Minuten länger gewesen. Je verstörender das Video ist, desto mehr überschätzen sie seine Dauer.[8] Nach einem stressigen Ereignis erinnern wir uns meist ganz genau an die Einzelheiten dessen, was wir gesehen, gehört und sogar gerochen haben. Die Vielfalt und Neuartigkeit dieser Erinnerungen beeinflussen unser Gefühl dafür, wie lange etwas gedauert hat. Wir lernen, eine bestimmte Menge an Erinnerungen in einen bestimmten Zeitrahmen zu packen. Damit kommen wir weitgehend klar, aber in einer lebensbedrohlichen Situation führt die Intensität des Erlebten zu einem Überschuss an Erinnerungen. Jede Sekunde fühlt sich vollkommen neuartig an, was uns den Eindruck vermittelt, das Ereignis hätte länger gedauert, als es tatsächlich der Fall war – als hätte es in Zeitlupe stattgefunden. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass sich das Gehirn in Situationen wie etwa einem Autounfall auf die Dinge konzentriert, die zum Überleben nötig sind, und Nebensächlichkeiten wie die Umgebung, die Abfolge der Songs im Radio oder die Anzahl der vorbeifahrenden Autos komplett wegfiltert. All dies würde normalerweise dazu beitragen, dass die verstrichene Zeit geschätzt werden kann. Ohne Details kommt es eben zu einer Zeitverzerrung.
Die große Frage ist, ob die Kombination aus vielfältigen Erinnerungen und fehlenden Details ausreicht, um die Zeit so drastisch zu verlangsamen. Vielleicht trifft eine radikalere Erklärung zu: Ist es möglich, dass die Art und Weise, mit der das Gehirn die Zeit misst, ihm das Gefühl gibt, sie würde sich verlangsamen? Gesetzt den Fall, das Gehirn würde die Zeit messen, indem es seine eigenen Verarbeitungsprozesse »beobachtet«, dann würde es in einer Notsituation, wenn alles wahnsinnig schnell geht, mehr »Beats«, also Taktschläge und Eindrücke, zählen und dadurch glauben, es sei auch mehr Zeit vergangen. Ist also das Gehirn am Rasen, um sich zu retten, dann ist das gleichzeitig auch seine Uhr. Ich werde im nächsten Kapitel darauf zurückkommen. Zuvor betrachten wir aber noch ein paar andere kuriose Faktoren, die eine Verzerrung der Zeit bewirken. Die lebensbedrohlichen, von rasenden Gedanken erfüllten Momente höchster Konzentration sind nicht die einzigen Auslöser einer Verlangsamung. Auch das Gegenteil davon – wenn es nichts gibt, worauf man sich konzentrieren kann, und man sich schlicht und einfach langweilt – hat einen ähnlichen, wenngleich nicht ganz so extremen Effekt, genau wie eine Reihe anderer Erlebnisse.
Kein besonders nettes Experiment
Nehmen wir an, Sie nehmen an einer Studie teil. Beim Eintreffen wissen Sie zwar, dass sie im Fachbereich Psychologie durchgeführt wird, nicht aber, worum es genau geht. Es gibt fünf weitere Teilnehmer, von denen jeder ein Namensschild trägt. Alle machen einen netten Eindruck, wirken aber gleichzeitig unsicher, was jetzt passieren wird. Die Frau, die den Versuch leitet, sagt, dass Sie sich zunächst einmal kennenlernen sollten, und gibt Ihnen ein Blatt mit Themen, über die gesprochen werden soll: den Ort auf der Welt, den Sie am liebsten besuchen würden; Ihr peinlichstes Erlebnis; was Sie wählen würden, wenn Sie einen Wunsch frei hätten; und so weiter. Also erzählen Sie sich gegenseitig schreckliche Erlebnisse wie das mit der elektrischen Haarbürste, die sich bei der Vorbereitung auf eine Hochzeit in den Haaren verfing, sodass Sie mit herabhängendem Kabel die Straße entlanggehen mussten (mir ist das einmal passiert). Der Psychologe sagt, Sie würden paarweise zusammenarbeiten, und um die Dinge zu erleichtern, sollen Sie zwei Teilnehmer nennen, mit denen Sie das am liebsten machen würden. Das ist leicht. Sie füllen den Zettel aus und warten, wen Sie zugeteilt bekommen. Als Sie dann hineingerufen werden, sehen die Versuchsleiter ganz bedröppelt aus und sagen, dass niemand Sie als Wunschpartner angegeben habe. So etwas, sagen sie weiter, sei ihnen noch bei keinem einzigen ihrer Versuche untergekommen, weshalb sie es für das Beste halten, wenn Sie den Test doch besser alleine machen. Sie sind ein bisschen überrascht und – wenn Sie ehrlich sind – auch verletzt, aber Sie sagen sich, dass Ihnen die Meinung wildfremder Leute ziemlich egal sein kann und Sie sie ja sowieso nicht besonders sympathisch fanden. Sie lassen sich nicht anmerken, dass Sie sich ärgern, und machen den Test, so gut es geht. Als Erstes lässt man eine Stoppuhr laufen, und Sie sollen raten, wie viel Zeit vergangen ist.
Während Sie aber dasitzen und sich fragen, warum keiner Sie mag, ist Ihnen verborgen geblieben, dass auch die anderen Teilnehmer jeweils einzeln in ein Zimmer gebracht wurden, die Hälfte mit der gleichen Begründung wie bei Ihnen, die andere mit dem Hinweis, sie seien von jedem der anderen ausgewählt worden, was eine gerechte Aufteilung unmöglich mache. Ein derber Test, wie Sie vielleicht finden, aber noch lange nicht so derb wie der, der in der Versuchsreihe später durchgeführt wurde und bei dem man den Teilnehmern sagte, anhand ihrer Angaben zur Person sei ersichtlich, dass auch bei mehreren Eheschließungen keine dieser Beziehungen von Dauer sein würde und sie mit allergrößter Wahrscheinlichkeit im Alter einsam sein würden. Ich möchte an dieser Stelle hinzufügen, dass im Anschluss jeweils erklärt wurde, alles sei nur erfunden gewesen.