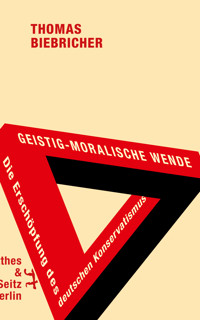25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Damit alles bleibt, wie es ist, muss sich alles ändern.« Der berühmte Satz aus dem Roman Der Leopard ist so etwas wie das inoffizielle Motto des gemäßigten Konservatismus. Parteien wie die CDU arrangierten sich mit Veränderungen und erwiesen sich als Anker der Stabilität. Heute ist nicht mehr sicher, ob die rechte Mitte hält: Setzen ihre Vertreter weiterhin auf Ausgleich und behutsame Modernisierung? Oder auf polarisierenden Kulturkampf?
In der Bundesrepublik waren die letzten Merkel-Jahre von unionsinternen Richtungsstreits geprägt. Doch nicht zuletzt der Aufstieg Donald Trumps hat gezeigt, dass die Identitätskrise der rechten Mitte kein exklusiv deutsches Phänomen ist: In Italien füllten Berlusconi und radikal rechte Parteien wie Giorgia Melonis Fratelli d’Italia das durch die Implosion der Democrazia Cristiana entstandene Vakuum. In Frankreich spielen die Républicains zwischen Macron und Le Pen kaum noch eine Rolle. Und die Tories versinken nach dem Brexit-Chaos in Unernst und Realitätsverweigerung. Thomas Biebricher widmet sich dieser internationalen Dimension und zeichnet die turbulenten Entwicklungen seit 1990 nach. Seine Befunde sind auch deshalb brisant, weil sich am gemäßigten Konservatismus die Zukunft der liberalen Demokratie entscheidet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 912
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Thomas Biebricher
Mitte/Rechts
Die internationale Krise des Konservatismus
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der Originalausgabe, 2023.
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Brian Barth
eISBN 978-3-518-77534-9
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Einleitung
Rechts der Mitte
Konservatismus – gemäßigt und radikal
Krisenhypothesen und die Logik des Vergleichs
I
. Italien
Präludium: Die Implosion der Democrazia Cristiana und das Ende der Ersten Republik
1. Berlusconismus: Markteintritt und erste Jahre in der Opposition
Lega Nord: Radikalisierung
Alleanza Nazionale: Entradikalisierung
2. Casa delle Libertà: Die Rückkehr des Centrodestra an die Macht
3. Das Ende der Ära Berlusconi
Das Ende der Zweiten Republik? Der Centrodestra in der Opposition
4. 2018 und danach: Zwischen Populisten und Technokraten, Corona und Ukraine
Coronapolitik
II
. Frankreich
1. Die Ära Chirac
Drei Familien der französischen Rechten
Der Triumph des Centre-droit
Erste Krisen der rechten Mitte
Die Rückkehr Le Pens und die Konsolidierung der rechten Mitte
Stabwechsel
2. Sarkozy und der Sarkozyismus
Sarkozyismus in der Praxis
Der Niedergang der rechten Mitte
Opposition: (Kurzer) Wiederaufstieg und (langer) Fall
3. Zwischen Macron und Le Pen
Countdown to Extinction – Les Républicains und der Absturz der rechten Mitte
Chronik eines aufgeschobenen Todes
III
. Großbritannien
1. Im langen Schatten der Eisernen Lady: John Major
Back to Basics
2. Der Post-Thatcherismus in der Opposition: Von William Hague bis David Cameron
David Cameron und die Erfindung des Civic Conservatism
3. Der Weg in den Brexit
Into the Maelström
Zusammenfassung
Und in Deutschland?
Ausgewählte Literatur
Bildnachweise
Dank
Register
Fußnoten
Informationen zum Buch
Einleitung
Am 22. Oktober 2022 empfing der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella Giorgia Meloni im Quirinalspalast, um sie zur Ministerpräsidentin zu ernennen, nachdem ihre Partei Fratelli d'Italia die Wahlen am 25. September klar gewonnen hatte. Seitdem wird Italien von einer Koalition regiert, deren Seniorpartner eine postfaschistische (Fratelli d'Italia) und eine rechtspopulistische (La Lega) Partei sind. Zwei Tage später trat Liz Truss, die britische Premierministerin und Vorsitzende der Conservative Party, nach einer historisch kurzen Amtszeit von gerade einmal sechs Wochen zurück, nachdem ihre Regierung das Land mit einer radikalen, aber unausgegorenen Budgetpolitik beinahe ins Chaos gestürzt hätte. Truss war nach Theresa May und Boris Johnson bereits die dritte Vorsitzende der Tories, die ihren Hut nehmen musste, obwohl sie nie eine General Election verloren hatte, und hinterließ ihrem Nachfolger Rishi Sunak eine Partei, die von internen Kämpfen über den Brexit und ihre Positionierung im politischen Raum tief zerstritten, um nicht zu sagen zerrissen ist. Knapp zwei Wochen zuvor hatte die Nemesis der Konservativen, der ehemalige Ukip-Vorsitzende Nigel Farage, der Partei eine düstere Zukunft prophezeit: »Die Tories werden bei der nächsten Wahl ausradiert werden, genau wie 1997, und sie haben es zutiefst verdient.«[1]
Nur fünf Tage vor der Vereidigung Melonis wurde in Schweden Ulf Kristersson von der Moderaten Sammlungspartei zum Regierungschef gewählt. Er führt eine Koalition mit Liberalen und Christdemokraten, die aber über keine parlamentarische Mehrheit verfügt. Der bürgerlich konservative Kristersson muss sich daher auch auf die Stimmen der Schwedendemokraten stützen, einer einst aus rechtsextremen Milieus hervorgegangenen Partei, die auch heute noch am äußersten rechten Rand angesiedelt ist. Dementsprechend wird seine Regierung zu Konzessionen gezwungen sein, vor allem in der Innen- und Einwanderungspolitik. Etwa zwei Wochen nach dem Regierungsantritt Melonis fanden in den Vereinigten Staaten die Midterm-Wahlen statt, bei denen nicht nur Abgeordnete des Repräsentantenhauses und Senatoren, sondern auch Gouverneure in diversen Bundesstaaten gewählt wurden. Nach BBC-Recherchen traten für die Republikaner auf den diversen Ebenen mindestens 126 Kandidaten an, die explizit infrage stellten, dass Joe Biden der rechtmäßig gewählte Präsident ist und von denen einige sogar beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 präsent waren.[2] Den beeindruckendsten Sieg konnte Ron DeSantis feiern, der als Gouverneur von Florida in einem ehemaligen Swing State mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt wurde und der für einen Trumpismus ohne Trump steht: weniger erratisch und dafür womöglich wesentlich effektiver. Währenddessen tourten den ganzen Herbst über in Frankreich die drei Kandidaten für den vakanten Vorsitz der ehemals gaullistischen Partei Les Républicains durch die Kreisverbände. Der Slogan des späteren Siegers Éric Ciotti lautete: »La droite au cœur«;[3] einer seiner unterlegenen Rivalen, der Senator Bruno Retailleau, der selbst dem rechten Flügel der Partei zugerechnet wird, begründete seine Kandidatur ausdrücklich damit, Ciotti stehe zu weit rechts.[4] Diesem kommt nun die Aufgabe zu, zu retten, was von der ehemaligen Mitte-rechts-Macht noch zu retten ist, die bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Frühjahr 2022 verheerende Niederlagen erlitten und damit endgültig die Hegemonie über das Spektrum rechts der Mitte an den Rassemblement National von Marine Le Pen verloren hatte.
Was all diese Ereignisse innerhalb weniger Wochen schlaglichtartig dokumentieren, ist das Thema dieses Buchs: die internationale Krise des Konservatismus – genauer: die Schwächung, Radikalisierung oder das völlige Verschwinden der Kräfte eines gemäßigten Konservatismus, deren angestammter Platz in der rechten Mitte zusehends verwaist. Und obwohl der Fokus auf den Dynamiken in drei der wichtigsten europäischen Länder liegt – Italien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich –, so ist die Krise des Konservatismus doch auch in Deutschland angekommen, was sich ebenso schlaglichtartig illustrieren lässt: Die Wahl Melonis sorgte nämlich auch hierzulande für kontroverse Debatten, denn zum Wahlbündnis von Fratelli d'Italia und Lega gehört auch Silvio Berlusconis Forza Italia, und da diese nun einmal seit 1999 Mitglied der Europäischen Volkspartei (EVP) ist, hielt es deren derzeitiger Vorsitzender, der CSU-Politiker Manfred Weber, für eine gute Idee, zur Wahl der italienischen Schwesterpartei aufzurufen – auch wenn klar war, dass Berlusconi bei einem Sieg des Bündnisses einer Postfaschistin den Steigbügel halten würde. Damit stand Weber in einem gewissen Gegensatz zu seinem Vorgänger im Amt als EVP-Chef, dem Polen Donald Tusk, der noch im März die große Mitte-rechts-Partei Spaniens, den Partido Popular (PP), zumindest leise, wenn auch ein wenig treuherzig ermahnte, nachdem dieser in Kastilien-Leon mit der rechtsgerichteten Vox erstmals eine Koalitionsregierung gebildet hatte: »Ich hoffe, dass es sich nur um einen Unfall handelt.«[5] Jedenfalls war auch Webers Parteikollege Markus Söder nicht erfreut über dessen Wahlaufruf: Es könne nicht die Aufgabe »bürgerlicher Parteien« sein, »rechtsnationale und rechtsradikale Regierungen zu ermöglichen«, so der bayerische Ministerpräsident.[6] Jener bayerische Ministerpräsident, der selbst im Landtagswahlkampf 2018 zwischenzeitlich scharf nach rechts in Richtung AfD-Terrain abgebogen war. Beschwerden über die Wahlkampfhilfe für Forza Italia vonseiten Webers, der diese übrigens damit begründete, dass Berlusconi als bürgerlicher Anker einer Rechtskoalition fungieren werde, kamen auch von der CDU, die aber ihr ganz eigenes Problem mit Rechtsaußen hat. Am 11. November 2022 stimmten im thüringischen Landtag CDU- und AfD-Fraktion für den CDU-Antrag »Gendern, nein danke«, der mit dieser rechten Mehrheit tatsächlich angenommen wurde, und auch wenn die Berliner Zentrale danach von parlamentarischer Normalität sprach, war es das natürlich nicht: AfD-Flügel-Ikone Björn Höcke frohlockte und freute sich diebisch über die abermalige Verwischung der Grenzen zwischen rechter Mitte und rechtem Rand, schließlich war es ebenfalls im Erfurter Landtag gewesen, dass eine Mehrheit von FDP, CDU und AfD Anfang 2020 den Liberalen Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt hatte – wenn auch für gerade einmal 24 Stunden. Nur wenige Tage vor der gemeinsamen Abstimmung gegen das Gendern hatte sich just Mike Mohring zu Wort gemeldet, der damals als Fraktionsvorsitzender das Kemmerich-Desaster mitverantwortet hatte und danach alle Ämter verlor. Es ergebe wenig Sinn, so Mohring, »die AfD parlamentarisch durch Ausgrenzung zu überhöhen, ohne dass sie sich inhaltlich beweisen muss«,[7] womit er zumindest den Eindruck erweckte, am Kooperationsverbot mit der AfD zu kratzen, das die Bundespartei in der Folge des Erfurter Debakels 2020 beschlossen hatte. Und all diese Versuche der Aus- und Abgrenzung sowie, umgekehrt, der bewussten Grenzverwischung vollziehen sich natürlich vor dem Hintergrund eines langwährenden inhaltlichen Auszehrungsprozesses des deutschen Konservatismus und des damit verbundenen Profilverlustes der Christdemokratie, die sich im Wahlkampf 2021 besichtigen ließen. Darüber, dass die Krise des Konservatismus auch ein deutsches Phänomen ist, konnte also spätestens zu jenem Zeitpunkt kein Zweifel mehr bestehen. Und dass diese Krise andauert, verschärft durch die AfD-Konkurrenz von rechts, welche die Union vor allem in Ostdeutschland zu spüren bekommt, kaschieren auch die günstigen Umfragewerte einer Oppositionspartei nicht.
Nun könnte man sich auf den Standpunkt stellen, dass all dies Probleme für Konservative sind, aber eine zentrale Grundannahme der folgenden Ausführungen lautet, dass die Krise des Konservatismus eine nicht zu unterschätzende Rolle im Rahmen einer anderen Krise spielt, die weitaus mehr mediale und auch akademische Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat: die Krise der liberalen Demokratie, der sich allein in den letzten Jahren eine Vielzahl von Büchern gewidmet hat; von Yascha Mounks Der Zerfall der Demokratie über David Runcimans So endet die Demokratie sowie Wie Demokratien sterben von Steven Levitsky und Daniel Ziblatt bis hin zu einschlägigen Titeln im deutschen Sprachraum, wo zuletzt immerhin eine demokratische Regression diagnostiziert wurde.[8] Nimmt man diese unübersehbare diskursive Verdichtung als Maßstab, muss man zu dem Schluss gelangen, dass die Lage überaus ernst ist. Allerdings dürfte es angesichts der Fülle an Literatur auch nicht überraschen, dass sich die Befunde hinsichtlich der Ursachen teils erheblich unterscheiden, wenn nicht sogar widersprechen[9] – wobei eine der Gemeinsamkeiten darin besteht, dass sie den Permutationen des Konservatismus und den Dynamiken der rechten Mitte insgesamt wenig Beachtung schenken.
Aber ist dies nicht auch insofern gerechtfertigt, als es schlicht wenig plausibel erscheint, eine vermeintliche konservative Misere als Faktor für die Krise der liberalen Demokratie in Betracht zu ziehen? Schließlich agierte der Konservatismus, historisch gesehen, doch lange Zeit als der große Gegenspieler von Liberalismus und Demokratie. Und während viele Fürsprecher der liberalen Demokratie diese als Vehikel oder gar als Garant für eine progressive Politik ansehen, gelten Konservative als Skeptiker im Hinblick auf Fortschrittserzählungen, die den damit einhergehenden Versprechungen misstrauen, wenn sie als progressiv deklarierte Politik nicht gar aktiv bekämpfen. Ganz abgesehen davon, dass der Konservatismus aus mancher Perspektive als Marionette wirtschaftlicher Interessen erscheint und zudem als zentrales Ziel die Aufrechterhaltung hierarchischer Gesellschaftsstrukturen verfolge, was freilich mit allerlei Rhetorik über Tradition und Geschichte bemäntelt werde.[10] Man könnte also zunächst vermuten, dass ein im Niedergang begriffener Konservatismus eine der wenigen guten Nachrichten für die in Bedrängnis geratene liberale Demokratie und ihre Werteordnung darstellt – doch dies wäre entschieden zu kurz gegriffen.
Welch wichtige Rolle konservative Kräfte in der Formierungsphase (liberaler) Demokratien spielen, hat der Politikwissenschaftler Daniel Ziblatt herausgearbeitet, der zwei unterschiedliche Muster identifiziert, denen solche Entwicklungen historisch folgten:
Wir sehen, dass in einigen Ländern ein blitzartiger demokratischer Durchbruch in Wirklichkeit Teil eines relativ kontinuierlichen Demokratisierungsprozesses ist. Punktuelle Momente […] des demokratischen Wandels kumulieren sich im Laufe der Zeit und werden selbstverstärkend, indem sie Nachfrage nach weiteren solchen Momenten erzeugen und erfüllen. Im Zuge solcher Prozesse wird es immer schwieriger, die Demokratisierung wieder rückgängig zu machen. In anderen Ländern hingegen sind diese Durchbruchsmomente, wenn sie überhaupt auftreten, Teil von etwas, das man wohl am ehesten als ungesicherte Wege der Demokratisierung charakterisieren kann. […] Den Durchbrüchen geht häufig entweder ein völliger Zusammenbruch der Demokratie oder ein unterschwelliger autoritärer Rückfall voraus, ein Oszillieren der Regime, das einen dauerhaften demokratischen Wandel sowohl instabil als auch schwer fassbar macht.[11]
Ausschlaggebend dafür, welchen Pfad junge Demokratien beschreiten, sind laut Ziblatt gerade konservative Parteien, wie er am Beispiel der gelungenen Demokratisierung des Vereinigten Königreichs und dem Scheitern der Weimarer Republik ausführt. Nur gut organisierte und wirkmächtige konservative Akteure, die zumindest weite Teile der alten (ökonomischen) Eliten repräsentierten, konnten jenen angesichts massiver Verlustängste die Sicherheit bieten, die dafür sorgte, dass sie ihre Machtressourcen nicht gegen die noch fragile Demokratie mobilisierten. Anders formuliert, ist es also gerade die Stärke konservativer Kräfte, die laut Ziblatt eine gelingende Demokratisierung ermöglicht; fehlen diese Akteure, fragmentiert sich das Feld der rechten Mitte oder es kommt – womöglich als Folge – zu einer Radikalisierungsdynamik, dann verpuffen die progressiven Energien, und die Reaktion setzt sich durch. Ziblatt hat hier vor allem junge Demokratien im Sinn, aber die wichtige, wenn nicht gar entscheidende Rolle konservativer Akteure ist nicht auf diese frühe Phase beschränkt. Denn auch in konsolidierten liberalen Demokratien sind oftmals gerade sie es, die einer Politik zum Durchbruch oder zumindest zu breiter gesellschaftlicher Akzeptanz verhelfen, der sie aus ideologischen Gründen eigentlich ablehnend gegenüberstehen müssten. Das berühmteste Beispiel für dieses Paradoxon lieferte der glühende Antikommunist Richard Nixon, der 1972 völlig überraschend nach China reiste und die sogenannte »Pingpong-Diplomatie« initiierte. »Only Nixon could go to China« hat sich seitdem als Aperçu eingebürgert und verweist darauf, dass bestimmte Reformen und Initiativen bedeutend größere Chancen auf Erfolg haben, wenn sie von ihren vermeintlichen Gegnern ausgehen.[12] Die konservative Politikgeschichte enthält einige Beispiele für solch überraschende Parteinahmen: So waren es gerade in Kontinentaleuropa gemäßigt konservative, und zwar vor allem christdemokratische Parteien, die nach dem Zweiten Weltkrieg sozialstaatliche Strukturen auf- beziehungsweise ausbauten, und auch die europäische Integration wurde insbesondere von diesen Akteuren vorangetrieben, obwohl doch zu erwarten gewesen wäre, dass der im konservativen Spektrum weitverbreitete Patriotismus, wenn nicht gar Nationalismus einem solchen Unterfangen entgegenstehen würde – wobei allerdings hinzuzufügen ist, dass das Motiv hinter der Europäisierung für viele Christdemokraten gerade die Konsolidierung nach dem Krieg darniederliegender Nationalstaaten war.[13] Und selbst wenn Konservative sich nicht an die Spitze von Bewegungen setzen, die ihnen eigentlich fernstehen, hängt von ihrem Verhalten in starkem Maße ab, welchen Verlauf gesellschaftlicher Wandel nimmt, wie er in liberalen Demokratien – und nicht nur dort – nun einmal unvermeidlich ist: ob Veränderungen als Bedrohung codiert und Ressentiments gegen sie und typischerweise dann auch gegen sichtbare Minderheiten geschürt werden, die als Sündenböcke für alle unliebsamen Aspekte des Neuen herhalten müssen; oder ob Transformationen mit Skepsis und Vorbehalten, aber doch letztlich konstruktiv begleitet und gesteuert werden. Noch etwas pointierter ließe sich sogar die nicht zuletzt immer wieder auch von manchen Konservativen vertretene These formulieren, dass sich die Gestaltungsspielräume in dem Maß erweitern, in dem es starke und einflussreiche konservative Akteure gibt, die das Fundament für eine innovative Politik liefern, indem sie Transformationsprozesse moderieren und für das Gros der Bevölkerung materiell und ideell akzeptabel machen: Es sind gerade die schnellen Autos, so ein Bonmot des Politikwissenschaftlers Karl W. Deutsch, die besonders gute Bremsen brauchen, womit das paradox anmutende Bedingungsverhältnis von gesellschaftlicher Innovation und konservativer Politik auf den Punkt gebracht wird.
Und spielt der Konservatismus so schon eine wichtige Rolle für junge und reife Demokratien, gilt dies, a fortiori, erst recht für Demokratien, die mit dem Tod bedroht sind, wie es ja manche der oben erwähnten Titel für die Gegenwart nahelegen. Hier geht es weniger darum, ob konservative Akteure die konterrevolutionären Energien der Eliten eines Ancien Régime binden können, als vielmehr um die Frage, ob sie in der Lage sind, diejenigen in Schach zu halten, die wankende Regime im Namen von Rechtspopulismus, illiberaler Demokratie und Autoritarismus umstürzen oder doch zumindest bis zur Unkenntlichkeit entstellen wollen; ob sie gegenüber diesem Treiben in einer apathisch-passiven Haltung verharren oder ob sie sich gar auf die Seite dieser Kräfte schlagen und so der liberalen Demokratie den Todesstoß versetzen. Gerade die deutsche Geschichte verweist eindringlich auf die diesbezüglich entscheidendende Rolle konservativer Akteure; schließlich ist die Weimarer Republik nicht nur die Geschichte einer jungen Demokratie, sondern auch die einer jung gestorbenen, wobei den Konservativen nicht zu Unrecht die Rolle der Totengräber zugeschrieben wird. Zusammengefasst könnte man sich sogar dem Historiker Brian Girvin anschließen, der schreibt: »Eine demokratische Rechte ist eine notwendige Bedingung der Demokratie.«[14] Jedenfalls ist aber Jan-Werner Müller in seiner Einschätzung zuzustimmen: »Auch wer selbst keineswegs konservativ ist, hat ein Interesse daran, dass die Rechte innerhalb einer pluralistischen Demokratie deutliche Konturen zeigt – und sich gleichzeitig ganz klar vom Populismus abgrenzt.«[15]
Das Schicksal des Konservatismus geht also alle an, denen die Verteidigung der liberalen Demokratie und ihrer Potenziale am Herzen liegt, sei es aus der Überzeugung, dass sie die beste aller politischen Welten darstellt, oder aus der eher pragmatischen Sichtweise, dass sie zwar ihrerseits Schwächen hat, aber doch zum einen grundsätzlich offen erscheint für eine weitergehende »Demokratisierung der Demokratie«[16] und vor allem immer noch dem zu bevorzugen ist, was unter den aktuellen Vorzeichen wohl an ihre Stelle treten würde – vermutlich in etwa das Gegenteil aller radikaldemokratischen Visionen und einer »Demokratie im Präsens«,[17] auf die im linken Spektrum manche(r) hoffen mag. Vor diesem Hintergrund lautet die Grundannahme des vorliegenden Buches, zugespitzt formuliert, dass den Dynamiken der rechten Mitte nicht zuletzt und vor allem deshalb Aufmerksamkeit gebührt, weil sich hier das Schicksal der liberalen Demokratie entscheidet. Denn gerade in der heutigen und auch schon länger anhaltenden Konstellation einer Linken in der Defensive, über deren strukturelle Schwäche auch Überraschungserfolge wie der Sieg der deutschen Sozialdemokraten bei den Bundestagswahlen 2021 nicht hinwegtäuschen können, ist es die rechte Mitte, die zur politisch neuralgischen Zone wird – die aber in der Flut der Krisenliteratur eine eher marginale Rolle spielt. Die folgenden Ausführungen sollen diese Leerstelle füllen, indem sie diese Zone in einer vergleichenden Längsschnittanalyse ausleuchten und sich vor allem mit jenen Akteuren befassen, deren natürlicher Lebensraum sie ist und die heute zusehends vom Aussterben bedroht scheinen, falls sie nicht längst verschwunden sind: gemäßigte Konservative.
Rechts der Mitte
Die Rede von der rechten Mitte und einem dort ansässigen gemäßigten Konservatismus bedarf natürlich der weiteren Erläuterung, wobei die zentrale Frage lautet, wodurch genau sich ein gemäßigter Konservatismus auszeichnet und wovon er wie zu unterscheiden ist. Beginnen wir aber mit dem politischen Raum der rechten Mitte. Der offensichtlichste Einspruch gegen die Verwendung eines solchen Konzepts liegt vermutlich in der fehlenden analytischen Schärfe begründet, verbunden mit einer problematisch anmutenden Eindimensionalität.
Es steht außer Frage, dass die politische Mitte als analytisches Konzept insofern mit einigen Schwierigkeiten behaftet ist, als wir es hier mit einer alles andere als unschuldigen Vorstellung zu tun haben. Die Mitte ist schließlich keine rein deskriptive Bezeichnung einer arithmetischen oder geometrischen Größe.[18] Vielmehr handelt es sich schon seit der Antike um eine politische Normvorstellung, die dementsprechend normativ aufgeladen ist. Bereits bei Aristoteles sind Mitte und Maß Leitideen, die es anzustreben gilt, und bis in die heutige Zeit hat der Zweiklang aus Maß und Mitte insbesondere im konservativen Spektrum nichts von seiner Anziehungskraft eingebüßt.[19] Die Mitte wird so zur immanenten Utopie des politischen Raums und entsprechend mythisiert als Ort, der inhärent den Rändern entgegengesetzt ist und mit einer Haltung korrespondiert, die allem Extremen und Überbordenden eine Absage erteilt.[20] Dabei muss man allerdings nicht Hegel sein, um die Dialektik zu erkennen, in der Mitte und Ränder zueinander stehen. Die Mitte grenzt sich vom Randständig-Extremen ab, und umgekehrt attackieren die marginalisierten Radikalen die Saturiertheit, Ambitionslosigkeit und das zutiefst Laue der Mitte, die nun einmal weder Fisch noch Fleisch ist. Beide bleiben dabei gegenseitig aufeinander angewiesen, um das Spiel der abgrenzenden Positionierung weiterhin spielen zu können, denn wo es keine Ränder gibt, ist auch keine Mitte. Damit wird aber zugleich klar, dass politische Landschaften, in denen alle Akteure in irgendeine alte oder neue Mitte streben, weil sie dort die viel beschworene Medianwählerin[21] vermuten, zu Problemen führen, da ihnen die Alternativen fehlen und man in der Eintönigkeit landet, was vor allem noch zu Beginn der nuller Jahre etwa Colin Crouch unter dem Stichwort der Postdemokratie und noch wesentlich schärfer Chantal Mouffe als Post-Politik kritisierte.[22] Seit einigen Jahren ist diese Sorge einer gänzlichen Vermittung jedoch in weiten Teilen des Diskurses der gegenteiligen Befürchtung gewichen, dass nämlich die Zentrifugalkräfte dermaßen angewachsen sind, dass die Mitte (und die Mittelschicht als ihre soziologische Trägerin) erodiert:[23] »Things fall apart; the centre cannot hold«, wie es in dem viel zitierten Gedicht The Second Coming von William Butler Yeats aus dem Jahr 1919 heißt. Dementsprechend müsse angesichts gesellschaftlicher Polarisierungs- und Spaltungstendenzen eine verloren gehende Mitte erst einmal wiederhergestellt und stabilisiert werden, weswegen es unbedingt erforderlich sei, »sich zur Mitte [zu] bekennen«, wie es etwa der Grüne Robert Habeck immer wieder von seiner Partei verlangt.[24] Die Magie der Mitte als politischer Sehnsuchtsort entfaltet also gerade unter den derzeitigen Diskursvorzeichen wieder ihre volle Wirkung, wobei sie insbesondere für Konservative dem Selbstverständnis nach ihr von jeher angestammtes Terrain darstellt: Wo wir sind, da ist die Mitte! Tatsächlich ist das Verhältnis von Konservatismus und Mitte, wie bereits angeklungen, ein durchaus enges. Man könnte sogar vermuten, dass die Mitte per se konservative Konnotationen mit sich führt, erscheint sie doch als Inbegriff dessen, was sich gegen die Neuerungen und Umwälzungen stemmt, die von den Rändern her herandrängen. »Sie [die Mitte] setzt auf Stabilität und bleibt skeptisch gegenüber den Verheißungen der Zukunft.«[25] Und gerade diese Unverbindlichkeit sowie tendenzielle Indifferenz gegenüber Verheißungen und Bedrohungen der Zukunft etwa in Form des Klimawandels machen Mitte und Mittelwege umgekehrt zum Angriffsziel derer, denen es um wünschenswerte oder schlicht existenziell notwendig erscheinende Veränderungen geht. Die berühmten Zeilen des Barockdichters Friedrich von Logau bringen es auf den Punkt: »In Gefahr und höchster Not bringt der Mittelweg den Tod.«
Gehört die »Mitte« also zu den voraussetzungsreicheren und bisweilen auch umstritteneneren Konzepten der »politologischen Geographie«,[26] so dürfte die Spezifizierung rechte Mitte beziehungsweise Mitte-rechts zunächst einmal nicht unbedingt dazu beitragen, diese Bedenken zu zerstreuen. Denn schließlich gilt es heute als politologische Binsenweisheit, dass das Links-rechts-Schema aufgrund seiner Unterkomplexität längst ausgedient hat, weshalb stattdessen ein mehrdimensionales Modell der politischen Landschaft eingefordert wird. An Differenzierungsmöglichkeiten besteht hier ja kein Mangel: Man kann sinnvollerweise zwischen materialistischen und postmaterialistischen Einstellungen etwa innerhalb des linken Spektrums unterscheiden, und auch für die Differenzierung zwischen einer autoritären und einer liberalen Linken lassen sich plausible Argumente anführen, wobei es wiederum beträchtliche Überlappungen zwischen materialistisch/autoritären Haltungen einerseits und postmaterialistisch/liberalen andererseits gibt.[27] Analoge Differenzierungen kann man rechts der Mitte vornehmen, und die Kritiker des Links-rechts-Schemas weisen darauf hin, dass sich so Konstellationen ergeben, in denen rechte und linke »Liberale« sich womöglich näher stehen als liberale und autoritäre Linke, so dass die Labels »links« und »rechts« ihre Aussage- und politische Zuordnungskraft weitgehend verlören.
Auf diese ja keineswegs haltlosen Bedenken lässt sich meiner Ansicht nach mit zwei Überlegungen reagieren. Die erste Frage ist dabei, welchen Grad an analytischer Schärfe wir von unserem politischen und politikwissenschaftlichem Vokabular erwarten (können). Es trifft sicherlich zu, dass sowohl die Terminologie der Mitte wie auch das Links-rechts-Schema Schwierigkeiten hätten, vor dem Tribunal der analytischen Philosophie zu bestehen – aber dies gilt für eine ganze Reihe weiterer Begrifflichkeiten, mit denen politische Akteure und ihre wissenschaftlichen Beobachterinnen hantieren, was mir auf den zentralen Punkt zu verweisen scheint, dass wir es mit einem Vokabular zu tun haben, das tief in Haltungen und Diskursen verankert ist; es handelt sich um die Idiomatik, in der politischen Identitäten Ausdruck verliehen und in der um die entsprechenden Selbst- und Fremdbeschreibungen gerungen wird. Auch wenn die Wissenschaft natürlich nicht einfach die Semantik der politischen Auseinandersetzung für bare Münze nehmen darf, muss sie doch registrieren, dass das Links-rechts-Schema ja keineswegs erst seit gestern infrage gestellt wird, dass es sich aber trotz der jahrzehntelang anhaltenden Kritik ob seiner vermeintlichen Obsoleszenz standhaft weigert, endlich obsolet zu werden und aus der politischen Sprache zu verschwinden:
Die Wahrnehmung politischer Unterschiede in der Terminologie von links und rechts konstituiert und reflektiert die Politik repräsentativer Demokratien durch eine natürlich erscheinende, aber historisch kontingente räumliche Metapher, die dauerhaft, alles durchdringend, allgemein und außergewöhnlich vielseitig ist und die das Prinzip endemischen und legitimen Konflikts zwischen gleichwertigen Alternativen verkörpert.[28]
Offensichtlich entfaltet dieses Vokabular trotz oder gerade wegen seiner Unterkomplexität nach wie vor eine nicht zu unterschätzende Orientierungswirkung und bezeichnet Familienzugehörigkeiten, die auch in der Gegenwart Bedeutung für die Akteure haben.[29] Die Politikwissenschaft tut meiner Ansicht nach daher gut daran, die Sprache, derer sich politische Subjekte bedienen, nicht ohne Weiteres als unscharf oder gar irreführend abzutun, sondern diese bei all ihren analytischen Schwächen ernst zu nehmen. Das bedeutet, dass sie reflektiert und im Bewusstsein der Probleme versuchen kann, diese Begrifflichkeiten in ihre Beschreibungen und Analysen aufzunehmen, ohne dass diese dadurch automatisch disqualifiziert würden.[30]
Auch im Hinblick auf das Vokabular der Mitte scheint mir seine analytische Schwammigkeit zumindest im vorliegenden Kontext nicht sonderlich bedenklich, im Gegenteil. Die (rechte) Mitte, um die es hier geht, ist eben gerade nicht in erster Linie ein mit den Instrumenten der demoskopisch-statistischen Kartografie exakt bestimmbares Terrain, sondern ein imaginierter und normativ überhöhter Raum, der ohne die mitlaufenden Assoziationen des Repräsentativen und des Normalen nicht annähernd so interessant wäre – weder aus der Perspektive Konservativer, die ihn für sich beanspruchen, noch auch aus der Perspektive der sozialwissenschaftlichen Beobachterin. Dass die Mitte-Terminologie dermaßen mit Bedeutung auf- oder gar überladen ist, stellt daher keinen Einwand gegen ihre Verwendung dar, vielmehr handelt es sich um eine Kategorie, die für das (Selbst-)Verständnis des Konservativen und daher auch seine (kritische) Analyse geradezu unabdingbar erscheint. Dies gilt natürlich nicht für jede Art von Konservatismus, wie ich noch erläutern werde, aber nach der hier vertretenen Auffassung stellt die rechte Mitte den politischen Raum dar, der auf der ideologischen Ebene mit einem gemäßigten Konservatismus korrespondiert. Dies führt uns zur zentralen und im Folgenden ausführlich zu erörternden Frage, wodurch sich ein solchermaßen spezifizierter Konservatismus auszeichnet und ob und gegebenenfalls wie er sich von anderen Varianten unterscheiden lässt.
Konservatismus – gemäßigt und radikal
Es versteht sich beinahe von selbst, dass es gewagt ist, von einem (gemäßigten) Konservatismus in dieser Allgemeinheit zu sprechen, denn für politische Ideologien gilt grundsätzlich, dass ihre Situiertheit in bestimmten raumzeitlichen Kontexten zu einer merklichen Variationsbreite in ihrer konkreten Ausbuchstabierung führt. Diese kaum zu leugnende Kontextualität von Ideologien ist besonders ausgeprägt im Falle des Konservatismus, wofür es systematische Gründe gibt, auf die ich weiter unten zurückkomme. Daher gilt es in der Konservatismusforschung als fragwürdig, vom Konservatismus im Allgemeinen zu sprechen, und dementsprechend geht es in diesem Buch ja auch und gerade um die Analyse der Entwicklung von Konservatismen in spezifischen Kontexten.[31] Dieser soll hier aber ein allgemeinerer Konzeptionalisierungsversuch vorangestellt werden, um einheitliche Terminologien und analytische Kategorien zu erarbeiten, die in der historisch-vergleichenden Untersuchung zum Tragen kommen können. Dieses Unterfangen einer allgemeinen Bestimmung des Konservativen kann sich nicht zuletzt auf die einflussreichen Arbeiten Michael Freedens stützen.[32] Sein »morphologischer« Ansatz in der Analytik von Ideologien, die er als mehr oder weniger systematische Konglomerate von aufeinander bezogenen Konzepten versteht, ist alles andere als unsensibel gegenüber ihren kontextuellen Ausprägungen und Modifikationen. Der englische Politikwissenschaftler vertritt allerdings die Meinung, dass diese Variationsbreite das betrifft, was er als periphere und anliegende (adjacent) Konzepte betrachtet, die in konzentrischen Kreisen um Kernkonzepte gelagert sind, die man aus der Fülle der eine Ideologie kennzeichnenden Vorstellungen als gemeinsamen Nenner herausdestillieren kann. Nimmt man etwa das Beispiel des Liberalismus, lässt sich Freedens Annahme folgendermaßen veranschaulichen: Zwar hat sich der Liberalismus in seiner Geschichte gelegentlich auf eine Allianz mit dem Nationalismus eingelassen, doch die Nation gehört sicherlich nicht zum Sine-qua-non-Katalog des liberalen Ideenhaushalts, sie ist ein peripheres oder bestenfalls ein anliegendes Konzept, das aber eben für das Verständnis unterschiedlicher Spielarten des Liberalismus in bestimmten Kontexten durchaus seine Bedeutung hat. Dagegen handelt es sich beim Individuum und seiner Freiheit um Kernkonzepte, ohne die ein wie auch immer gearteter Liberalismus als solcher unkenntlich würde, wobei hier im Sinne Freedens zu ergänzen wäre, dass sich die ideologische Substanz erst in dem Moment erschließt, wo geklärt wird, welche Konzeption(en) von Freiheit für den Liberalismus kennzeichnend sind – etwa ein negatives Freiheitsverständnis im Sinne Isaiah Berlins im Unterschied zu positiven Freiheitsbegriffen, bei denen es weniger um Abwehrrechte des Individuums als um seine tatsächliche Ermächtigung und Befähigung geht, das eigene Leben selbstbestimmt zu gestalten.
Ausgehend von dieser morphologischen Herangehensweise und aufbauend auf Freedens Untersuchungen zum Konservatismus sollen zunächst zwei Kernkonzepte herausgearbeitet werden, die für diese Tradition über die jeweiligen Kontexte hinweg prägend, ja unabdingbar sind. Auf dieser Grundlage wird es dann möglich sein, die für meinen Analyserahmen zentrale Unterscheidung einzuführen und zu begründen, nämlich die zwischen einem genuinen Konservatismus, der nach der hier vertretenen Meinung nur ein gemäßigter sein kann, und einem radikal-militanten, der, genau genommen, allenfalls als Grenzfall gelten kann und bestenfalls noch mit einem Fuß auf dem Boden des Konservatismus steht und diesen mit dem anderen ganz bewusst längst hinter sich gelassen hat – auch wenn er immer noch für sich selbst beansprucht, das Konservative zu repräsentieren, ja womöglich sogar den einzig wahren Konservatismus.
In meiner Lesart ist der Raum des Konservativen aufgespannt zwischen einem substanziellen und einem prozeduralen Pol. Dazwischen bewegt sich unabhängig von spezifischen Kontexten die konservative Ideenwelt, und abgesehen von einigen Grenzfällen lässt sich jede Variante konservativen Denkens auf der höchsten Abstraktionsebene als eine je unterschiedlich gewichtete Kombination aus diesen beiden Komponenten beschreiben. Beginnen wir mit dem substanziellen Pol, da er sich in direktem Anschluss an das Alltagsverständnis des Konservativen identifizieren lässt. Demgemäß ist Konservativen nämlich vor allem daran gelegen, etwas zu bewahren. Konservatismus leitet sich etymologisch vom lateinischen conservare ab, was sich als »erhalten« oder »bewahren« übersetzen lässt, und dieser archetypische Impuls kennzeichnet das Konservative auch schon, bevor es überhaupt so benannt wird; das entsprechende Label bürgert sich nämlich erst im 19. Jahrhundert ein und geht zurück auf die 1818 von François-René de Chateaubriand ins Leben gerufene Zeitschrift Le Conservateur. Dieser scheinbar simple Impuls wird zwar oft als symptomatisch für eine eher simpel gestrickte Geisteshaltung angeführt, welche dem Konservatismus gelegentlich auch den Spott seiner Gegner wie John Stuart Mill einbrachte, der seinerzeit die britischen Tories schlicht als »the stupidest party« etikettierte; in Wirklichkeit ist es aber alles andere als unkompliziert, konservativ sein zu wollen. Denn selbst wenn – zunächst einmal ins Ungenaue gesprochen – der Status quo aus Sicht des Konservatismus zu bewahren ist, so würde doch selbst der hartgesottenste Konservative nicht behaupten, dass alles Existierende zu erhalten ist, weil es existiert – auch wenn solche »positionalen« Deutungen des Konservatismus durchaus vertreten worden sind.[33] Es mag Menschen mit konservativen Neigungen geben, die etwa aus religiösen Gründen der Meinung sind, dass unheilbare Krankheiten einen Sinn haben, aber auch solche Konservative hätten wohl kaum etwas dagegen, wenn hier Heilungsmethoden entwickelt würden. Gerade in der protestantischen Tradition gilt die Welt als gefallen, doch die Gläubigen sind keineswegs dazu verpflichtet, dies zu akzeptieren, vielmehr handelt es sich um Herausforderungen, die, soweit möglich, auch tätig zu überwinden sind.
Der Erhalt des Status quo qua Status quo und damit auch in all seinen Facetten ist es also nicht, was Konservative antreibt. Stattdessen stellt sich ihnen die Frage, was genau und welche Aspekte des Seienden aus welchen Gründen als bewahrenswert gelten können. Spätestens hier wird also erkennbar, dass Konservativ-Sein bei näherem Hinsehen eine recht aufwendige Geisteshaltung ist, wenn sie diese Frage für sich beantworten will. Und daran gibt es letztlich selbst dann kein Vorbeikommen, wenn man den Konservatismus auf eine reine »Denkform« zu reduzieren versucht, die überhaupt nicht an bestimmte Inhalte gebunden und daher auch nicht auf der gleichen Ebene wie etwa Liberalismus oder Sozialismus angesiedelt sei. Zuletzt hat Andreas Rödder, einer der einflussreichsten Interpreten des zeitgenössischen Konservatismus im deutschen Kontext, immer wieder für eine solche Lesart plädiert. Der Konservatismus verfüge über »kein fixes Set von spezifischen Werten oder Inhalten und erst recht keine geschlossene politische Theorie. Was daraus folgt, ist eher eine Form des politischen Denkens mit bestimmten methodischen und inhaltlichen Grundlagen.«[34] Rödder greift mit einer solchen Deutung eine lange Tradition konservativer Selbstbeschreibungen auf, in der die eigene Haltung als pragmatisch-undogmatisch und damit im Gegensatz zu ihren intellektuellen und politischen Gegnern als dezidiert anti-ideologisch herausgestellt wird. Konservatismus ist demnach eben gerade keine Ideologie, sondern, wenn überhaupt, eine Art Anti-Ideologie; eine Weltanschauung des vermeintlich unverstellt nüchtern-skeptischen Blicks auf Menschen und Dinge, die dementsprechend auffallend positiv mit dem bescheuklappten Blick von Liberalen, Feministinnen oder Sozialisten kontrastiert, die im Endeffekt Gefangene ihrer ideologischen Festlegungen bleiben. Im konservativen Zugriff auf die Welt kommt dagegen der gesunde Menschenverstand zur Geltung, der Common Sense der normalen Leute, die der Mitte der Gesellschaft entstammen. Doch auch wenn Rödders Ausführungen zur Charakterisierung des Konservatismus und einer möglichen zeitgenössischen Ausbuchstabierung einiges für sich haben, kann diese entschlackte Interpretation des Konserativen als Denkform des skeptischen Pragmatismus doch nicht ganz überzeugen. Denn zunächst einmal ist natürlich die konservative Selbstbeschreibung als Nicht-Ideologie eine zutiefst ideologische, die mit der Selbstverortung in der unmarkierten Mitte korrespondiert. Zudem ist aber vor allem nicht erkennbar, wie dieser Denkform-Konservatismus das Problem der Identifizierung des Bewahrenswerten lösen soll. Rödder selbst verwahrt sich ebenfalls gegen die Vorstellung des Konservatismus als reflexhafter und völlig unspezifischer Bewahrungsimpuls, ist aber nicht in der Lage zu erklären, wie er zu seinen konkreten Positionierungen und Parteinahmen für oder gegen bestimmte Veränderungen gelangt (zum Beispiel Gleichberechtigung der Geschlechter ja, Quote nein), und kann dies auch nicht dadurch kaschieren, dass er im Endeffekt einen in erster Linie prozedural bestimmten Konservatismus skizziert, auf den wir weiter unten zu sprechen kommen. Der zentrale Punkt bleibt also, dass Konservative auf eine Instanz angewiesen sind, die ihnen die Frage nach dem Bewahrenswerten beantwortet. Und dies führt uns zum ersten Kernkonzept des Konservatismus, das ich als normative Natürlichkeit bezeichnen möchte.
Das konservative Denken kann nicht anders, als eine zumeist implizit bleibende und recht vage Vorstellung einer guten Ordnung zu hegen und so zumindest ansatzweise die Frage nach dem Bewahrenswerten zu beantworten; das heißt, nur die Aspekte des Seienden, die als Teil dieser guten Ordnung gelten können, sind auch tatsächlich erhaltenswert. Worauf sich diese Ordnung gründet, lässt sich unterschiedlich ausbuchstabieren. Im religiösen Register handelt es sich um eine göttliche Schöpfungsordnung, die zu bewahren ist; in stärker säkularisierten Varianten mag es eine naturrechtliche Ordnung sein. Daneben kann auch ein bestimmtes, nicht notwendig religiös geprägtes Menschenbild die Grundlage der Ordnungsvorstellung bilden oder aber geschichtliche Urgründe, auf denen das Bestehende gewachsen ist. Entscheidend ist jedoch, dass all diesen Begründungsfiguren ein Moment der Unverfügbarkeit innewohnt. Ihre Pointe besteht darin, dass bestimmte Grundkoordinaten nicht zur menschlichen Disposition stehen. Der Versuch, über sie verfügen zu wollen, würde eine Hybris verraten, die unweigerlich katastrophale Folgen nach sich zieht. Freeden hat dieses Element der Unverfügbarkeit mit der Charakterisierung des konservativen Kernkonzepts als eine transzendentale Begründung zu fassen versucht. Der entscheidende Punkt bleibt, dass es sich um eine externe Normquelle handelt, die unabhängig von menschlichem Dafürhalten existiert. In meiner Lesart kann man diese Normquelle allerdings noch etwas genauer spezifizieren, indem man nämlich darauf abhebt, dass das Gute hier ausnahmslos aus einer wie auch immer gearteten Natürlichkeit abgeleitet wird. Das Natürliche, verstanden als das Gottgewollte, Menschengerechte oder geschichtlich Gewordene, ist letztlich das Bewahrenswerte und liefert damit einen normativen Maßstab, anhand dessen das Bestehende eingeordnet werden können soll. Eine normativ aufgeladene Vorstellung des Natürlichen beziehungsweise eine normative Natürlichkeit ist damit als Kernkonzept der substanziellen Komponente des Konservatismus festzuhalten.
Im Prinzip scheint damit das zentrale Problem der konservativen Weltanschauung behoben, indem es der Autorität einer externen Instanz überantwortet wird, doch leider fehlt es diesen externen Instanzen zumeist ebenfalls an Klarheit und eindeutigen Beurteilungskriterien. Sicher, aus religiösen Traditionen wie auch aus anthropologischen Überlegungen mögen sich normativ ausgezeichnete Ordnungsvorstellungen ableiten lassen, diese bleiben zunächst freilich notwendigerweise vage und hochabstrakt und dürften aufgrund dessen zudem zum Gegenstand konfligierender Interpretationen werden. Konfrontiert mit der Frage, wie man sich aus konservativer Perspektive zu einer konkreten Initiative stellen soll, hilft der Verweis auf die luftigen Höhen einer überzeitlichen guten Ordnung zunächst wenig, ist hier doch eine nicht zu unterschätzende Übersetzungs- beziehungsweise Transferleistung notwendig, deren Resultat alles andere als über jeden Zweifel erhaben sein dürfte. Diese Misslichkeit einer zumeist im Ungefähren verharrenden normativen Natürlichkeit führt zu einer folgenschweren Eigenart der konservativen Phänomenologie, auf die schon Karl Mannheim in seiner klassischen Studie über den Altkonservatismus deutscher Prägung hingewiesen hat. Konservatismus, so Mannheim, dürfe keineswegs mit dem Traditionalismus des Immergleichen verwechselt werden. Seine Spezifik gewinne er aus der reflexiven Wendung eines reinen Traditionalismus: Verteidigen wolle der Konservatismus nämlich nicht unbedingt das, was zu den unhinterfragten Praktiken und Konventionen des Alltags gehört, denen habituell gefolgt wird, sondern das, was diesen Status bereits verloren hat und zum Gegenstand der kritischen Kontestation geworden und so konkret in seinem Bestand gefährdet ist: »Dieses originäre konservative Erleben wird da reflexiv, seiner Eigenart bewußt, wo in dem Lebensraume«, so Mannheim, »in welchem es vorhanden ist, bereits andersgeartete Lebenshaltungen und Denkweisen auftreten, von denen es sich in ideologischer Abwehr abheben muß.«[35]
Angesichts der zumeist nebulös bleibenden Ordnungsvorstellungen, die sich aus einer normativen Natürlichkeit herauslesen lassen, bleibt der Konservatismus also in gewisser Weise auf seine Gegner angewiesen, deren Angriffe die schemenhaften Vorstellungen überhaupt erst zu klaren Positionen und Gegenpositionen vereindeutigen. Nicht von ungefähr gilt die Französische Revolution als kollektiver Versuch der großflächigen Infragestellung und Transformation der Gesellschaft zwar nicht als Urszene des Konservatismus, dessen Anfänge weiter zurückreichen, aber doch als entscheidender Galvanisierungsmoment, durch den er sich als wirkmächtige politisch-intellektuelle Bewegung formiert und konsolidiert. All dies hat eine Reihe von Implikationen. Zunächst einmal wird an dieser Stelle deutlich, dass der Konservatismus einen wesentlich reaktiveren Charakter hat als etwa Liberalismus und Sozialismus. Natürlich beziehen alle politischen Ideologien einen Teil ihrer Identität aus ihren Gegnerschaften, aber diese Abhängigkeit erscheint im Fall des Konservatismus aus den genannten Gründen besonders ausgeprägt, was im Übrigen auch bedeutet, dass das Verschwinden mancher seiner Gegner für den Konservatismus nicht Anlass zu uneingeschränktem Jubel sein kann, sondern weitaus ambivalenter beurteilt werden muss. Zugleich ist es aber gerade dieser prononcierten Reaktivität geschuldet, dass der Konservatismus sich in so hohem Maß kontextspezifisch entwickelt: Seine Physiognomie hängt eben immer entscheidend von den konkreten Herausforderungen ab, mit denen er es hier und jetzt zu tun hat. Und die können in den jeweiligen nationalen Zusammenhängen bei allen sicherlich existierenden Parallelen durchaus unterschiedlich gelagert sein. Darüber hinaus führt diese Bezogenheit auf Antagonisten und deren Angriffe auf bestimmte Aspekte des Status quo zu einer letzten und womöglich folgenschwersten Konsequenz, die die konservative Erfahrungswelt in entscheidender Weise prägt.
Es handelt sich um das, was man zu Recht als die Tragik des Konservatismus bezeichnen kann, und die darin liegt, dass sich die Anstrengungen, die ein durch konkrete Infragestellungen des Status quo auf den Plan gerufener Konservatismus zu dessen Erhaltung unternimmt, nicht immer, aber doch sehr oft letztlich als vergeblich erweisen. Das Problem besteht darin, dass Konservative typischerweise nicht eigentlich das Bestehende zu verteidigen versuchen, wie es ihrem Selbstverständnis entspricht, sondern das Vergehende. Diese bereits ins Rutschen geratenen Traditionsbestände, die eben keine Bindungswirkung mehr entfalten, zu stabilisieren, erweist sich oftmals als aussichtslos oder es gelingt nur vorübergehend und auf eine Weise, welche die Pointe der normativen Natürlichkeit konterkariert. Denn das, was nun im Alltagsleben schon nicht mehr als selbstverständlich gilt, kann zwar noch aufrechterhalten werden, indem es etwa durch rechtliche Kodifikation und/oder staatliche Sanktionierung gestützt wird; aber bereits in dem Moment, wo ehemals habituell eingeübte Praktiken als erhaltenswert deklariert werden müssen, haben sie ja die Natürlichkeit verloren, die ihre normative Begründung liefern sollte. Das seiner traditionalen Autorität Entkleidete und im Vergehen Begriffene kann dann nur noch künstlich aufrechterhalten werden und so nicht mehr den normativen Status des Natürlichen beanspruchen, der es gerade auszeichnen sollte. Es handelt sich um eine rein simulierte und somit artifizielle Natürlichkeit.
Aber damit noch nicht genug der Schwierigkeiten, mit denen sich Konservative konfrontiert sehen. Denn es stellt sich natürlich die Frage, wie mit dieser alles andere als untypischen Situation umzugehen ist, in der sich alle Abwehrkämpfe zur Bewahrung eines bestimmten Aspektes des Status quo als aussichtslos erweisen und sich entsprechende Wandlungsprozesse nicht länger leugnen lassen. Es handelt sich, wie später noch deutlicher werden wird, um einen Schlüsselmoment der konservativen Erfahrung, in dem sich der spezifische Charakter des Konservativen zeigt. Wie geht man also damit um, wenn man, wie etwa der deutsche Konservatismus, jahrzehntelang dagegen angekämpft hat, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften einen eheanalogen Status erhalten, und sich nun plötzlich dem Faktum der gesetzlich kodifizierten Ehe für alle gegenübersieht? Grundsätzlicher formuliert: Wenn das Kernanliegen des Konservatismus in der Verteidigung einer aus dem Seienden zumindest im Prinzip herauspräparierbaren guten Ordnung besteht, was bedeutet es dann, wenn regelmäßig bestimmte Aspekte, die als Teil dieser Ordnung aufgefasst werden, wie etwa das natürlich-normative Leitbild dessen, was Familie ist und sein soll, verloren gehen? Hier gibt es im Prinzip drei Reaktionsmöglichkeiten, die wegweisend und prägend für eine jeweilige Spezifik des Konservativen sind. Konzentrieren wir uns an dieser Stelle zunächst nur auf die beiden, die meiner Ansicht nach genuin konservativ sind; auf die dritte komme ich weiter unten zurück.
Die erste Möglichkeit besteht darin, den stattfindenden Wandel mit einer Mischung aus Fatalismus und Lakonie zu quittieren. Aus dieser Perspektive erscheint die Geschichte insgesamt als ein Verfallsprozess, dem man sich zwar im Prinzip entgegenstellen kann, jedoch ohne jegliche Chance, ihn aufzuhalten. Von daher erscheint es angezeigt, diese Entwicklungen als unabänderliches Schicksal zu akzeptieren – ohne sie dadurch gutzuheißen. Im Gegenteil, die kulturpessimistische Haltung, die dieser Reaktion zugrunde liegt, bleibt ja ganz dezidiert auf Distanz zu den sinistren Prozessen der Modernisierung und Postmodernisierung. Aber sie hat sich in einem passivischen Ressentiment gegen die Gegenwart eingerichtet und kultiviert ihre tendenzielle Misanthropie, in die hier die konservative Skepsis umschlägt, im Rahmen eines ausgeprägten Privatismus. Denn – und das ist von entscheidender Bedeutung – dieser elegische Konservatismus erschöpft sich in der Klage über den Niedergang von Familie, Kirche sowie Kapitalismus und sieht keinerlei Möglichkeiten, diese Tendenz umzukehren, vielmehr erscheint dieser Geisteshaltung schon die bloße Ambition, eine solche Trendwende herbeizuführen, als heillos naiv und unvereinbar mit der nüchtern-illusionslosen Blickweise auf die Welt, die gerade diese Art von Konservatismus für sich in Anspruch nimmt. Hier wird die Absage an Fortschrittsnarrative und ihre Versprechungen auf die Spitze getrieben; nichts wird mehr gut, das Paradies ist und bleibt unwiederbringlich verloren, so lautet die Diagnose, die sich eine gedankliche Askese auferlegt und sich grundsätzlich jede Art von Zuversicht und Hoffnung auf eine bessere Zukunft in einer bemerkenswerten Hartleibigkeit versagt – um dann aber doch gelegentlich mit raunendem Unterton die vage Möglichkeit einer Art polittheologischen Erlösung anzudeuten, wohl auch um das tragische Bewusstein, von dem sich hier mit Nietzsche sprechen ließe, nicht in blanken Nihilismus kippen zu lassen. Im deutschen Kontext könnte man hier eine Linie ziehen, die von Oswald Spengler und seinen Vorläufern über Martin Heidegger bis zu Botho Strauß reicht.
Die zweite Möglichkeit, die sich Konservativen in Reaktion auf politische und gesellschaftliche Wandlungsprozesse bietet, kommt zwar ausdrücklich besser gelaunt daher, das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es die psychologisch wesentlich voraussetzungs- und entbehrungsreichere der beiden Optionen darstellt. Dem umwölkten Gemüt des Kulturpessimisten stellt diese Geisteshaltung die Forderung nach »guter Laune und Gelassenheit« (Rödder) im Umgang mit gesellschaftlichen Transformationsprozessen entgegen. Konservative dieser Couleur neigen mit einer nicht unerheblichen Nonchalance dazu, unliebsame Veränderungen hinzunehmen – und sich mit ihnen zu arrangieren. Man mag Neuerungen jahrelang bekämpft haben und sich gegen bestimmte Auflösungsprozesse ebenso lang im Namen des Status quo gestemmt haben, doch wenn diese Entwicklungen Wirklichkeit geworden sind, wischt man sich schulterzuckend den Mund ab und erklärt kurzerhand den neuen Status quo zur Geschäftsgrundlage des konservativen Projekts, der eben nun (in bestimmten Aspekten) zu verteidigen ist. Das für den deutschen Kontext sicherlich beeindruckendste Beispiel einer solchen Kehrtwende ist die Wandlung des Nachkriegskonservatismus, der 1945 nach zumindest in weiten Teilen jahrzehntelang gepflegter Feindschaft seinen Frieden mit Demokratie und – mit einiger Verzögerung – auch dem Liberalismus macht und beschließt, dass die rechtsstaatlich eingehegte Demokratie nun verteidigt werden muss, beispielsweise gegen die Achtundsechziger, die eine weitergehende Demokratisierung der Demokratie forderten. Es liegt nahe, an Figuren wie Konrad Adenauer als Repräsentanten eines solchen oftmals christdemokratisch eingefärbten Konservatismus zu denken, und dies trifft auch sicherlich zu, allerdings interessanterweise nicht nur wegen des mit Adenauer assoziierten Mottos »Keine Experimente« (der Wahlslogan, mit dem die CDU 1957 das beste Wahlergebnis ihrer Geschichte erzielte). Denn vor dem Hintergrund der hier etwas stilisiert dargestellten Geisteshaltung ließe sich auch das von Adenauer überlieferte Zitat »Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern« als quintessenziell konservatives Motto anführen. Man darf allerdings nicht vergessen, dass Adenauer hinzufügte: »Nichts hindert mich daran, klüger zu werden.« Und hier ist schon zu erkennen, dass es durchaus Versuche gibt, der Nonchalance dieses Konservatismus eine Deutung zu geben, die nicht unweigerlich auf reinen Opportunismus hinausläuft, sondern sie mit typisch konservativen Werten und Tugenden verbindet: »Liberale Konservative leben […] in dem Bewusstsein, dass das, was heute für unverrückbar richtig gehalten wird, morgen als völlig falsch erscheinen kann – so wie uns das, was gestern als richtig galt, heute oft merkwürdig und falsch vorkommt.«[36]
Es ist also die über alle konservativen Spielarten hinweg geteilte Skepsis gegenüber der Leistungsfähigkeit der menschlichen Vernunft, die hier zum Tragen kommen soll. Im Bewusstsein der Fehlbarkeit der Ratio und in Ablehnung ihrer doktrinären Überhöhung behält sich der Konservative vor, falschzuliegen und sein Urteil zu revidieren, ganz gemäß den Maximen des Kritischen Rationalismus eines Karl Popper. Aber bei aller fallibilistischen Veredelung dieser Flexibilität bleibt hier doch ein schaler Beigeschmack – und zwar insbesondere für Konservative: Schließlich gelten gerade unter ihnen Prinzipientreue und vom Zeitgeist unangekränkelte Standfestigkeit als nicht zu unterschätzende Tugenden. Man muss freilich nicht unbedingt konservativ sein, um die kognitiven Dissonanzen zu verspüren, die zwangsläufig mit diesen schmerzhaften Anpassungsprozessen verbunden sind, und die Tatsache, dass diese ja kein einmaliges Ereignis, sondern gewissermaßen ein Strukturelement der konservativen Erfahrung darstellen, hat manche Kommentatoren sogar dazu bewegt, die Idee des Konservatismus an sich infrage zu stellen: »Zu viele Geister haben aus zu vielen Gründen versucht, zu viele Dinge zu bewahren, als dass sich von einer kohärenten politischen Idee sprechen ließe.«[37] Aber auch wenn man nicht so weit geht, muss man doch festhalten, dass es eine bemerkenswerte Leistung ist, die diese Art von Konservatismus zu erbringen hat, um die eigene Haltung nicht gewissermaßen unintelligibel werden zu lassen. Denn warum genau würde man eigentlich einen Status quo verteidigen, der genau das beinhaltet, gegen das man sich vehement gestemmt hat – und zwar immer wieder aufs Neue? Die Antwort findet sich meiner Ansicht nach in einer Abwägung, die dieser Konservatismus unternimmt und dabei typischerweise zur immergleichen Schlussfolgerung gelangt, welche lautet: Es ist besser, diesen in zunehmendem Maße unvollkommenen Status quo zu akzeptieren, als die Stabilität der Verhältnisse dadurch zu gefährden, dass man vehement gegen bestimmte Neuerungen oder gar den durch diese gekennzeichneten neuen Status quo insgesamt opponiert. Gerade diese Parteinahme für den Metawert der Stabilität und die Bereitschaft, darüber bestimmte inhaltliche Überzeugungen bezüglich der Gestaltung der politisch-sozialen Welt zurückzustellen, macht vielleicht nicht das entscheidende, aber doch ein prägendes Element dessen aus, was ich als gemäßigten Konservatismus charakterisieren möchte und was sich in vielen Punkten mit dem deckt, was andere (wie im obigen Zitat Rödder) auf ebenso plausible Weise als Liberalkonservatismus etikettieren.[38] Konservativ sein heißt in diesem Sinne eben auch, die Disziplin aufzubringen, die eigenen Überzeugungen nicht absolut zu setzen und für das hohe, vielleicht höchste Gut der Stabilität noch die unappetitlichsten Kröten zu schlucken. Selbst der kulturpessimistische Konservatismus bleibt in diesem Sinne gemäßigt, als er es sich zumindest versagt, den Affekt gegen das Neue in eine entsprechende Politik zu übersetzen und öffentlich auszuleben. Und angesichts des überaus voraussetzungsreichen heroischen Defätismus, der hier zu besichtigen ist, sollte niemand auf die Idee kommen, dass es sich beim (gemäßigten) Konservatismus um eine Geisteshaltung für simple Gemüter handelt.
Wenden wir uns nach dieser Betrachtung des substanziellen Pols des Konservatismus nun dem prozeduralen Ende zu, dem es weniger um die Frage der Verteidigung des Seienden im Namen einer (implizit vorschwebenden) guten Ordnung geht, sondern ausdrücklich darum, wie konservative Politik gesellschaftliche Transformationsprozesse begleiten kann und soll, die als unabweisbares Faktum verstanden werden. Es ist dieser prozedurale Pol, der in den meisten zeitgenössischen Versuchen einer Aktualisierung konservativer Ideologie gegenüber dem substanziellen stärker betont wird, wohl nicht zuletzt, um die vielfältigen Schwierigkeiten zu umgehen, auf die wir bei dessen Untersuchung gestoßen sind. Ob dieser als Strategie tragfähiger ist, wird sich freilich als durchaus fraglich erweisen. Das konservative Kernkonzept, das sich mit diesem Pol verbindet, kann man als erfahrungsbasierten Inkrementalismus bezeichnen. Wenn der Wandel schon unvermeidbar ist, so sollen dabei zumindest nicht die über die Zeit entstandenden Erfahrungsbestände einfach über Bord geworfen werden. Das Wissen, auf das der Konservatismus setzt, entsteht nicht in Schreibstuben und schon gar nicht am theoretischen Reißbrett, sondern basiert einzig auf der Erfahrung in Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit; denn bei aller metaphysisch-theoretischen Überformung der Figur der guten Ordnung bleibt das konservative Politikverständnis zutiefst positivistisch, jedenfalls ist es der programmatische Anspruch, gewissermaßen evidenzbasierte Politik zu betreiben – auch wenn es in der Praxis nicht immer so aussehen mag. Erfahrungswissen ist in Konventionen, Traditionen und Institutionen gespeichert, und daher besteht mit deren Verlust auch die Gefahr, dass jenes Wissen, das oftmals ein eher implizites Wissen im Sinne von tacit knowledge ist, verloren geht. Soll dies vermieden werden, so müssten gesellschaftliche Reformen am Bestehenden anknüpfen, auch wenn sie jenes im Endeffekt ersetzen sollen. Die Lehren der Vergangenheit auszuschlagen und stattdessen allein auf die Kraft der reformerischen Vernunft zu vertrauen, erscheint Konservativen als eine Form der Hybris, die immer mit der Gefahr einhergeht, dass gerade als progressiv deklarierte Reformen letztendlich zu einem Rückfall hinter ein bereits erreichtes Entwicklungsniveau führen. Der Respekt vor der Vergangenheit, der sich in dieser Betonung der Erfahrung zeigt, wird komplementiert durch einen Respekt vor der Gegenwart der sozialen Welt, die auf komplexe Weise verwoben und gleichzeitig äußerst fragil erscheint. Beides erhöht zusätzlich die Gefahr, die mit jeglicher politischen Initiative, die über die bloße Erhaltung des Bestehenden hinausgeht, verbunden ist, vor allem eben dann, wenn sie nicht die Lehren der Vergangenheit mit in Betracht zieht.
Wer es gut mit dem Konservatismus meint, der deutet diese Befürchtungen als Beleg für ein fein entwickeltes Gespür für die Grenzen der intentionalen Gestaltbarkeit von Gesellschaften, deren (Reproduktions-)Prozesse kausal unübersichtlich sind und oft genug nicht linear ablaufen. Wer hier allzu beherzt eingreift und großflächige Transformationen und gar metaphorische oder reale Revolutionen anzettelt, der muss im schlimmsten Fall damit rechnen, dass die Widerständigkeit des sozialen Materials solche Ambitionen in ihr Gegenteil verkehrt. Entsprechende Vorsicht ist also geboten, und diese übersetzt sich in das Leitbild inkrementellen Handelns, das sich nach jedem kleinen Reformschritt zunächst einmal versichern kann und muss, dass die Stoßrichtung einer Maßnahme nicht durch ihre nichtintendierten Konsequenzen konterkariert wird. Dementsprechend lautet das Credo des Konservativen in den Worten von Michael Oakeshott bündig zusammengefasst: »[E]r bevorzugt kleine und begrenzte Innovationen gegenüber großen und unbestimmten.«[39] Und auch hier dürfte abermals das Bewusstsein über die Begrenztheit des eigenen Wissens und die entsprechende Fehleranfälligkeit politischen Handelns den Ausschlag für ein Leitbild geben, das ebenfalls die Lehren des Fallibilismus beherzigt: Popper leitete aus seinen erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Untersuchungen ja immerhin die Schlussfolgerung ab, dass Politik im besten Fall als »piece-meal engineering« zu betreiben sei, nicht zuletzt, weil dessen inkrementeller Charakter noch die größten Korrekturpotenziale beinhalte, sollte sich ein bestimmter Schritt als fehlgeleitet herausstellen. Interessanterweise führen diese Überlegungen zu einem Politikideal, das abermals, wie schon im Fall der normativen Natürlichkeit, Anleihen bei der Natur nimmt. Denn es sind organische Wachstumsprozesse, die die konservativen Kriterien an politisch gestaltete Transformationen am ehesten erfüllen, und daher ist es durchaus konsequent, wenn bei Oakeshott die Aufgabe des Konservativen an die eines Gärtners erinnert. Im Gegensatz zum Ingenieur, der mit der Macht der Naturwissenschaften im Rücken glaubt, der Natur letztlich seinen Willen aufzwingen zu können und von einer tendenziell unbegrenzten Plastizität seines Gegenstandes ausgeht, handelt der Gärtner im Wissen um die Grenzen der Gestaltbarkeit und um die Störungsanfälligkeit dessen, was seiner Hege und Pflege anvertraut ist. Hier führen radikale Rosskuren selten zum Erfolg, vielmehr geht es um die (indirekte) Unterstützung wünschenswerter Prozesse, die man nicht beliebig manipulieren, sondern allenfalls mehr oder weniger erfolgreich kultivierend begleiten kann. Dem floralen Eigensinn, mit dem der Gärtner rechnen muss, entspricht auf der sozialen Ebene, was Systemtheoretiker bisweilen als gesellschaftliche Immunitätspotenziale bezeichnen, die bestimmte Interventionen bei aller Vehemenz wirkungslos verpuffen lassen, wenn sich die Wirkungen nicht sogar in das Gegenteil des intendierten Effekts verkehren.
Die Metapher der Gärtnertums, die man übrigens von (neu-)rechter Seite immer wieder lächerlich gemacht hat, enthält noch eine weitere, letzte Einsicht in das (normative) Politikverständnis des Konservatismus. Außerhalb von Gewächshäusern spielen offensichtlich die Wetterverhältnisse eine zentrale Rolle, wenn es um Erfolg und Misserfolg gärtnerischer Aktivitäten geht. Angesichts der Ungewissheit im Hinblick auf mittel- und langfristige Wetterentwicklungen wird die kluge Gärtnerin im Rahmen ihrer Möglichkeiten vorausschauend agieren. Sie wird Regenwasser in Tonnen sammeln, um Trockenperioden vorzubauen, und andere Maßnahmen treffen, um auf bestimmte Eventualitäten reagieren zu können, ohne zu radikalen (Rettungs-)Aktionen gezwungen zu sein. Konsequent zu Ende gedacht, hat konservative Politik damit auch eine dezidiert präventiv-prophylaktische Dimension; bei allem Wissen um die kognitiven Grenzen des menschlichen Intellekts versucht man doch, so vorausschauend wie möglich zu handeln, aber eben gerade, um nicht die Praktikabilität des erfahrungsbasierten Inkrementalismus zu unterminieren. Wer von sich plötzlich rasant wandelnden (Wetter-)Verhältnissen überrascht wird, der kommt nicht um drastische Reaktionen umhin, die nur dem erspart bleiben, der vorsorgt und in das investiert, was man heute gerne mit dem Begriff der »Resilienz« bezeichnet. Auf den Punkt gebracht, wenn auch auf paradoxe Weise, hat diese vorausschauende Intuition des Konservatismus Fürst Salina in Giuseppe Tomasi di Lampedusas Roman Der Leopard: »Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, dann ist es nötig, dass sich alles verändert.« Anders und etwas weniger paradox formuliert: Wenn für Max Weber Politik das Bohren harter Bretter war, dann ist es aus konservativer Perspektive das beständige Drehen an winzigen Schrauben – um zu verhindern, dass jemals an den großen Rädern gedreht werden muss.
Damit sind wir beinahe am Ende dieser Exposition des Konservatismus auf der Basis seiner substanziellen (normative Natürlichkeit) und prozeduralen (erfahrungsbasierter Inkrementalismus) Kernkonzepte angelangt. Bevor wir uns der Unterscheidung zwischen diesem gemäßigten und damit genuinen Konservatismus und quasikonservativen Spielarten jenseits der rechten Mitte zuwenden, gilt es noch einmal, das Verhältnis zwischen substanziellem und prozeduralem Pol genauer zu erläutern, da hiervon auch gerade mit Blick auf die Plausibilität derzeitiger Aktualisierungsversuche der konservativen Agenda einiges abhängt. Wie bereits angedeutet, zielt etwa Rödders Lesart auf eine fast gänzliche Prozeduralisierung. Zum einen lehnt er die Vorstellung eines inhaltlich definierten Konservatismus zugunsten einer reinen Denkform ab, und darüber hinaus sieht er das zentrale Charakteristikum in einer »bestimmten Haltung zum Wandel«; diesen verträglich zu gestalten, »ist das Anliegen eines liberalen Konservatismus«.[40] Die Geistesgeschichte hält einen reichen Schatz an Aperçus und Bonmots bereit, die in eine ähnliche Richtung zielen und zu deren bekannteren die Maxime des einstigen britischen Premierministers Salisbury gehört, der die konservative Agenda dahingehend zusammenfasste, dass es darum gehe, den »Wandel zu verzögern, bis er harmlos geworden ist«.[41] Aber auch wenn die Politik der kleinen Schritte hier ganz eindeutig das Ideal bezeichnet, so halte ich es dennoch nicht für überzeugend und schon gar nicht im Sinne des Konservatismus als intellektuelle Tradition und politische Bewegung, sie zum Selbstzweck zu erheben und ihn damit auf eine Art politischen Bremsklotz zu reduzieren. Denn die inkrementelle Politik bedarf immer noch der Orientierung bezüglich der Richtung, in welche sich die Verhältnisse bewegen sollen oder eben auf keinen Fall bewegen dürfen. Ein Konservatismus, der sich vollständig von seiner substanziellen Komponente entkoppelt hätte, würde tatsächlich die Frage aufwerfen, ob es sich hier überhaupt noch um eine politische Ideologie im vollen Sinn des Wortes handelt. Abgesehen von diesen konzeptionellen Bedenken schiene mir die ausschließliche Konzentration auf die Durchsetzung von Geschwindigkeitsbegrenzungen als Kernaufgabe – außer auf deutschen Autobahnen – aber auch aus Sicht des Konservatismus selbst problematisch. Denn schließlich handelte es sich dann um eine Geisteshaltung, die in ihrer völligen Entkernung der Beliebigkeit Tür und Tor öffnet und ihre Positionen geradezu kasuistisch aus einer unübersichtlichen Gemengelage von Faktoren und deren völlig intransparenten Gewichtung ableitet, und so mal hier und mal dort landet. Zwar trifft es empirisch zu, dass heute in vielen Kontexten der Konservatismus vor allem in einer prozedural ausgedünnten Gestalt auftritt, aber dies ist ja Teil der Symptomatik der Krise, die ihn erfasst hat; jedenfalls wäre – bei allen Schwierigkeiten, die der substanziellen Seite des Konservatismus zu eigen sind – die Strategie einer radikalen Prozeduralisierung, die inhaltliche Festlegungen im Namen von Pragmatismus und Kontextspezifik kategorisch von sich weist, zumindest gewagt, was nicht bedeutet, dass sie nicht in manchen Kontexten de facto dominiert, wie wir in den folgenden Kapiteln noch sehen werden.
Das Hauptaugenmerk dieses Buchs gilt der rechten Mitte und dem gemäßigten Konservatismus, der sie typischerweise besetzt und unter den – es sei an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt – auch die Christdemokratie subsumiert wird. In der Politiwissenschaft gibt es schon seit längerer Zeit eine Debatte darüber, ob die Christdemokratie als eigenständiges Phänomen gelten kann, das sich hinlänglich etwa von Konservatismus unterscheiden lässt.[42] Von denjenigen, die dies bestreiten, wird unter anderem angeführt, dass die vermeintlichen Alleinstellungsmerkmale zu eng als auch zu weit gefasst seien. Zu eng insofern, als es fragwürdig erscheint, die Praxis zeitgenössischer christdemokratischer Parteien wie etwa der Union in Deutschland dahingehend zu charakterisieren, dass es um die Mobilisierung von Religion zur Überwindung oder der Neutralisierung des Klassenkonflikts gehe – dazu ist die tatsächliche politische Praxis trotz aller rituellen Beschwörungen des »christlichen Menschenbildes« in vielen Fällen bereits viel zu säkular gerahmt. Zu weit insofern, als die Bereitschaft, den Ausgleich zwischen den Lagern zu suchen, als vermeintlich christdemokratische Kernkompetenz doch keineswegs auf jene begrenzt ist, sondern eben gemäßigte Konservatismen jedweder Couleur kennzeichnet. Diese Einwände erscheinen mir durchaus stichhaltig, wichtig ist hier aber eine Differenzierung. Meiner Ansicht nach lässt sich sehr wohl eine Ideologie der Christdemokratie identifizieren, und diese ist damit zumindest auf der Ebene der Theorie und gewissermaßen als Idealtyp auch abgrenzbar von anderen Ideologien, wobei die Theoriebildung oftmals den politischen Praktikern vorbehalten blieb, die bis in die sechziger Jahre auch in vielen Fällen durchaus erkennbar christdemokratische Politik betrieben.[43] Worauf aber vor allem der erste der oben erwähnten Punkte abzielt, ist doch vielmehr die Frage, inwieweit diese Unterscheidbarkeit auch noch auf der Ebene der Praxis zeitgenössischer nominell christdemokratischer Parteien existiert. Hier gibt es womöglich kleinere Parteien, die über ein spezifisch christdemokratisches Profil verfügen, und in manchen Momenten mögen die Positionierungen und Entscheidungen einer CDU oder einer ÖVP ihr christdemokratisches Erbe aufscheinen lassen, aber so weit ich sehen kann, sind dies eher Ausnahmen. Im Hinblick auf die Praxis ist es daher grundsätzlich nicht mehr zwingend erforderlich, systematisch zwischen christdemokratischen und anderen Mitte-rechts-Parteien zu unterscheiden – möglicherweise auch deshalb, weil christdemokratische Vorstellungen in vielerlei Hinsicht mittlerweile ein Allgemeingut der rechten Mitte darstellen und die Christdemokratie als eigenständiges Phänomen gewissermaßen zum Opfer ihres eigenen Erfolges in der Vergangenheit geworden ist:[44] Das Gebot der Subsidiarität entstammt ursprünglich der katholisch-christdemokratischen Ideenwelt, doch wie wir sehen werden, hinderte das die britischen Tories, die von ihrer Tradition her natürlich nicht als christdemokratische Partei zu deklarieren sind, keineswegs daran, diese Forderung im Hinblick auf das Verhältnis zwischen der supranationalen Ebene der EU und den Mitgliedstaaten immer wieder offensiv zu formulieren. Zusammenfassend scheint mir im Lichte all dieser Erwägungen die Einordnung der Christdemokratie in die Kategorie des gemäßigten Konservatismus daher gerechtfertigt.[45]
Jedenfalls speist sich das Interesse an der rechten Mitte, wie bereits erläutert, aus der Annahme, dass sie aus den erwähnten Gründen zumindest unter den gegebenen Bedingungen zu einem zentralen Austragungsort von Konflikten und zum Schauplatz von daraus resultierenden Dynamiken wird. Diese sind für das Schicksal der liberalen Demokratie von höchster Bedeutung, denn der gemäßigte Konservatismus kann in diesem Kontext auf unterschiedliche Weise eine konstruktive Rolle spielen. Doch diesem aus liberaldemokratischer Sicht positiven Szenario stehen weniger positive Alternativen gegenüber, die, vereinfacht gesagt, darin bestehen, dass der gemäßigte Konservatismus auf eine Nischenexistenz reduziert wird oder ganz verschwindet und in der Folge andersgeartete politische Kräfte an seine Stelle treten – wobei dies auch dadurch der Fall sein kann, dass sich ehemals gemäßigt konservative Akteure in etwas transfomieren, was sich nicht mehr sinnvoll als gemäßigt bezeichnen lässt. Doch was ist dieses nicht gemäßigte Andere; wie lässt es sich bezeichnen und wie lässt es sich vor allem von einem genuinen Konservatismus, wie er hier vorgestellt wurde, unterscheiden?
Bei diesem Anderen handelt es sich um das, was Natascha Strobl in jüngster Zeit als »radikalisierten« und was Andreas Rödder als »illiberalen Konservatismus« gekennzeichnet hat,[46] was sich aber meiner Ansicht nach auch schlicht als Autoritarismus bezeichnen ließe und was im gesellschaftlichen wie auch akademischen Diskurs nach wie vor vorwiegend mit dem, vorsichtig formuliert, vieldeutigen Label des Rechtspopulismus etikettiert wird. Hier ist nicht der Platz, diese terminologischen Debatten im Detail durchzuarbeiten, und letztendlich erscheint mir die inhaltliche Differenzierung wichtiger als die Etikettierung. Dennoch ist im Hinblick auf Letztere zumindest auf zwei Probleme beziehungsweise Gefahren hinzuweisen. Der Begriff des (Rechts-)Populismus erfreut sich seit einigen Jahren großer Aufmerksamkeit, allerdings ist bis heute zutiefst umstritten, wie man ihn konzeptionalisieren soll, wobei sich etwa zwischen einer liberalen und einer postmarxistischen Deutung differenzieren lässt.[47] Dass diese Kontroversen andauern, ist per