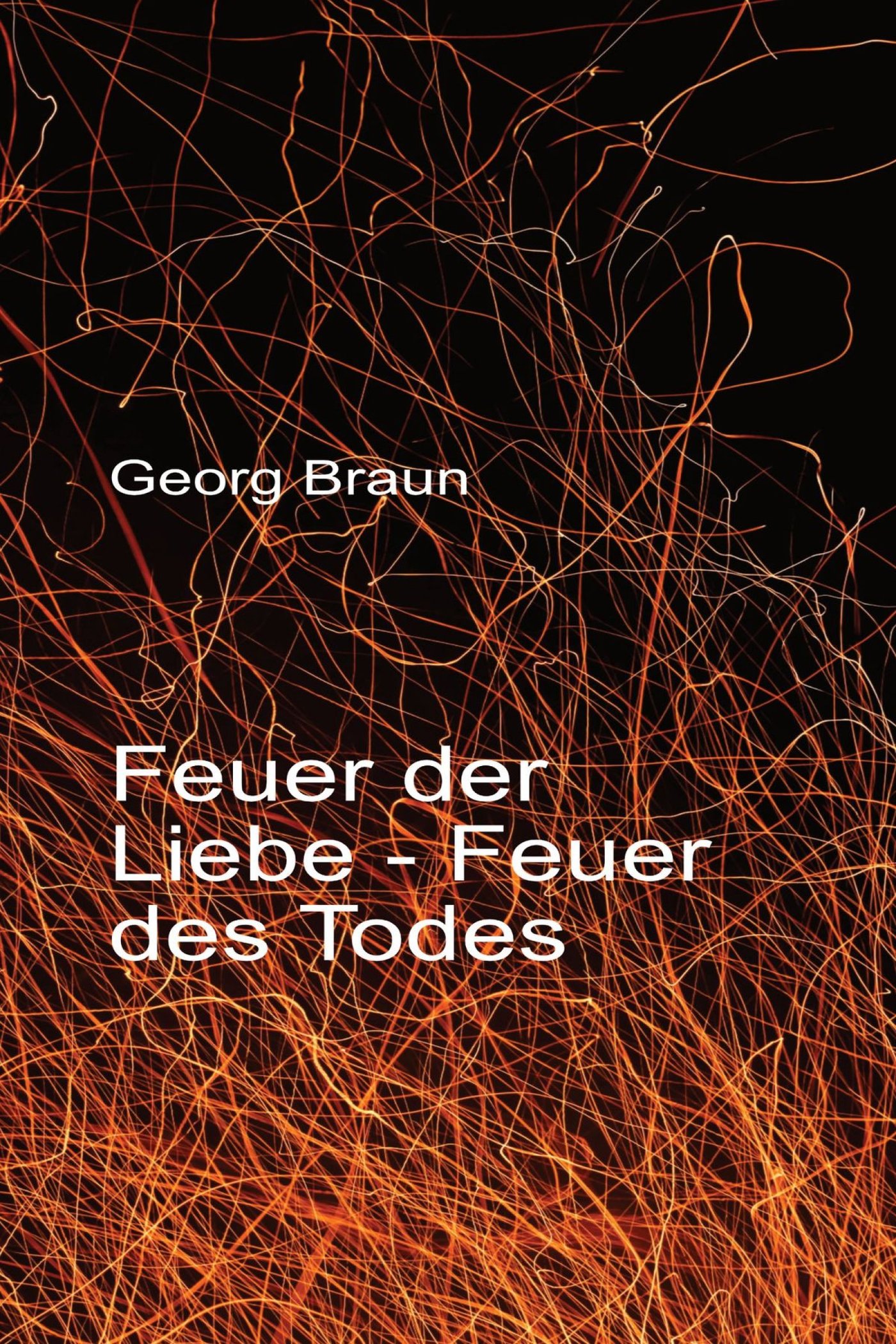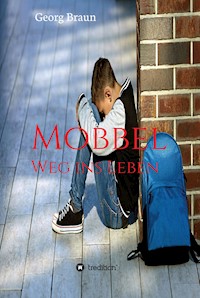
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Schüler Markus Walter, der mit der Mutter während der Bürgerkriegswirren aus Tschetschenien geflohen war, kommt in eine sechste Klasse der Realschule in Wildberg, wird wegen des Aussehens "Mobbel" genannt und fortan schikaniert und gemobbt. Auf einer Klassenfahrt eskaliert die Situation: Mobbel verprügelt zwei der härtesten Mobber übel und verschwindet. Nach langem Suchen taucht er wieder auf. Zu Hause soll ihm der Prozess gemacht werden, der einen ungewöhnlichen Ausgang nehmen wird ….
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Georg Braun
Mobbel
Weg ins Leben
© 2016 Georg Braun
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7345-4931-1
e-Book:
978-3-7345-4932-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Mobbel
Weg ins Leben
Georg Braun
Frostiger Empfang
»Hi, Mobbel«, begrüßte Andy seinen neuen Klassenkameraden in der Klasse 6c der Zauberbergrealschule in Windberg. »Jogginghose, die im Schweiß trieft, Respekt, wie haste das hingekriegt?«
»Lass mich in Ruhe«, giftete Mobbel, der eigentlich Markus Walter hieß. Mit eingezogenen Schultern blickte er nach hinten, wo er einen Sitzplatz im Klassenzimmer vermutete. Zwei Plätze schienen frei zu sein. Als er den ersten Stuhl anlief, fauchte Kevin ihm entgegen:
»Hier steht meine Tasche, für dich ist hier kein Platz.«
Als er sich auf den Weg zur zweiten unbesetzten Tischhälfte machen wollte, rief Nathalie:
»Stinker, bleib mir vom Leib. So jemand wie du hat hier keinen Platz.«
Mit Tränen in den Augen und voller Wut packte Markus seinen Schulranzen, rannte zur Tür hinaus, worauf die Klasse 6c johlte.
»Dieses mobbelige Würstchen hat uns gerade noch gefehlt«, feixte Annika.
Die Partystimmung kühlte auf null ab, als unverhofft die Tür aufging und Rektor Anton Scholter in Begleitung von Markus eintrat.
»Kann mir jemand ausführlich erklären, was hier vorgefallen ist und euch zur Erheiterung gebracht hat?«
Betroffenes Schweigen oder feige Zurückhaltung beherrschten die Stimmungslage. Minutenlang hielten die Schülerinnen und Schüler still. Keiner wagte einen Laut zu produzieren, während Andy durch seine Mimik und Gestik der Klasse zu verstehen gab, nichts, aber auch nicht einen einzigen Sterbenston zu äußern. Ansonsten…
»Damit wir uns richtig verstehen: Markus Walter gehört ab sofort zu eurer Klassengemeinschaft.« Sagte es und verschwand.
Digitaler Feuertanz
@Annika: Der Mobbel heute hat `ne richtige Show abgezogen. Dem müssen wir unsere Spielregeln erklären.
@Andy: Für den reicht das nicht. Der braucht eine echte Feuertaufe, sonst rennt der ständig zum Scholter.
@Nathalie: Passt auf, was ihr tut. Ich möchte nicht von euch wegen dem in die Scheiße gezogen werden.
»Morgen Mobbel, schön, dass du heute bei uns bist«, begrüßte Annika den Neuen auffällig heuchlerisch.
Markus bemerkte die alles andere als ehrlich gemeinte Äußerung als Zeichen, dass man es ihm in dieser Klasse möglichst schwer machen wollte. Woran das lag? Er konnte sich keinen Reim darauf machen. Heute erschien er nicht mit der speckigen Jogginghose.
Er hat die Mutter gebeten, ihm eine coole Jeans zu besorgen. »Bring noch ein geiles Shirt aus dem New Yorker mit.«
»Wo ist der Laden?«
»In der Fußgängerzone in Stuttgart.«
»Warum interessierst ausgerechnet du dich für Shirts? Bis heute würdest du in einem Kartoffelsack rumlaufen.«
»Bitte, Mama, tu mir den Gefallen. Ich erkläre dir das später.«
@Andy: Der Stinker trägt heute eine andere Hose. Die erste Lektion hat er verstanden.
@Nathalie Wir sollten seine Geduld ruhig austesten. Wenn er zu uns gehören will, muss er leiden.
»Ja, Mobbel, du hast aber schnell kapiert, dass wir eine edle Truppe sind. Die Schmuddelhose hast du wohl im Flüchtlingscamp abgegeben.«
»Du bist wohl ein ganz cooler Typ, Andy«, schmeichelte sich Mobbel scheinbar bei dem Anführer und Klassensprecher ein.
»Schlaues Bürschchen, Respekt.«
»Du hältst ziemlich viel von dir.«
»Mobbel, pass auf: Wenn du hier überleben willst, musst du immer wissen, auf welcher Seite du stehst.«
Andy meinte, Mobbel einnorden zu müssen. Der wirkte unbeeindruckt trotz der Drohung. Denn Andy wusste noch nicht, wer der eigentlich war, den er Mobbel nannte. Abfällig und grundlos. Der zweite Tag an der Schule und in der Klasse verlief deutlich angenehmer als der erste. Er gab der Mehrheit der Klasse zu verstehen, dass er gewillt war, einer von ihnen zu werden. So zumindest verstanden Andy, Nathalie & Co. die neuen Signale des Novizen. Sie ließen sich interessiert auf kommende Erfahrungen mit Markus ein.
Urus - Martan, Tschetschenien, Sommer 2005
»Mhamzov, komm zurück! Wir müssen etwas besprechen.«
»Ich spiele aber so gerne mit meinen Freunden«, meinte der Dreijährige.
»Du kehrst sofort um! Sonst gehst du mir nie mehr raus! « Wegen der Drohung kullerten große, kugelrunde Tränen über das Gesicht des Jungen. Er verstand die Welt nicht. Einmal im Leben kann er mit anderen Kindern in den verseuchten Tümpeln des Vorbezirks vom Urus-Martan, einer Regionalstadt im mittleren Westen Tschetscheniens, spielen. Kospania, der Mutter von Mhamzovs, ist die permanente Lebensbedrohung fast egal. Sie vermag nicht mehr, sich gegen die alltäglichen Probleme zu stemmen. Fünf Minuten nach der unmissverständlichen Aufforderung kehrte Mhamzov missmutig nach Hause zurück.
»Ich spiele so gerne. Was gibt`s?«, jammerte der Junge.
»Papa verabschiedet sich von uns. Er muss für längere Zeit weg. Du wirst ihn erst mal nicht mehr sehen.«
»Papa, wohin gehst du?«, fragte der kleine Sohn.
»Mach dir keine Sorgen, Mhamzov, es wird alles wieder gut.« Der Knirps entdeckte die an die Wand des Hausflures gelehnte Waffe. Er wuchs mit solchen Lebensbegleitern auf. Mhamzov hatte mitbekommen, wie russische Guerilla-Krieger den Vater seines Papas erschossen hatten – vor etwa einem Jahr. Ob er genau hatte realisieren können, was es mit Gewehren auf sich hatte, hatten die Eltern nicht ergründet. Ihnen schien recht, wenn das Kind so wenig wie möglich vom Krieg mitbekam. Sie unternahmen nicht die kleinsten Versuche, das zukünftige Treiben von Homza, seinen Einsatz für die Unabhängigkeit Tschetscheniens von der Russischen Republik, zu erklären. Mhamzov hätte es sowieso nicht verstanden.
Sohn und Vater drückten sich minutenlang. Die kleinen Ärmchen des Buben umschlungen die Taille des zukünftigen Freiheitskämpfers. Die Tränen benetzten den Holzboden der baufälligen Baracke der Familie Kabulatov. Die Seele des kleinen Mannes ahnte, dass der Vater lange Zeit abwesend sein würde.
»Mach es gut, Papa. Vergiss mich nicht.«
Die Tränen Homzas schossen in Fluten aus den Augen. Die Worte des Kleinen kamen für ihn völlig überraschend. Der Junge drückte ihm einen Stein in die Hand.
»Der soll dich an mich erinnern.« Sagte es und rannte zu seinem kleinen Bett, auf das er sich schmiss und mit der Rührung kämpfte.
Kospania entschied, ihr Sohnemann sollte nach draußen gehen, den Abschiedsschmerz vergessen. Für einen Dreijährigen bedeutet der Vater alles. An ihm orientiert sich ein männlicher Heranwachsender, was der Papa sagt, ist Gesetz.
Der Junge raffte sich nur schwer auf. Zu stark pochten die Schmerzen in seinem Herzen, als dass er einfach zur Tagesordnung hätte zurückkehren können, aus der ihn die Mama herausgerissen hatte.
Homza und Kospania küssten einander inniglich, drückten sich und verbargen die Tränen. Für das Paar bedeutete das die erste Trennung in der bisher fünf Jahre andauernden Ehe. Mit Mitte Zwanzig, glücklich, trennte man sich nur schwer vom verehrten Partner. Sowohl Kospania als Homza hätten sich keinen besseren aussuchen können. Sie wirkten rundum happy und zufrieden und vermittelten auch ihrem Buben das Gefühl, geliebt zu sein. An Kindergarten oder andere Betreuungs-möglichkeiten, wie die westliche Welt sie kannte, war nicht zu denken. Zum einen existierten diese Optionen nicht, zum anderen brachten die Kabulatovs nicht genug Geld auf. Die Umgebung betreute die Kinder. Im Krieg benötigte man die Mütter, um Nachschub zu produzieren. Kospania schuftete als Waffenproduktionshelferin in einer Fabrik vor ihrem Wohnort. Sie wechselte sich mit einer Nachbarin in der Betreuung der Kinder ab. Hygienische Defizite, auch für Kleinkinder lebensbedrohliche, nahm sie in Kauf. Wo das tägliche Überleben erkämpft werden musste, bekamen Zimperlichkeiten Hausverbot.
Mhamzov beobachtete, wohin der vermisste Papa lief, nachdem er schmerzvoll Abschied von Frau und Sohn genommen hatte. Durchs Fenster, in der als Wohnstube deklarierten Kammer sah er, wie Homza auf einen Militärwagen stieg, zusammen mit einigen anderen Männern. Väter, die für die Freiheit ihrer Familien und der Unabhängigkeit ihres Vaterlandes in den Krieg zogen.
Die Russische Föderation war zerbrochen, als der Kalte Krieg Ende der achtziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts ein Ende gefunden hatte. Die damalige Sowjetunion hatte seit dem Jahre 1917 existiert. Nach außen hatten die sechsundzwanzig einzelnen Mitgliedsländer der Föderation eine harmonische Einheit demonstriert. Nach innen hatte es gewaltig geknistert, denn die Menschen hatten häufig Not gelitten und die Parteiführer sich einen Dreck darum geschert.
Auch die Tschetschenen hatten nach Unabhängigkeit vom russischen Joch. Sie hatten ihre Eigenständigkeit, was den Machthabern in Moskau wie eine Aufforderung ins Land einzumarschieren, vorgekommen war. Sie provozierten einen unglaublich brutalen Krieg. Wie ein Vater, der nicht einsah, dass die Kinder erwachsen geworden waren, reagierte der russische Präsident auf das berechtigte Anliegen nach Souveränität. Die Tschetschenen ergriffen die Waffen. Es ging ihnen um ihr ein und alles. Niemand durfte den stolzen Männern auf der asiatischen Seite der ehemaligen Sowjetunion die Rechte streitig machen. Wenn es ihnen in diesem Moment nicht gelingen würde, die russischen Krallen zu stutzen, dann nie mehr. Demokratie, Menschenrechte – alles gefällige Begriffe, solange man sie genoss. Die Westeuropäer kapierten ihre komfortable Lage nicht und akzeptierten das harte Vorgehen der Einwohner des kleinen Staates kaum. Wer sein Leben lang Mitbestimmung und Menschenrechte in Anspruch nehmen durfte, verstand nicht, dass dafür Jahrhunderte zuvor Menschen ihre Existenz geopfert hatten. Homza Kabulatov sehnte sich nach Freiheit und kämpfte für die Menschenrechte, damit Mhamzov eines Tages unbeschwert atmen und durchs Land reisen dürfte.
Der Jeep transportierte etwa dreißig Kämpfer in die Hauptstadt nach Grosny. Dort brauchte man ihre Kraft und ihre Schusswaffen. Die Russen nahmen den Regierungssitz in der Stadt ein; den galt es, mit aller Macht zurückzuholen. Homza schien nicht in allen Einzelheiten klar, wie unterlegen er mit seinen Truppen war. Mit Enthusiasmus und abgrundtiefem Hass ließen sich die russischen Truppen nur begrenzt besiegen. Die vom Volk gewählten Machthaber vermieden das diplomatische Parkett. Heißsporne wie Homza opferten eher das eigene Leben, als dass sie weiterhin unter russischen Befehlshabern und Unterdrückern ihr Dasein fristen würden. Andere ehemalige Mitgliedsstaaten der Russischen Föderation konnten ebenfalls souverän werden, warum Tschetschenien nicht? Wie Kleinkinder eifersüchtig um Bonbons stritten, so argumentierten die tschetschenischen Freiheitskämpfer. Was hatten sie für Vorteile, wenn sie den Hinterbliebenen nur noch als Grabsteine und Erinnerungsfragmenten übrig blieben?
Diese tiefschürfenden Gedanken provozierten die Gewaltspirale eher, als dass sie sie befriedet hätten. Niemand kehrte feige in die Heimat retour und ließ die Mitstreiter als russisches Kanonenfutter zurück. Sie dachten weder an die eigenen Familien noch an die zerstörte Infrastruktur nach einem jahrelangen Krieg. Die Zukunft durfte, solange die Gegenwart ungeklärt schien, in den Augen der Soldaten keine Rolle spielen. Ob es ein lebenswertes Leben jemals geben würde, entschied sich in diesen Momenten. Entweder man drängte den Feind aus dem Land oder man blieb Sklave im eigenen Haus.
Hinterland Tschetscheniens, Herbst 2005
Homza und seine Truppe erlitten herbe Verluste. Darin eingeschlossen die etwa zwanzig Toten, die übrig geblieben waren. Sie blieben verwundet mitten im Gelände liegen und verreckten wie angeschossenes Wild. Oder die russischen Soldaten, die technisch ausgereiftere Waffen besaßen, töteten sie. Kabulatov kämpfte nur noch mit neun anderen Mitstreitern um die Freiheit eines kleinen, sehr überschaubaren Landstreifens. Nachdem er drei Monate seine Familie, vor allem Mhamzov, nicht mehr in den Armen gehalten hatte, ergriff ihn eine tiefe Sehnsucht. Zweifel nagten an seinem Gewissen, ob er die richtige Entscheidung getroffen und mitgekämpft hatte.
Die tschetschenischen Truppen agierten weitgehend führungslos. Die Wut auf die russischen Besatzer trieb ihren Hass auf die oberste Stufe der Skala.
So seltsam es sich anhörte, der Krieg verschaffte Kospania Arbeit. Ohne die gewaltsame Auseinandersetzung würde die ungelernte Mutter Trübsal blasend die Baracke bewachen und ausschließlich Mhamzov beglucken, was für den Buben entwicklungshemmend wirken könnte. Homza zweifelte an der Sinnhaftigkeit der Situation, Kospania stiftete sie einen Halt. Der Hass auf die Russen vereinte die jungen Eltern, die ihre Kindheit und Jugend genug unter den Entbehrungen gelitten hatten. Zum ersten Mal erhielten sie eine Chance, so etwas wie »Freiheit« zu erleben. Während Kinder in Westeuropa Unfreiheit kaum buchstabieren vermochten, lechzten Kospania und Mhamzov nach einem Gefühl der Selbstbestimmung. Jede Entscheidung, angefangen bei dem Schulbesuch, musste ausgiebig und gründlich bedacht werden. In den etwa dreißig Kilometer entfernt liegenden Geschäften herrschte Angebotsarmut. Gesunde Lebensmittel fand man dort ebenso wenig wie Süßigkeiten oder Joghurt in reichhaltiger Zahl. Auf den Dörfern betrieben die Leute Landwirtschaft – so gut die Böden diese ermöglichten. Nur stark resistente Obstsorten überlebten die unwirtlichen Vegetationsbedingungen des kleinen Landes. Der Zentralismus in der Zeit der alten Sowjetunion diktierte eine Abgabequote der Ernte. Sozialistisch handeln, hieß, die Erträge zu teilen – auf den Notsituationen blieben die Einzelstaaten alleine sitzen.
»Warum die anderen Schmarotzer mitschleppen, die selbst arbeiten und einfahren können, statt uns arme Leute auszubluten?« Männer wie Homza dachten so oder ähnlich.
Sie hatten von Moskau und den Tyrannen an der Macht die Schnauze gestrichen voll, aber wie schlau war es, sich von ihnen abknallen zu lassen? Er haderte mit dem Schicksal.
»Wir hatten eigentlich fast immer genug zu essen, trotz der Deppen in Moskau.«
Die Erinnerungen an die gefallenen Kollegen, ihre aufgerissenen Augen, die zweifelnd nach oben starrten, umschlang die zarte Seele des Familienvaters. Für wen oder was opferten sie sich? Dafür, dass sie statt einem gesunden Brot zwei ungesunde kaufen könnten?
»Marktwirtschaft frisst auch die Menschen, nicht nur der Sozialismus.«
Wie teuer durfte die politische Freiheit werden? Diese Frage hatte hinter dem Bruderkrieg gestanden. Homza fand in den Kampfpausen keine für ihn total überzeugende Antwort. »Alles hat zwei oder mehr Seiten. Man kann nicht einfach behaupten, ein Krieg gegen Moskau sei die richtige Entscheidung.«
Homza kauerte in einem tiefen Graben. Man erkannte von der Ferne nicht, dass Menschen darin lauerten, bis der Kampf fortgesetzt wurde. Ein Mitsoldat kramte aus dem Rucksack einen Bunsenbrenner hervor. Damit bereiteten sie etwas zu essen. Etwa Feldhasen, die unfreiwillig vor der Flinte herumliefen. Oder einen Hirsebrei. Aufwändige Mahlzeiten mussten bis zur Zeit nach dem Krieg zurückgestellt werden. Im Graben flatterte ein dreckiges Stück Papier. Er nahm es, glättete es ein wenig und kramte einen Stift aus seinen Habseligkeiten hervor. Die Sehnsucht nach Kospania und dem Jungen diktierte ihm folgende Wörter:
»Meine innigst geliebte Kospania, Mhamzov, du, mein Goldschatz. Ich vermisse euch so sehr. Die Kämpfe verliefen unglaublich enttäuschend. Ich zweifle heute, ob es sinnvoll war, das Leben für ein wenig bessere Nahrungsmittel auf dem Kampfplatz hinzugeben. Mich beherrscht eine Panik, euch nie mehr zu sehen. Die russische Überlegenheit treibt uns in die Enge. Liebe Grüße, Homza.«
Die Zeilen drückte er einem Bauern in die Hand, den er von den Eltern kannte. Dem war sofort bewusst, was er damit zu tun hatte.
Die russischen Truppen rückten energisch näher. Die übrig gebliebenen Partisanen, zu denen Homza zählte, trafen in der folgenden Nacht eine Entscheidung, wie sie im Falle der unausweichlichen Bedrohung vorgehen wollten. Sie wollten in den nächsten Stunden eine Route wählen, auf der sie den Gegnern offenbar den Weg frei machen würden. In Wahrheit würden sie versuchen, von hinten diese einzuschnüren, um sie entweder gefangenzunehmen oder zum Rückzug zu zwingen. Dass die Strategie die Option zu scheitern beinhaltete, bedachten die Draufgänger im Überschwang nicht. Sie vergaßen die Freischärler, die flugs die Fahnen wechselten und plötzlich auf russischer Seite angriffen. Die jugendliche, fast schon verbotene Naivität, lockte die Überzeugungstäter in eine gefährliche Enge.
Scheitern mit Überzeugung
Die vollends eingebrochene Dunkelheit gab in ihrer stoischen Ruhe den tschetschenischen Soldaten die Aufforderung, die nahegelegenen Wälder anzulaufen, möglichst geräuschlos. Man entzündete Kerzen, um wenigstens die Augen des nächsten Kollegen erahnen zu können. Außerdem orientierte es sich mit Kerzenschein deutlich einfacher in den auch bei Tageslicht dunklen Nadelwäldern. Bei Helligkeit verabredete man die Route, die sich in der schwarzen Nacht zu einem unerreichbaren Wagnis aufschwang. Homza wie die anderen Kämpfer kamen in ihrem Leben nie mehr als fünf Kilometer aus den Dorfgrenzen hinaus. In die fremden Wälder vor Grozny wollten sie eindringen, gleichzeitig kämpfte jeder für sich alleine mit der alle beherrschenden Angst zu sterben. Was selbst bei Tag zu einem Ritt auf der Rasierklinge verkam, entwickelte sich zu einem nahezu kopflosen Selbstmordabenteuer. Homza überlegte schon seit einigen Metern, ob er nicht doch lieber ... ein Kameradenschwein wollte er nicht werden, und ein dummer, unbedachter Ehemann und Vater? Die berühmte Wahl zwischen Pest und Cholera. Egal, für was er sich entscheiden würde, er träfe die falsche Wahl. Die Familie lebte für ihn gefühlt eine Ewigkeit entfernt. Die Kameraden setzten auf ihn und sie benötigten seine Unterstützung dringender als die Familie einen hadernden Ehemann oder Papa. Wenn er wegliefe, schaute er mit größerer Wahrscheinlichkeit in die Todesröhre, als wenn er weitermachte. Das stand fest. Felsenfest! Von einem toten Mann hatte niemand etwas, am wenigsten Kospania und Mhamzov. Von zwei dummen Möglichkeiten schnappte er die mit mehr Sinnhaftigkeit. Die Gemeinschaft, auch eine täglich schrumpfende, bot stärkeren Rückhalt als ein Einzelkämpferdasein. Die Ratio besiegte das Herz. Trotzdem kullerten Tränen die rauen Wangen hinunter, so dass Andrey, der engste Vertraute Homzas, ihn fragte:
»Junge, was ist los? Hast du Angst?«
»Du etwa nicht?«
»Homza, wir haben nur zusammen eine Chance. Wer abhaut, schädigt die Gemeinschaft und begibt sich in eine todsichere Situation. Todsicher!«
»Das ist mir bewusst geworden. Ich habe Frau und Kind.
Egal, was ich tue, ich treffe die falsche Wahl.«
»So würde ich es nicht sagen. Wir waren uns im Klaren, wir wollten Freiheit und Unabhängigkeit. Die erhalten wir von den Russen nur gegen die Aufbietung unseres Lebens. Wenn du die Freiheit für deinen Jungen wünschst, darfst du jetzt nicht kneifen.«
Überzeugender vermochte niemand die minimale Chance auf den Punkt zu formulieren. Andrey motivierte die Rumpftruppe, um jeden Preis weiterzukämpfen. Sollte das Leben je einen Sinn erhalten, dann den hellsten in der aktuellen Lage. Einen klareren, überzeugenderen Liebesdienst für die Bevölkerung präsentierte das Dasein nicht. Wer für sich und die Familie angenehmere Zeiten ersehnte, musste dafür mit dem Leben einstehen. Diese Erkenntnis dämmerte allen, sogar in ihrer unbarmherzigen Kompromisslosigkeit.