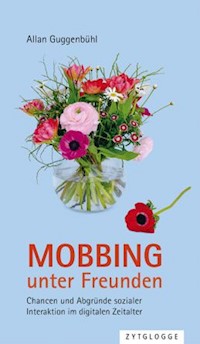
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Freunden kann man vertrauen. Denkt man. Loyalität und Vertrauen sind auch enorm wichtig bei der kollegialen Zusammenarbeit. Weiss man. Aber es läuft nicht immer so ab, wie man denkt und weiss. Auch im Freundeskreis oder in Teams sind versteckte Aggressionen, Eifersüchteleien, Intrigen und Mobbing an der Tagesordnung. Die entsprechenden Aktionen geschehen subtil, manchmal unbewusst und oft sogar gerade im Namen von Freundschaft und Teamgeist. Im digitalen Zeitalter erfolgen Angriffe zudem häufi g im virtuellen Raum anonym und werden in den sozialen Medien besonders heftig ausgetragen.Der Psychologe, Psychotherapeut und Experte für Jugendgewalt Allan Guggenbühl geht dem Phänomen «Mobbing unter Freunden» auf den Grund und leuchtet die dunklen Aspekte von Teambeziehungen aus. Er erläutert typische Mobbingsignale und stellt präventive Massnahmen vor. Sein Buch ist ein Plädoyer für Loyalität und Vertrauen im sozialen Miteinander, denn: Freundschaft und Kollegialität zeichnen sich dadurch aus, dass man schwierigen Situationen nicht ausweicht, sondern sie bewältigt. Für sich und gemeinsam!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Titel
1. Schlägereien und verbale Gemeinheiten werden peinlich: der Durchbruch der Zivilisation
Die Kündigung
Gewaltverzicht als Kulturleistung
2. Ausrichtung auf die Gemeinschaft
Analogieschlüsse
Der Irrglaube an das Primat der Denkleistungen
Sind unsere Begründungen mentale Spielereien?
Die Chance der Vergleiche mit der Tierwelt
Unser Verhalten wird grösstenteils von unserem Kollektiv bestimmt
Distinktionscodes
Kleine Handlungen verbergen wichtige Informationen
Auf keinen Fall auffallen
Die Hoffnung auf Gegenleistung
Das Problem der ‹free riders›
Unser zwiespältiges Verhältnis zur Kultur
Schattenmotive
Kulturcodes
3. Das trügerische Selbstbild
Das Selbstbild spiegelt nicht unsere Persönlichkeit wider
Das Selbstbild als Anpassungsleistung
Funktion des Selbstbildes: Eigenpropaganda!
Das Selbstbild dient der Krisenprävention
Krisen erlauben uns einen Blick in die Tiefe unserer Seele
Selbsttäuschungen als Zeichen psychischer Gesundheit
4. Die Kunst der Umdeutung
Unsere Fähigkeit zur Manipulation
Wem kann man vertrauen?
Die Suche nach Hinweisen
Testfragen und Umnebelungsthemen
Gezieltes abaissement
Gruppenidentifikationen
Der Gruppentest
Respekt vor Tabus
5. Wie werde ich jemanden los?
Die Taktik des Mobbers
Wieso mobben wir?
Mobbing gehört zum Grundrepertoire menschlicher Verhaltensweisen
Mobbing als Kehrseite unserer Anpassungsfähigkeit
Originelle Menschen muss man mobben
Gefährdung eines Gruppenstandards
Tabubrecher
Unbewusste Mobbingstrategien
Techniken der jeweiligen Gruppen einsetzen
Hohe Sozialkompetenz erleichtert Mobbing
Der Andere soll sich blossstellen
Ausgrenzung dank vertrauensvollen Informationen und Quali-Gesprächen
Prosoziale Argumente
Bullshit
Mobbing geschieht unbewusst
6. Mobbingtaktiken
Kompliziere die Sache!
Ausseninstanzen zitieren
Fachwörter gezielt einsetzen
Der Andere soll sich als schwach und fehlerhaft erleben
Immer in Übereinstimmung mit deinem Gewissen handeln
Verwirrung nutzen
Gegenangriffe vor dem Angriff auslösen
Feindbilder aufbauen
Gezielt loben
Abhängigkeiten kreieren
Sich als Opfer deklarieren
7. Gegenkräfte
Die Sehnsucht nach Zugehörigkeit
Pflege der natürlichen Skepsis
Überschaubare Betriebe
Pflege deine Feinde
Abaissement du niveau mental
‹Dirty jokes› und doofe Bemerkungen
Alltagsrituale
Wohin mit dem emotionalen Abfall?
Massnahmen gegen den Informations-Tsunami
Auseinandersetzungen statt Lösungen
8. Digitalisierung und Mobbing
Reitfreunde
Die problematische Aussage
Virtuelle Welt, reales Mobbing
Töne austauschen
Missverständnisse erleichtern das Gespräch
Details verraten uns
Gespräche sind Minenfelder
Die Kunst des Vertrauens
Unsere natürliche Konfliktscheu
Schriftliche Kontakte kaschieren die Persönlichkeit
Das exklusive Zweiergespräch
Ein Handy wir sind
Das Geflüster der heissblütigen Geliebten
Die Einnahme des Richterstuhls
Shitstorms als Anbindungsakte
Die Verlockungen der grossen weiten Welt
Der Auftritt unserer inneren Monster
Die sozialen Medien als Schaubühne
Der «Pornolehrer»
Machen die sozialen Medien einsam?
Streit gehört zu Freundschaften
Friends sind nicht immer Freunde
Das Handy als Ersatzobjekt
Emotionen verbinden
Die Kehrseite von Gemeinschaften
Die Entsorgung von emotionalem Abfall
Treppenhausgeflüster als sozialer Kitt
Der Wert der leichten Zerstreuung
Kollektive Lernprozesse
Über den Autor
Über das Buch
Allan Guggenbühl
Mobbing unter Freunden
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
3., korrigierte Auflage 2023
Überarbeitete und ergänzte Neuauflage des 2008 erschienenen Titels «Anleitung zum Mobbing» (ISBN 978-3-7296-0754-5)
© 2021 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenKorrektorat: Gregor Szyndler, www.korrigieren.bizUmschlaggestaltung: bido-graphic, Muttenz
Allan Guggenbühl
Mobbing unter Freunden
Chancen und Abgründe sozialer Interaktion im digitalen Zeitalter
1.Schlägereien und verbale Gemeinheiten werden peinlich: der Durchbruch der Zivilisation
Die Wirklichkeit verletzt dich pausenlos, sie ist ein extrem unerfreulicher Ort.
Woody Allen1
Die Kündigung
«Mit grossem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass Herr Waltisburger auf Ende Juli seinen Rücktritt eingereicht hat!», teilt der Klinikchef seinen Mitarbeitern mit. In der Runde reagiert das Team der Bettenabteilung betroffen, der Arztkollege von der Medienabteilung verlegen und die neue Mitarbeiterin des Pflegedienstes erstaunt. Was war geschehen? An den Fähigkeiten von Herrn Waltisberger zweifelt niemand.
Er gilt als innovativ, engagiert und als guter Organisator. Gegenüber seinen Mitarbeitern und den Patienten war er stets korrekt und freundlich. Er ist auch in der Öffentlichkeit ein gern gesehener Redner und hat entscheidend dazu beigetragen, dass seine Abteilung einen ausgezeichneten Ruf hat. Herr Waltisberger gelang es auch, einige wichtige Forschungsaufträge an Land zu ziehen und ein gutes Betriebsklima zu schaffen. Offensichtlich ist er eine beliebte und hoch kompetente Persönlichkeit.
Oder ist er eher ein grosses Ärgernis? Aus der Sicht einiger Fachkollegen, von ein paar Mitarbeitern und von der Mehrheit der anderen Abteilungschefs ist eine solche Person nicht tragbar. Er gefährdet interne Abläufe und Vorrechte und ist schon alleine wegen seiner Energie ein Ärger.
Ihn loszuwerden verlangte einen gewissen Effort. In einer zivilisierten Institution schickt man keinen Schlägertrupp los und kontaktiert keinen Scharfschützen, sondern man geht geschickter vor: Bei einem wichtigen Forschungsauftrag fand man formale Gründe, wieso Herr Waltisberger ihn nicht übernehmen konnte; eine Mitarbeiterin, die er wegen Inkompetenz entlassen hatte, bezichtigte ihn des sexuellen Übergriffs und bei der Direktion konnte man ausserdem durchsetzen, dass das Budget von Waltisberger wegen des Projekts 22 gekürzt wurde. Als dieser schliesslich gezwungen war, einen Kongress zu seinem Forschungsgebiet abzusagen, weil es plötzlich an Räumlichkeiten mangelte, war klar, dass er demissionieren musste. Allseits bedauert man seinen Rücktritt und bei seiner Verabschiedung werden sicher salbungsvolle Worte vom Departement, von der Direktion, seinen Kollegen und Kolleginnen ertönen. Man ist ja auch ein Problem los.
Bei dieser Szene handelt sich um ein Geschehen, wie es sich schon Tausende Male in Firmen, in Banken, in Staatsbetrieben, in der Politik, in Kulturvereinen oder in der Kirche abgespielt hat. Ein Kollege muss zurücktreten, weil er sich zu sehr einsetzt, zu gute Ideen einbringt oder weil er nicht faul ist. Ein Mitarbeiter wird herausgedrängt, weil er die Privilegien der anderen angreift oder einfach irgendwie nicht dazu passt. Natürlich: Offen dürfen wir unsere Ablehnung nicht zeigen und es wäre peinlich, wenn man die wahren Gründe nennen würde. Niemand gesteht sich ein, dass man eine Kollegin aus dem Büro heraushaben will, weil sie zu viel mit ihren männlichen Kollegen flirtet, viel Lob bekommt und ausserdem immer Blusen mit doofen Ausschnitten trägt – weil man sie als bedrohlich empfindet und deswegen loswerden will.
Selbstverständlich geschieht das alles zivilisiert, unter strikter Wahrung der Façon und Etikette. Auch wenn unser Urteil über einen Arbeitskollegen oder sogar über einen Verwandten endgültig ist – wir bleiben zivilisiert. Der zivilisierte Mitteleuropäer setzt andere Mittel ein: die Intrige, Hinterlist, Täuschung, Unterstellung oder ein Argument aus dem Fundus der Cancel Culture. Wer offensichtliche Mittel wie persönliche Beschimpfungen oder Gewalt einsetzt, disqualifiziert sich zweifach. Einerseits entlarvt er sich als Rohling und andererseits verrät er auch seine Inkompetenz. Er versteht es nicht, Kulturcodes zu seinem Vorteil einzusetzen, sondern er greift auf archaische Mittel zurück.
Wenn man als Schüler einen Kollegen nicht mag, kann man der Lehrerin gegenüber beiläufig erwähnen, dass er spickt, ein Pornoheft unter dem Tisch hat oder sich abschätzig über die Schule äussert. Wenn man in einer Firma gegen Kollegen vorgeht, erwähnt man dem gemeinsamen Chef gegenüber, dass man sich Sorgen um die Qualität der Arbeit macht, und fragt besorgt nach, wie es dem Kollegen gehe, er sei ja so oft krank und darum nicht verlässlich. In der Schule können die Qualitätskriterien des Teams zitiert werden, wenn man einen Lehrerkollegen loswerden will, und in einer Firma spricht man vielleicht von mangelnder Konfliktkompetenz, wenn einem ein Kollege nicht passt. Man muss dazu fähig sein, ohne Gesichtsverlust, ohne unfreundlich zu wirken und ohne seinen guten Ruf zu verlieren, gegen einen Kollegen zu intrigieren. Machtkämpfe finden heute nicht offen statt. Wenn wir uns durchsetzen wollen, müssen wir die Codes des Systems – sei es ein Bundesbetrieb, eine Firma oder eine Bildungsinstitution – zu unserem Vorteil einsetzen.
Gewaltverzicht als Kulturleistung
Dass wir Konflikte ohne Gewalteinsatz lösen, ist ein Fortschritt und ein nobles Ziel.2 Während Jäger und Sammler relativ friedlich zusammenlebten und nicht zu extremen Gewalteinsätzen neigten, hat sich die Gewalt bei sesshaften Kulturen enorm gesteigert. In den meisten Gesellschaften war es üblich, dass man die eigenen Ideologien und Interessen mit Gewalt durchsetzte. Wenn jemand bereit war, Gewalt einzusetzen, oder zur Brutalität neigte, wurde er sogar bewundert und hatte Chancen auf eine hohe Position und auf Ehre.
Gewalt wurde nicht als etwas Pathologisches verstanden, sondern als legitimes Mittel, um sich gegen Konkurrenten und vor allem gegen Fremdlinge durchzusetzen. Kriege galten als normales Mittel, um sich gegen andere Stämme, Nationen oder Clans durchzusetzen.
Gemäss einer Untersuchung von Ember und Ember zogen 75 % der primitiven Gesellschaften mindestens zweimal jährlich in den Krieg.3 In der nubischen Grabstätte in Gebel Sahaba fand der Archäologe Fred Wendorf heraus, dass über 40 % der Toten vor 12 000 bis 15 000 Jahren eines gewaltsamen Todes gestorben waren!4 In prähistorischen Gesellschaften scheint eine konstante Bereitschaft bestanden zu haben, in den Krieg zu ziehen, das Nachbardorf, den verwandten Stamm oder die Nachbarinsel zu zerstören.
Gewalt war alltäglich. In Crow Creek in South Dakota wurde eine Grabstätte gefunden, in der über 500 Männer, Frauen und Kinder begraben liegen. Die meisten von ihnen wurden richtig abgeschlachtet. Vor ihrem grausamen Tod wurden sie skalpiert und gefoltert.5 Gewalttätige Auseinandersetzungen gab es auch unter den Bewohnern der arktischen Regionen von Kanada. Die Athapaskan-Indianer sollen im 19. Jahrhundert die Chugach-Eskimos überfallen und massakriert haben. Die höchste Prozentzahl an Toten bei einem kriegerischen Konflikt erlitten nicht Frankreich, England und Deutschland während des Ersten Weltkriegs, wie man glauben würde, sondern die Yanomami des Amazonas oder die Jivaro in Ecuador.
Todesfälle verursachten jedoch nicht nur kriegerische Auseinandersetzungen, auch in friedlichen Zeiten waren die Mordraten in wenig entwickelten Gesellschaften höher als in der sogenannt zivilisierten Welt. Die Mordrate unter den indianischen Dorfbewohnern von Illinois war 140-mal höher als in Grossbritannien und 70-mal höher als in den USA in den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts.6
Gewalt war auch im Mittelalter als Mittel zur Durchsetzung des eigenen Rechts legitim. Oft arteten Konflikte in grausame Gewaltexzesse aus, wie dieser Bericht aus dem Jahre 1063 beschreibt:
Als sich der König und die Bischöfe zum Abendgottesdienst versammelten, kam es wegen der Aufstellung der bischöflichen Stühle wieder zu einem Tumult, nicht wie das vorige Mal durch einen zufälligen Zusammenstoss, sondern durch einen seit Langem vorbereiteten Anschlag. Denn der Bischof von Hildesheim, der die einmal erlittene Zurücksetzung nicht vergessen hatte, hatte den Grafen Ekhert mit kampfbereiten Kriegern hinter dem Altar verborgen. Als diese den Lärm der sich streitenden Männer hörten, stürzten sie rasch hervor, schlugen auf die Fuldaer teils mit Fäusten, teils mit Knüppeln ein, warfen sie zu Boden und verjagten die über den unvermuteten Angriff wie vom Donner Gerührten mühelos aus der Kapelle der Kirche. Sogleich riefen diese zu den Waffen; die Fuldaer, die Waffen zur Hand hatten, scharten sich zu einem Haufen zusammen. Brachen in die Kirche ein und inmitten des Chores und der Psalmen singenden Mönche kam es zum Handgemenge: Man kämpfte jetzt nicht mehr nur mit Knüppeln, sondern mit Schwertern. Eine hitzige Schlacht entbrannte und durch die ganze Kirche hallten statt der Hymnen und geistlichen Gesänge Anfeuerungsgeschrei und das Wehklagen der Sterbenden (...). Der König erhob zwar währenddessen laut seine Stimme und beschwor die Leute unter Berufung auf die königliche Majestät, aber er schien auf taube Ohren zu predigen.7
Wer sich im Mittelalter ungerecht behandelt oder beleidigt fühlte, griff zur Selbsthilfe. Fehden wurden persönlich ausgetragen. Die Kontrahenten wurden geschädigt, bis sie bereit waren, einzulenken und die an sie gerichteten Forderungen akzeptierten. Vor allem die Adligen hatten das Recht, selbst für Recht und Ordnung zu sorgen. Sie durften sich wehren, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlten. Das Fehderecht hatte unzählige gewalttätige Auseinandersetzungen zur Folge. Erst mit dem Ewigen Landfrieden von 1495 setzte sich langsam das staatliche Gewaltmonopol durch. Konflikte wurden fortan nicht immer und nur mit dem Schwert oder der Faust gelöst, sondern allgemeine Regeln der Konfliktbewältigung setzten sich durch. Das archaische Fehderecht wurde eingeschränkt und Duelle wurden verboten.
Gewalt wurde nicht nur dank dem Durchbruch der Zivilisation eingeschränkt, sondern es gibt auch demografische Gründe. Der Rückgang der Gewalt hängt auch mit der veränderten Bevölkerungsstruktur zusammen. Gemäss Gunnar Heinson gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Ausmass der Gewalt und der ‹youth bulge›.8 Damit ist der Anteil der unter 15-Jährigen in einer Gesellschaft gemeint. Je höher der Anteil der Jungen, desto grösser die Gewaltbereitschaft und die Wahrscheinlichkeit kriegerischer Auseinandersetzungen. Bei Familien mit vielen Kindern ist es wahrscheinlicher, dass junge Männer für Gewalteinsätze zur Verfügung stehen. Da sich die Bedeutung des Einzelnen für den Fortbestand der Familie reduziert, sind junge Männer eher bereit, sich für ein gesellschaftliches Ideal, eine Ideologie oder die Familienehre zu opfern. Die emotionale Bindung an das einzelne Kind wird schwächer. Die Familie kann den Verlust eines Sohnes eher verkraften, wenn noch zwei, drei weitere Söhne da sind. Bei einem Einzelkind oder zwei Söhnen wäre der Fortbestand der Familie gefährdet. Gesellschaften, die einen hohen Anteil an jungen Männern aufweisen, zeichnen sich durch ein beträchtliches Unruhepotenzial aus.
Wenn Familien im Durchschnitt drei oder vier Söhne aufziehen, dann gibt es mehr junge Männer, die bereit sind, für die Familie, den Stamm, das Tal oder eine Religion zu kämpfen. In der Schweiz wurde dieses Problem früher durch fremde Kriegsdienste gelöst. Die Antwort auf den Überschuss an jungen Männern waren Solddienste. Die schweizerischen Regierungen gestatteten fremden Ländern das Anwerben von Söldnern.
Im 16. und 17. Jahrhundert dienten zwischen 40 000 und 70 000 Schweizer in den Armeen Frankreichs, der Niederlanden, des Piemonts, Sardiniens und Englands. Das eigene Aggressionspotenzial wurde ausgelagert, die ‹youth bulge› kommerziell genutzt.9 Politische Ambitionen wurden begraben.
Heute sind in Ländern wie Äthiopien, Afghanistan, Somalia, Niger, Mali, Pakistan, dem Irak, dem Kongo, dem Sudan und in den palästinensischen Gebieten über 40 % der Bevölkerung unter 15 Jahre alt. Wenn gleichzeitig das Ernährungsproblem gelöst und ein gewisses Bildungsniveau erreicht wurde, besteht die Gefahr, dass Konflikte gewalttätig ausgetragen werden. Bei obigen Ländern handelt es sich um jene Gebiete, in denen in den letzten Jahren Gewalt und Terrorismus leider sehr verbreitet waren.10 Die Demografie scheint einen Einfluss auf die Art und Weise zu haben, wie wir mit Konflikten umgehen. In der Schweiz und in Deutschland sind lediglich 21 bzw. 19 % der Bevölkerung unter 15. Mit der sinkenden Anzahl Jugendlicher sinkt auch die Gewaltquote. Oder mit anderen Worten: Die Alten meiden körperliche Auseinandersetzungen – wenn sie aggressiv sind, dann setzen sie andere Mittel ein.
Der Blick in die Geschichte und auf andere Kulturen zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass wir in einer der friedlichsten Kulturen leben, die je existierten. Offene und rohe Gewalt ist zurückgegangen. Es gibt in der Stadt Zürich deutlich weniger Wirtshausschlägereien als vor hundert Jahren, die Dorfjugend der Prättigauer, Engadiner, Toggenburger und Walliser Dörfer geht viel weniger aufeinander los, als noch vor 150 Jahren und heute kann man sogar des Abends sicher von Basel nach Zürich reisen. Das Ausmass der Gewalt hat abgenommen. Natürlich erhöht sich dadurch nicht das subjektive Sicherheitsgefühl. Parallel zur Reduktion der Gewaltquote haben die Besorgnis und die Angst vor Gewalt zugenommen. Gewalt wurde zu einem Medienthema, über das wir allgemeine Ängste und Besorgnisse abhandeln. Unsere Sensibilität der Gewalt gegenüber hat zugenommen, sie wird öffentlich registriert und wir rufen nach Massnahmen.
Wer sich heute durchsetzen will, wählt subtilere Methoden. Faustschläge, der donnernde Zornausbruch oder der Einsatz von Waffen sind Mittel, die Randfiguren der Gesellschaft einsetzen. Nicht integrierte Jugendliche, verwirrte Alkoholiker oder verblendete Fanatiker greifen zur Gewalt. Sie setzen sich damit sogleich ins Unrecht, werden vielleicht sogar bestraft und tragen eine Zwei auf dem Rücken.
Endnoten
1In einem Interview im ‹ZEITmagazin-Leben› 51/07, S. 30.
2LeBlanc, St. (2003): ‹Constant Battles›. New York: St. Martins Press.
3Ember, C. & Ember M. (1990): ‹Cultural Anthropology›, 6. Auflage. New York: Prentice Hall.
4Wendorf, F. & Schild, R. (1986): ‹The Wadi Kubbanijy Skeleton: a Late Paleolithic Burial from Southern Egypt›. Dallas: Southern Methodist University Press.
5Keeley, L. (1996): ‹War before Civilization›. New York: Oxford University Press, S. 68 ff.
6Ebenda.
7Althoff, G.; Goetz, H.-W. & Schubert, E. (1998): ‹Menschen im Schatten der Kathedrale›. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 5.
8Heinsohn, G. (2006): ‹Söhne und Weltmacht›. Zürich: Orell Füssli.
9Widmer, S. (1971): ‹Illustrierte Geschichte der Schweiz›. Band 2, Zürich: Benziger, S. 241 ff.
10Äthiopien war in kriegerische Auseinandersetzungen in Somalia verwickelt und führte Krieg in der Tigray-Provinz, der furchtbare Darfur-Konflikt im Sudan führte zu Hunderttausenden von Toten und in Afghanistan kämpfte die NATO von 2001 bis 2021 gegen die Al Kaida.
2.Ausrichtung auf die Gemeinschaft
Eine Frau trifft sich heimlich mit einem Mann für ein Schäferstündchen. Hinter einem Gebüsch kommt man rasch zur Sache. Sex ist angesagt. Weil ihr heimlicher Liebhaber eine tiefe soziale Position einnimmt, ist Vorsicht geboten. Sie müssen aufpassen, weil der Mann der Frau eine einflussreiche Stellung in ihrer Gemeinschaft innehat und es auf keinen Fall tolerieren würde, wenn sich seine Frau mit jemand anderem tritt. Ihr Liebhaber würde geschlagen, getreten und von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Nun ist der Mann erregt. Er beginnt sich zu vergessen und will einen Lustschrei ausstossen. Bevor es jedoch so weit kommt, hält ihm die Frau schnell die Hand vor den Mund. Der Schrei könnte sie verraten.
Beim Personal dieser Szene handelt es sich natürlich nicht um Menschen, sondern um Affen. Die Szene wurde vom Biologen Frans de Waal bei einer Gruppe gefangener Schimpansen beobachtet.11 Offensichtlich sind die Menschen nicht die Einzigen, die Handlungen verbergen und sich gegenseitig austricksen. Auch unsere nächsten Verwandten in der Tierwelt sind dazu fähig. Interessant sind die Details: Die Schimpansin verhindert durch ihre Handlung einen Schrei, der sie beide verraten könnte. Sie wendet eine potenzielle Gefahr ab, der sie sich und ihren Kumpanen durch die Eskapade aussetzt. Sie scheint sich bewusst zu sein, dass sie mit ihrem Verhalten einen Code bricht: Als Schimpansen-Weibchen ist man einem Männchen zugeordnet und darf sich nur mit ihm abgeben. Fremdgehen ist verboten und wird geahndet. Die Handbewegung an den Mund ihres Liebhabers zeigt, dass die Schimpansin diesen Zusammenhang realisiert. Sie weiss, dass ihre Tat Ärger auslösen kann. Sie unterscheidet zwischen Richtig und Falsch, hat einen Gruppencode internalisiert. Statt diese Verhaltensregel zu respektieren, wählt sie eine andere Strategie. Sie setzt einen Trick ein, um ihr Verhalten zu verbergen und sie maskiert sich und täuscht ihren Gatten. Die Eskapade wird versteckt. Aus moralistischer Sicht verhält sie sich unehrlich, falsch und verlogen! Die Schimpansin handelt doppelbödig. Ist damit der erste Schritt Richtung Zivilisation getan?
Analogieschlüsse
Vergleiche zwischen Menschen und Tieren sind problematisch. Die Gefahr ist, dass wir unser eigenes Verhalten auf unsere tierischen Verwandten projizieren. Wir konzentrieren uns auf Ähnlichkeiten und vergessen die Differenzen. Wir beobachten die Tiere durch die Brille der menschlichen Zivilisation und suchen nach Bestätigungen. Es gibt vieles, das uns von der Tierwelt trennt. Nicht nur haben wir uns diesen eigenartigen aufrechten Gang angeeignet, sondern wir sind ein Wesen, das sich der Kultur verpflichtet hat. Wir sind nicht Sklaven unserer Instinkte, sondern kulturelle Werte und Regelungen beeinflussen unser Tun. Über die Jahrtausende haben wir ein System aufgebaut, durch das wir unsere animalischen Bedürfnisse zügeln und kanalisieren. Im Gegensatz zu Schimpansen lesen wir Zeitungen, bauen Flugzeuge und machen uns Sorgen über die Klimaveränderung! Wir sinnieren über den Sinn des Lebens, bestatten unsere Toten, malen Bilder von uns selbst und versuchen uns auch gegenüber fremden Menschen solidarisch zu verhalten.
Der Irrglaube an das Primat der Denkleistungen
Es gibt noch einen weiteren grundlegenden Unterschied. Wir sind Wesen, die denken. Wir lassen uns nicht von spontanen Impulsen leiten, sondern wir versuchen uns an der Ratio zu orientieren. Wir können Handlungen und Ereignisse in unserem Kopf durchspielen, Regeln aufstellen und Systeme entwickeln. Bei Streitigkeiten fordern wir Mitmenschen auf, «doch endlich Vernunft anzunehmen!», und vor Entscheidungen erwägen wir Pro und Kontra. Bewusste Überlegungen sollen die Basis unserer Handlungen sein. Wir entwerfen Konzepte, schmieden Pläne, setzen Ziele und wägen Optionen ab. Wir sind überzeugt, dass wir über die Freiheit der Wahl verfügen. Man kann sich für oder gegen eine Tat entscheiden.
Denken wirkt auf uns stimulierend. Wir stellen uns vor, dass vieles anders sein könnte. In unserer Vorstellung können wir Personen manipulieren und in die Weltpolitik eingreifen. «Der hastige Rückzug aus Afghanistan hätte verhindert werden können, wenn die Amerikaner die Kultur des Paschtunen miteinbezogen hätten!»; oder: «Wie würde man reagieren, wenn man 1910 Adolf Hitler in einem Wiener Café antreffen würde und wüsste, was er später anrichten wird?»
Wir sind sicher, dass wir nicht unseren Trieben ausgeliefert sind, sondern wir können als eigenständig handelnde Individuen auf die Umwelt einwirken. Unsere Aktionen werden durch unseren Willen gesteuert. Ich kann entscheiden, ob ich einen Kaffee trinken oder beim Bier bleiben soll. Ich kann bestimmen, ob ich mir über Weihnachten einen Sonnenbrand auf einem Strand in Mauritius einholen will oder in einem Restaurant in Küblis Karten legen soll. Grundlegende Entscheide sind mir überlassen. Es liegt an mir, ob ich weiterhin als Buchhalter der Raiffeisen-Bank in Visp arbeite oder aber als Strassenmusikant in Sidney mein Geld verdienen möchte. Dank unserem Denken können wir uns Folgen und Konsequenzen unserer Handlungen vorstellen.
Wir sind fähig, von unserer persönlichen Situation zu abstrahieren und andere Perspektiven einzunehmen. Wie wäre es, wenn ich zu einer Skitour auf den Piz Raschli aufbrechen würde, statt vor diesem Computer zu sitzen? Die Umwelt und unser Schicksal erleben wir nicht als ein Faktum, sondern sie wird form- und beeinflussbar. Unsere Vorstellungskraft identifiziert jedoch nicht nur Möglichkeiten, sondern konfrontiert uns auch mit verpassten Chancen und Missgriffen. Was wäre aus meinem Leben geworden, wenn ich mit siebzehn eine Banklehre absolviert hätte, anstatt Sozialarbeit zu studieren? Wieso habe ich nicht interveniert, als ein Trampassagier von einem betrunkenen Punk belästigt wurde?
Wenn wir denken, dann eröffnen sich uns neue Perspektiven, doch wir werden auch an die Begrenztheiten unseres Daseins erinnert. Im Kopf erobern wir die Welt und lösen Probleme, doch quälen wir uns auch wegen Misserfolgen und Debakeln. Wegen unserer Fähigkeit, die Welt und uns selber denkerisch zu verarbeiten, zu durchdringen und durch unsere Denkakte zu gestalten, beanspruchen wir eine Sonderposition unter den Lebewesen.
Sind unsere Begründungen mentale Spielereien?
Doch ist dieser Anspruch auch berechtigt? Handelt es sich beim Denken wirklich um eine autonome Kraft, die über unser persönliches Schicksal entscheidet, die waltend und gestaltend in die Umwelt eingreift? Wir sind persönlich von der Überlegenheit unserer Denkakte überzeugt. Wir verkünden, wieso wir heute Abend lieber ein Buch lesen statt ins Kino gehen wollen, wieso wir eine Kinks-CD anhören wollen, statt einen Spaziergang an den Seen zu machen oder einen Aperitif im ‹Toto› einzunehmen. Entscheidungen führen wir auf eigene Überlegungen zurück.
Ein Blick auf die Tierwelt und auf unser eigenes Verhalten macht jedoch skeptisch. Welche Begründung für ihr Verhalten würde die Schimpansin geben, wenn sie wie ein Mensch denken könnte? Sie habe versucht, einen Kollegen zu trösten, ihr Mann sei halt brutal zu ihr oder ein Kindheitstrauma habe zur Folge, dass sie Sex mit Liebe verwechsle. Wenn wir unser Verhalten und unsere Motive wirklich verstehen wollen, dann müssen wir unseren Einsichten, Schlussfolgerungen und Theorien gegenüber kritisch sein. Die Gründe, die wir für unsere Taten angeben, sind vielleicht nachgeliefert. Unsere Denkakte spiegeln nicht nur unsere Motive, Ziele und Bedürfnisse wider, sondern haben vielleicht noch eine andere Bedeutung. Unsere persönlichen Einsichten können nicht alleinige Grundlage sein, um die Hintergründe unserer Handlungen zu verstehen, sondern wir müssen uns selber auch zum Objekt unserer Reflexion machen. Unsere Begründung dafür, weshalb wir etwas tun, ist vielleicht nur eine schöne Geschichte. Wir müssen versuchen, die Bedingungen zu identifizieren, die sich hinter unseren Gedanken, Schlussfolgerungen und Philosophien verstecken. Was macht es aus, dass wir so denken, wie wir denken? Welche Bedeutung haben unsere Einsichten, wenn sie nur bedingt die Ursachen unserer Handlungen aufdecken?
Aus materialistischer Sicht handelt es sich bei unserem Denken um eine Folge unserer Gehirnaktivitäten. Wenn wir einen Gedankenblitz haben, dann korrespondiert dies mit einer Erregung der neuronalen Netzwerke im präfrontalen Cortex und im limbischen System. Ein Denkakt speist sich aus neurologischer Sicht aus verschiedenen Quellen innerhalb eines komplexen interaktiven Systems. Die Bilder, die wir in unserem Kopf entwickeln, sind ein Epiphänomen; eine Folge von elektrischen Entladungen und Konvergenzen. Wie diese Gehirnprozesse verlaufen, hängt vom Zustand des Gehirns ab. Ein Gehirntumor verändert Denkprozesse beträchtlich, wie auch eine Vergiftung oder Trunkenheit. Auch das Geschlecht hat einen Einfluss. Bei gleichen Denkaufgaben werden bei Frauen andere Gehirnregionen als bei Männern aktiviert.12
Unser Denken spiegelt jedoch nicht nur neurologische Prozesse wider. Was und wie wir denken, ist auch eine Funktion von äusseren Bedingungen. Soziale Hintergründe, die Erziehung, der Zeitgeist und die Religion spielen eine Rolle. Wir denken gemäss unseren soziokulturellen Vorgaben, unserem Habitus. Wir würden sicher anders denken, wenn wir im 19. Jahrhundert geboren, in einer anderen sozialen Schicht aufgewachsen wären oder ein anderes Geschlecht hätten. Vor fünfzig Jahren wurde vehement gegen Autoritäten gewettert und die Abschaffung des Leistungsprinzips gefordert, heute denkt man anders.13 Unser Denken folgt den Schablonen des Zeitgeistes.14 Auch unsere Gefühle und Komplexe beeinflussen unser Denken. Wenn wir wütend oder beleidigt sind, dann denken wir anders über eine Partnerschaft nach als gleich nach einem Sechser im Lotto. Unsere Emotionen beeinflussen unsere Einsichten.15 Auch die persönliche Lebensgeschichte hinterlässt in unseren Denkleistungen Spuren.
Wenn wir denken, dann werden wir nicht durch die «rationale Vernunft» geleitet, sondern durch eine Vielzahl von Faktoren und «animalischen Instinkten», die Metaphern, Geschichten und Bilder aus der Umwelt für ihre Argumente heranziehen.16 Denken ist also nicht ein autonomer Akt, sondern Ausdruck einer komplexen innerpsychischen Wirklichkeit und äusserer Beeinflussungen. Der Geist ist nicht unabhängig, sondern Spiegelbild unseres sozialen Kontextes, unserer Biologie und unserer persönlichen wie auch kollektiven Geschichte. Auch wenn wir uns anstrengen und Objektivität anstreben – was wir herausfinden, wird immer von anderen Situationen und Faktoren beeinflusst. Der Geist ist in der Psychologie des Menschen gefangen. Bei den Zusammenhängen, die wir in unserem Gehirn konstruieren, kann es sich um wichtige Erkenntnisse, mentale Spielereien oder Zitate eines launigen öffentlichen Diskurses handeln. Der unabhängige Geist ist eine Fiktion, wie es der französische Philosoph René Descartes (1596–1650) postuliert.
Dies bezieht sich auch auf Entscheidungen. Auch wenn wir überzeugt sind, selber entschieden zu haben, haben wir vielleicht lediglich eine Tendenz bestätigt, die unsere Biologie oder unsere soziale Situation anbot. Wir können darum nie wissen, ob unsere Überlegungen der eigentliche Grund unserer Handlungen sind oder ob unser Bewusstsein lediglich eine Referenz an eine Bezugsgruppe leistet, auf einen persönlichen Komplex reagiert oder ein biologisches Programm abläuft. Bei Entscheidungen und Denkleistungen handelt es sich also grösstenteils um einen unbewussten Prozess.
Die Chance der Vergleiche mit der Tierwelt
Zurück zu den Tieren. Beobachtungen in der Tierwelt helfen uns vielleicht, grundlegende archetypische Verhaltensmuster zu erkennen. Tiere lenken uns nicht durch komplizierte Erklärungen, Begründungen und andere Geschichten ab, sondern präsentieren nacktes und durch keine Rhetorik relativiertes Verhalten. Die Absenz von Begründungen erlaubt es uns, eigene archaische Motivationsstrukturen zu erkennen. Dank dem Vergleich mit unseren biologischen Verwandten gelingt es uns eher, den unbewussten Anteil unseres Verhaltens zu erkennen. Wir merken, welche Verhaltensweise vielleicht instinktoide Ursprünge hat und welche angelernt oder trainiert werden kann. Wir können den Entscheidungsraum identifizieren, der unserem Willen zur Verfügung steht. Es wird uns auch eher möglich, das Animalische vom Menschlichen zu trennen. Beobachtungen in der Tierwelt schärfen unseren Blick für Verhaltensweisen, die nicht rational und vom Willen gesteuert sind. Wir erkennen, wo bei uns ein unbewusstes Programm abläuft und wie gross unser Beeinflussungshorizont ist. Diese distanzierte Beobachtungsart sollten wir auch bei uns anwenden. Auch wir sollten uns mit einer neutralen Lupe betrachten und uns nicht gleich durch unsere Begründungen ablenken lassen. Der Schlüssel zum Verständnis unserer Motive liegt nicht nur in subjektiven Überlegungen und Spekulationen über uns selbst, sondern in nüchternen Beobachtungen unseres und des Verhaltens der Primaten. Die Parallelen, die wir zwischen Tierwelt und uns ziehen können, weisen darauf hin, dass gewisse Verhaltensweisen instinktgesteuert sind.
Vergleiche mit der Tierwelt sollten jedoch nicht der Legitimation problematischer Verhaltensweisen dienen. Wir sollten deswegen nicht das ausschweifende Sexualverhalten der Bonobos,17 die Vergewaltigungen der Orang-Utans18 oder die Aggressivität der Schimpansen übernehmen. Den Einfluss unbewusster Faktoren anzuerkennen heisst nicht, dass wir problematischem Verhalten ausgeliefert sind. Vergleiche weisen darauf hin, dass ein grosser Teil unseres Sozialverhaltens nicht so einzigartig ist, wie wir vielleicht meinen. Wenn wir die Macht dieser Urmuster oder Archetypen anerkennen, haben wir eine Chance, uns aus den Klauen der unbewussten Mächte zu befreien. Er braucht die Anerkennung dieses animalischen Referenzpunktes, damit wir weiterkommen. Unsere Theorien, Erklärungen und Begründungen müssen immer wieder mit dieser Psychologie des Menschen in Verbindung gebracht werden. Intrigen, Täuschungen und Mobbing sind nicht nur Produkte unserer Kultur, sondern es handelt sich um Verhaltensweisen, die eine archetypische Basis aufweisen. Diese ist tief in unserem Unbewussten als Disposition vorhanden und formuliert, lenkt und entwickelt auch entsprechende mentale Bilder und Begründungen. Wenn es in der Tierwelt normal ist, dass man mobbt und täuscht, wieso sollte es bei den Menschen anders sein?
Unser Verhalten wird grösstenteils von unserem Kollektiv bestimmt
Die kleine Szene der untreuen Schimpansin weist jedoch noch auf etwas anderes hin. Sie verweist auf ein existenzielles Dilemma. Es geht um das Problem von Individuum und Gemeinschaft. Ähnlich wie Schimpansen richten auch wir uns nach Gemeinschaften aus. Als soziale Wesen sind uns die Kontakte und die Hilfe von vertrauten Artgenossen wichtig. Wir leben nicht als Einzelgänger, sondern wachsen in Kollektive hinein. Unsere ersten Schritte und Worte wagen wir in der Familie, betreut und gepflegt von Vater und Mutter. Wir können nur überleben, wenn sie uns helfen. Der Säugling unterscheidet bald, welchen Menschen er vertrauen kann. Er schreit, wenn eine gute Kollegin der Mutter ihn in die Arme nehmen will oder ein fremder Nachbar ins Spielzimmer eintritt. Der Bekanntenkreis weitet sich aus. Das Kind ordnet die Menschen um sich herum verschiedenen Kreisen zu. Es erkennt, dass der knauserige Onkel und die exaltierte Tante irgendwie zum Kreis der Familie gehören, der gemütliche Nachbar jedoch eigentlich ein Fremder ist. Es ordnet Kontakte und Begegnungen den sozialen Kreisen und Gruppen zu, die ihr Milieu unterscheidet. Da gibt es neben den Familienmitgliedern, Nachbarn und Freunden auch noch die Alkoholiker vor dem Lebensmittelladen um die Ecke und die komische Frau am Bahnhof. Das Kind realisiert auch selber, dass es bestimmten Gruppen oder Kreisen angehört. Es versteht sich als Sohn der Familie Bütschwiler, typischer Bewohner des Seefelds in Zürich oder als Mitglied des Stamms des Wuaraos im Orinoko.
Die Zugehörigkeit zu diesen Gemeinschaften ist jedoch nicht gratis. Um einem Kreis, einer Familie oder sonst einem Kollektiv anzugehören, muss man sich anstrengen. Man muss bereit sein, sich prägen zu lassen. Die Gemeinschaft oder das Kollektiv drängen uns ihre Verhaltenweisen, Sprache und Werte auf. Bei diesen handelt es sich nicht um genuine Eigenentwicklungen, sondern um Variationen universeller Muster und Codes. Überall auf der Welt kommuniziert der Mensch über das Reden. Eine Sprache zu entwickeln ist eine anthropologische Grundeigenschaft.
Wir parlieren auf Deutsch, Schweizerdeutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, jedoch auch auf Katalanisch, Amarisch, Bengalisch, Gälisch, Aleutisch, Gagausisch, Tofalarisch, Udisch, Nogaisch, Suaheli oder Ingurisch – weltweit gibt es über 6000 Sprachen. Damit nicht genug. Auch innerhalb des gleichen Sprachraums werden Unterschiede gemacht. Regionale, familiäre und soziale Unterschiede manifestieren sich in sprachlichen Färbungen und Eigenarten – und in Gebärden: Überall auf der Welt braucht der Mensch die Hände, wenn er aus der Ferne kommunizieren möchte. Wie man mit den Händen jedoch winkt, zustimmt oder ablehnt, ist von Kultur zu Kultur, von Gemeinschaft zu Gemeinschaft unterschiedlich. Wenn wir in eine Gemeinschaft hineinwachsen und in ihr sozialisiert werden, dann wird von uns verlangt, die jeweiligen kulturellen Codes zu übernehmen. Wir dürfen einer Gemeinschaft angehören, von ihr profitieren, wenn wir ihre Form der Kommunikation, der Intonation oder ihre Verhaltensweise übernehmen.
Der Grund ist klar. Es geht um Loyalitäten. Genau wie Delfine sich aufgrund ihrer Dialekte verschiedenen Schwärmen zuordnen, wollen wir wissen, ob jemand zu uns gehört oder aus einer uns unbekannten Menschengruppe stammt. Oft werden über kleine sprachliche Aberrationen Zugehörigkeiten kommuniziert. Ein Bundesrat, der in einem akzentfreien Hochdeutsch spricht, ist verdächtig. Durch seine Intonation und seine Helvetismen drückt er aus, dass er der Schweiz und nicht nur dem deutschen Kulturraum angehört. Als Winterthurer sprechen wir von ‹nid› statt ‹nöd›, genauso wie ein Bewohner von Bern von ‹Modis› statt ‹Meitli› spricht wie ein Zürcher. Regionen und Städte grenzen sich durch bestimmte Kernwörter voneinander ab. Meistens handelt es sich um Wörter, die häufig gebraucht werden. Die Sprache ist darum nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern sie verdeutlicht Zugehörigkeiten. Dialekt und Soziolekt dienen der Identifikation. Es gibt keine Lingua franca oder universalen Codes, weil Regionen und soziale Schichten auf ihre Erkennungssignale pochen. Man will wissen, welchem Stamm, welcher Familie, welcher Gemeinde, welchem Land oder welcher sozialen Schicht jemand angehört. Wir streben nach Übersicht, weil wir unmöglich allen Menschen trauen können und uns nur mit wenigen Gruppen verbunden fühlen. Wenn jemand redet, dann wollen wir wissen, wo er herkommt. Spricht jemand den gleichen Sprachcode, fühlen wir uns verstanden.
Distinktionscodes
Wir teilen Mitmenschen jedoch nicht nur aufgrund der Sprachcodes verschiedenen Gruppen zu. «An der Uni gibt es zwei Studentengruppen: die Landeier und Städter!», behauptet eine Studentin der Universität Zürich. Die Landeier könne man klar an ihrem Kleidungsstil erkennen. Während Städter dunkle Farben bevorzugen, modisch gekleidet sind und keine weissen Turnschuhe tragen, sei dies bei den Landeiern anders: Sie fallen durch übergrosse Jacken, Hoodies und pseudomoderne Jeans auf.
Durch die Kleider verraten wir unsere Zugehörigkeiten. Obwohl wir uns theoretisch alle gleich kleiden und die gleichen Accessoires bei H & M, in der Migros oder sonstwo kaufen könnten, wählen wir nach spezifischen Kriterien aus. Meistens gefällt uns das, was unsere Bezugsgruppe vorschreibt. Der Geschmack ist keine unabhängige Grösse, sondern eine Funktion unserer Bezugsgruppe. Er wird durch unsere Clique, Region oder Nation definiert. In den Vereinigten Staaten gelten kurze, bequeme Slacks und T-Shirts als der ultimative Freizeitlook, während sich die Schweizer während der Freizeit gerne in Jeans stürzen. Unser Kleidungsstil ist eine Anpassungsleistung. Über die Kleidung kommunizieren wir Loyalitäten und Zugehörigkeiten. Die kritische Distanz der Altachtundsechziger der Gesellschaft gegenüber drückt sich heute noch in der Kombination aus blauer Jeans, Jacke, Hemd und Krawatte aus. Als Londoner stört es uns nicht, mit einem rosaroten Hemd bei der Arbeit zu erscheinen und Nordamerikaner legen am Arbeitsplatz grossen Wert auf makellos geglättete Hemden.
Kleine Handlungen verbergen wichtige Informationen
Kulturelle oder Gruppenidentifikation sind oft über kleine Variationen alltäglicher Handlungen möglich. Unsere Bezugsgruppen drücken Alltagshandlungen ihren Stempel auf. Nicht Gleichheit wird angestrebt, sondern Distinktion. In England hält man die Gabel beim Essen verkehrt und in der Schweiz müssen die Hände auf dem Tisch sein. Solche Eigenarten dienen der Abgrenzung gegenüber Aussenpersonen. Nochmals: Unsere subjektive Einschätzung kann ganz anders sein. Wir meinen, einen persönlichen Stil zu pflegen. Die kulturelle Prägung oder die Prägung durch unsere Bezugsgruppen können wir schwer erkennen. Auch wenn wir selber überzeugt sind, einen eigenständigen Stil zu pflegen, verraten sie doch unsere Verbundenheiten. Wir grüssen laut und deutlich wie Berner, zögerlich wie Appenzeller oder inszenieren Stress und Zeitmangel, wie es unter gewissen Beamten verbreitet ist. Wir setzen Wiener Schmäh ein oder die nüchterne, leicht arrogante Anrede der Bewohner von Stockholm. Der Psychologe Joseph Fargas mass in verschiedenen europäischen Ländern die Zeit, die verging, bis der hintere Autofahrer hupte, wenn der vordere Fahrer trotz grüner Ampel nicht anfuhr. Die Italiener waren am schnellsten. Nach fünf Sekunden wurde die Autohupe betätigt. Die Spanier liessen sich eine Sekunde länger Zeit, während die Franzosen nach sieben Sekunden ungeduldig wurden. Am längsten hielten es die Deutschen aus. Ganze siebeneinhalb Sekunden warteten sie, bis sie sich dem vorderen Fahrer bemerkbar machten!19





























