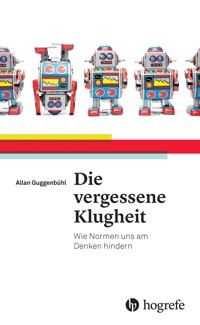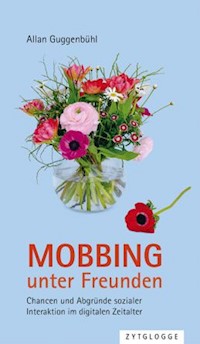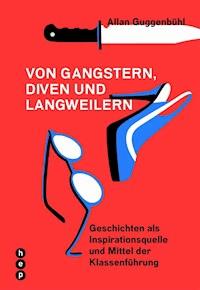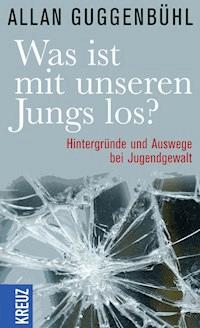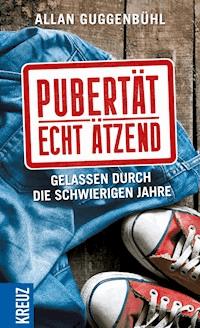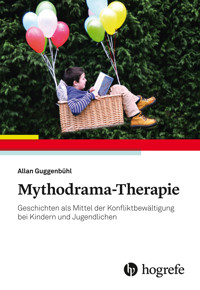
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie können Geschichten im Rahmen von Beratung und Therapie von Kindern und Jugendlichen gezielt eingesetzt werden? Allan Guggenbühl zeigt in vorliegendem Fachbuch, wie Geschichten helfen können, schwierige Situationen zu bewältigen. Er stellt dazu das von ihm entwickelte Mythodrama ins Zentrum. Das Buch dient als Einführung in das Mythodrama. Es liefert Fachpersonen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, eine fundierte Anleitung, wie das Mythodrama in ihrer Arbeit eingesetzt oder Elemente davon verwendet werden können sowie welche Geschichten sich besonders dafür eignen.Allan Guggenbühl beschreibt anschaulich die sieben Schritte des Mythodramas:1. Schritt: Der Grund des Zusammenseins – Fokussierung2. Schritt: Die Spielphase – die Kunst der leichten Zerstreuung3. Schritt: Die Inszenierung – das Erzählen einer Geschichte 4. Schritt: gelenkte Imagination5. Schritt: Drama, Bild und lockere Rede – die Performance6. Schritt: Transfer7. Schritt: Blick auf mögliche konkrete ÄnderungenDas Mythodrama lässt sich in verschiedenen Settings anwenden, wie bei thematischen Therapiegruppen (Kinder oder Jugendliche aus alkoholbelasteten Familien), der Arbeit mit jugendlichen Gewalttätern oder der Intervention bei Konflikten in Schulen. Das Verfahren hat sich bereits in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, in den USA sowie in China, Japan und Georgien bewährt und etabliert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Prof. Dr. Allan Guggenbühl
Institut für Konfliktmanagement
Untere Zäune 1
8001 Zürich
Schweiz
E-Mail: [email protected]
Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Psychologie
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Dr. Susanne Lauri
Bearbeitung: Barbara Buchter, Freiburg
Herstellung: René Tschirren
Umschlagabbildung: Getty Images/Natalia Crespo
Umschlaggestaltung: Claude Borer, Riehen
Satz: Mediengestaltung Meike Cichos, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2021
© 2021 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96027-2)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76027-8)
ISBN 978-3-456-86027-5
https://doi.org/10.1024/86027-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Der Mensch lebt in Geschichten
1 Mut zum Halbchaos: Grundlage der Gruppentherapie
1.1 Therapie mit Kindern und Jugendlichen
1.1.1 Grundlagen der Gruppentherapie
1.1.2 Die Qualitäten halbchaotischer Sitzungen bzw. der Gruppenpsychotherapie
1.1.3 Sprache: der Diskurs in der Gruppe
1.1.4 Relativierung der Selbstdarstellung der Teilnehmenden
1.1.5 Multiple Kontakte als Ressource
1.1.6 Übertragungen
1.1.7 Konflikte
1.1.8 Schatteninhalte durch Konflikte und Ärger erschließen
1.1.9 Die Außenwelt schaut zu
1.2 Grundlage der mythodramatischen Gruppentherapie
2 Phase eins: die Inszenierung der Gemeinschaft
2.1 Hilfe annehmen: ein Zeichen von Schwäche?
2.1.1 Die Angst vor dem eigenen Machtverlust
2.1.2 Aufwertungen dank Annahme einer Hilfeleistung
2.2 Das dritte Element: der furchtlose Ritter
2.2.1 Geschichten erweitern den Denkhorizont
2.2.2 Gruppengröße: Die Vielzahl macht es aus
2.3 Arbeitsschritte vor Gruppenbeginn
2.3.1 Die Notwendigkeit der Öffentlichkeitsarbeit
2.3.2 Der Einbezug der Vorinformationen
2.3.3 Führt Professionalisierung zu partieller Blindheit?
2.4 Gut gemeint ist nicht immer gut: Abklärungsodyssee
2.4.1 Die schädlichen Auswirkungen von Diagnosen
2.4.2 Vorurteile und Zuschreibungen spiegeln den sozialen Kontext wider
2.4.3 Der kritische Blick auf Akten
2.4.4 Auch die Meinungen der Kinder und Jugendlichen sind wichtig
2.5 Erstkontakte sind entscheidend
2.5.1 Begrüßungen signalisieren Bedeutungen
2.5.2 Verlauf der Vorgespräche
2.5.3 Kinder und Jugendliche als Täter begrüßen
2.6 Gruppenbeginn: Unterthemen der einzelnen Sitzungen
2.6.1 Nervosität und gebannte Aufmerksamkeit
2.6.2 Setzung der Form der Zusammenarbeit
2.6.3 Die Gruppe steht im Zusammenhang mit dem eigenen Leben
2.6.4 Betonung der Gemeinsamkeiten
2.6.5 Kleine Geschichten helfen weiter
2.7 Persönliche Einschätzung: Verhalten innerhalb der Gruppe
2.8 Flexible Zielsetzungen und Erwartungen der mythodramatischen Therapie
3 Phase zwei: Spaß und Bewegung – das gemeinsame Spiel
3.1 Spielerische Begegnungen erleichtern den Kontakt
3.2 In der Einfachheit liegt das Geheimnis
3.3 Die ganz normale Unterwerfung macht uns tüchtig
3.4 Im Spiel zeigt sich unsere Einzigartigkeit
4 Phase drei: die Macht der Geschichten
4.1 Die Kunst, in eine andere Welt einzutauchen
4.2 Geschichten als ein Medium des Kontaktes
4.2.1 Welche Sprache eignet sich für die Geschichten?
4.2.2 Das Geschichtenerzählen als Anbindungsakt
4.3 Gemeinschaften leben von Geschichten
4.4 Irritationen führen uns weiter
4.5 Die Sprengkraft der Archetypen
4.6 Gegensätze ziehen sich an
4.7 Fern und doch nah: der Topos
4.8 Trügerische Wahrheiten
4.9 Die Auswahl der Geschichten
4.9.1 Protagonisten und Antagonisten: Held, Opfer, Mentor etc.
4.9.2 Die Suche nach der passenden Geschichte
4.9.3 Der Mut zur eigenen Geschichte
4.9.4 Die Klimax ist der Beginn der Imagination
4.10 Erzähltechniken
4.10.1 Wenn der Erzähler zur Geschichte wird
4.10.2 Die Kunst des Memorierens
4.10.3 Hören, Sehen, Tasten, Schmecken und Riechen
4.11 Fieslinge, Narren und Helden – wer und wie sind sie?
4.12 Die Pause in der mythodramatischen Geschichte
4.12.1 Wiedererkennung ermöglicht Phasen der Entspannung
4.12.2 Pausen binden die Zuhörer ein
4.13 Bezüge zur Außenwelt einbauen
4.14 Das Geschichtenerzählen als Anbindungsakt
4.15 Der Einsatz von Bildern
4.16 Die Zuhörer sind gescheiter als der Erzähler
4.17 Haupt- und Nebenszenarien einsetzen
4.18 Gefühle und Stimmung durch Details ausdrücken
4.19 Der Einsatz von Mental Movers
5 Phase vier: durch Fantasien entführt werden – die Imagination
5.1 Durch den Raum stampfen, schreien: Inszenierungen
5.1.1 Schummeln als Gruppenerlebnis
5.1.2 Provokativ, harmlos, extrem oder banal: Jeder Schluss ist erlaubt
5.1.3 Räume: die Kunst der leichten Unordnung
5.2 Die konstruktive und die zerstörerische Kraft der Imagination
5.2.1 Unsere ganz normalen Verrücktheiten
5.2.2 Die Sehnsucht nach Grenzerfahrungen
5.2.3 Imaginationsreisen sind anarchistisch
5.3 Die Beseelung unseres Daseins
5.4 Exzentrische Interessen und Hobbys
5.5 Innere Vorstellungen beeinflussen Entscheidungen
5.6 Bilder fördern Imaginationen
5.7 Sind Enttäuschungen vorprogrammiert?
5.8 Imaginationen bereichern Beziehungen
5.9 Imaginationen – Realität oder Wunschdenken?
5.9.1 Die Gefahr starrer Zuschreibungen und Realitätsverlust
5.9.2 Unsere Vergangenheit: Fantasie oder Tatsachenbericht?
5.9.3 Imaginierte Persönlichkeitseigenschaften
5.9.4 Die mediale Inszenierung unserer Einzigartigkeit
5.9.5 In der Fremde ist das Leben spannender!
5.10 Führt Effizienz zu Imaginationsabwehr?
5.11 Die Autonomie der Person – eine Illusion?
5.12 Zwischen Realität und Fantasie: Kinder und Imagination
6 Die Umsetzung innerer Bilder
6.1 Bildliche Darstellung der Imaginationsinhalte
6.2 Interpretationen
6.2.1 Interpretation versus Diagnose
6.2.2 Das Setting bei Interpretationen
6.2.3 Vorgehen bei Bildinterpretationen
6.3 Dramatisierung
6.3.1 Anweisungen an die Untergruppen
6.3.2 Zusätzliche Anweisungen
6.3.3 Requisiten
6.3.4 Die Bühne
6.3.5 Die Rolle des Gruppenleiters während des Theaterspiels
6.4 Freies Improvisieren der Schlussversion
6.5 Fazit
7 Der Schritt in die Realität: der Transfer
8 Epilog: Profil des Mythodramas
Literatur
Der Autor
Sachwortverzeichnis
|9|Der Mensch lebt in Geschichten
Zusammenfassung
Am Anfang dieses Kapitels wird dargestellt, wie sich Kinder in die Welt hineinfantasieren und sich und der Umwelt Bedeutung geben. Anschließend wird die Rolle der Innenwelt bei Kindern und Jugendlichen beschrieben und die Möglichkeit, durch Geschichten als Psychotherapeut mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Die Geschichten werden als Brücken zur Innenwelt von Kindern und Jugendlichen verstanden und in ihrer Bedeutung für Gemeinschaften, aber auch als Verbindungsglied zwischen der Innenwelt der Kinder oder Jugendlichen und den Lebensrealitäten analysiert.
Simmentaler Kühe grasen auf dem Feld, am Horizont glitzert der Zürichsee. Im Hintergrund hört man einen Rasenmäher und den Trolleybus, der an der Endstation dieses Wohnquartiers kehrt. Ich lade meinen Einkauf aus dem Fond meines Wagens und überlege mir, was das letzte Gekritzel auf meinem Einkaufszettel bedeutet. Mascarpone? Plötzlich höre ich eine Stimme hinter mir: „Dies ist eine gefährliche Gegend!“, werde ich informiert. „Räuber treiben ihr Unwesen, haben bereits ein Haus am Waldrand in Brand gesetzt!“ Während ich mich umdrehe, teilt mir eine andere Stimme mit: „Keine Angst! Wir beschützen Sie!“
Hinter mir stehen nicht Polizisten oder eine Bürgerwehr, sondern drei sieben- bis achtjährige Knaben. Sie haben sich mit Holzschwertern, Wasserpistolen und einem Pfeilbogen bewaffnet. Sie haben einen Auftrag zu erfüllen! Sie müssten gegen Räuber vorgehen, teilen sie mir mit. „Woher wisst ihr von diesen Räubern?“, will ich wissen. Die Antworten kommen fast gleichzeitig aus drei Mündern: „Jemand hat zwei Männer beobachtet, die zum Häuschen am Wald geschlichen sind. |10|Sie sind eingebrochen, um die Spuren zu verwischen. Nachher haben sie das Haus angezündet!“ Ein Junge fügt aufgeregt hinzu, jemand habe ihm gesagt, dass diese Verbrecherbande jemanden gefangen nehmen wollte! Als ich ungläubig reagiere, zeigen die Knaben aufgeregt Richtung Wald: Tatsächlich steht dort ein ausgebranntes Gartenhäuschen!
Das Gartenhäuschen war nicht von Räubern angezündet worden, sondern wegen eines Grills in Brand geraten. Auch wurde das Quartier nicht von einer Bande heimgesucht. Die Räuber gab es nur in den Köpfen dieser Jungen. Die Räubergeschichte kursierte jedoch auch unter anderen Kindern dieses Quartiers. Viele waren überzeugt, dass es diese bösen Männer wirklich gibt. Fake News? In den Augen dieser Kinder war das abgebrannte Gartenhäuschen am Waldrand der ultimative Beweis des Treibens düsterer Männer. Aus ihrer Sicht müsste auch den Erwachsenen klar sein: Gegen diese Bösewichte musste etwas unternommen werden! Die heldenhaften sieben- bis achtjährigen Jungen waren dazu bereit.
Die Episode spielte sich vor einigen Jahren in einem friedlichen Vorstadtquartier ab. Alles schien so, wie es sein sollte. Die Autos waren auf der rechten Straßenseite, in der blauen Zone geparkt, ein Facility Manager wischte den Vorplatz eines Wohnhauses, ein Jogger hatte seine Runde beendet und klaubte seine Post aus seinem Briefkasten, eine Frau entsorgte einen städtischen blauen Kehrichtsack im blockeigenen Container. Eine Spaziergängerin hielt schuldbewusst einen Hundekotbeutel in der Hand, der von ihrem Pinscher stammen musste. Im ersten Stock des Wohnblockes sah man hinter einem Fenster einen Jugendlichen an einem Pult. Alle verhielten sich gesellschaftskonform, nur das Verhalten der drei Knaben war außergewöhnlich.*
Würde ein extraterrestrisches Wesen die Szene beobachten, dann müsste es schlussfolgern, dass allen außer den Knaben ein Chip in ihren Gehirnen implantiert worden war! Ihr Verhalten folgte einem Regelsystem. Die Erwachsenen orientierten sich an rationalen Überlegungen und gesellschaftlichen Codes. Sie erfüllten definierte Funktionen, passten sich an. Das Verhalten der Knaben hingegen ließ sich nicht aus dem Kontext ableiten. Sie verhielten sich nicht konform, sondern lebten eine Fantasie aus. Haben Erwachsene keine Fantasien mehr?
Könnten wir in die Köpfe der Erwachsenen blicken, dann erhielten wir vielleicht ein anderes Bild. Ihre Konformität könnte vorgetäuscht sein. Wahrscheinlich werden auch sie von Fantasien umgetrieben. Die Spaziergängerin mit dem Hundekotbeutel hatte sich vielleicht vorgestellt, wie ihr Pinscher den Jogger beißt |11|und im Quartier für Aufruhr sorgt. Der Jogger wurde vielleicht durch die Hundehalterin an seine Ex-Frau erinnert, die die Fenster des Nachts immer geschlossen haben wollte. Der Chauffeur betrachtete die Glätte der Endschlaufe und versetzte sich innerlich in einen Lastwagenfahrer, der über einen vereisten See im Yukon braust. Der Jugendliche war in ein Computergame vertieft und stellte sich vor, als Ritter in einem Turnier um die schöne Genevieve zu kämpfen. Mit anderen Worten: Auch Erwachsene haben Fantasien. Im Gegensatz zu Kindern distanzieren sie sich jedoch meistens von ihren andrängenden, spontanen Vorstellungen. Sie haben gesellschaftliche Erwartungen und eigene Aufgaben zu erfüllen. Die eigene Rolle und Funktion in der Gesellschaft zu erfüllen hat Priorität.
Diese Einstellung zeichnet die Mehrheit der Menschen aus. Man distanziert sich von seiner Fantasiewelt. Innerlich brodelt es jedoch weiter, spontane Bilder, Gefühle und Empfindungen führen ein Eigenleben. Vor dem inneren Auge werden Szenen rekapituliert, Wünsche erfüllt, Traumen verarbeitet oder Zukunftsszenarien entworfen, ohne dass man darauf eingeht. Die spontanen Einfälle werden als flüchtige Gedanken oder Abfallprodukte des Gehirns empfunden. Handlungen nach Fantasien auszurichten, wäre unangebracht, würde den Alltag durcheinanderbringen. Man behält sie deswegen lieber für sich, verdrängt sie und lässt nur jene Fantasien zu, die die Gesellschaft akzeptiert und sie nicht irritieren. Man will schließlich niemanden vor den Kopf stoßen.
Um die Hintergründe dieses Phänomens zu verstehen, bietet sich die Psychologie an: Sie sucht nach Gesetzmäßigkeiten, Zusammenhängen, Motiven und Einflussfaktoren unseres Verhaltens und Erlebens. Sie analysiert Fehlhandlungen, Störungen, studiert Beziehungen, organisiert Untersuchungen und evaluiert Leistungen. Die Psychologie basiert auf zwei Erkenntniskanälen: Außenbeobachtungen und Auseinandersetzungen mit dem Innenleben. In der empirischen Psychologie geht es um die Außenschau. Sie ist der Realität verpflichtet. Sie gewinnt Erkenntnis aufgrund von Beobachtungen. Es geht um das Sammeln von Erfahrungswissen und das Erkennen von Gesetzmäßigkeiten. In der empirischen Wissenschaft werden darum Untersuchungen durchgeführt, die zu Evidenzen (evidence based) führen. Sie konzentriert sich auf messbare Eigenschaften und interpersonal feststellbare Verhaltensweisen. Durchschnitte werden errechnet und Signifikanzen gesucht. Schlussfolgerungen sollen nachvollzieh- und vor allem replizierbar sein.1 Was man beobachtet oder untersucht, kann fotografiert, gefilmt, protokolliert oder durch Interviews objektiviert werden.
|12|Der zweite Erkenntnisweg ist die Innenschau. Wenn wir uns dem Innenleben zuwenden, dann versuchen wir uns aus uns selbst heraus zu verstehen. Ausgangspunkt dieses Erkenntnisweges sind innere Wirklichkeiten: Bilder, Fantasien, Gedanken, die Außenpersonen nicht zugänglich sind. Diese private Welt kann nicht objektiviert werden, da sie nur dem inneren Auge und Ohr der betreffenden Person zugänglich ist. Außenpersonen können unser Innenleben weder fotografieren noch Tonbandaufnahmen herstellen oder filmen. Es bleibt der Außenwelt verborgen. Was in uns abläuft, kann weder von Zweitpersonen eingesehen noch empirisch erfasst werden. Wir sind die einzigen Zeugen unserer persönlichen Träume, Fantasien, Visionen, Gedanken, und nur wir werden mit unseren eigenen Emotionen konfrontiert. Auch den neuesten neurologischen Techniken gelingt es nicht, die Gedanken und Fantasien eines Menschen zu entschlüsseln.
Vieles, was uns antreibt, erklärt sich jedoch erst durch den Einbezug des Geschehens der Innenwelt. Darum ist die Reflexion über uns selbst wichtig für das Verständnis unserer Motive, Einstellungen und Ziele. Da unser Innenleben jedoch weder mit Daten noch direkten Beobachtungen erfasst werden kann, können wir Gesetzmäßigkeiten nur erdenken: Theorien und Modelle aufstellen, die helfen, uns zu verstehen. Die Grundlage sind Erinnerungen, Assoziationen, Einfälle, Fantasien, Komplexe und Gefühle, denen wir mithilfe des Bewusstseins nachgehen. Oft haben die Inhalte unseres Innenlebens jedoch keinen oder nur einen losen Zusammenhang mit äußeren Faktoren. Fantasien führen, wie ich später genauer erläutern werde, ein Eigenleben. Sie sind kaum zu beeinflussen. Sie sind nicht Produkte unseres Willens, sondern unbewusster Kräfte. Diese treiben mit uns ihr eigenes Spiel, wir sind ihnen ausgesetzt. Eine Fantasie verfolgt, ein Gefühl bedrängt uns, eine Idee lässt uns nicht los oder ein Gedanke geht uns nicht aus dem Kopf. Die Innenwelt hat ihre eigenen Regisseure und folgt einem eigenen Skript. Was in uns abläuft, verhält sich oft anarchisch, missachtet soziale Konventionen und kümmert sich nicht um die Moral. Unsere Innenwelt ist kein Abbild äußerer Eindrücke, sondern generiert sich aus angeborenen Anlagen, Erinnerungen und Erlebnissen.
Der Innenwelt können wir uns jedoch indirekt zuwenden, sind dabei aber auf Vermittlungen angewiesen. Dazu haben wir ein großartiges Mittel zur Verfügung: die Sprache. Durch sie erhalten wir Informationen jenseits unseres Sinnes- und Wahrnehmungshorizonts. Sie bieten uns Metaphern an, dank derer wir in unbekannte Gefilde vordringen können. Die Sprache hilft uns, geistige Beschränkungen zu überwinden. Wir können deswegen auch das Geschehen unserer Innenwelt ebenso wie auch jenes unserer Mitmenschen sprachlich erfassen. Wenn jemand uns schildert, dass er im Traum in weißer Kleidung einen riesigen Kon|13|zertsaal aufsuchte und hilflos auf einem alten Handy herumdrückte, bis der Dirigent, in Frack und Windeln gekleidet, ihn begrüßte, dann entwickeln wir dank der Versprachlichung ein Bild dieser absurden Szene in unserem Kopf. Natürlich ist dieses persönlich gefärbt und entspricht nur approximativ den Vorstellungen des Träumers. Dank der Sprache ahnen wir, was sich im Inneren des Mitmenschen abspielt.
Das Innenleben reduziert sich nicht auf statische Bilder wie in einer Galerie, sondern zeichnet sich durch eine Dynamik aus. Es gleicht einem Theater. Dramen, Tragödien, Komödien, Romanzen werden inszeniert. Verschiedenste Figuren treten in diversen Szenarien auf. Wir sehen uns auf eine Alp im Berner Oberland versetzt und einen Tango tanzen, sind in einem Zug nach Sidney und werden durch ein Krokodil verfolgt oder sitzen im Pig & Whistle in Kyoto, trinken ein Bier, während Präsident Biden eintritt und mit Mäusen tanzt. Unser Innenleben ist uns oft unverständlich, vielfach faszinierend oder hie und da auch irritierend. Das Innenleben spiegelt gleichzeitig unsere Lebenswelt wider. Oft treten Menschen auf, die uns vertraut sind, vieles bleibt aber auch mysteriös. Wieso stelle ich mir vor, wie ich den Bellevueplatz sprenge? Was soll diese erotische Fantasie über eine Arbeitskollegin? Unser eigenes Innenleben zu entschlüsseln und darin einen Sinn zu suchen, bleibt die persönliche Lebensaufgabe von uns allen. Doch wie soll man die einzelnen Bilder, Eindrücke, Gedanken, Einsichten, Empfindungen und Gefühle einfangen? Wie können wir mit unseren inneren Fantasien, Ablagerungen und Engrammen umgehen? Und: Wie bringen wir diese innere Kakofonie mit dem Tsunami an Eindrücken der Außenwelt in Zusammenhang?
Die Antwort lautet: durch Geschichten. Der Mensch hat schon früh die Fähigkeit entwickelt, Paradoxien, Irritationen, Faszinationen und Traumen durch Geschichten einzufangen (Pinker, 1997). Durch sie werden Einzelereignisse und Bilder miteinander verbunden und zu einem sinnvollen Ganzen entwickelt. Geschichten werden aus Erinnerungen, dem eigenen Wissen, gesellschaftlichen Vorgaben konstruiert und sind eine Antwort auf ein Problem oder eine Herausforderung. Mithilfe von Geschichten versuchen wir uns zu verstehen, mit unseren Mitmenschen in Kontakt zu treten und Gemeinschaften zu entwickeln (Wilson, 2003). Wir kreieren sie aus gesellschaftlichen Mythen, Beziehungserfahrungen, Traumen, archetypischen Vorgaben, reichern sie mit persönlichen Erlebnissen an und kalibrieren sie mit der eigenen Einstellung. Geschichten verwenden persönliche Eindrücke, Tatsachen und amplifizieren diese von eigenen Fantasien und Erwartungen. Sie sind das Bindeglied zwischen Außen- und Innenwelt, das Resultat eines Kompromisses zwischen psychologischen Bedürfnissen und den Anpassungsforderungen der Außenwelt. Persönliche Bedürfnisse werden platziert, er|14|lebte Traumen relativiert oder hervorgehoben. Geschichten geben uns eine Orientierung.
Viele Geschichten, die wir entwickeln und die uns faszinieren, handeln von Konflikten. Es geht um Situationen, die überfordern, belasten oder irritieren. Eindrücke, Tagesreste, Erlebnisse und Erinnerungen werden verarbeitet. Sie sind der Versuch der Seele, mit schwierigen Ereignissen oder Problemen umzugehen, indem innere Ressourcen einbezogen werden, um eine Perspektive zu finden, um weiterzukommen.2 Gedanken, Beobachtungen, Erinnerungen, Träume und Wahrnehmungen werden durch die Geschichte in einen Ablauf gebracht, sodass wir etwas verstehen und aus einem Geschehen vielleicht sogar einen Sinn ableiten können. Wir glauben dann zu verstehen, wieso etwas geschehen ist und was es zu bedeuten hat.
Geschichten mobilisieren ein drittes Element unseres Daseins: die Imagination. Sie erlaubt uns, in fiktionale Welten einzutauchen. Die Fiktion befreit uns von der Gefangennahme durch die Realität. Wir können dem Hier und Jetzt etwas entgegensetzen, wenn es droht, uns zu vereinnahmen. Dies geschieht bereits bei banalen Ereignissen. Wir kritisieren die Partnerin, weil sie zu spät kommt. Eigentlich geht es lediglich um die Koordination der eigenen Fortbewegung, damit man zum gleichen Zeitpunkt an einem bestimmten Ort präsent ist, ein organisatorisches Problem. „Alle in eurer Familie nehmen es mit der Pünktlichkeit ungenau, schon dein Vater …“, werden wir vielleicht der Partnerin vorwerfen und zur Antwort bekommen, dass man selbst aus einer „pingeligen Spießbürgerfamilie“ stamme, die nur Pflicht und Ordnung im Kopf habe. Wir reagieren mit Familiengeschichten.
Natürlich glauben wir, dass sie wahr sind, doch oft handelt es sich um „thruthy stories“: persönliche Geschichten, bei denen wir beanspruchen, dass sie stimmen, obwohl es sich ganz oder zum Teil um Fiktionen handelt (Gottschall, 2012, S. 161ff.). Auch wenn wir uns um Wahrheit bemühen und scheinbar Fakten zitieren, handelt es sich um Fantasien (Schacter, 2001, S. 71ff.; Livingstone Smith, 2004, S. 9ff.). Wir versuchen, uns mithilfe einer Geschichte von der Realität zu distanzieren, indem wir die entsprechende Herausforderung in einen anderen Topos transferieren.3 Geschichten helfen uns bei der Bewältigung eines Problems, können jedoch auch Konflikte verschärfen.
|15|Gemeinschaften leben von Geschichten. Sie ermöglichen das Zusammenleben und stärken die Solidarität der Mitglieder untereinander.4 Familien brauchen Geschichten, damit interne Differenzen und Persönlichkeitsunterschiede kompensiert werden und das Gefühl einer gemeinsamen Herkunft entsteht. Firmen leben von Geschichten, um den Angestellten eine Vision oder sich ein Profil zu geben. Jeder einzelne Mensch entwickelt zudem eine persönliche Lebensgeschichte, durch die er persönliche Eigenschaften, Stärken, Schwächen und Schwierigkeiten begründet. Eine persönliche Lebensgeschichte gehört zum Selbstbild. Sie dient der Orientierung im Leben und hilft Entscheidungen zu fällen.
Zurück zur Eingangsgeschichte. Die drei Jungen fühlten sich berufen, in ihrem Quartier für Ordnung zu sorgen. Haben sie jedoch wirklich an die Räubergeschichte geglaubt? Wohl kaum. Eher ist wahrscheinlich, dass die Geschichte für sie eine Quasirealität war. Es handelte sich um eineRealitätskonstruktion, wie wir es bei Kindern immer wieder beobachten. Die Knaben haben nicht wirklich geglaubt, dass es die Räuber gibt, doch sie haben sich in eine Stimmung versetzt, die die Räuber in reale Figuren verwandelte. Sie lebten die Räubergeschichte sowohl emotional als auch mental. Dank dieser Identifikation konnten sie sich innerlich in die Räuberszenerie versetzen und die entsprechende Spannung, Angstlust und Suche nach Antworten nachvollziehen. Sie konfrontierten sich mit einem existenziellen Thema: dem Umgang mit dem Bösen.
In diesem Beispiel zeigt sich eine Funktion der Geschichten. Sie sind als eine Vorlage unserer Umwelt und von uns selbst zu verstehen. Sie sind zudem eine wichtige Verbindung zwischen der Realität und der Innenwelt. Dank ihrem fiktionalen Charakter können wir uns eher der Unmittelbarkeit des Moments hingeben und über diesen Umweg sowohl emotional wie auch mental unser Dasein ausloten. Geschichten sind eine Brücke zwischen der Innerlichkeit und der Welt dort draußen, sie machen uns mächtig und handlungsfähig. Voraussetzung ist jedoch ein Verständnis für Quasirealitäten. Während jüngere Kinder in ihnen eine Ressource sehen und Geschichten spielerisch umsetzen, tendieren Erwachsene dazu, ihre Bedeutung zu relativieren oder sie zu kategorisieren. Es geht dann nicht um eine spielerische Darstellung von Ereignisfolgen und ihre Auswirkungen, sondern um Fake News, Fakten, wahre Geschichten, Tatsachen, Klatsch oder Erfindungen. Die Gefahr ist, dass damit ihre Bedeutung vergessen wird. Geschichten sind eine wertvolle Zugabe in unserem Leben, helfen uns, Innen und Außen zu verbinden. Sie sind eine Aufforderung zur Auseinandersetzung mit sich selbst und der Um|16|welt. Wenn Geschichten jedoch verdinglicht, analysiert, auf ihren Wahrheitsgehalt hin geprüft oder nach ihrer literarischen Qualität beurteilt werden, dann drohen wir uns von ihnen zu distanzieren. Wir lösen uns aus ihnen heraus. Der Widerhall, den eine Geschichte möglicherweise in uns auslöst, wird nicht wahrgenommen oder als unwichtig erachtet. Es wird nicht erkannt, dass eine Geschichte auch Ausdruck eines inneren Geschehens ist oder auf ein verborgenes Motiv hinweisen könnte.
Dies ist bei den Personen der Geschichte in der Vorstadtsiedlung der Fall: Die Hundehalterin kämpft möglicherweise mit Aggressionen, identifiziert sich vielleicht zu sehr mit ihrem Pinscher; der Jogger hat die Trennung von seiner Frau nicht überwunden; der Buschauffeur möchte seinem Leben eine Wende geben und seine Abenteuerlust ausleben, und der Jugendliche hätte gerne eine Freundin, die er beeindrucken kann. Sie entwickeln Geschichten, bestückt mit Elementen ihres Daseins, die ihnen einen Weg zu sich selbst und ihrem Dasein ermöglichen würden. Diese innere Ressource wird jedoch nicht genutzt. Im Gegensatz zu vielen Kindern, die ihre Fantasien als Quasirealität wahrnehmen, neigen wir dazu, sie zu ignorieren. Als Erwachsener muss man in der Gesellschaft funktionieren. Die Anpassung an Codes und Normen steht im Vordergrund. Es gilt sich zu bewähren, durchzusetzen, mit den Mitmenschen zu kommunizieren, die Stellung zu bewahren, empathisch zu sein und den eigenen Ruf nicht zu zerstören. Der Dialog mit der eigenen Innerlichkeit rückt in den Hintergrund.5 Dieser Entfremdungsprozess hat sich durch die Digitalisierung unseres Lebens verstärkt. Unser Bedürfnis nach Geschichten leben wir über Filme, Netflix und Medienklatsch aus. Wir lassen uns aufregen, beängstigen, irritieren und steuern durch konstruierte Geschichten, ohne uns selbst einzubringen oder infrage zu stellen. Der Prozess, den Geschichten auslösen können, wird im Alltag nicht integriert. Wenn jemand von einer Netflix-Serie hingerissen ist oder einen Roman verschlingt, dann wird selten ein persönlicher Bezug hergestellt. Geschichten werden in einem unpersönlichen Raum abgehandelt, damit sie uns nicht gefährlich werden. Wir können uns der Illusion hingeben, sie hätten nichts mit uns selbst zu tun, sondern es gehe um Unterhaltung, Informationen oder Zerstreuung. Wir drohen uns selbst, unsere Seele zu übersehen.
In diesem Buch wird ein Weg aufgezeigt, wie man die Distanz zwischen der Innenwelt und der Außenwelt kreativ nutzen kann. Die Innenwelt wird als Ressource verstanden, dank derer wir dem eigenen Leben Tiefe verleihen, Gefahren er|17|kennen und das Leben einen Sinn bekommt. Wie C. G. Jung beschreibt, führt der Weg ins Leben über die Auseinandersetzung mit sich selbst. Um sich diesem Mysterium des Seins anzunähern, braucht es jedoch entsprechende Modelle und Begrifflichkeiten.
Das Mythodrama hilft vor allem Kindern und Jugendlichen, sich mit ihrer Innenwelt auseinanderzusetzen. Was in ihnen vorgeht, wird dank der Geschichten erschlossen. Geschichten enthalten Symbole und Bilder, die die Kinder oder Jugendlichen anregen, zu fantasieren und sich ihrer Emotionen gewahr zu werden.6 Über das Mythodrama treten sie eine Reise zu sich selbst an mit dem Ziel, das eigene Potenzial zu nutzen, damit sie Herausforderungen und Probleme besser bewältigen. Sie nutzen ihre Eigenwelten, um sich in der Realität zu ordnen und zu motivieren und um Herausforderungen anzupacken. Die Räubergeschichte der Knaben ist ein Beispiel, wie dies geschehen kann. Ihre Geschichte ermöglichte ihnen, sich als Gemeinschaft zu erleben, eigene Energien zu mobilisieren und sich auf ein gemeinsames Ziel zu einigen. Das Mythodrama geht von folgenden Erfahrungen aus:
Respekt vor der eigenen Innenwelt
Die Auseinandersetzung mit der Innenwelt ist bei Kindern und Jugendlichen eine Voraussetzung, um schulische und persönliche Herausforderungen zu bewältigen. Wenn die Innenwelt sich in einer Geschichte widerspiegelt, dann hilft dies Kindern und Jugendlichen, jedoch auch Erwachsenen, sich zu ordnen. Passt ein Narrativ, dann finden Emotionen, Frustrationen und Hoffnungen einen Weg ins Bewusstsein. Bei den Knaben war es die Räubergeschichte. Sie haben sich an einer narrativen Vorgabe orientiert, um eigene Fantasien und Bestrebungen auszudrücken.
Quasirealität realisieren
Um die Bedeutung zu erfassen, braucht es jedoch das Element der Quasirealität. Damit es zu seelischen Resonanzen kommt, müssen sie ins eigene Leben überführt werden. Dies geschieht, indem wir Geschichten weiterspinnen, spielerisch umsetzen, sie bildlich ausdrücken, in einem Sandspiel darstellen oder in einem |18|Theater dramatisieren. Dank Inszenierungen und Konkretisierungen können wir persönliche Bedeutungen erahnen. Der Kontakt zwischen Innen und Außen wird hergestellt, und wir machen uns wieder mit dem eigenen Dasein vertraut. Die Knaben haben die Räubergeschichte gelebt, indem sie sie in ihren Alltag transferiert, weitergesponnen und sich persönlich gewidmet haben. Diese Quasirealität ermöglichte ihnen, sich selbst kennenzulernen und ihrem Alltag einen Sinn zu verleihen. Ob diese mit den eigentlichen Bedeutungen der Geschichte übereinstimmt, ist nicht relevant. Entscheidend ist, dass die Geschichte ihnen half, sich selbst zu dechiffrieren und mentale Energien zu aktivieren.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden in diesem Buch nicht durchgehend weibliche und männliche Formen parallel, sondern oftmals neutrale Formen oder – den Regeln der deutschen Sprache folgend – das generische Maskulinum verwendet. Dennoch schließen alle enthaltenen Personenbezeichnungen das jeweils andere Geschlecht mit ein.
Die Reproduzierbarkeit ist jedoch leider in vielen psychologischen Untersuchungen nicht gewährleistet. Siehe Richie (2020)
Traumen können jedoch zu einer Fixierung auf ein Ereignis führen. Die betroffene Person bleibt dann innerlich stecken und ist unfähig, eine Perspektive zu entwickeln.
Eindrücklich sind die Schilderungen des Priesters Lawrence Jenco (1934 – 1996), der eine 19-monatige Gefangenschaft durch radikale Schiiten erlebte. Er habe die Zeit nur überlebt, weil er innerliche Reisen unternahm. Siehe dazu Jenco (1995)
In van Schaik & Michel (2017) werden die biblischen Geschichten dargestellt als Versuch menschlicher Gemeinschaften, um die Herausforderungen der Sesshaftigkeit zu bewältigen.
Was damit gemeint ist, habe ich in meinem Buch Die vergessene Klugheit. Wie Normen unser Denken verhindern (Guggenbühl, 2016) zu beschreiben versucht.
Der bekannte amerikanische Philosoph Allan Bloom meinte in einem Gespräch mir gegenüber, nachdem ich mich als Psychologe vorgestellt hatte, dass für ihn William Shakespeare alle Psychologen in den Schatten stellte. Er habe – mehr als die meisten Psychologen – die Menschen verstanden und in seinen Stücken ihre Psyche dargestellt.
|19|1 Mut zum Halbchaos: Grundlage der Gruppentherapie
Zusammenfassung
Dieses Kapitel beginnt mit Fragen und Herausforderungen, mit denen Therapeuten im direkten Kontakt mit einem Kind oder Jugendlichen konfrontiert werden, wenn sie helfen und mit ihm arbeiten wollen. Anschließend führt es in die Grundlagen der Gruppenpsychotherapie mit Kindern und Jugendlichen ein. Vor allen beim Versuch, bei Konflikten zu helfen, kommt man oft an Grenzen, wenn man sich nur auf das Gespräch verlässt. Es braucht weitere Mittel, wenn wir Kindern oder Jugendlichen helfen wollen, ihre Herausforderungen und Probleme zu bewältigen. Es gilt, ihr Inneres zu erschließen und ihnen zu helfen, ihre Ressourcen zu entdecken. Im zweiten Teil dieses Kapitels werden die Qualitäten und Möglichkeiten des Gruppensettings beschrieben. Die Gruppensituation und vor allem das Bewusstsein, unter sich zu sein, verändert bei vielen Kindern und Jugendlichen das Verhalten: Sie öffnen sich. Im Kapitel wird aufgezeigt, welche gruppendynamischen Entwicklungen und Gefahren zu berücksichtigen sind, anschließend werden die archetypischen Zusammenhänge der Gruppenpsychotherapie erläutert, die Voraussetzung für das Mythodrama sind.
1.1 Therapie mit Kindern und Jugendlichen
Ein Erstgespräch mit einem Jungen, den seine Eltern auf Wunsch der Schule bei mir angemeldet haben. „Ich weiß nicht, wieso ich hier bin“, teilt mir der Elfjährige mit und schaut nervös um sich. Sein Blick fällt auf ein Bild, das hinter mir an der Wand hängt. Ich frage ihn, wie es in der Schule gehe. „Sehr gut!“, entgegnet er mir und fügt hinzu, „ich bin der beste und beliebteste Schüler der ganzen Schule!“ |20|Und nach einer Pause: „Wo ist die Insel auf dem Bild?“ „In Schottland“, erkläre ich ihm. Nun wird der Knabe gesprächig: „Dort gibt es Monster in unterirdischen Kanälen!“, informiert er mich. Er wisse jedoch, wo sie sich verstecken!
Ein wenig später rede ich mit den Eltern. Sie sind verzweifelt. Natürlich würden sie ihren Sohn lieben, doch sein Verhalten zu Hause und in der Schule sei oft unerträglich. Die Spielzeuge seiner jüngeren Schwester habe er aus Wut im Fluss in der Nähe ihres Wohnorts entsorgt. Beim Essen weigere er sich kategorisch, das Aufgetischte zu berücksichtigen, und am Morgen brächten sie ihn oft nicht aus dem Bett, da er nicht in die Schule wolle. Den Lehrpersonen zufolge handle es sich bei ihm um einen intelligenten und vifen Jungen, doch sei er nicht steuerbar. Er ignoriere Anweisungen, sei während der Lektionen laut und werfe mit beleidigenden Sprüchen um sich. Die Schulleitung überlege sich, ihn auszuschließen, nachdem einige Eltern sich wegen ihm beklagt hätten. Die Eltern des Jungen wissen nicht weiter. Der Junge selbst ist jedoch überzeugt, dass alles in Ordnung sei. Was ihn störe, seien seine nervösen Eltern und die unfähigen Lehrpersonen …
Als Kinder- und Jugendpsychologe hat man oft mit Kindern oder Jugendlichen zu tun, bei denen die eigene Problemeinschätzung derjenigen ihrer Umgebung diametral entgegengesetzt ist und die nicht über ihre Probleme reden. Während Eltern und Lehrpersonen über das Verhalten oder den emotionalen Zustand besorgt oder sogar verzweifelt sind, erleben diese Kinder oder Jugendlichen sich selbst und ihre Situation als unproblematisch. Sie leiden, doch aus ihrer Sicht aufgrund der Umstände. Sie sehen in der Folge nicht ein, wieso sie zu einem Psychologen müssen.
Es gibt natürlich auch Kinder und Jugendliche, die selbst den Wunsch äußern, mit einer Außenperson über ihre Sorgen zu reden. Die Mehrzahl jedoch formuliert kein Problem oder keine Sorge, sondern ist einfach mal da und wartet auf das, was auf sie zukommt. Bei der Therapie von Kindern oder Jugendlichen handelt es sich meistens um eine verordnete Maßnahme. Die Eltern, die Schule oder Experten haben ihnen dazu geraten oder es bestimmt.
Im Gegensatz zu Erwachsenen haben Kinder und Jugendliche nur eine vage Vorstellung von der Arbeitsweise eines Psychotherapeuten oder Psychologen, auch wenn man ihnen vorher seine Funktion erklärt hat. Sie lassen sich auf etwas Unbekanntes ein und müssen in die Therapie eingeführt werden. Dies geschieht nicht nur über Informationen, sondern über eine emotionale Einstimmung und Anbindung. Sowohl in der Einzeltherapie wie auch in der Gruppentherapie gilt es, dem Kind oder Jugendlichen bewusst zu machen, dass man unabhängig von der Schuldfrage mit ihnen arbeitet. Es geht nicht um eine Nacherziehung, sondern |21|darum, herauszufinden, was in ihnen abläuft und wie es ihnen besser gehen kann. Ich selbst frage in der ersten Sitzung, wieso sie denken, dass sie bei mir sind. Die allermeisten Kinder und Jugendlichen antworten, dass die Eltern oder die Schule sie zu mir schicken. Einige erwähnen Schwierigkeiten, andere fühlen sich als Opfer und fast alle erkennen ihren Anteil nicht. Sie sind sich nicht gewohnt, sich selbst zu problematisieren. Praktisch alle Kinder und in einem leicht geringeren Ausmaß die Jugendlichen sind jedoch offen für neue Kontakte. Sie sind emotional ansprechbar und neugierig. Da sie meistens keine Ahnung haben, welches die deklarierten Gründe ihrer Anmeldung bei mir sind, schildere ich meinen Wissensstand des Problems. Reagiert das Kind oder der Jugendliche nervös oder betroffen, dann wende ich mich einem Thema zu, das sich spontan ergibt oder es bzw. ihn interessiert. Es geht darum, Töne auszutauschen und das Kind oder den Jugendlichen ankommen zu lassen.
Wenn ich eine Einzeltherapie beginne, dann nähere ich mich langsam dem Kind oder Jugendlichen an. Meine Worte und Reaktionen versuche ich ganz auf die Befindlichkeiten meines Gegenübers abzustimmen. Ich versuche mir vorzustellen, welches seine Sorgen und Interessen sind. Bei einem zwölfjährigen Jungen besprachen wir vor allem das Strafsystem seiner Schule, ein Mädchen klagte über ihre disloyalen Freundinnen und ein anderer Junge beschwerte sich über seine fordernde Mutter. Als Therapeut geht es für mich darum, hinzuhören. Gelingt es, ein Vertrauensverhältnis zwischen uns herzustellen, dann mache ich mir als Psychotherapeut Gedanken über die Form der Auseinandersetzung. Bei Kindern empfiehlt es sich, neben der Sprache eine Ebene einzuführen, mithilfe derer sie sich indirekt ausdrücken können. Es kann sich um das Sandspiel (siehe dazu Smith, 2012), um Puppentheater, Malen, freies Spiel oder Geschichten handeln. Welche Methode eingesetzt wird, hängt neben den fachlichen Kompetenzen des Therapeuten entscheidend auch von der Persönlichkeit und den Interessen des Kindes oder Jugendlichen ab. Nicht alle Kinder spielen gern oder wollen malen.
Einzeltherapie hilft einem Kind oder Jugendlichen, sein Selbstvertrauen zu stärken, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten und sich innerlich zu ordnen, um persönliche Herausforderungen besser zu bewältigen. In der Einzeltherapie internalisiert das Kind oder der Jugendliche mit der Zeit den Therapeuten oder die Therapeutin. Sie oder er wird zu einer inneren Ressource, an der sie sich orientieren können. Dies gibt ihnen Kraft, eigene Schwierigkeiten besser zu bewältigen, seien es eine Depression, Ängste oder Frustrationen.
Viele Probleme im Kindes- und Jugendalter betreffen jedoch den Außenbereich. Sie müssen sich in der Schule, bei Kollegen und auch in der Familie bewähren und mit entsprechenden Herausforderungen umgehen. Sie müssen sich als soziale |22|Wesen bewähren, lernen, sich in einer Gemeinschaft zu bewegen, durchzusetzen und abzugrenzen. Sie bewegen sich auf einer Bühne, auf der andere Codes und Regeln als zu Hause gelten. Es gilt sich anzupassen. Bei diesem Prozess vermischen sich eigene Sensibilitäten oder Probleme mit Anpassungsschwierigkeiten. Die Kinder oder Jugendlichen drohen ihre Schwierigkeiten zu externalisieren. Sie agieren Ängste, Unsicherheiten, Aggressionen oder Verzweiflung aus. Sie suchen nicht in sich selbst nach Zusammenhängen und Ursachen, sondern führen sie auf andere Personen oder Situationen zurück. Die Lehrperson ist „schuld“, die Kollegen sind „gemein“ oder die Eltern „unverständig“. Die Folge ist, dass sie mit Forderungen konfrontiert werden, die sie nicht verstehen. Die Schule, Kollegen und oft auch die Eltern verlangen, dass sie sich benehmen. Ihre Probleme hängen damit zusammen, dass sie sich mit einem Kollektiv auseinandersetzen müssen. Sie erfahren sich als Teil einer Gruppe oder Gemeinschaft, die eigene Regeln und Codes aufstellt und sich durch eine spezielle Dynamik auszeichnet. Sie erfahren die Macht, den Reiz und die Gefahren des Kollektivs. Sie haben Mühe, sich anzupassen und die Forderungen der Gemeinschaft zu erfüllen, und müssen Kompetenzen entwickeln, um mit dieser Situation umzugehen.
1.1.1 Grundlagen der Gruppentherapie
Hier beginnt die Bedeutung der Gruppenpsychotherapie. Wie in der Einzeltherapie richtet sich die Gruppenpsychotherapie nicht nach den Normen und Regeln, die die Schule als Repräsentant des Kollektivs einfordert, sondern sieht im Kind oder Jugendlichen ein eigenständiges Subjekt,