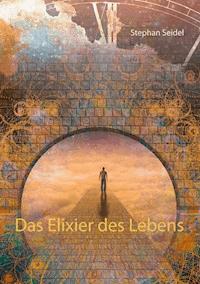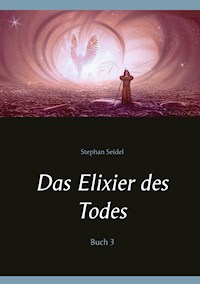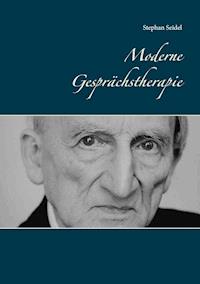
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Aus dem Inhalt: Sehe ich die Welt, wie sie wirklich ist? Ist der Mensch frei? Wer bin ich? Was will ich? Lebt der Mensch nur einmal? Warum kann der Mensch böse sein? Das vorliegende Buch ist Arbeits- und Lehrbuch: es wird in Theorie & Praxis das Konzept der Therapeutischen Dichtung dargelegt wird und zugleich gezeigt, inwiefern sie die Grundlage für eine moderne Gesprächstherapie bildet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Widmung
Für meine Mutter
Motto
Ungeist kann nicht Ungeist erkennen. Nur Geist kann den Ungeist erkennen, nur Moral die Unmoral.
Nur Geist kann auf den Ungeist wirken, nur Moral das Unmoralische wandeln, nur Heilendes das Kranke genesen lassen.
Immer kann nur ein höheres Prinzip ein niederes wandeln.
Du kannst nicht durch bloße Gymnastik deine physischen Schäden reparieren.
Du kannst nicht deine seelischen Störungen nur durch Gefühle wieder gut machen.
Geistige Impulse aber werden es können.
(Paul Bühler)
Inhaltsverzeichnis
WARUM DIE WELT SO IST WIE SIE IST
1.1 W
AS WEIß UND WAS GLAUBE ICH
?
1.2 S
EHE ICH DIE
W
ELT
,
WIE SIE WIRKLICH IST
?
1.3 I
ST DER
M
ENSCH FREI
?
1.4 S
IEH MIT
G
EISTES
-A
UGEN
!
1.5 E
RKENNE UND DU WIRST FREI SEIN
!
1.6 L
IEBE DAS
B
ÖSE GUT
!
LEITMOTIVE DER THERAPEUTISCHEN DICHTUNG
2.1 W
ER BIN ICH
? W
AS WILL ICH
?
2.2 D
ER THERAPEUTISCHE
D
ICHTER
– T
EIL
1
DIE KUNST DER THERAPEUTISCHEN DICHTUNG
3.1 D
ENKEN
, F
ÜHLEN
, W
OLLEN
– 3 B
EREICHE DER
S
EELE
3.2 D
ER THERAPEUTISCHE
D
ICHTER
– T
EIL
2
3.3 D
ER
S
INN DES
L
EBENS
3.4 S
CHULD
, R
EUE
, V
ERGEBUNG
LEBENSFRAGEN DER THERAPEUTISCHEN DICHTUNG
4.1 W
ORAN SOLL UND KANN DER
M
ENSCH NOCH GLAUBEN
?
4.2 L
EBT DER
M
ENSCH NUR EINMAL
? – T
EIL
1
4.3 D
AS
E
RWACHEN DES
I
CH
– T
EIL
1
4.4 L
EBT DER
M
ENSCH NUR EINMAL
? – T
EIL
2
4.5 D
AS
E
RWACHEN DES
I
CH
– T
EIL
2
4.6 W
ARUM KANN DER
M
ENSCH BÖSE SEIN
?
4.7 L
IEBE DEINEN
N
ÄCHSTEN WIE DICH SELBST
!
ZUSAMMENFASSUNG
AUSBLICK: THERAPEUTISCHE DICHTUNG
6.1 T
HEORIE UND
P
RAXIS
6.2 P
AUL
B
ÜHLER UND DIE
T
HERAPEUTISCHE
D
ICHTUNG
LITERATURVERZEICHNIS
Vorwort
Das vorliegende Buch stellt eine überarbeitete Fassung meiner Magisterarbeit dar, in deren Mittelpunkt Goethes und universitär erstmalig Albert Steffens (einstmals ein ebenso bekannter Dichter wie Hermann Hesse) pädagogisch-therapeutische Alterswerke standen. Ich versuchte darin zu zeigen, wie Dichtung über die bloße Unterhaltung oder Belehrung hinausgehen und eine heilende Komponente zu entfalten vermag.
Als therapeutische Dichtung steht und wirkt sie für sich selbst, kann aber ebenso von einem Therapeuten als Grundlage einer Gesprächstherapie eingesetzt werden. Wie hat man sich dieses konkret vorzustellen? Es sind hier vielfältige Anwendungsbereiche denkbar, intrinsisch wie auch extrinsisch orientiert.
Therapeutische Dichtung in der Selbstanwendung kann den Therapeuten aufgeschlossener, empathischer werden lassen für die Themen seiner Klienten. Es ist dies nicht in einer reinen Nützlichkeitsanalyse darstellbar, sondern indem der Therapeut an sich selbst arbeitet, tritt er auch seinen Klienten in neuer, verwandelter Form gegenüber. Die Vielfältigkeit der therapeutischen Dichtung eröffnet hier ein breites Spektrum.
Bei der Anwendung für den Patienten sind der Kreativität des Therapeuten keine Grenzen gesetzt: Er kann ihm ein Buch als Lektüre empfehlen, das thematisch passt, aber genauso gut eine Passage als Einstieg oder Abschluss für ein Gespräch wählen; er kann eine Passage vorlesen und dann in klassischer Therapieform den Patienten die eigene Gefühlswelt ungefährdet erleben lassen. Das würde man sich so vorstellen, dass der Patient Einwände erheben kann an bestimmten Stellen des Textes, die ihn in irgendeiner Form berühren oder ansprechen. Es wäre denkbar zu fragen, wo der Text aus Sicht des Patienten geändert werden sollte und wenn ja – warum? Manchmal genügt auch ein Text, um im Sinne einer Vorbildfunktion dem Patienten einen anderen Blickwinkel zu ermöglichen.
Das vorliegende Buch ist Arbeits- und Lehrbuch. Arbeitsbuch, indem der Leser erfährt, was es bedeutet, therapeutische Dichtung konkret anzuwenden. Und Lehrbuch, indem an zwei klassischen Werken beispielhaft gezeigt wird, welche thematischen und pädagogisch-therapeutischen Anwendungsmöglichkeiten darin enthalten sind.
Dergestalt bildet es die Grundlage für eine moderne Gesprächstherapie.
1. Warum die Welt so ist wie sie ist
Im Folgenden soll keine Geschichte der Philosophie gezeichnet, sondern die erkenntnistheoretische Grundlage der Therapeutischen Dichtung gegeben werden. Wer glaubt, dass er auf diese Darstellung verzichten kann, weil sie ihm zu theoretisch und der Vorzug der Praxis zu geben ist, möge dieses Kapitel überspringen.
1.1 Was weiß und was glaube ich?
Die Philosophie in Deutschland vor der Aufklärung ist im Wesentlichen durch Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) und Christian Wolff (1679-1754) geprägt. Leibniz entwickelt die so genannte „Monadenlehre“, in der er behauptet, die Menschenseele sei eine Art selbstständiges, belebtes Wesen, das nicht entsteht und nicht vergeht. Die Monade erlebt nur das, was in ihr ist –, das Außen, die Natur, ist nur ein Scheinbild, hinter dem die wahre Welt liegt, wo Gott existiert, der als höchste Monade alle anderen Monaden in eine harmonische Wechselwirkung bringt. Das erkenntnistheoretische Resultat dieser Vorstellung ist: An Selbsterkenntnis ist nicht zu denken, es muss dem Menschen genügen, ein Glied der göttlichen Ordnung und Substanz zu sein. Damit steckt in dieser Lehre jedoch nichts Neues; Leibniz verwendet die alten religiösen Vorstellungen von Gott, Seele und Unsterblichkeit, die er nachträglich als scheinbar von der Vernunft bewiesene Wahrheiten ausgibt.
Ähnlich verhält es sich mit Christian Wolff: Er unterscheidet sinnliche Wahrheiten, die durch Beobachtung gewonnen werden, von höheren Erkenntnissen, welche die Vernunft aus sich selbst schöpft. Auch bei Wolff stellt sich heraus, dass jene höheren „Erkenntnisse“ im Grunde genommen nichts Anderes als die tradierten religiösen Offenbarungswahrheiten sind.
Mit diesen „philosophischen“ Konzepten seiner Zeit sah sich der Philosoph Immanuel Kant konfrontiert.
1.2 Sehe ich die Welt, wie sie wirklich ist?
Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung. (1977, Bd. 6, 53)
Diese Worte Immanuel Kants (1724-1804) stammen aus seinem Aufsatz „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ (1783), mit denen er das Unternehmen einleitete, die Vernunft einer kritischen Prüfung zu unterziehen, um so etwas über die Beweiskraft der Begriffe aussagen zu können.
Kant stützte sich dabei auf die Überlegungen John Lockes (1632-1704) und David Humes (1711-1776), beide Vertreter der englischen Aufklärung (Empirismus), die sich bereits vor ihm mit dem menschlichen Erkenntnisvermögen auseinandergesetzt hatten. Hume fragte sich: Wenn ich heute einen Apfel von einem Baum fallen sehe, habe ich dann das Recht zu sagen, dass dies immer so sein wird? Selbst wenn ich es unzählige Male beobachte, kann ich daraus mit Sicherheit folgern, ein für alle Ewigkeiten gültiges Gesetz gefunden zu haben? Hume postulierte, dass eine solche Absolutheit nicht als gesichert angesehen werden kann; vielmehr sieht der Mensch gewisse Vorgänge und gewöhnt sich daran, sie in einen bestimmten Zusammenhang zu setzen. Ob aber dieser Zusammenhang, ob ewig gültige Gesetze existieren, die etwas darüber aussagen, kann der Mensch nicht wissen.
Kant war bis zu diesem Zeitpunkt Anhänger der Wolff’schen Philosophie gewesen und hatte dementsprechend an die Unumstößlichkeit „ewiger Wahrheiten“ (Gott, Gesetz von Ursache und Wirkung usw.) geglaubt. Als er Hume las, musste er feststellen, dass sogar bei einfachen Wahrheiten von einem Beweisen gar nicht die Rede sein kann, sondern dass alles, was der Mensch in dieser Hinsicht weiß, aus der Gewohnheit heraus angenommen wird. Damit sah sich Kant vor die existenzielle Frage gestellt, ob es wirklich keine ewigen Wahrheiten gibt? In diesem Kontext fielen ihm die Gesetze der Mathematik ein, die immer und notwendig wahr sein müssen, und an deren Richtigkeit es keinen Zweifel geben konnte. Außerdem, so war er sich sicher, muss das physikalische Gesetz von Ursache-Wirkung ewige Gültigkeit besitzen.
Und doch hatte Hume die Unbeweisbarkeit dieser von Kant als Axiome empfundenen Urteile nachgewiesen, weil sie aus der Beobachtung des Äußeren gewonnen waren. Die Beobachtung jedoch kann immer nur sagen, was gewesen ist, niemals vermag sie zu sagen, ob es auch immer so sein muss und sein wird. Um sich nicht völlig zu der wolffschen oder humeschen Weltanschauung bekennen zu müssen (und damit eine als falsch zu klassifizieren), strebte Kant einen Kompromiss an, indem er eine ganz neue Fragestellung formulierte: Wie ist es möglich, dass der Mensch (wahre) Erkenntnisse über die Welt haben und trotzdem nicht auf die Urgründe des Seins stoßen kann, hier also eine Grenze des Erkennens vorliegt?
Kant sah nur einen Ausweg: Er musste das Wissen um die Dinge auf den Menschen selbst zurückführen unter Beibehaltung der (objektiven) Existenz dieser Dinge, was seinen Ausdruck in dem (neu gebildeten) Begriff des „Ding an sich“ fand. Wenn der Mensch so eingerichtet ist, dass von ihm alles abhängt, dann ist dies die Lösung des Problems, dann ist es möglich zu sagen: Zweimal zwei ist deshalb gleich vier, weil dies in der Konstitution des Menschen begründet liegt –, mit einer objektiven Gesetzmäßigkeit hat es nichts zu tun (es wäre sogar möglich, dass in Wirklichkeit „zweimal zwei gleich drei“ oder „zweimal zwei gleich fünf“ ist). Auch muss der Mensch konstitutionell bedingt jede Wirkung mit einer Ursache verknüpfen; ob aber in den „Dingen an sich“ das Prinzip von Wirkung und Ursache wirklich existiert –, es ist nicht möglich, darüber Aufschluss zu erlangen! Auf der ganzen Welt gibt es nur Eines, dessen sich der Mensch ganz gewiss sein kann: Das Sittengesetz. Kant postulierte es als den kategorischen Imperativ, als das „Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft“: „Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ (Bd. 7, 140) Nur in der strengen Hingabe an das Sittengesetz kann der Mensch Vollkommenheit und Glückseligkeit erlangen, seinem Dasein einen Sinn geben.
Was hatte er damit aber genau genommen erreicht? Kant hatte bewiesen, dass das Wissen des Menschen beschränkt ist und er seinem Leben selbst keinen Sinn geben kann. Zwar existieren Sinnhaftigkeit, Gott usw., aber diese höchsten Wahrheiten sind nicht der Erkenntnis zugänglich, es handelt sich um moralische Wahrheiten (Offenbarungswahrheiten), denen sich der Mensch unterordnen muss. Die Aufklärung Kants hat demnach nicht den Menschen zum Gebrauch seiner Erkenntnisfähigkeit geführt, dies war auch niemals ihre ursprüngliche Absicht, wie Kant in der Vorrede zur „Kritik der reinen Vernunft“ zugibt: „Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen.“ (Bd. 3, 33) Um die Wahrheit und Gewissheit bestimmter (mathematisch-mechanischer) Erkenntnisse zu retten, opferte er die Möglichkeit menschlicher Einsicht in den Weltengrund und leugnete die Idee der Freiheit für den Menschen.
1.3 Ist der Mensch frei?
Aus einem Sklaven der Natur, solang’ er sie bloß empfindet, wird der Mensch ihr Gesetzgeber, sobald er sie denkt. Die ihn vordem nur als Macht beherrschte, steht jetzt als Objekt vor seinem richtenden Blick. Was ihm Objekt ist, hat keine Gewalt über ihn, denn um Objekt zu sein, muß es die seinige erfahren. (1999, Bd. 5, 270)
In seinen Briefen „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ weist Friedrich von Schiller (1759-1805) den Weg, wie der Mensch durch das Denken seine Vernunft ausbilden und (höhere) Einsicht erlangen kann. Er stellt sich damit gegen Kants kategorischen Imperativ, der den Menschen zum Sklaven der Pflicht degradiert, und nähert sich einem Monismus, während Kant einen Dualismus vertritt. Schiller führt das Denken auf zwei Hauptbegriffe zurück, die im Goethe’schen Sinne „Urphänomene“ genannt und als solche nicht weiter zurückverfolgt werden können. Der erste Begriff ist die sog. Person, i.e. die von der Natur verliehene Ichheit. Sie ist ein Unveränderliches, Beharrendes, Außerzeitliches und absolut in sich Gegründetes. Als dieses reine Selbst ist es nur Form.
Der zweite Begriff wird durch die Gefühle, Stimmungen und Erlebnisse der Person bestimmt und heißt Zustand. Auch wenn mit „Zustand“ eher etwas Festes und Verharrendes vorgestellt wird, bezeichnet Schiller damit das Wechselnde und Wandelnde, das in der Zeit Verlaufende und Vergängliche. Dieses sich stetig im Fluss Befindende ist Stoff. Solange der Mensch nichts empfindet (dies bezieht sich nur auf Sinneseindrücke), ist er also ewige Form; solange er nur empfindet, „ist er noch weiter nichts als Welt, wenn wir unter diesem Namen bloß den formlosen Inhalt der Zeit verstehen.“ (ebenda, 235) Daraus folgt:
Um also nicht bloß Welt zu sein, muß er der Materie Form erteilen; um nicht bloß Form zu sein, muß er der Anlage, die er in sich trägt, Wirklichkeit geben. Er verwirklicht die Form, wenn er die Zeit erschafft und dem Beharrlichen die Veränderung, der ewigen Einheit seines Ichs die Mannigfaltigkeit der Welt gegenüberstellt; er formt die Materie, wenn er die Zeit wieder aufhebt, Beharrlichkeit im Wechsel behauptet und die Mannigfaltigkeit der Welt der Einheit seines Ichs unterwürfig macht. (ebenda, 235-236)
Zur Erfüllung dieser Aufgabe stehen dem Menschen zwei Kräfte zur Verfügung, die er, weil sie den Menschen antreiben, Triebe nennt. Der erste Trieb ist der Stofftrieb. Jener entzündet sich an den Außendingen, er will aus sich heraus, möchte alles nach außen projizieren, kurz: er will leben.
[Jener] geht aus von dem physischen Dasein des Menschen [...] und ist beschäftigt, ihn in die Schranken der Zeit zu setzen und zur Materie zu machen: nicht ihm Materie zu geben, weil dazu schon eine freie Tätigkeit der Person gehört, welche die Materie aufnimmt und von sich, dem Beharrlichen, unterscheidet. Materie aber heißt hier nichts als Veränderung oder Realität, die die Zeit erfüllt; mithin erfordert dieser Trieb, daß Veränderung sei, daß die Zeit einen Inhalt habe. (ebenda, 236)
Demgegenüber existiert ein Formtrieb:
[Dieser] geht aus von dem absoluten Dasein des Menschen oder von seiner vernünftigen Natur und ist bestrebt, ihn in Freiheit zu setzen, Harmonie in die Verschiedenheit seines Erscheinens zu bringen und bei allem Wechsel des Zustands seine Person zu behaupten. Da nun die letztere als absolute und unteilbare Einheit mit sich selbst nie im Widerspruch sein kann, da wir in alle Ewigkeit wir sind, so kann derjenige Trieb, der auf Behauptung der Persönlichkeit dringt, nie etwas anders fordern, als was er in alle Ewigkeit fordern muß; er entscheidet also für immer, wie er für jetzt entscheidet, und gebietet für jetzt, was er für immer gebietet. Er umfaßt mithin die ganze Folge der Zeit, das ist soviel als: er hebt die Zeit, er hebt die Veränderung auf; er will, daß das Wirkliche notwendig und ewig und daß das Ewige und Notwendige wirklich sei; mit anderen Worten; er dringt auf Wahrheit und auf Recht. (ebenda, 237)
Während im Stofftrieb die Notwendigkeit in den Sinnendingen (im Materiellen), die auf den Menschen einstürmen, hervortritt, ist beim Formtrieb die Notwendigkeit im Geistigen zu suchen, in der Logik des Menschen, die abstrahiert und alles zu Gesetzen, die ewig sind, machen möchte, um die Welt der Mannigfaltigkeit auf ein Einheitlich-Beharrendes zurück zu führen. Beiden Trieben ist der Mensch zunächst unterworfen: Der Stofftrieb fesselt an die Welt, der Formtrieb an das Ewige; dadurch machen sie den Menschen unfrei. Indem ein jeder Trieb um die Vorherrschaft kämpft, drohen sie, den Menschen auseinander zu reißen.
Wie von selbst tritt nun die Frage auf: Ist dieser Zwiespalt unüberbrückbar? Kann sich der Mensch nur für den einen und gegen den anderen Trieb entscheiden, d.h. gibt es statt einer Synthese nur ein Entweder-Oder? Kant hatte dieses Problem „gelöst“, indem er sagte, der Mensch muss sich dem ewigen „Du sollst“ unterordnen und der Pflicht dienen. Schiller hingegen postulierte: Der Mensch kann sich die ehernen Gesetze der Logik und der Vernunft so zu Eigen machen, dass er ihnen ohne Zwang folgt, weil er das Reine einsieht und es freiwillig will. Er hat damit sein sittliches Gefühl geläutert und die Neigungen hinaufgebracht zum Geistigen. Gleichzeitig kann der Mensch die Vernunftgesetze in die Triebe herunterbringen, wodurch insgesamt Harmonie zwischen den vernunftveredelten Trieben und der leidenschaftlichen Vernunft hergestellt wird. Freiheit entsteht dann durch die Versöhnung von Form- und Stofftrieb. Mit diesen verhält es sich wie mit den Schalen einer Waage, die nicht leer sein müssen, um im Gleichgewicht zu sein, sie können auch beide dasselbe Gewicht enthalten und dadurch die Ausgewogenheit herbeiführen: „Diese mittlere Stimmung, in welcher das Gemüt physisch und moralisch genötigt und doch auf beide Art tätig ist, verdient vorzugsweise eine freie Stimmung zu heißen [...].“ (ebenda, 257) Wer jenen mittleren Zustand, den Schiller auch den ästhetischen nennt, anstrebt und erreicht, schafft etwas Neues, was seinen Ursprung allein im Ich des Menschen hat – den Spieltrieb1: