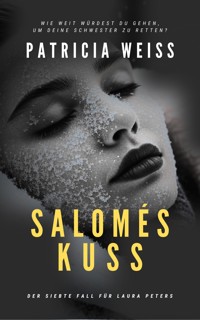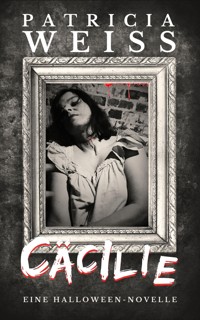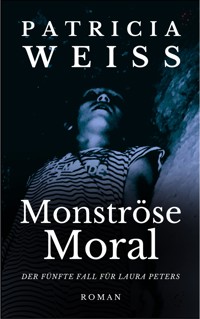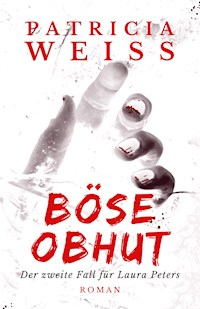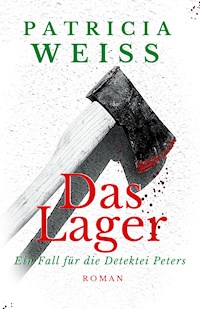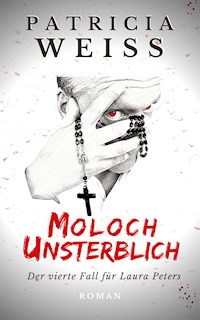
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
"Die Kamera zoomte auf die Machete, die er hoch über den Kopf erhoben hielt, und fuhr die lange, verschmutzte Klinge entlang. Das Sichtfeld glitt zurück in die Totale. Zeigte die junge Frau, deren Gesicht ein einziges Entsetzen war." Laura Peters wird ein Video zugespielt, in dem ein Mord gezeigt wird, und macht sich auf die Suche nach dem Täter. Als die Leiche eines kleinen Jungen, der fünf Jahre zuvor spurlos verschwunden ist, in einer verborgenen Kammer auf einem Dachboden gefunden wird, erkennt sie, dass sie es nicht nur mit einem Mörder, sondern auch mit einem jahrhundertealten System des Bösen aufgenommen hat. Doch sie stößt auf eine Mauer des Schweigens und muss lernen, dass nicht jeder das ist, was er zu sein scheint, und dass Vertrauen tödlich enden kann ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum neobooks
Moloch Unsterblich
Der vierte Fall für Laura Peters
Kriminalroman
Das Buch
„Die Kamera zoomte auf die Machete, die er hoch über den Kopf erhoben hielt, und fuhr die lange, verschmutzte Klinge entlang. Das Sichtfeld glitt zurück in die Totale. Zeigte die junge Frau, deren Gesicht ein einziges Entsetzen war.“
Laura Peters wird ein Video zugespielt, in dem ein Mord gezeigt wird, und macht sich auf die Suche nach dem Täter. Als die Leiche eines kleinen Jungen, der fünf Jahre zuvor spurlos verschwunden ist, in einer verborgenen Kammer auf einem Dachboden gefunden wird, erkennt sie, dass sie es nicht nur mit einem Mörder, sondern auch mit einem jahrhundertealten System des Bösen aufgenommen hat.
Doch sie stößt auf eine Mauer des Schweigens und muss lernen, dass nicht jeder das ist, was er zu sein scheint, und dass Vertrauen tödlich enden kann ...
Die Bücher von Patricia Weiss
Moloch Unsterblich ist der vierte Roman, in dem Laura Peters mit ihrem Team ermittelt.
Alle weiteren Bände der Laura-Peters-Serie mit Das Lager, Böse Obhut, Zweiundsiebzig, Monströse Moral, Verlassene Seelen und die Halloween-Novellen Cäcilie und Escape If You Can sind als Taschenbuch und als E-Book im Internet erhältlich, zum Beispiel auf der Autorenseite
https://www.patriciaweiss.de
Kontakt
Patricia Weiss freut sich auf den Austausch mit ihren Lesern auf der Facebook-Seite Patricia Weiss – Autorin, auf X (Twitter) Tri_Weiss und auf Instagram tri_weiss.
Impressum
Texte: © Copyright by Patricia Weiss
c/o
Relindis Second Hand
Gotenstr. 1
53175 Bonn
Covergestaltung und Foto: Patricia Weiss
Model: Christian Sydow
Lektorat: Katharina Abel
Alle Rechte vorbehalten.
Veröffentlichung: 2019
Moloch Unsterblich ist als Taschenbuch und als E-Book erhältlich.
Der Kuss der Muse, nur gehaucht, entfesselt den Sturm ...
Für meine lieben Eltern.
Und für die Beste Gruppe der Welt.
Love life, stay weird!
Moloch
* Der Moloch wird in der Bibel erwähnt und ist ein Gott oder ein König, dem Kinderopfer dargebracht wurden.
* Moloch ist ein Synonym für eine gnadenlose Macht, die alles verschlingt.
Mittwoch
Die Ästhetik des Tötens gewinnt an Schönheit mit der passenden Musik.
Der Übergang vom Leben zum Tod ist ein harter Cut. Kein sanftes Dahingleiten, kein langsames Entschweben, kein seichtes Diffundieren in eine andere, bessere Welt.
Jedenfalls nicht für den Beobachter.
Im einen Moment ist ein Körper noch voller Leben, im nächsten nur noch eine leere Hülle. Und dazwischen ist lediglich ein schmaler Grat.
Ein sehr schmaler.
Mit der Fernbedienung schaltete er den CD-Player aus und der Raum versank in tiefe Stille. Er stützte den Ellenbogen auf die massive Eichenplatte des Esstisches, legte das Kinn in die hohle Hand und studierte sein Gegenüber. Noch vor wenigen Minuten hatte das Objekt gestöhnt und geschnauft, sich zu den monumentalen Klängen von Orffs O Fortuna aufgebäumt und gewunden, gesabbert und mit fetten, kleinen Händen versucht, den Kragen zu öffnen, um das kommende Schicksal abzuwenden.
Sein Blick wanderte über den kaum angerührten Teller mit Rotkohl, Klößen, Rinderbraten und Soße und den seelenlosen Koloss dahinter, dessen Leibesfülle ihn zwischen den Lehnen des Stuhles und der Tischplatte festklemmte und am Umfallen hinderte. Der Anblick der hervorgequollenen Augen, die zu Lebzeiten kaum über die runden, rotglänzenden Backen hervorgesehen hatten, des rot-blau angelaufenen Gesichts und der heruntergeklappten Kinnlade, aus der die Zunge heraushing, weckte kein Gefühl in ihm. Keine Regung. Nicht einmal Ekel. Die Hände blieben auch im Tod in den weißen Hemdkragen gekrallt und zeugten von der verzweifelten Gier der letzten Atemzüge nach Sauerstoff.
Das war gut.
Auf den ersten Blick sah es aus wie ein Unfall durch Ersticken.
Doch er wollte noch ein bisschen nachhelfen.
Ohne Eile erhob er sich, näherte sich dem Teller, der vor dem Objekt stand und griff nach dem Besteck. Durch die dünne Membran der Einmalhandschuhe meinte er, einen Rest von Wärme zu spüren, die die Finger des Toten auf das verzierte Silber übertragen hatten. Eine letzte Erinnerung an das Leben, die Lebendigkeit, die noch bis vor wenigen Augenblicken den Körper des Kolosses erfüllt hatte, bevor sie als winziger Tropfen vom ewigen Ozean der kosmischen Energie absorbiert worden war. Sorgfältig schnitt er ein ordentliches Stück vom Rinderbraten ab, dann drückte er mit dem Messer die Zunge des Objektes nach unten und stopfte mit der Gabel das Fleischstück so tief in den Rachen, wie er konnte. Einen aufmerksamen Gerichtsmediziner würde er damit nicht täuschen können, aber die Behörden waren überlastet – mit etwas Glück würde dieser Körper nicht lange auf dem Seziertisch bleiben.
Im offenen Kamin prasselte und knackste das Feuer und verbreitete eine Hitze im Zimmer, die die Kerzen auf dem Tisch zum Schmelzen brachte. Schweißtropfen liefen über sein Gesicht. Hervorgerufen durch die Wärme ... oder durch das überdimensional große Bild, das über dem Kamin hing und einen gütig dreinschauenden Pfarrer in Soutane zeigte, der von schwarzen Kindern umringt war. Es stammte aus der Zeit, als das Objekt noch nicht so fett gewesen war wie ein Walross. Die eine Hand umfasste den Stab,
... du warst ein böser Junge, ein elender Taugenichts ...
die andere streckte er den Kindern entgegen, Handrücken oben, die Finger leicht nach unten gekrümmt
... braver Kerl, das hast du gut gemacht ...
Er wischte sich mit dem Ärmel über die feuchte Stirn. Die Angst, in der Kindheit sein ständiger Begleiter, schien zurückzukommen. Ein Kloß im Bauch, der sich ausbreitete, ihn lähmen wollte. Doch das ließ er nicht zu. Er war kein Opfer mehr. Er wehrte sich jetzt. Schlug zurück.
Vernichtend.
Seine Finger krampften sich um das Messer. Am liebsten hätte er ...
Er straffte die Schultern, streckte den Rücken, hob das Kinn, atmete bewusst dreimal tief durch. Der stinkende Giftnebel der Erinnerungen verflüchtigte sich, wich der kühlen Brise trostspendender Ratio.
Der Plan.
Er musste sich an den Plan halten, dann war alles gut. Sorgfältig die einzelnen Schritte abarbeiten. Einen nach dem anderen. Improvisation war etwas für Versager und führte ins Verderben.
Sunzi sagte in ‚Die Kunst des Krieges‘ Handle umsichtig, rasch und unkompliziert. Das war jetzt gefordert.
Wieder ruhiger geworden sah er sich um. Im hinteren Teil des Raumes stand ein Ohrensessel vor einem wandhohen Regal mit unzähligen gelehrten Schriften.
Komm näher, mein Sohn ... knie dich hier neben mich ...
Die Wucht der plötzlichen Erinnerung, seit Ewigkeiten verschüttet, ließ ihn taumeln, blendete gleißend seine Seele. Er keuchte, kämpfte den Gedanken nieder. Richtete die Aufmerksamkeit gewaltsam wieder auf die Gegenwart. Das Hier und Jetzt, wo er die Regeln machte.
Und sie exekutierte.
Gnadenlos, kaltblütig, präzise.
Er ließ den Blick weiterwandern. Prunkstück des Raumes war der Esstisch, lang und massiv wie eine Rittertafel, an dessen Kopfende das Objekt soeben sein letztes Abendmahl eingenommen hatte.
Und es hatte ihm Vergnügen bereitet, es ihm zu kredenzen.
Die Chili-Thai-Koriander-Suppe, als Vorspeise serviert in einem Tässchen, das man auf einen Zug austrinken sollte, war die richtige Wahl gewesen. Die scharf-seifige Gewürzmischung hatte jeden irritierenden Fremdgeschmack überdeckt. Allerdings setzte die Wirkung erst nach zweiundzwanzig Minuten und siebenunddreißig Sekunden ein. Er hatte die Stoppuhr gestellt, um die Information in seine Tabelle einzutragen.
Ohne Musik war das Sterben banal und nichtssagend.
Mit Musik ein dramatisch zerstörerischer Akt von beklemmender Schönheit.
Aber es musste sorgsam aufeinander abgestimmt sein.
Wie eine gut inszenierte Oper. Der Zeitraum, bis die Reaktion eingesetzt hatte, war länger gewesen als beabsichtigt. Er schätzte den Koloss auf gute 130 Kilo. Wenn er es noch mal mit so einem Kaliber zu tun hatte, würde er die Dosierung hochsetzen. Dafür war der Todeskampf unerwartet kürzer verlaufen.
Enttäuschend kurz.
Fünf Minuten zweiundvierzig zwischen den ersten Anzeichen und dem letzten Atemzug. Herzschwäche, Bluthochdruck und Adipositas hatten ihn bei seinem Vorhaben unterstützt. Allerdings hatte er das Stück mehrfach von vorne spielen müssen. Ärgerlich. Vielleicht musste er es auswechseln. Etwas von Wagner nehmen. Oder Vivaldi. Aus den Vier Jahreszeiten. Das gäbe dem Akt des Tötens eine ganz neue Interpretation, eine charmante Leichtigkeit, Beschwingtheit. Aber das würde viel Arbeit bedeuten. Und er wollte nicht mehr warten.
Seine Zeit war gekommen.
Jetzt.
Das Objekt hatte natürlich versucht, Hilfe zu alarmieren. Hatte sich zuerst an ihn gewandt. Flehend die Hände in seine Richtung gestreckt. Doch er hatte ihn nur unbewegt angesehen. Vielleicht hatte auch der Hauch eines Lächelns um seine Mundwinkel gespielt und ihn verraten. Sicher war er sich da nicht. Zu lange hatte er auf diesen Augenblick gewartet, ihn immer wieder im Kopf durchgespielt. Möglich, dass er für einen kurzen Moment die Kontrolle über seine Gesichtszüge verloren hatte. Dann war das Dämmern der Erkenntnis auf dem Gesicht des Objekts sichtbar geworden. Dass es zu spät war. Dass er ihn nicht retten würde, ja, dass er sogar der Verursacher der Notlage war.
Ein Verräter.
Eine Natter, die das Objekt an seinem Busen genährt hatte.
Reue traute er ihm nicht zu. Selbstgerecht und gnadenlos war er gewesen. Sadistisch und brutal. Hatte sich gesonnt in der Gewissheit der Absolution von ganz oben. Von ganz, ganz oben. Eigentlich hätte er schon damals seinen Glauben verlieren müssen. Als er noch klein, hilflos und dumm war und das Objekt ihm gezeigt hatte, dass die Hölle keine abstrakte Vorstellung vom Jenseits war, sondern im Diesseits äußerst real existierte.
Erschaffen von Teufeln, wie das Objekt einer war.
Und von denen es so viele gab.
Doch er hatte weiter fest geglaubt, gebetet, um Besserung gefleht, um Erleuchtung. Damit er erlöst würde aus dem Martyrium. Doch nichts hatte sich geändert. Heute wusste er, dass es dort oben niemanden gab, der zuhörte und half. Dass er sich nur selbst befreien und retten konnte. Es stimmte, das Objekt hatte ihn an seinem Busen genährt. Oder streng genommen an einem anderen Körperteil, weiter unten. Aber mit Gift. Und hatte ihn dadurch zur Natter gemacht, zu einem Taipan, der giftigsten Schlange der Welt.
Und jetzt war er auf der Jagd.
Das Objekt hatte versucht, zu fliehen. Doch damit hatte er gerechnet und ihn mit einer Jacke, die er um ihn geworfen und hinter der Lehne zusammengehalten hatte, auf dem Stuhl gehalten. Sicher wäre Festhalten oder Fesseln leichter gewesen, aber das hätte Verletzungen hinterlassen, Hämatome, die einen Leichenbeschauer stutzig machen konnten.
Er blickte auf die Uhr, wie er es den Abend über schon hundert Mal gemacht hatte.
Zeit aufzuräumen und die Spuren zu verwischen. Oder die Brücken hinter sich abzubrechen, wie Sinzu sagte. Er kontrollierte den Sitz der Einmalhandschuhe und arbeitete seine Liste ab. Das Gedeck spülen, das er benutzt hatte, und zurück in den Schrank räumen. Die Fingerabdrücke von all den Stellen wegputzen, die er berührt hatte, als er keine Handschuhe getragen hatte, um das Objekt nicht misstrauisch zu machen. Mit dem Kleberoller über den Teppich fahren, um Haare oder sonstige Partikel von ihm zu entfernen. Natürlich würde er Spuren hinterlassen, aus denen man seine DNS ermitteln konnte.
Aber dazu musste erst mal jemand bemerken, dass ein Mord stattgefunden hatte.
Sonntag
1 Panoramapark, Rüngsdorf
Opfer im Labyrinth des Blutrausches
Es kratzte an der Tür. Jaulen, Krallen auf dem Parkett im Flur. Erneutes Scharren an der Schlafzimmertür. Schlaftrunken richtete sich Laura Peters auf, tastete im Dunkeln nach dem Schalter der Nachttischlampe und knipste sie an.
Der Wecker zeigte fünf Uhr.
Seufzend sank sie zurück in die Kissen und zog sich die Decke über den Kopf. Die Nacht war ein einziger Albtraum gewesen. Wie fast jede Nacht in den letzten Wochen. Diabolische Augen hatten sie durch ein Labyrinth gejagt, aus dem es kein Entkommen gab. Sie rannte durch verschlungene Gänge, flüchtete vor dem Unvorstellbaren. Doch am Ende wartete das Skalpell auf sie. Die Klinge, die vor ihren Augen stählern aufblitzte, um dann in ihr Fleisch zu schneiden. Auf sie niederfuhr, tiefe Wunden in ihren weichen Bauch, ihre Arme und Beine riss und ihr Blut in leuchtend hellroten Tropfen durch die Luft spritzen ließ.
Und die Stimme, emotionslos und seltsam hell:
Schneiden, um zu verletzten, Stechen, um zu töten.
Immer wieder war sie keuchend hochgefahren, hatte sich aufgesetzt, das Licht angeschaltet und die verschwitzte Stirn abgewischt. Hatte versucht, sich zu beruhigen. Nur um im Dunkeln erneut als Opfer im Labyrinth des Blutrausches zu enden.
Sie hatte das Gefühl, erst vor fünf Minuten Ruhe gefunden zu haben. Und sie brauchte den Schlaf dringend. Doch das Kratzen und Jaulen konnte sie nicht ausblenden.
„Ich komme ja schon“, murmelte sie und schälte sich aus dem Bett. Barfuß tappte sie über das kalte Parkett zur Tür und öffnete sie. Vor ihr saß der betagte Dackel der Nachbarin, legte den Kopf schief und wedelte.
„Friedi.“ Sie bückte sich und streichelte über das weiche, rotbraune Fell. „Geh wieder schlafen. Es ist noch viel zu früh.“ Doch der Hund war anderer Meinung. Schwanzwedelnd watschelte er den Flur entlang zur Wohnungstür, drehte den Kopf und sah sie an. Es war klar, was er vorschlug.
„Oh Mann. Echt jetzt? Warte, ich ziehe mir wenigstens etwas über. Draußen ist es eisig.“ Laura verspürte wenig Lust, so früh in die Kälte hinausgejagt zu werden, aber wenn der Hund musste, wollte sie kein Risiko eingehen und hinterher Friedis Häufchen vom Teppich entfernen müssen.
Sie zog sich die Jeans und einen Wollpullover über das Schlafshirt und stieg barfuß in die weich gefütterten Boots. Vom Haken im Flur angelte sie die Daunenjacke.
Als der Dackel sah, dass seine Bemühungen Früchte trugen, vollführte er ein paar schaukelnde Hüpfer mit den Vorderpfoten und wedelte stärker.
„Komm, Friedi.“ Laura beugte sich zu ihm hinunter und hielt ihm das abgewetzte Halsband entgegen. Doch der Hund zog den Kopf weg und duckte sich an ihr vorbei.
„Jetzt mach schon“, seufzte sie und verfolgte ihn gebückt durch den Flur, bis sie ihn in eine Ecke drängen und ihm das Geschirr überziehen konnte. Sie hakte die Leine ein, schnappte sich die Schlüssel von der Kommode neben der Tür und verließ die Wohnung.
Die Kälte traf sie wie ein Schlag.
Ihr Körper, der noch die Bettwärme gespeichert hatte, begann, unkontrolliert zu zittern. Sie schlang die Arme um sich und verkroch sich tief in der Jacke. Dem Dackel schienen die Minusgrade nichts auszumachen, die Nase dicht am Boden verfolgte er konzentriert schnuppernd eine Spur den Bürgersteig entlang. Ohne auf sie zu achten, schlug er den Weg zum Panoramapark ein und zerrte sie hinter sich her.
Laura setzte die Kapuze auf, zog den Ärmel über die Hand, in der sie die Leine hielt, und vergrub die andere tief in der Jackentasche. Mit gesenktem Kopf und hochgezogenen Schultern lief sie dem Dackel hinterher.
Es war stockdunkel, lediglich die Straßenlaternen tauchten den Weg in regelmäßigen Abständen in goldgelbe Lichtkegel. Die Straßen lagen ruhig da, die Häuser schliefen friedlich vor sich hin. So früh am Morgen war noch niemand unterwegs.
Der Park, von dem aus man tagsüber einen schönen Blick auf den Rhein hatte, lag unbeleuchtet vor ihnen. Hohe Bäume reckten sich in den frühmorgendlichen Himmel. Es war ein idyllisches Fleckchen. An sonnigen Tagen spielten Kinder auf dem Klettergerüst, Senioren spazierten die sandigen Wege entlang und Hunde tollten über die Wiesen. Doch der Park hatte auch eine andere Seite: Gegen Abend wechselte das Publikum und Jugendliche belagerten die Bänke, um Drogen zu nehmen und Bier zu trinken. Und im Sommer hatte Lauras Assistentin Gilda hinter einem Busch sogar eine Leiche gefunden.
Kein schöner Gedanke.
Laura hätte es vorgezogen, an der Straße weiterzugehen, doch der Dackel zog sie zielstrebig in die Grünanlage. Die Wege schienen ihn nicht sonderlich zu interessieren, er steuerte quer über die Wiese auf ein Gebüsch zu. Laura holte mit klammen Fingern das Handy aus der Tasche und aktivierte die Taschenlampe. Der Lichtkegel war schmal und nicht besonders hell. Mehrmals strauchelte sie in dem unebenen Gelände und traf schließlich eine Entscheidung.
„Friedi, warte.“ Sie zog den unwilligen Dackel zu sich heran und leinte ihn ab.
Wedelnd verschwand er in der Dunkelheit.
„Komm aber zurück, wenn ich dich rufe!“ Sie wusste, wie entlarvend hilflos das klang. Aber es brachte nichts, hinter dem Tier her durch das Gras zu stolpern.
Wenige Meter vor sich hörte sie ihn durch die Büsche rascheln. Unbeholfen tastete sie sich mit den Füßen in seine Richtung vor, doch bevor sie ihn erreicht hatte, entfernte er sich wieder von ihr.
„Friedi!“ Sie rief ihn nur leise, um die Anwohner in den benachbarten Häusern nicht zu wecken.
Erwartungsgemäß hörte er nicht auf sie.
Stattdessen schlug er an. Bellte wie rasend.
„Friedi! Aus!“ So schnell wie möglich versuchte sie, zu ihm zu gelangen. „Sei ruhig!“ Ein Ast ratschte ihr durchs Gesicht, sie tauchte nach unten und schlug blind danach.
„Verdammt noch mal, Friedi, sei still!“
Endlich hatte sie ihn erreicht. Sie griff nach seinem Geschirr und hakte die Leine ein. Dann leuchtete sie mit der Taschenlampe die Umgebung ab. Vor ihr befand sich eine Bank, auf der etwas Dunkles lag. Sie ließ den Lichtstrahl darüber wandern: Beine, eine Hand, ein Kopf, der zur Seite gefallen war.
„Oh mein Gott!“
Ein Mann!
War er tot?
Er musste tot sein. Bei diesen Minusgraden konnte niemand auf einer Parkbank herumliegen, ohne zu erfrieren. Sie griff nach der Hand, prüfte, ob sie noch warm war. Aber natürlich war sie kalt. Ihre Eigene fühlte sich ja auch wie ein Eisklumpen an. Vorsichtig schob sie ihre Finger in den Kragen seiner Jacke, um nach einem Puls zu suchen.
„Nein!“
Sie schreckte zurück. Er lebte! Ein Glück. Aber vielleicht war er gefährlich? Wer bei diesen Temperaturen und zu der Uhrzeit hier herumlag, führte womöglich nichts Gutes im Schilde. Innerlich wappnete sie sich, jederzeit die Flucht anzutreten.
„Sie können hier nicht liegen bleiben, es ist zu kalt!“ Sie griff seine Schultern und schüttelte ihn.
„Lass mich in Ruhe!“ Er versuchte, sie wegzuschieben.
„Jetzt kommen Sie schon!“ Laura ließ sich nicht abwimmeln. „Wo wohnen Sie? Sie können nicht hierbleiben. Soll ich jemanden anrufen?“
„Nein!“
Mit viel Mühe gelang es ihr, ihn aufzurichten, doch er sank sofort nach vorne.
„Jetzt helfen Sie mir doch ein bisschen. So geht das nicht.“
Plötzlich krampfte sein Körper sich zusammen, er erbrach sich.
Direkt auf ihre Füße.
„Oh Mann!“ Sie sprang zur Seite, ohne ihn loszulassen. „Ich rufe die Polizei. Oder einen Krankenwagen.“
„Nein!“ Seine Stimme klang verzweifelt, brüchig.
Friedi stupste die Hand des Mannes an. Der schluchzte auf und fing an zu schniefen. „Nicht die Polizei. Sie dürfen nichts erfahren. Er bringt mich um! Was soll ich bloß tun?“
„Ruhig.“ Laura überlegte, während sie abwesend seine Schulter tätschelte.
Dann ließ sie den Lichtstrahl ihres Handys erneut über ihn wandern. Schmal, Daunenjacke, Jeans, Sneakers. Das war kein Mann. Jedenfalls noch kein richtiger. Er war vielleicht siebzehn, achtzehn Jahre alt. „Junge, was treibst du dich nachts im Park herum?“
Sie erwartete keine Antwort und bekam auch keine.
Der Lichtstrahl streifte den Dackel, der mit den Vorderpfoten mitten in der Lache aus Erbrochenem stand und wedelte.
„Friedi, komm da raus.“ Sie zerrte den Hund zu sich. „Was soll ich denn mit dir machen?“ Sie hatte Mitleid mit dem Jungen. Wenn sie die Polizei rief, würde er sicher Ärger bekommen. Und bestimmt hatte er das auch verdient, sie brachte es trotzdem nicht übers Herz.
„Kannst du laufen?“
Er weinte weiter, ohne zu reagieren. Ihre Hand, die noch auf seiner Schulter lag, drückte sanft zu. „Hey, kannst du laufen, habe ich gefragt!“
Zum ersten Mal schien er sie wahrzunehmen, das Schluchzen versiegte.
„Du kannst erst mal mit zu mir kommen. Ich wohne nur ein paar Häuser weit weg. Da wärmst du dich auf, trinkst einen Kaffee und dann überlegen wir weiter. Ist das ein Vorschlag?“
Im Licht der Handylampe nickte er.
„Ist dir noch schlecht?“
Er schüttelte den Kopf.
„Gut, dann steh auf. Ich helfe dir. Stütz dich auf mich. Ich halte dich schon. Ich bin stärker, als ich aussehe.“ Sie versuchte, munter zu klingen. Auch, um sich selbst Mut zu machen. „Und tritt nicht in dein Erbrochenes“, fügte sie hinzu. Doch sie sah ein, dass das zu viel verlangt war.
Der Weg zurück war mühsam. Nach anfänglicher Scheu hatte sie alle Zurückhaltung fahren lassen, sich seinen Arm um die Schultern gelegt und den eigenen Arm fest um seine Hüfte geschlungen. Zu ihrer großen Erleichterung trugen ihn seine Beine und er ließ sich widerstandslos mitführen.
Nicht so der Dackel.
Friedi hatte eine interessante Stelle entdeckt und war nicht bereit mitzukommen. Und als sie ihn hinter sich her zerrte, änderte er die Taktik und lief kreuz und quer vor ihren Füßen her, sodass sie ständig über ihn stolperten. Als sie in den Vorgarten des Mietshauses einbogen, in dem sich ihr Apartment befand, war sie schweißgebadet.
In der Wohnung angekommen, entledigte sie sich ihrer verschmutzten Stiefel und feuerte sie in die Ecke. Dann half sie dem Jungen aus seinen Sneakers und bugsierte ihn aufs Sofa.
„So, du kannst dir die Decke nehmen. Soll ich den Kamin anmachen?“
Ihr Besucher sah sich um, sein Blick wanderte über die Umzugskisten, die überall im Raum verteilt waren, und blieb am Kaminofen hängen, der in der Ecke stand.
„Okay, ich nehme das mal als ein Ja.“
Laura wohnte erst seit ein paar Wochen hier. Ein Einbrecher, der sich als sadistischer Stalker entpuppt hatte, hatte sie in der alten Wohnung heimgesucht und ihre Sachen durchwühlt. Auch wenn sie wusste, dass er ihr nichts mehr tun konnte, hatte sie sich dort nicht mehr sicher gefühlt und sich nach einer anderen Unterkunft umgesehen. Das neue Domizil lag nur wenige Schritte von ihrer Detektei entfernt, hatte Rheinblick und Kamin, da hatte sie nicht lange überlegt.
Sie schichtete Holzscheite auf, gab ein paar Stücke Kaminanzünder dazu und entfachte das Feuer. Dann ging sie in die Küche und schaltete die Kaffeemaschine an. Während das heiße Getränk in die Tasse lief, suchte sie die Schränke nach Keksen und Schokolade ab. Da sie nicht der gut organisierte Vorratstyp war, fanden sich nur eine geöffnete Tüte mit ein paar hart gewordenen Gummibärchen und das letzte Rippchen einer Nussschokolade. Besser als nichts.
Als sie mit zwei Kaffeetassen zurück ins Wohnzimmer kam, bot sich ihr ein idyllisches Bild.
Der junge Mann hatte sich auf den weichen Polstern des Sofas in eine Decke gewickelt, Friedi lag neben ihm und hatte den Kopf auf sein Bein gelegt. Im Kaminofen loderte das Feuer und verbreitete eine angenehme Wärme. Laura widerstand dem Impuls, den Hund von der Couch zu scheuchen, und verdrängte den Gedanken an seine schmutzigen Pfoten.
„Kaffee“, sagte sie munter und stellte eine Tasse vor ihn. „Und etwas Süßes. Das ist gut für die Nerven.“ Sie setzte sich ihm gegenüber in den Zwanzigerjahresessel mit den Löwenfüßen, zog die Beine auf das Polster und vergrub die nackten Füße unter einem Kissen. „Es ist schon sechs Uhr, so langsam fängt der Tag an. Selbst ein Sonntag.“ Der Versuch, den Jungen durch belanglose Konversation und einen Scherz aus der Reserve zu locken, misslang. Er wärmte die Finger an der Kaffeetasse und starrte ins Feuer.
„Was ist passiert? Warum hast du im Park auf der Bank gelegen? Du bist doch kein Obdachloser, das sehe ich. Hattest du Ärger? Oder hast du Drogen genommen und nicht mehr nach Hause gefunden?“
Die Wärme und der Kaffee hatten den Jungen wieder etwas aufgerichtet. Trotzdem schwammen in den blauen Augen immer noch Tränen, die er tapfer wegzuschlucken versuchte. „Danke, dass Sie mich mitgenommen haben. Es war verdammt kalt dort draußen. Hätte schiefgehen können.“
Laura lachte trocken. „Das ist wohl wahr.“
„Es stimmt, ich habe ein paar Bier getrunken. Und etwas geraucht.“
„Im Park? Allein?“
„Nein, bei einem Freund.“
„Dann hast du es nicht mehr bis nach Hause geschafft.“ Laura war erleichtert, dass er keine Selbstmordabsichten gehabt hatte. Sonst hätte sie seine Eltern oder einen Notdienst informieren müssen. So konnte sie ihn einfach gehen lassen, wenn er sich wieder besser fühlte.
„Ja. Nein. Ich wollte nachdenken. Und ich war ... durcheinander. Ich weiß auch nicht.“ Er beugte sich zu Friedi hinunter, streichelte über das Fell und eine Träne lief seine Wange hinab. Er biss sich auf die Lippen.
„Liebeskummer?“, riet Laura das Erstbeste, was ihr in den Sinn kam.
„Quatsch. Liebeskummer ist ein Scheiß.“ Er schob sich eine Strähne aus der Stirn und sie sah, dass seine Hand zitterte. „Es ist gestern Nacht etwas Schlimmes geschehen. Das werde ich nie wieder aus meinem Kopf kriegen. Ich weiß nicht, wie ich damit leben kann.“
Laura wurde es unbehaglich. War er doch ein Selbstmörder? „Was ist passiert?“, fragte sie hart.
„Das kann ich nicht sagen. Dann kriegt mein Kumpel echt Ärger. Und dann lässt er es mich büßen. Nein, das geht nicht.“ Er schüttelte heftig den Kopf und Kaffee schwappte aus seiner Tasse. „Oh, Entschuldigung!“
„Macht nichts.“ Laura winkte ab. Nach Friedis Schmutzpfoten machte das auch keinen Unterschied mehr. Sie wohnte in der Wohnung, es war keine Möbelausstellung. „Was hat dein Freund getan? Gib mir wenigstens einen Hinweis. Handelt es sich um etwas Kriminelles? Eine Straftat?“
Der Junge nickte unmerklich, sah zu Boden und hielt sich die Hand vors Gesicht.
„Jetzt sag schon. Du brauchst keine Angst zu haben, dass ich dich verpetze. Ich bin Detektivin, da ist Diskretion nicht nur Ehrensache, sondern gehört zu meinem Job.“
„Detektivin?“ Er sah hoch. Zum ersten Mal zeigte er Interesse an ihrer Person. „Das hätte ich nicht gedacht.“
„Warum? Weil ich eine Frau bin? Wir haben auch unsere Methoden.“ Sie zwinkerte ihm aufmunternd zu. „Los, was ist passiert?“
„Ach, vielleicht war es ja gar nicht so schlimm. Ich hatte ja echt einiges geraucht. Da kann man sich schon mal Sachen einbilden.“
„Los jetzt!“ Lauras Ton wurde unbarmherzig.
„Also, wir waren bei meinem Kumpel. Er ist kein richtiger Freund. Ich kann ihn eigentlich nicht ab. Ein Lauch. Total toxic. Aber meine Bros und ich hängen zusammen mit ihm ab. Er hat ein cooles Haus. Mit Pool. Und gut gefüllter Bar. X verschiedene Ginsorten und so’n Zeug. Und seine Eltern sind fast nie zu Hause. Aber er baut ständig irgendeinen kranken Scheiß. So richtig. Als wäre er nicht ganz sauber im Kopf. Vielleicht wirft er einfach zu viele Pillen ein. Ich versuche, mich immer da rauszuhalten. Geht mich ja auch nichts an, was er macht. Aber gestern Abend ...“ Er stockte, schluckte hart und presste die Lippen aufeinander.
Laura sah ihn unverwandt an.
„Also gestern hatten wir ziemlich viel getrunken. Und noch mehr geraucht. Und er hat einen Dackel. So einen wie den hier.“ Er streichelte sanft über Friedis Rücken. „Er hat den Hund den ganzen Abend geärgert. Und wir haben gelacht. Dabei war es nicht lustig. Überhaupt nicht. Ich mag Hunde. Und ich habe auch gelacht. Obwohl ich es gar nicht wollte.“ Wieder rollten die Tränen.
Laura räusperte sich. „Ich verstehe. Und dann hat er dem Hund etwas Schlimmes angetan. Richtig?“
„Ja.“ Der Junge nickte. „Er hat eine Weinflasche genommen ... und ... und ... sie kaputt geschlagen ... der Hund hat so geschrien ...“ Weiter kam er nicht, da er heftig würgen musste.
Laura sprang auf, rannte in die Küche und kam mit einer Teigschüssel zurück.
Doch der Junge winkte ab. „Geht schon wieder.“ Aber er sah käsebleich aus.
„Okay, ich glaube, ich habe verstanden, was passiert ist.“ Laura war es auch ganz schlecht. Am liebsten hätte sie mit ihm geweint. Geweint um diese unschuldige, vertrauensvolle Kreatur, die zum Zeitvertreib von einem sadistischen Arschloch gequält worden war. In ihrem Beruf hatte sie viel zu sehen bekommen und war sogar selbst in die Hände eines sadistischen Monsters geraten, das sie gefoltert hatte, nur um seinen Spaß zu haben. Die Erinnerung daran bereitete ihr schlaflose Nächte und machte es schwer, einfach nur den Alltag zu bewältigen. Doch Tierquälerei und Gewalt gegen Kinder waren für sie weit schlimmer. Diese Zerstörung von Vertrauen und Unschuld stand an der Spitze der Skala der Scheußlichkeiten, zu denen Menschen fähig waren. Solche Taten machten sie fassungslos und riefen unendliche Traurigkeit und rasende Wut in ihr hervor.
„Ich muss nachdenken“, murmelte sie. Mehr zu sich selbst als zu ihrem Besucher.
„Vielleicht geht es dem Hund ja gut?“ Seine Augen bettelten nach einer Lüge. Wie ein kleiner Junge, dem man sagen soll, dass alles wieder gut wird.
Aber Laura fühlte sich nicht danach, ihm diesen Trost zu spenden. Er hatte zugesehen. Hatte nichts getan. Hatte nicht verhindert, dass die widerliche Tat vollzogen worden war. Hatte dem armen Hund nicht geholfen. Am liebsten hätte sie sich vor lauter Abscheu in die Schüssel übergeben. Stattdessen nahm sie einen tiefen Schluck abgekühlten Kaffee.
„Du konntest nichts tun, um das zu verhindern?“ Sie versuchte, neutral zu klingen, kühl, beherrscht. Aber sie musste die Lippen zusammenpressen, um nicht loszuschreien.
„Nein. Ich war betrunken. Ich weiß auch nicht. Du kennst ihn nicht. Man kann ihn nicht aufhalten, wenn er sich etwas vorgenommen hat. Er ist völlig crazy. Der hätte das Gleiche mit mir angestellt.“
„Du weißt, dass es mit dem Kerl nicht so weitergehen kann? Das war sicher nicht seine erste Schandtat.“ Sie schnaubte. Schandtat. Das Wort klang so harmlos, so überhaupt nicht angemessen. Schändung? Frevel? Ruchlosigkeit? Für manche Dinge gab es keine Bezeichnung, die ausreichte, um auch nur im Mindesten das Ausmaß des Abartigen wiederzugeben. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und ballte die Hände zu Fäusten. „Und du weißt, dass es nicht seine letzte ... Schandtat ... sein wird.“
„Ich weiß. Alle wissen es. Seine Eltern auch. Er hatte schon oft Ärger mit der Polizei. Muss sogar jede Menge Sozialstunden abbrummen. Wenn ich ihn jetzt verpetze, kriegt er garantiert Jugendknast. Der Richter hat ihm gesagt, dass es seine letzte Chance sei.“
„Ich glaube, es wäre das Beste für ihn, wenn man ihn aus dem Verkehr zöge. Das Beste für alle. Für den Hund war es ein Desaster, dass man ihn nicht eingebuchtet hat.“
„Ich weiß.“
„Was machen wir jetzt?“
Der Junge fuhr hoch, sah sie erschrocken an, zuckte die Schultern. „Keine Ahnung. Wir können nichts tun. Das sind Bonzen, total reich. Die Eltern kaufen jeden. Da kommt man nicht gegen an. Man kriegt nur jede Menge Ärger!“
„Das werden wir ja sehen!“ Laura hob das Kinn und machte schmale Augen. „Wie heißt das Bürschchen? Den knöpfe ich mir vor.“
„Aber du verrätst mich nicht!“ Beschwörend starrte er sie an.
Sie zögerte, dann nickte sie. „Ist okay. Ich halte dich da raus.“
„Es ist Moritz Anton.“
„Anton. Von Anton Vandenberg? Der Baufirma?“
„Genau. Die sind so reich, das kann man sich nicht vorstellen. Deshalb kann Moritz sich alles erlauben. Ihm kann keiner was.“
„Wir leben in einem Rechtsstaat, nicht in einer Bananenrepublik. Niemand kann sich über das Gesetz stellen, nur weil er reich ist.“ Laura setzte die Tasse auf einem Umzugskarton ab. „Ich denke, es wird langsam Zeit, dass du nach Hause kommst. Deine Eltern machen sich bestimmt Sorgen, wenn du die ganze Nacht weg bist.“
„Stimmt, ich hau ab. Vielen Dank für deine Hilfe. Und den Kaffee. Und denk dran, du verrätst mich nicht. Sonst bin ich am Arsch. Du hast es versprochen.“ Er wickelte sich aus der Decke und erhob sich.
„Ja, ich habe es versprochen. Mach dir keinen Kopf. Wie heißt du überhaupt?“
„Leo Wagner. Ich bin der, der den Jugend-Forscht-Preis gewonnen hat.“
„Und ich bin Laura Peters. Die, die deinem Freund die Hölle heißmachen wird.“
Montag
2 Detektei
Mit dem Ellenbogen drückte Laura die rostige Klinke herunter und schob das schmiedeeiserne Gartentor auf. Die Tasche an ihrer Schulter wog schwer und schien jeden Augenblick zu Boden rutschen zu wollen. Friedi, dessen Leine sie zusammen mit einem Stoffbeutel in der rechten Hand hielt, hatte Bedenken, ihr auf das Grundstück zu folgen, und versuchte, sie zur Straße zurückzuzerren. Laura hielt dagegen, blies eine Haarsträhne vor den Augen weg und drehte sich zu ihm um.
„Jetzt komm, Friedi, sonst fällt mir alles hin.“ Sie bemühte sich um einen freundlichen Tonfall, obwohl sie am liebsten alles hingeworfen hätte. Warum erzählte sie dem Hund das überhaupt? Er verstand sowieso nicht, was sie sagte. Und wenn doch, dann war es ihm egal. Sie trat in den Vorgarten und zog ihn hinter sich her.
Es war bereits acht Uhr, trotzdem war es noch nicht richtig hell. Friedi blieb stehen, schnüffelte an einem Busch und hob feierlich das Bein, dann trottete er neben ihr den Weg entlang. Ein eisiger Windstoß blies ihr ins Gesicht und wehte eine Dornenranke von der Mauer. Laura zog den Kopf ein und tauchte nach unten.
„Ha! Diesmal nicht!“ Sie freute sich, dass sie der Heckenrose, die sich gerne in ihrer Jacke festhakte, entkommen war, und wertete es als gutes Omen für den Tag.
Laura schloss die Haustür auf, zog Friedi hinter sich her in den Hausflur und öffnete die Tür zur Büroetage. Im Vorraum traf sie auf ihre Assistentin Gilda.
„Ciao Laura.“ Gilda strahlte sie an. Dann entdeckte sie den Dackel, sprang auf und kam hinter dem Schreibtisch hervor. „Wen haben wir denn da? Du bist ja ein Süßer!“ Sie kniete sich auf den Boden und wuschelte den Kopf des Tieres mit beiden Händen.
„Das ist Friedi.“ Laura stellte die Taschen ab und hakte die Leine aus.
„Seit wann hast du einen Hund?“
„Er gehört mir nicht. Ich passe nur eine Weile auf ihn auf. Meine Nachbarin, eine ältere Dame, musste am Samstag überraschend ins Krankenhaus. Da sie niemanden hat, der ihn zu sich nehmen kann, hat sie mich gefragt. Oder vielmehr der Sanitäter, der sie abtransportiert hat, hat gefragt. Das konnte ich nicht abschlagen.“
„Wie lieb von dir! Kennst du dich mit Hunden aus?“
„Überhaupt nicht. Und er hört nicht für fünf Cent. Er hat seinen eigenen Kopf.“
Gilda lachte. „Hast du deinen eigenen Kopf?“ Amüsiert zauste sie durch das rotbraune Fell. Dann strich sie sich die langen, dunklen Haare nach hinten und schaute zu Laura hoch: „Friedi ist ein lustiger Name.“
„Das ist sein Spitzname. Eigentlich heißt er Friedensreich. Aber auf den Namen reagiert er auch nicht.“
„Friedensreich? Das hört sich sehr würdevoll an.“ Gilda streichelte jetzt den Bauch des Dackels, der sich hilfreich auf den Rücken gelegt hatte.
Laura hängte die Jacke an die Garderobe, griff nach den Taschen und zwängte sich im Krebsgang an den beiden vorbei in ihr Büro.
„Wenn du möchtest, gehe ich zwischendurch mit ihm spazieren“, hörte sie Gilda rufen.
„Das wäre nett. Er ist auch wirklich lieb. Wenn man macht, was er will.“
Laura setzte sich hinter den Schreibtisch, warf den Computer an und prüfte den Posteingang der Mails.
Erfahrungsgemäß erhielten sie die meisten Anfragen am Wochenende. Anscheinend hatten die Leute dann mehr Zeit, über ihre Mitmenschen nachzudenken und sich zu entschließen, einen Detektiv zu beauftragen.
So war es auch heute.
Neun Interessenten hatten sie angeschrieben und baten um einen Rückruf oder direkt um einen Terminvorschlag. Sie machte sich eine Notiz, sie später zu kontaktieren.
Aus der Küche nebenan hörte sie das verheißungsvolle Brummen der Kaffeemaschine, kurz darauf trat Gilda mit zwei Tassen in ihr Büro und stellte eine vor sie auf die Tischplatte.
„Herrlich, danke, das ist jetzt genau das Richtige.“ Laura nahm genüsslich einen Schluck von dem ungesüßten Milchkaffee. Dann bückte sie sich, zog eine Papiertüte aus der Tasche, die neben ihrem Stuhl stand, und legte sie auf den Tisch. „Komm, setz dich. Ich habe Schokocroissants mitgebracht. Bei dieser Kälte und Dunkelheit braucht man jede Menge Kohlehydrate, sonst kriegt man Depressionen.“
„Da hast du recht.“ Gilda lachte, zog sich einen Sessel vor den Schreibtisch und bediente sich.
„Welche Termine stehen für heute an?“ Laura warf einen Blick auf den Tischkalender, ein analoges Arbeitsmittel, das sie vor allem für ihre Kritzeleien beim Nachdenken nutzte.
„Gleich kommt eine Interessentin vorbei, die mich über unsere Webseite kontaktiert hat. Sie hat das Gefühl, verfolgt zu werden, mehr Details kenne ich nicht. Du musst nicht dabei sein. Das kriege ich allein hin. Ist bestimmt kein großes Drama, eher das Übliche.“
Laura nickte.
Die Fälle, die sie bearbeiteten, waren in gewisser Weise alle gleich und meist keine große Herausforderung: Zeitungsdiebe, Fremdgeher, Auskünfte über Vermögensverhältnisse während und nach Scheidungen. Gilda hatte daneben ein zweites Standbein aufgebaut und stellte Nachforschungen im Internet über Fake-Accounts, Love-Scammer und untreue Liebhaber an. Für jemanden mit ihren Computerfähigkeiten keine schwierige Aufgabe. Doch es hatte auch große Fälle für die Detektei gegeben, die bundesweit Schlagzeilen gemacht und ihnen einiges an Berühmtheit eingebracht hatten.
Eine leise Wehmut überkam Laura bei dem Gedanken. Es waren spannende, geradezu berauschende Zeiten gewesen. Das Team hatte eng zusammengehalten, sie hatte sich so lebendig gefühlt. Aber sie waren auch jedes Mal in Gefahr geraten. Der Hauch von Wehmut ließ abrupt nach und wich eisiger Beklommenheit. Bei ihrem großen Fall im Sommer war Laura von einem Sadisten entführt worden. Er hatte sie übel zugerichtet. Das Wort ‚Folter‘ versuchte sie aus ihrem Kopf zu verdrängen, damit es nicht zu dominant wurde und irgendwann allen Platz in ihrem Gehirn einnahm.
Erst in letzter Sekunde hatten ihre Kollegen sie retten können.
Gerade noch rechtzeitig.
Oder vielleicht auch nicht.
Sie spielte es gerne herunter, vor allem vor sich selbst, aber sie hatte neben Narben am ganzen Körper auch ein Trauma davongetragen. Der Täter hatte ihr in einer Diskothek aufgelauert, ihr K.O.-Tropfen in den Drink gemischt und sie entführt. Er konnte ihr nicht mehr gefährlich werden, trotzdem hatte sie die nächtlichen Ausflüge nach Köln zum Tanzen und Spaß haben eingestellt. Es war irrational, aber sie traute sich nicht mehr. Hatte einen regelrechten Horror davor. Und auch in ganz normalen Alltagssituationen konnte es mittlerweile passieren, dass die Angst sie hinterrücks überfiel und sie die Erinnerungen an das schreckliche Erlebnis übermannten.
Wahrscheinlich musste sie einen Therapeuten oder Psychologen aufsuchen. Aber dazu konnte sie sich nicht durchringen. Die Vorstellung, auf der Couch zu liegen und ihre tiefsten Geheimnisse und Ängste jemandem preiszugeben, der vermutlich selbst noch viel ernstere psychische Störungen hatte, schreckte sie ab. Natürlich war sie sich im Klaren darüber, dass das ein Vorurteil war, aber sie konnte es nicht abschütteln. Sie war einfach nicht der Typ, der sein Innerstes nach außen kehrte. Es widerstrebte ihr schon, sich Freunden zu offenbaren. Fremden gegenüber verursachte es ihr regelrecht Übelkeit. Sie war eben mehr der „Reiß-dich-zusammen-Typ“.
Doch wenn sie nichts gegen die Panikattacken unternahm, würde es schlimmer werden, das war ihr klar.
Natürlich hatte sie über Alternativen nachgedacht. Aber Selbsthilfegruppen für Betroffene von Gewalt waren erst recht keine Lösung.
Wie sah das aus, wenn die Chefin einer Detektei mit anderen Opfern in einem Stuhlkreis über ihre Ängste jammerte?
Angeblich konnte man anonym bleiben, aber sie würde es nicht lange verheimlichen können. Bad Godesberg war ein Dorf, sie war hier bekannt. Und auch in Bonn. Und im Prinzip im ganzen Land. Nach der Lösung des letzten Falles war ihr Bild in allen Zeitungen gewesen. Und wenn herauskam, dass sie sich therapieren ließ, konnte sie den Laden dichtmachen.
Niemand würde eine verschüchterte Detektivin beauftragen, die sich vor Angst in die Hosen machte.
„Laura?“ Gilda schnipste mit den Fingern vor ihrem Gesicht und riss sie in die Wirklichkeit zurück. „Alles okay? Du siehst blass aus.“
Sie winkte ab. „Alles gut. Ich hatte nur zu wenig Schlaf am Wochenende. Friedi ist ein Frühaufsteher. Mach dir keinen Kopf.“
„Das verstehe ich. Aber ihr werdet euch schon einspielen. Wann kommt Marek eigentlich wieder?“ Die Assistentin war aufgestanden und sammelte die leeren Tassen ein.
„In ein paar Tagen. Wer weiß das schon so genau.“
Ihr zweiter Detektiv, den sie gerne als polnischen James Bond bezeichnete, hatte sich wieder abgeseilt. Wohin und weshalb wusste keiner, aber sie ging davon aus, dass er einen Privatauftrag erledigte. Er hatte angedeutet, dass er immer noch Kontakte zu den polnischen Polizeibehörden und, wie sie stark vermutete, auch zum Geheimdienst hatte und dem einen oder anderen einen Gefallen schuldete.
„Drake hat übrigens angerufen und gesagt, dass er nachher vorbeikommt“, rief Gilda im Hinausgehen über die Schulter.
„Soso. Hat er wirklich gemeint, dass er zu uns kommt? Oder will er zu einer Nachbarin?“ Laura zwinkerte.
Der dritte Detektiv war im Hauptberuf Schriftsteller und hatte bei ihnen angeheuert, um für einen Thriller zu recherchieren und die Arbeit in einer Detektei kennenzulernen. Die Zusammenarbeit mit ihm war erfolgreich gewesen, er hatte einiges dazu beigetragen, dass sie den dritten großen Fall lösen, einen Mörder entlarven und ein Attentat hatten verhindern können. Doch neben seinem umfassenden Wissen auf vielen Gebieten zeichnete er sich auch durch seine Beliebtheit bei den Nachbarinnen aus, die er reihum und ausdauernd beglückte.
Das Klingeln an der Haustür ersparte Gilda die Antwort.
3 Wohnung Südstadt
Wer sagt, Gewalt löse keine Probleme, macht es nicht richtig.
Swetlana Braun wollte auf Schatzsuche gehen. Sie schüttelte die langen, schwarzen Haare nach hinten, setzte den Helm auf, schwang sich rittlings auf den Motorroller und brauste los. Der Chef der Reinigungsfirma Clean-and-Quick, in der sie mit viel Glück vor zwei Jahren einen Job ergattert hatte, war heute nicht da und der Sekretärin hatte sie erzählt, dass sie einen Arzttermin hatte. Die hatte zwar die Augen zusammengekniffen und misstrauisch geguckt, sie dann aber gehen lassen. Vermutlich war es ihr sogar recht, dass Swetlana sich aus dem Staub machte.
Schwungvoll brauste sie die Straße entlang, schlängelte sich durch die Autos, die vor einer roten Ampel warteten, und kürzte über den Bürgersteig ab. Haarscharf an den auf Hochglanz polierten Budapestern eines Anzugträgers vorbei, dem sie mit der Schulter die Zeitung aus der Hand wischte.
Die erbosten Rufe quittierte sie im Davonfahren mit einem lauten Lachen und erhobenem Mittelfinger.
Den Schlüssel für die Wohnung, die sie unter die Lupe nehmen wollte, hatte sie am Morgen aus dem Büro ihres Vaters mitgehen lassen. Er war der Chef einer Entrümpelungsfirma und hätte es niemals erlaubt, dass sie in einem Objekt, wie er es nannte, schon vor ihm nach Wertgegenständen suchte. Und würden seine Mitarbeiter das spitzkriegen, ginge es ihr erst recht schlecht. Natürlich erhielten sie ihren Lohn, aber Fundstücke von Wert wurden nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel unter ihnen und ihrem Vater aufgeteilt und waren ein schönes Zubrot. Wenn sie ihnen das vor der Nase wegschnappte, wäre Schluss mit lustig. Da würde es auch nicht helfen, dass sie die Tochter des Chefs war.
Doch bisher hatte sie nie jemand erwischt.
Jeder Mensch hat einen Schatz, sagte ihr Vater immer. Man musste nur gründlich genug danach suchen. In den meisten Fällen hatten die Hinterbliebenen das bereits getan, aber manche Dinge waren so gut versteckt, dass sie nicht gefunden wurden. Jedenfalls nicht von normalen Leuten. Von ihrem Vater schon. Er hatte mal einen ziemlichen Batzen Geld tief unten in einem Stapel Zeitungen ausgegraben, ein Kästchen mit Schmuckstücken hinter den Kacheln über einem Toilettenkasten freigelegt und einen goldenen Ring im Schirm einer Wohnzimmerlampe entdeckt.
Man musste nur wissen, wo man suchen musste.
Da die Entrümpelung der Wohnung erst für den nächsten Tag anstand, wollte Swetlana die Gelegenheit nutzen, sich ungestört umzusehen. Sie bremste den Roller ab, zog das Handy aus der Jackentasche und überprüfte die Adresse, die sie aus den Unterlagen ihres Vaters abfotografiert hatte. Auf dem Fußweg ließ sie das Fahrzeug ausrollen und kam vor einem schmiedeeisernen Gitter zum Stehen.
Das Haus war ein Altbau.
Nicht im Bestzustand, aber gut in Schuss. Das war vielversprechend. Wer hier wohnte, musste Geld haben. Jedenfalls ein bisschen. Mittlerweile waren es nämlich nicht mehr nur die Messi-Buden und Armen-Unterkünfte in den schlechten Wohnsiedlungen, zu denen ihr Vater bestellt wurde. Immer häufiger beauftragten ihn auch gut betuchte Hinterbliebene, die keine Zeit oder Lust hatten, sich mit dem Leerräumen einer Wohnung zu beschäftigen. Natürlich verlangten diese Kunden, dass alles, was von Wert gefunden wurde, abgeliefert werden sollte. Manche ließen es sich sogar schriftlich geben, setzten Verträge auf. Swetlana grinste bei dem Gedanken. Wie wollten sie es denn nachprüfen? Schön blöd.
Und gut für sie.
Sie schloss die Haustür auf, schlüpfte in das Halbdunkel des Hausflurs und erklomm leise die Marmorstufen der Treppe bis zum obersten Stockwerk. Die Nachbarn mussten nicht unbedingt mitbekommen, dass sie da war. Das Leben war voll dummer Zufälle und sie erzählten es morgen womöglich ihrem Vater.
Die Wohnungstür klemmte, doch als sie dagegen drückte, schwang sie auf.
Die Schatzsuche konnte beginnen.
In Swetlanas Bauch kribbelte es. Sie liebte diesen Moment, wenn sie das erste Mal eine fremde Wohnung betrat. Die Vorstellung, einen Haufen Geld und Schmuck zu finden, den Jackpot zu knacken und endlich zu den Reichen und Schönen zu gehören, berauschte sie.
Sie blieb einen Augenblick im Flur stehen und spürte in die kalten Räume hinein, um sicherzugehen, dass die Wohnung wirklich verlassen war.
Geräusche gab es immer. An keinem Ort der Erde herrschte absolute Stille. Jedenfalls an keinem, an dem sie sich jemals aufgehalten hatte. Doch bewohnte Wohnungen hörten sich anders an als leerstehende. Das Surren eines Kühlschranks, das Glucksen einer Heizung oder Verkehrslärm, der durch ein auf Kipp geöffnetes Fenster drang, verrieten, dass der Bewohner nur kurzzeitig abwesend war.
Alles Geräusche, die in unbewohnten Räumen fehlten.
Und der Geruch unterschied sich: Die Aura des Bewohnten, hervorgerufen durch einen Hauch von Parfüm, Seife oder Putzmittel in der Luft, den Duft von Blumen oder des letzten Essens schlug schnell um in die abweisende Atmosphäre des Verlassenen, geprägt durch Staub, Müll oder verrottende Essensreste.
Swetlana konzentrierte sich auf ihren Radar. Aber außer dem leisen Ticken einer Uhr und dem gedämpften Lärm, der von der Straße drang, war es totenstill. Im wahrsten Sinne des Wortes. In den Notizen ihres Vaters hatte sie gelesen, dass die alte Frau, die hier gewohnt hatte, tot in ihrem Bett aufgefunden worden war. Eigentlich ein gutes Ende. Besser, als ewig in einem Pflegeheim halb bewusst- und bewegungslos vor sich hinzuvegetieren. Nicht ganz so schön war, dass man sie erst nach drei Tagen entdeckt hatte. Das deutete darauf hin, dass sie einsam gewesen sein musste. Und es erklärte den Muff. Diese Mischung aus saurer Milch, Moder und einem Hauch Maiglöckchen-Parfüm. Wie der Geruch der uralten Frau Schmitz-Wedecke, die früher zwei Stockwerke über Swetlana gewohnt hatte und sich nicht mehr waschen konnte. Sie hatte ihr immer alte, verklebte Bonbons geschenkt, die sie später heimlich weggeworfen hatte.
Swetlana war den Geruch gewöhnt. Sie hatte schon schlimmere Buden betreten, in denen sie kaum hatte atmen können und in denen es vor Ungeziefer nur so gewimmelt hatte. Es machte ihr nichts aus. Sie war abgehärtet.
Aber die Mädchen in der Grundschule damals hatte es gestört.
Die rosa Marzipanschweinchen, die nach Niveacreme und Plätzchen rochen, in der Stunde hinter ihrem Rücken getuschelt und sie in der Pause geärgert hatten. In der ersten Klasse hatten sie sie Zigeunermädchen genannt. Das hatte sie eigentlich gar nicht schlimm gefunden. Im Gegenteil, es hatte wie etwas Besonderes geklungen. Und es stimmte ja auch. Swetlanas Vater war Roma. Und sie hatte den deutschen Pass, weil er eine Deutsche geheiratet hatte. Eine richtige Deutsche. Mit blonden Haaren und blauen Augen, so wie die Frauen, die samstags die Straße fegten und Apfelkuchen backen konnten. Was ihre Mutter leider nie gemacht hatte. Aber optisch schlug Swetlana mit der schwarzen Mähne, den dunklen Augen, der gedrungenen Figur und vor allem ihrem Temperament nach seiner Familie. Und auch ihre Kleider waren anders gewesen. Bunter, lustiger. Zusammengesammelt von Flohmärkten und Säcken aus der Kleidersammlung, die die Leute abends an die Straße stellten. Nicht die Standard-Ausrüstung, die alle trugen und die die gepflegten Mamis im Supermarkt am Tchibo-Stand gekauft hatten.
Die Lehrerin hatte dem Treiben eine Weile zugesehen und den Schweinchen dann verboten, sie Zigeunerin zu nennen. Warum, hatte sie nicht verstanden. Man sagt das nicht, war die lapidare Erklärung gewesen. Als wäre Zigeuner ein Schimpfwort. Und wie sie dann gelernt hatte, war es auch eins. Ein Wort, durchtränkt von einer Ewigkeit an Vorurteilen, Verfolgung und Diskriminierung. Und schlechten Erfahrungen. Das musste sie zugeben. Aber das waren die Leute selbst schuld. Wenn eine Gesellschaft einem mit Ablehnung und Repressalien begegnete, musste sie damit rechnen, dass man sich andere, manchmal nicht legale Wege suchte, um zurechtzukommen.
Die rosa Mädchen hatten sich artig gefügt – und einen neuen Schimpfnamen für sie gefunden.
Stinkerbell.
Damals hatte sie ein Hausaufgabenheft benutzt, auf dem die Fee Tinkerbell aus Peter Pan abgebildet war, die ihr so gut gefiel, weil sie frech und unabhängig war, Streiche spielte und so gar nicht in das Klischee der braven Prinzessin passte. Die Mädchen hatten gemeint, dass Swetlana müffelte. Sie hatten Müffeln gesagt, nicht Stinken. Stinken war ein ordinäres Wort, das benutzten sie nicht, dazu waren sie zu fein. Aber Müffeln hatte sie noch mehr getroffen, es hatte den Abgrund zwischen ihr und den anderen noch viel größer erscheinen lassen. Sie hatten sie damit gehänselt, dass ihr Vater so einen dreckigen Job hatte und die Scheiße der Toten wegräumte. Für das Wort Scheiße waren sie sich nicht zu fein gewesen.
Da war Stinkerbell die richtige Bezeichnung.
Eine Zeit lang hatte ihr der Schimpfname etwas ausgemacht. Vor allem, weil sich die rosa Schweinchen hinter dem Rücken der Lehrerin die Nase zuhielten, wann immer sie sie sahen, und nichts mit ihr zu tun haben wollten. Das hatte sie so traurig gemacht, dass sie nicht mehr in die Schule gehen wollte. Den Eltern hatte sie gesagt, dass sie sich nicht gut fühle und zu Hause bleiben müsse, aber sie waren hart geblieben. So war ihr nichts anderes übrig geblieben, als irgendwann den Spieß umzudrehen, sich die Mädchen zu schnappen, wenn sie allein unterwegs waren, und sie gehörig zu verdreschen.
Wer sagte, Gewalt löse keine Probleme, machte es nicht richtig.
Keins der Mädchen hatte jemals von den Prügeln erzählt. Sie hatten zu viel Angst vor ihr gehabt. Den Spitznamen hatte Swetlana trotzdem behalten. Sie war so daran gewöhnt, dass sie sich manchmal selbst als Stinkerbell vorstellte. Eine Weile hatte sie sogar mit dem Gedanken gespielt, sich den Namen auf das Schulterblatt tätowieren zu lassen. Als Kampfname. Und eine mit einer Kalaschnikow bewaffnete Elfe. Aber dann hatte sie doch einem reich verzierten Totenkopf mit Schlapphut und Rose zwischen den Zähnen den Vorzug gegeben.
Swetlana schüttelte die Erinnerungen ab, blickte auf die Uhr und gab sich einen Ruck. Zu lange durfte sie sich nicht hier aufhalten. Die Zeit lief. Die Wohnung war nicht groß, nur vier Türen gingen vom Flur ab. Sie öffnete die erste und betrat ein Wohn-Esszimmer. Schrankwand Eiche, Tisch Eiche, Stühle Eiche. Eine Sitzgarnitur aus Cord, ein gefliestes Tischchen mit gedrechselten Füßen. Kein Fernseher, den hatten die Hinterbliebenen gebrauchen können und selbst abtransportiert. Mit geübten Fingern durchwühlte sie Papiere in Schubladen, blätterte durch die wenigen Bücher, Standardwerke wie Krieg und Frieden, Doktor Schiwago, Liebesküsse auf der Intensivstation und den ADAC-Atlas, und schüttelte Zeitschriften aus. Nichts. Mit der Taschenlampe des Handys leuchtete sie hinter die Verkleidung der Heizung und griff tief in den Spalt zwischen Polster und Lehne des Sofas. Sie förderte einen Kuli, ein paar Metallhaarspangen und zwei Euro zutage.
Ein Anfang.
Sie schob den Tisch zur Seite und rollte den Teppich ein. Fehlanzeige. Kein Geld darunter, keine losen Dielen. Sie räumte die Sachen wieder an ihren Platz, ohne sich allzu große Mühe zu geben. Fast alle Wohnungen, in die ihr Vater mit seinem Räumkommando kam, waren vorher von Angehörigen durchsucht worden. Da wäre es eher aufgefallen, wenn es zu aufgeräumt war.
Im Schlafzimmer wurde der muffige Geruch stärker. Zwar war ausgiebig gelüftet worden, sonst hätte sie es hier drin nicht ausgehalten, aber die fleckige Bettwäsche und die Matratze, auf der die Tote drei Tage gelegen hatte, waren noch da.
Das Bett war durchwühlt worden, das war deutlich zu erkennen. Vermutlich auf der Suche nach Geld. Allerdings nicht von einem Profi. Swetlana zog dünne Einweghandschuhe aus der Jackentasche und streifte sie über. Sorgfältig strich sie von allen Seiten über den Bezug der Matratze. Nichts. Sie öffnete die Schublade des Nachtschränkchens und schob achtlos Tabletten, eine Lupe, Heiligenbildchen, eine Lesebrille und Hustenbonbons durcheinander. Dann zog sie die Lade komplett heraus und kippte den Inhalt auf das Bett.
Aus dem Augenwinkel sah sie etwas Schimmerndes zu Boden fallen und unter das Bett rollen.
Was war das?
Ihr Jagdinstinkt erwachte. Sie kniete sich auf den Bettvorleger, legte den Kopf schräg und versuchte, den Gegenstand zu entdecken. Er war bis hinten an die andere Wand gerollt. Swetlanas Herz hüpfte.
Bestimmt ein Ring.
Und sicher aus Gold.
Sie rappelte sich auf und zerrte mit beiden Händen die heruntergerutschte Jeans wieder ein Stück höher über die Hüften. Dann trat sie ans Fußende und zog an dem massiven Bett, bis der Spalt zur Wand breit genug war, dass sie dazwischen passte. Seitlich schob sie sich bis zum Kopfende, ging in die Hocke und tastete den Boden ab. Ihre Finger schlossen sich um den filigranen Gegenstand. Sie hielt ihn gegen das Licht und betrachtete ihn mit zusammengekniffenen Augen.
Sie hatte recht.
Es war ein Goldring. Zwar ohne Stein, aber ein bisschen was wert war er. Sie lächelte und steckte das Schmuckstück in die Jackentasche. Dann trat sie Schritt für Schritt den Rückweg an, sorgfältig darauf bedacht, möglichst wenig mit der versifften Bettwäsche in Kontakt zu kommen.
Unter ihrem Fuß wackelte ein Dielenbrett.
Sie war wie elektrisiert. Das war es, wovon jeder Entrümpler träumte. Ein Versteck zu finden, in dem ein Schatz verborgen war. Solche Geschichten las man in den Zeitungen immer wieder: Ein armer Mann, der von Brot und Wasser lebte und in dessen Sofapolster ein Vermögen eingenäht war. Oder die Klofrau, in deren Garage Kleingeld im Wert von mehreren Millionen lagerte. Swetlana hatte es sich oft ausgemalt, wie dieser Moment sein würde. Und jetzt war er vielleicht gekommen: Eine Planke wackelte unter ihrem Fuß. Das konnte die Eintrittskarte in das Leben sein, das sie sich immer erträumt hatte.
Mit aller Kraft schob sie das Bett weiter von sich, kniete sich hin und probierte, das Brett zu entfernen. Doch das gestaltete sich als schwierig. Mit den Fingernägeln krallte sie sich durch das dünne Plastik der Handschuhe in den Spalt, um die Seite anzuheben, rutschte aber jedes Mal ab. Als ein Nagel abbrach, fluchte sie durch die Zähne. So hatte es keinen Zweck.
Wie war die alte Frau an das Versteck herangekommen? Schon um das Bett wegzuschieben, hätte sie ein Herkules gewesen sein müssen. Vermutlich war es doch nur eine Diele, die sich mit der Zeit gelockert hatte. Trotzdem. Sie konnte jetzt nicht aufgeben, sie musste sichergehen.
Schwer stützte sie sich auf die Matratze, erhob sich ächzend und zog das eng sitzende T-Shirt über dem Bauch glatt. Abwesend schob sie sich eine Strähne aus dem Gesicht und sah sich nach einem geeigneten Werkzeug um. Lang, schmal und stabil musste es sein. Natürlich! Ein Messer. Da hätte sie gleich drauf kommen können. In der Küche prüfte sie das Besteck und entschied sich für ein Brotmesser. Es war von minderer Qualität, der Griff aus verblichenem, abgestoßenem Plastik, aber die Klinge schien stabil zu sein.
Das Herz klopfte ihr bis zum Hals, als sie die Schneide in den Spalt schob und langsam zur Seite hebelte. Die Klinge bog sich gefährlich weit durch, doch endlich hob sich das Brett ein Stück.
In dem ungeheizten Schlafzimmer herrschte Eiseskälte, doch ihr floss der Schweiß nur so von der Stirn. Sie krallte die Finger in das Holz, zog, so stark sie konnte, und stocherte mit dem Messer nach.
Endlich drehte sich das Brett, fiel mit lautem Klonkern auf das Parkett und gab den Blick auf einen Hohlraum frei.
Sie beugte sich vor und schob die Haarsträhnen, die an ihrer feuchten Stirn klebten, zur Seite, um besser sehen zu können.
„Yes!“
In dem Versteck lag etwas.
Vor Aufregung zitterten ihr die Finger, als sie den Gegenstand herausnahm. Doch was sie in den Händen hielt, war nicht das, was sie sich erhofft hatte. Es war ein Heft, Din-A-5, wie man es in der Schule benutzte. So verstaubt und angegilbt, wie es war, schien es lange dort gelegen zu haben. Sie legte es zur Seite und tastete den Hohlraum erneut ab. Doch das Versteck war ansonsten leer.
„Fuck!“
Ihre Euphorie wich grenzenloser Enttäuschung.
Sie lehnte sich mit dem Rücken an die Wand und stützte den Kopf in die Hände. Ein Tagebuch oder sonst so ein Mist. Damit konnte sie nichts anfangen. Es war wertloser Scheiß, auch wenn es der alten Frau, oder wer auch immer das geschrieben hatte, so wichtig war, dass es unter den Dielen versteckt worden war. Am liebsten hätte sie sich eine Zigarette angezündet und den Frust zur Decke gequalmt. Aber dann würde ihr Vater sofort merken, dass sie vor ihm da gewesen war. Das durfte sie nicht riskieren.
Ein Blick auf die Armbanduhr sagte ihr, dass sie sich bereits seit einer Stunde hier aufhielt. Sehr viel länger würde sie nicht bleiben können, sonst nahm man ihr den Arzttermin nicht ab. Sie passte das Brett wieder in den Boden ein und rückte das Bett zurück.
Das Heft konnte sie in irgendeine Schublade zu anderen Papieren stopfen. Keinem würde es auffallen. Ohne großes Interesse blätterte sie durch die Seiten: Notizen, Aufzeichnungen, eingeklebte Zeitungsartikel und Fotos.