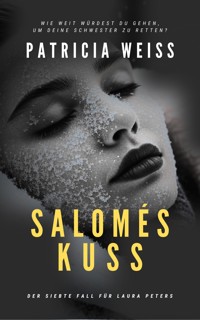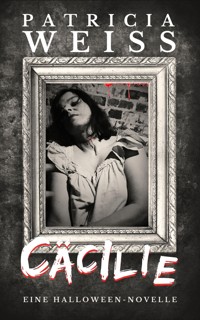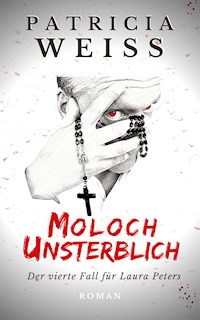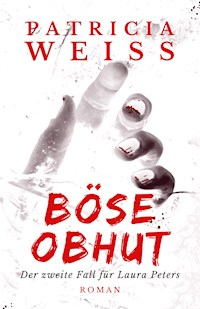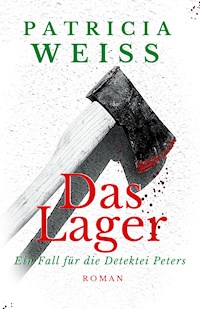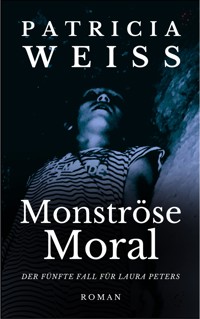
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
"Die Glühbirne hing nackt an einem Kabel von der Decke und tauchte den Keller in diffuses, rotes Licht. Ansonsten gab es nur ein Regal, auf dem der aufgeklappte Laptop stand und leise vor sich hinsurrte. Und die Webcam. Das lidlose Auge unverwandt und mitleidlos auf die Mitte des Raumes gerichtet. Auf den Stuhl. Aus Metall und mit extra stabilen Beinen und Armlehnen. Eine Sonderanfertigung für Adipositas-Patienten bis dreihundert Kilogramm. Und für Opfer, die durch die Hölle gehen mussten." Ihr neuer Fall führt die Detektivin Laura Peters in eine Klinik für Psychiatrie und in die mystischen Tiefen des Darknets. Sie kommt einem Psychopathen auf die Spur, der ein unglaubliches Spiel treibt. Als sie merkt, dass sie längst selbst Teil eines menschenverachtenden Experiments ist, muss sie eine herzzerreißende Entscheidung treffen. Denn Justin, das jüngste Teammitglied, könnte sein nächstes Opfer sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum neobooks
Monströse Moral
Der fünfte Fall für Laura Peters
Kriminalroman
Das Buch
„Die Glühbirne hing nackt an einem Kabel von der Decke und tauchte den Keller in diffuses, rotes Licht. Ansonsten gab es nur ein Regal, auf dem der aufgeklappte Laptop stand und leise vor sich hin surrte. Und die Webcam. Das lidlose Auge unverwandt und mitleidlos auf die Mitte des Raumes gerichtet. Auf den Stuhl. Aus Metall und mit extra stabilen Beinen und Armlehnen. Eine Sonderanfertigung für Adipositas-Patienten bis dreihundert Kilogramm.
Und für Opfer, die durch die Hölle gehen mussten.“
Ihr neuer Fall führt die Detektivin Laura Peters in eine Klinik für Psychiatrie und in die mystischen Tiefen des Darknets. Sie kommt einem Psychopathen auf die Spur, der ein unglaubliches Spiel treibt. Als sie merkt, dass sie längst selbst Teil eines menschenverachtenden Experiments ist, muss sie eine herzzerreißende Entscheidung treffen. Denn Justin, das jüngste Teammitglied, könnte sein nächstes Opfer sein.
Die Bücher von Patricia Weiss
Monströse Moral ist der fünfte Roman, in dem Laura Peters mit ihrem Team ermittelt.
Alle weiteren Bände der Laura-Peters-Serie wie Das Lager, Böse Obhut, Zweiundsiebzig, Moloch Unsterblich und Verlassene Seelen und die Halloween-Novellen Cäcilie und Escape If You Can sind als Taschenbuch und als E-Book im Internet erhältlich, zum Beispiel auf der Autorenseite
https://www.patriciaweiss.de
Kontakt
Patricia Weiss freut sich auf den Austausch mit ihren Lesern auf der Facebook-Seite Patricia Weiss – Autorin, auf X (Twitter) Tri_Weiss, auf Instagram tri_weiss und auf YouTube Patricia Weiss Autorin.
Impressum
Texte: © Copyright by Patricia Weiss
c/o
Relindis Second Hand
Gotenstr. 1
53175 Bonn
Covergestaltung und Foto: Patricia Weiss
Model: Julia Abel
Lektorat: Katharina Abel
Alle Rechte vorbehalten.
Veröffentlichung: Mai 2020
Monströse Moral ist als Taschenbuch und als E-Book erhältlich.
Für Miez.
Love life, stay weird.
Red Room
Ein Red Room ist ein Raum, in dem Menschen für Geld gequält werden.
Die Tortur wird live gestreamt und Zuschauer können sich über das Darknet und mithilfe einer aufwendigen Bitcoin-Zahlungsprozedur
zuschalten und zusehen.
Angeblich gehören Red Rooms zu den urbanen Mythen – und ich kann nur hoffen, dass das stimmt.
Neun Jahre zuvor
1 JVA Masdorf
Erst am Ende der Hoffnung, wenn es nichts mehr zu verlieren gibt, ist es die Verzweiflung, die die Kräfte des Bösen freisetzt.
Auf manche Orte kann man sich nicht vorbereiten. Egal wie groß die Befürchtungen oder wie niedrig die Erwartungen sind, alles kommt noch viel schlimmer. Manche Orte sind einfach die Hölle.
Das Gefängnis ist so ein Ort: Vordergründig geprägt von strenger Hierarchie und strikten Regeln, selbst für die privatesten Verrichtungen, öffnen sich hinter den verschlossenen Zellentüren die unheilvollen Weiten eines rechtsfreien Raums, in dem das System von Gut und Böse außer Kraft gesetzt und Sadismus zum obersten Prinzip wird.
Das Wochenende stand bevor, die Wärter waren gut gelaunt, tauschten ihre Pläne aus und rissen Witze über einen unerfahrenen Kollegen, der die Stellung halten musste. Es war fast sechs Uhr, alles wurde für den Schichtwechsel vorbereitet, Türen schlugen laut nachhallend zu und zunehmend kehrte Ruhe ein. Doch diese Ruhe war trügerisch.
Beklemmend.
Der Vorbote des Grauens, das auf ihn wartete.
Er trottete mit den anderen Gefangenen hinter dem keuchenden Wärter her, der süßlich nach Schweiß stank, und starrte auf die silberne Kette mit den Schlüsseln und Schließkarten, die an dessen Hose befestigt war. Den Gürtel konnte man nur erahnen, er war verborgen unter den Speckrollen, die sich weit über den Hosenbund wölbten. Mit jedem Schritt wuchs seine Verzweiflung. Er spürte Übelkeit aufsteigen, Panik. Wie ein gefangenes Tier rasten seine Gedanken und suchten nach einem Ausweg, aber sein Verstand gab ihm klar zu verstehen, dass es den nicht gab. Niemand würde ihm helfen, es gab keine Rettung.
Freitag Abend, achtzehn Uhr, bis Montag Morgen, sechs Uhr. Vor ihm lagen sechzig Stunden Martyrium. Und alles, was er tun konnte, war, darum zu kämpfen, am Leben zu bleiben.
Die Gruppe wurde kleiner, einer nach dem anderen bog in eine Zelle ab und wurde eingeschlossen. Er blieb als Letzter übrig. Der Wärter schlurfte zu einer geöffneten Tür, postierte sich daneben und suchte den richtigen Schlüssel: „Rein mit dir.“
Die Übelkeit stieg in ihm hoch und seine Füße wollten ihn nicht weiter tragen.
„Mach schon. Ich habe heute noch was anderes vor.“
Zögernd trat er in die Türöffnung. Sie hockten auf den Betten, die Arme auf die Beine in den Trainingshosen gestützt und warteten auf ihn.
„Nein!“ Der Schrei war in seinem Kopf so laut wie eine Explosion, doch über seine Lippen kam nur ein Flüstern.
„Vito hat darum gebeten, dass ihr das Wochenende gemeinsam verbringen könnt. Dann wünsche ich euch viel Spaß.“ Der Wärter stieß ihn in den Rücken und er stolperte in den Raum, konnte sich gerade noch an der Lehne eines Betts abfangen, um nicht hinzufallen. Die drei Zellenkameraden lachten dreckig. Hinter ihm fiel die Tür ins Schloss.
Das Spiel begann.
„Na, du Hurensohn? Freust du dich, uns zu sehen?“ Das Wiesel mit dem eklatanten Lispeln schickten sie jedes Mal vor. Er war der Schwächste des Trios und wurde von den anderen gemobbt, wenn es sonst kein Opfer gab. Doch wenn sie ihn mitmachen ließen, tat er sich mit besonderer Brutalität und Härte hervor, um sie zu beeindrucken.
„Guck, Schwuli, da ist der Eimer. Du machst dir bestimmt schon in die Hosen.“
Es begann immer mit Worten. Beleidigungen, Beschimpfungen. So pushten sie sich hoch, brachten sich in Stimmung. Versuchten ihn aus der Reserve zu locken, zu provozieren. Damit er einen Fehler machte, ausfallend wurde, womöglich als Erster zuschlug. Fast, als bräuchten sie einen Grund, eine Ausrede, um endlich loslegen zu können. Doch dem war nicht so. Es war lediglich ihr rituelles Vorspiel, das sie zelebrierten. Die Gewaltorgie würde auch beginnen, wenn er nicht reagierte.
Sich wehren half nicht, das hatte er bereits mehrfach versucht, es vergrößerte im Zweifel nur noch ihr Vergnügen und sein Leiden.
Dann blieb die Zeit stehen.
Sie arbeiteten sich an ihm ab. Traten ihn, bis sie müde wurden, und demütigten ihn auf jede nur erdenkliche Art. Aber so schlimm wie dieses Mal war es noch nie gewesen.
Seine Wahrnehmung bestand nur noch aus Schmerz. Schmerz und Angst. Unterbrochen von gelegentlichen Auszeiten, die ihm sein Bewusstsein gönnte, wenn es sich in eine Ohnmacht verabschiedete, weil der Körper an seine Grenze gelangt war. Doch sie holten ihn immer wieder zurück. Ein Guss kaltes Wasser und Schläge ins Gesicht reichten, um ihn aus gnädig schwarzer Nicht-Existenz zurück in die Hölle der Realität zu zwingen.
Seine Peiniger waren ausdauernd.
Die Freude am Quälen, das Adrenalin und die sexuelle Erregung bildeten einen Drogen-Cocktail, der wirksamer war als jedes Amphetamin.
Doch sechzig Stunden waren lang.
Selbst wenn sie unterbrochen wurden durch die Kontrollgänge des Wärters, der alle acht Stunden einen Rundgang machte und durch das kleine Fenster in der Zellentür guckte und sogar einmal eine Extrarunde einlegte, weil Zellennachbarn sich über den Lärm beschwert hatten, und er wissen wollte, ob ‚alles in Ordnung sei‘. Oder durch gelegentliche Essenspausen, bei denen immer einer bei ihm blieb, damit er nicht um Hilfe schreien oder fliehen konnte. Was absurd war, denn wenn es etwas an diesem Ort nicht gab, waren es Hilfe oder die Möglichkeit zu entkommen.
Doch gegen Sonntagnachmittag schien es ihm, als würden sie müde, als schlüge die Stimmung um.
Als wollten sie das Ganze beenden.
Und als würde ihnen plötzlich klar, was sie ihm angetan hatten.
Und dass selbst, wenn er sie nicht denunzierte, die Gefängnisleitung davon erfahren und sie anzeigen würde. Vorzeitige Entlassung oder Hafterleichterungen waren damit für die drei Monster in weite Ferne gerückt. Fast regte sich so etwas wie Schadenfreude in ihm. Wenn er dazu die Kraft gehabt hätte.
Doch dann entwickelte sich diese Idee.
Er konnte gar nicht sagen, wer zuerst darauf gekommen war, denn er dämmerte nur in seinem Schmerz dahin, erleichtert, für eine Weile Ruhe zu haben, aber plötzlich sprachen sie nur noch darüber, begeisterten sich mehr und mehr für den Plan, überboten sich an Vorschlägen für die Ausführung.
„Du wirst dich selbst umbringen, hast du verstanden?“ Vito, der Boss, sprach ihn zuerst an. Das tat er selten. Mit ihm sprechen. Meist ignorierte er ihn, während er ihn schlug, trat oder ihm sonst was antat. Sah ihn noch nicht einmal dabei an. Deshalb wirkten seine Worte umso Furcht einflößender.
„Er muss es selbst machen.“ Das Wiesel wippte aufgeregt auf seiner Matratze. „Hast du verstanden? Allein.“ Er lachte irre.
„Wir reißen einfach das Laken in Streifen und knoten es aneinander. Und dann hängt sich das Arschloch damit auf. Los, Body, dein Job.“ Vito gab dem dritten im Bunde, den sie Body nannten, weil er Muskeln wie ein Berg und ein Gehirn wie Erbsenpüree hatte, einen Wink. Der erhob sich, riss das Betttuch aus der Koje und versuchte, mit bloßen Händen einen Streifen abzutrennen. Doch das gestaltete sich schwieriger als erwartet.
Und erkaufte ihm Zeit. Letzte, kostbare Momente in seinem kurzen Leben, das ihm plötzlich wieder so wertvoll erschien. Die vergangenen zwei Tage hatte er nichts mehr herbeigesehnt als den Tod, sich gewünscht, dass alles endlich ein Ende finden würde – für immer. Doch jetzt, wo er auf der Matratze lag, so wie sie ihn dort hingeworfen hatten - ihm fehlte die Kraft, sich in eine bequemere Position zu drehen - und den dreien bei den Vorbereitungen zu seinem Suizid zusah, erwachte sein Lebenswille wieder. Er wollte nicht sterben. Nicht hier, nicht jetzt, nicht durch die Hand dieser Monster und erst recht nicht durch seine eigene.
Das Schicksal hatte sein Leben in einen Albtraum verwandelt, aber es musste auch wieder andere Tage geben.
Es konnte doch nicht alles so enden.
Laut ratschend gab das Betttuch nach und Body reichte dem Wiesel den ersten Streifen. Der Muskelprotz schien jetzt den Dreh herauszuhaben, die nächsten Stoffstücke dauerten nur noch wenige Augenblicke und schon bald hatten sie ein improvisiertes Seil hergestellt.
Das Wiesel beugte sich vor sein Gesicht und hielt es ihm hin.
Er schüttelte den Kopf, wollte sich wegdrehen, doch es war aussichtslos. Erst recht in seinem erbärmlichen Zustand. Sie grölten und johlten und feuerten ihn an.
Auch wenn er bald einverstanden war, sich zu töten, brachte er es nicht bis zu Ende. Jedes Mal, wenn er kurz davor stand, endlich zu tun, was sie von ihm wollten, regte sich sein Lebenswille und ließ sich nicht niederkämpfen. Immer wieder kroch er ins Leben zurück, nur um durch Tritte und Schläge zu einem weiteren Versuch gedrängt zu werden.
Die Prozedur zog sich ewig hin. Das Morgengrauen kündigte bereits den neuen Tag und damit die Wachablösung an.
Vito verlor die Geduld. Er gab Body einen Wink: „Mach du das.“
Der nickte, stand auf, sah einen Augenblick unbewegt auf ihn nieder, dann sprang er mit Anlauf und dem Hintern zuerst auf ihn runter.
Die letzten Gedanken bestanden aus der Erkenntnis, dass es geschafft war.
Schlugen um in Wut, Hass.
Und dem Aufblitzen von tödlichem Durst nach blutiger Rache.
Er würde wiederkehren.
Und sie alle finden.
Mit einem gewaltigen Krachen wurde es dunkel in seinem Kopf.
Endgültig.
Heute Sonntag
2 Ofenkaulen, Siebengebirge
Ein Tor in die Unterwelt.
Lillian Sawaris’ Herz klopfte bis zum Hals. Immer wieder studierte sie das Blatt mit der skizzierten Karte, um sicherzugehen, dass sie sich nicht verlaufen hatte. Eigentlich konnte es sich nur um einen Scherz handeln. Wer kritzelte schon solch kindische Wegbeschreibungen?
Aber Tina war verschwunden. Das war eine Tatsache.
Und derjenige, der ihr heute dieses Blatt unter die Matte vor die Wohnungstür gelegt hatte, wusste es.
Würde sie ihre Freundin wirklich am Ziel der Schnitzeljagd mitten im Wald finden? Sie war gestern aufgebrochen, um ihre Mutter zu besuchen, und seitdem nicht zurückgekehrt. Dabei hatten die beiden kein gutes Verhältnis, deshalb waren es meist Stippvisiten, geprägt von Zigarettenrauch, ranzigen Buttercremetortenstückchen und Vorwürfen. Oft dauerte es nur wenige Minuten, bis Tina von ihr als lesbische Schlampe beschimpft und aus der Wohnung gejagt wurde.
Die Homophobie der alten Frau wurde nur von ihrer Sammelwut übertroffen.
Das ganze Apartment war gesteckt voll mit Fröschen in jeglicher Ausführung: Keramik, Plüsch, Stein, Porzellan, Gummi, Plastik, Holz, Schokolade. Überall hockten diese Viecher und glotzten einen an. Und mittendrin thronte die Mutter auf dem Sofa, eine qualmende Kippe zwischen den nikotingelben Fingern, und starrte genauso. Eine fette Kröte in ihrem Tümpel. Lillian hatte die überfüllte Wohnung nur einmal betreten. Damals, als sie noch dachte, sie könnte Tinas Mutter mit Freundlichkeit einwickeln und dazu bringen, ihre Liebe zu der Tochter zu akzeptieren.
Sie lachte hart auf. Bevor dieser Moment eintrat, würde eher die Hölle zufrieren.
Die Wanderung hatte an einem Parkplatz im Siebengebirge begonnen. Von dort aus führte ein breit angelegter Weg zu einem beliebten Ausflugslokal. Doch schon an der ersten Biegung hatte sie den Weg verlassen und sich entsprechend den Anweisungen auf einem zugewachsenen Trampelpfad in die Botanik schlagen müssen. Noch waren die Büsche kahl, der Frühling war in weiter Ferne, und Blätter bedeckten braun und matschig den Boden. Mehrfach war sie auf dem abschüssigen Gelände weggerutscht und einmal hatte nur eine Wurzel, an die sie sich in letzter Sekunde klammern konnte, verhindert, dass sie in den Abgrund schlitterte.
War das Ganze ein makabrer Scherz? Steckte womöglich sogar Tina selbst dahinter? Lillian runzelte die Stirn. Das wäre das Letzte. Sie so in Sorge zu versetzen und dann mit einer Kinderpiratenkarte durch dieses Gestrüpp ins Nirwana zu schicken.
Sie folgte einer Biegung und vor ihr tauchte ein mächtiger Baumstamm auf, der quer über dem Weg lag. Ein Kreuz aus rosa Kreide bestätigte, dass sie den nächsten Punkt auf der Karte erreicht hatte. Der Stamm war so dick, dass ein Darübersteigen, ohne das Holz zu berühren, unmöglich war. Sie würde sich die Jeans an der feucht-moosigen Rinde versauen. Ihre Laune sank in den Keller. Wenn das hier ein Scherz war, dann würde jemand dafür bezahlen müssen.
Eigentlich konnte sie sich nicht vorstellen, dass Tina ihr das antun würde. Die Freundin war lustig, manchmal zu Unsinn und kindischen Streichen aufgelegt, aber nicht grausam. Oder sie hatte sich total in dem Menschen geirrt, der in den letzten sechs Monaten den wichtigsten Platz in ihrem Bett und in ihrem Herzen eingenommen hatte.
Der Weg führte jetzt über eine Schneise im Wald steil bergan und war von Brombeeren überwuchert. Immer wieder musste sie Ranken von der Hose lösen, die sich mit den Dornen durch den dicken Stoff tief in der Haut verhakt hatten. Erleichtert seufzte sie auf, als sie das Zwischenplateau erreichte, auf dem es mehr Bäume und weniger Dickicht gab und das Vorankommen leichter wurde. Sie beschleunigte die Schritte, schob Tannenwedel zur Seite und bückte sich unter Ästen durch. Dann lichtete sich der Wald und sie gelangte zum letzten Meilenstein.
Mit klopfendem Herzen näherte sie sich.
Der Untergrund wurde steiniger, sie musste aufpassen, dass sie nicht umknickte. Vor einer Felsspalte blieb sie stehen. Unschlüssig.
Die Finsternis starrte sie an.
Ein Tor in die Unterwelt.
Was nun? Wurde von ihr erwartet, dass sie in die Höhle kletterte und dort nach Tina suchte? Sie zog das Handy aus der Jacke, stellte die Lampe an und hielt sie ins Innere. Der Lichtstrahl war nicht sehr kräftig, hatte kaum Reichweite und ließ nur schemenhaft etwas erkennen. Lillian krallte die eine Hand in den Felsen, streckte die andere mit der Taschenlampe aus und beugte sich so weit wie möglich vor.
Der Gestank traf sie wie ein Keulenschlag.
Eine Mischung aus vergammeltem Fleisch, Moder und Fäkalien. Sie musste die Luft anhalten und sich zwingen, die Mission nicht sofort abzubrechen. Tapfer leuchtete sie in die Dunkelheit, doch außer, dass sich der Raum nach hinten in einen Gang zu verjüngen schien, konnte sie nichts erkennen und beendete das Unterfangen, bevor sie sich noch den Hals brach. Es musste anders gehen.
Sie schaltete das Blitzlicht der Kamera ein und schoss aufs Geratewohl Fotos in die Finsternis. Dann zog sie sich vom Eingang zurück, lehnte sich an einen Felsen, atmete erleichtert die frische Waldluft ein und sah die Bilder an. Auf der linken Seite des Gewölbes zeichneten sich die Überreste eines aus groben Ziegeln errichteten Kamins ab. Irgendwann früher schien diese Höhle von Menschen genutzt worden zu sein, doch das musste schon lange zurückliegen. Dahinter schimmerten Lichtpunkte wie kleine Glühwürmchen. Als sie das Foto vergrößerte, entdeckte sie ein gigantisches Spinnennetz, perfekt gewebt und intakt. Niemand, der größer war als eine Maus, hätte in den Gang, der von der Höhle in die Tiefen des Berges führte, vordringen können, ohne es zu zerstören. Doch wie lange brauchte eine Spinne, um so ein Netz zu weben? Einen Tag? Eine Stunde? Jedenfalls schien der Witzbold, der ihr die Schatzkarte vor die Tür gelegt hatte, nicht mehr hier zu sein. Blieb trotzdem die Spinne. Seufzend legte sie den Kopf in den Nacken und starrte durch die Baumkronen in den grauen Himmel. Die Vorstellung, in einen dunklen Gang voller Insekten, Fledermäuse und sonstigem Getier zu klettern, verursachte ihr Gänsehaut.
Lillian betrachtete das nächste Foto.
Vom Blitzlicht beleuchtete, helle Steine, die den Boden bedeckten. Und ein Gegenstand, an dem etwas Glänzendes befestigt war. Eine eisige Hand schien ihr in den Nacken zu greifen, schickte Kälteschauer durch den ganzen Körper. Ihre Finger zitterten so sehr, dass es ihr erst nach mehreren Versuchen gelang, das Bild zu zoomen. Doch eigentlich brauchte sie keine Bestätigung, sie wusste, was dort lag.
Es war eine roségoldschimmernde Tasche, an der ein Anhänger befestigt war: ein goldenes Herz mit den Buchstaben L und T.
Lillian und Tina.
Ihre Gedanken rasten.
War die Freundin dort drin? Sollte sie die Feuerwehr rufen? Aber was, wenn die sich mühsam mit einer ganzen Mannschaft durch das unebene Gelände im Wald kämpften, nur um eine billige Kunstledertasche aus einer Höhle zu retten? Womöglich musste sie den Einsatz bezahlen. Das konnte sie sich absolut nicht leisten.
Es half alles nichts, sie musste selbst nachsehen.
Lillian streifte die Kapuze über den Kopf, zog den Reißverschluss bis ganz nach oben und steckte die Hosenbeine in die urbanen Trekkingstiefel. Schuhe, die sie nur gekauft hatte, weil sie angesagt und stylish waren. Nicht, weil sie sich gerne in der Natur aufhielt. Dann kletterte sie über die Steine zurück zur Öffnung und aktivierte erneut die Taschenlampe des Handys.
Sie holte tief Luft, bückte sich und begab sich in die stinkende Finsternis.
Es dauerte einen Moment, bis sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, und auch dann konnte sie kaum mehr als das erkennen, was im Lichtkegel auftauchte. Rasch leuchtete sie einmal rundum, um sicherzugehen, dass keine Gefahr lauerte, vielleicht ein Tier, oder ein Obdachloser, oder womöglich der Kartenmaler selbst, dann bewegte sie sich auf allen vieren in Richtung Tasche. Der Boden, eine Mischung aus Steinen, Erde und Blättern, war unangenehm weich und klebrig unter den Fingern. Eine Konsistenz, die im Zusammenhang mit dem Gestank ekelerregende Assoziationen hervorrief. Ein hauchzartes Knistern an der Kapuze signalisierte ihr, dass sie ein Spinnennetz gestreift hatte. Es brauchte eisernen Willen, die Vorstellung an eine dicke Spinne, die jetzt womöglich über ihren Kopf krabbelte, zu verdrängen und weiter vorwärts zu kriechen.
Endlich tauchte im spärlichen Lichtstrahl die Tasche auf.
Lillian wollte sie an sich nehmen, doch sie schien sich festgehakt zu haben. Sie zog kräftiger, riss und ruckte gewaltsam daran.
Plötzlich ertönte ein raschelndes Schleifen.
Als ob etwas Großes in Bewegung geriet. Das Blut rauschte in ihren Ohren, als sie die Taschenlampe darauf richtete. Ein derber Männerschuh. Wie ihn Bauarbeiter oder Wanderer trugen. Zitternd ließ sie das Licht weiterwandern.
Sie wollte schreien, doch es kam nur ein Krächzen.
Ein Mann. Die Beine auf dem Boden lang ausgestreckt, den Rücken an der Wand, der Oberkörper leicht zur Seite gefallen, gehalten von den Armen, die rechts und links oberhalb des Kopfes an den Fels gekettet waren. Das Gesicht ausgemergelt und bleich.
Die Augen nur noch zwei leere Höhlen.
Montag
3 Detektei Rüngsdorf
Er hat es nicht ‚durch die Blume‘ gesagt, sondern durch den Titanwurz.
Detektivin Laura Peters trat durch das verschnörkelte, angerostete Gartentor in den Vorgarten der leicht ramponierten Jugendstilvilla in fast bester Wohnlage, bückte sich und hakte die Leine aus. Der betagte Dackel hoppelte in seinem eigentümlich schaukelnden Gang den Kiesweg entlang und verschwand im Gebüsch, aus dem im selben Augenblick die schwarze Nachbarskatze fauchend die Flucht ergriff.
„Friedi! Bei Fuß.“ Aber natürlich hörte er nicht. Das tat er nie und sie erwartete es auch gar nicht mehr. Er hatte seinen eigenen Kopf und manchmal half noch nicht einmal ein Stückchen Fleischwurst, um ihn zu etwas zu überreden. Sie hatte ihn vor drei Wochen in einer Notfallaktion zu sich genommen, als ihre Nachbarin ins Krankenhaus gekommen war. Die alte Dame hatte den Herzinfarkt nicht überlebt und nun stellte sich die Frage, was aus dem Waisenhund werden sollte. Laura musste zu ihrer Überraschung feststellen, dass sie an dem kleinen Kerl hing und ihn nicht wieder hergeben wollte. Doch dem Wunsch stand der Erbe der alten Dame im Wege.
Fest umklammerte sie den Griff des Rucksacks, tauchte unter einer Dornenranke hindurch und steuerte auf die Eingangstür zu. Es waren jetzt schon fast zwei Jahre vergangen, seit sie den Entschluss, ein neues Leben anzufangen, in die Tat umgesetzt und die Detektei Peters gegründet hatte. Und es war die richtige Entscheidung gewesen. Seitdem hatte sich viel ereignet, sie hatten vier große Fälle gelöst, bundesweit für Schlagzeilen gesorgt und sich einen Namen gemacht. Das kleine Unternehmen war am Markt etabliert und wirtschaftlich rentabel.
Doch das war nicht nur ihr Verdienst, sondern eine Teamleistung, an der vor allem Marek, ihr erster Detektiv, seinen Anteil hatte. Es war ein Glücksfall gewesen, dass er sich damals beworben hatte, und seiner Erfahrung und Entschlossenheit hatte sie schon mehrfach ihr Leben verdankt. Was er in seinem Vorleben getrieben hatte, war immer noch ein Rätsel. Sie tippte auf einen osteuropäischen Geheimdienst oder eine Spezialeinheit der Streitkräfte und nannte ihn, wenn sie ihn aus der Reserve locken wollte, den polnischen James Bond. Doch seine einzige Reaktion war jedes Mal nur ein belustigtes Lächeln. Er gab nichts preis.
Laura öffnete die Haustür, hinderte sie mit dem Fuß am Zufallen und drehte sich um. „Friedi! Komm! Friedi!“ Es raschelte im Gebüsch, dann tauchte der Dackel auf und kam gemächlich auf sie zu. Die Botschaft, die er damit senden wollte, war klar. Er kam nur, weil er sowieso gerade ins Haus wollte.
Nicht, weil sie gerufen hatte.
Das Büro war wie ausgestorben, kein strahlendes Lächeln ihrer Assistentin Gilda, kein Duft von Kaffee, kein Hauch des würzigen Rasierwassers des zweiten Detektivs Drake Tomlin.
Laura stellte die Tasche auf den Schreibtisch im Vorraum, befreite Friedi von seinem Geschirr und hängte ihre Jacke an die Garderobe.
„Siehst du, Friedi? Keiner da. Heute frühstücken wir allein. Leider auch keine Schokocroissants, ich werde mich flüssig ernähren müssen.“ In der Küche befüllte sie die Kaffeemaschine, schaltete, während das verheißungsvoll duftende Gebräu in die Glaskanne lief, im Büro den Computer ein und hörte die Nachrichten ab.
Keine Nachricht von Gilda. Nur drei Interessenten, die möglicherweise einen Auftrag für sie hatten und um Rückruf baten. Einer davon ein Mann mit sympathischer Stimme und dem Hauch eines Akzents. Laura notierte die Nummern auf einem Zettel und holte sich in der Küche einen Becher Kaffee. Wieder am Schreibtisch lehnte sie sich in ihrem Stuhl zurück, legte die Füße auf die Tischplatte, zog die Ärmel des dicken Wollpullis über die Hände und starrte in das triste Grau des morgendlichen Gartens hinaus.
Assistentin Gilda hatte ihr am Freitagabend eine WhatsApp geschickt, dass sie Urlaub brauche und schon auf Reisen sei.
Laura irritierte es, dass sie nicht vorher Bescheid gesagt, sondern sie vor vollendete Tatsachen gestellt hatte. Natürlich hatte das Mädchen eine Auszeit verdient. Keine Frage. Es war erst sechs Wochen her, dass sie den letzten großen Fall gelöst hatten. Gilda und eine andere junge Frau waren dabei in letzter Sekunde aus den Fängen zweier Auftragskiller befreit worden, deren Spezialität es war, ihre Opfer zuerst zu vergewaltigen, bevor sie sie umbrachten. Wie weit die Übergriffe während der Gefangenschaft gegangen waren, hatte die Assistentin nicht erzählt. Sie komme schon klar, das gehöre zum Job, war ihr lapidarer Kommentar gewesen. Und sie hatte glaubhaft gewirkt, schien unbeschwert und lustig zu sein wie immer. Aber vielleicht war das nur eine Täuschung gewesen, um sie nicht zu beunruhigen.
Laura nahm einen Schluck Kaffee, beschloss, das Thema Gilda auf später zu verschieben, und rief im Computer die Lokalnachrichten auf.
Folteropfer in Höhle im Siebengebirge gefunden
Mann wurde in Höhle an die Wand gekettet
Seit zwei Wochen vermisster Mann tot aufgefunden
Sie klickte auf den ersten Artikel und überflog ihn: Eine Spaziergängerin hatte am Vortag in einer Höhle, die zu den sogenannten Ofenkaulen im Siebengebirge gehörte, einen Leichnam gefunden. Ob es sich bei dem Toten um den seit mehr als zwei Wochen vermissten Roman L. handelte, konnte noch nicht bestätigt werden. Laut Polizeiangaben deutete die Auffindesituation auf ein Tötungsdelikt hin und die Ermittlungen waren aufgenommen worden. Der Mann war an die Felswand gekettet gewesen.
Laura starrte aus dem Fenster. Das wildromantische Siebengebirge war schon oft zum Schauplatz grausamer Taten geworden. Bei ihrem ersten Fall waren Mädchenleichen im Dornheckensee gefunden worden, jetzt hatte jemand einen Menschen in einer Höhle festgekettet und zu Tode gequält. Oder sonstwie getötet.
Es lief wieder ein Mörder frei herum.
„Ich rieche Kaffee. Lust auf Gesellschaft?“
Laura schreckte hoch. In der Tür stand Marek, trotz der Januarkälte wie immer in Lederjacke, T-Shirt, Jeans und Bikerboots.
„Klar. Hol dir einen Becher und setz dich zu mir.“
Kurz darauf schlenderte der Detektiv, den begeistert wedelnden Friedi dicht auf den Fersen, ins Büro zurück, ließ sich in einen Besuchersessel fallen und streckte die Beine von sich. Doch der Dackel war damit nicht zufrieden und hüpfte so lange vor ihm herum, bis er sich vorbeugte und ihn ausgiebig streichelte.
„Konntest du am Wochenende alles klären? Bleibt Friedi bei dir? Oder musst du ihn wieder abgeben?“
Laura verdrehte die Augen. „Ich habe den Neffen getroffen, der der Alleinerbe ist. Dennis, ein ziemlicher Widerling. Anscheinend war der Nachlass recht übersichtlich. Die alte Frau Pohl hat zwar in einer luxuriösen Wohnung gelebt, allerdings zur Miete. An Wertgegenständen war nichts vorhanden. Es gibt nur ein paar Möbel und Friedi. Der Kerl hat sich bei seiner Tante nie blicken lassen und jetzt regt er sich auf, dass kein Vermögen da ist. Wenn er sie öfter besucht hätte, hätte er das wissen können. Stattdessen hat er sich bei mir beschwert und mich sogar bezichtigt, ich hätte sie um ihr Geld erleichtert. Er war nicht davon abzubringen. Kannst du dir das vorstellen?“
Marek zuckte mit den Schultern und nahm einen Schluck Kaffee.
„Am liebsten hätte ich ihm gesagt, was ich von solchen Typen halte. Aber wir müssen ja eine Einigung für Friedi finden.“
„Und? Hat es geklappt?“
„Pfff.“ Laura starrte unglücklich in ihre Tasse. „Er möchte zweitausend Euro für den Hund haben.“
Marek lachte auf. „Verrückt.“
„Er erpresst mich. Will mir den Dackel wegnehmen, wenn ich nicht zahle. Und er hat durch die Blume gesagt, dass er Friedi einschläfern lassen wird, weil er schon so alt ist. Quatsch, er hat es nicht ‚durch die Blume‘ gesagt, sondern durch den Titanwurz. Er hat gemerkt, dass ich ein bisschen an Friedi hänge und hat jetzt die Dollarzeichen in den Augen.“ Sie sah Mareks fragenden Blick und fügte hinzu: „Titanwurz ist eine mannshohe Pflanze, die unglaublich schlecht riecht. Stinkblume wird sie genannt. Im Botanischen Garten in Bonn gibt es eine. Der lateinische Name gefällt dir sicher: Amorphophallus titanum. Übersetzt riesenhafter, unförmiger Penis.“
Der Detektiv lachte. „Riesenhaft ist okay. Unförmig? Na ja ... Du wirst ja wohl kaum auf die Forderung eingehen?“
„Nein. Diesem Arschloch einen solchen Batzen Geld in den Rachen zu werfen, widerstrebt mir zutiefst. Und ich kann es mir auch nicht so einfach aus den Rippen schneiden.“
„Und nun?“
Laura verschränkte die Arme. „Ich weiß es nicht. Er kommt am Wochenende, um die Wohnung auszuräumen. Dann soll ich ihm das Geld geben oder er nimmt Friedi mit.“
Marek sah sie forschend an. „Soll ich mich darum kümmern?“
Sie schüttelte den Kopf. „Danke, das ist lieb von dir. Aber ich werde mir selbst etwas einfallen lassen. Sollten alle Stricke reißen, komme ich gerne auf das Angebot zurück.“
Er zwinkerte ihr zu: „Gut!“ Dann beugte er sich zu dem Hund hinunter, der ihn mit in Falten gelegter Stirn unverwandt ansah, umfasste dessen Schnauze von unten und schüttelte sie sachte. „Mach dir keine Gedanken, alter Junge, von solchen Idioten lassen wir uns nicht beeindrucken.“
„Nein, das lassen wir nicht“, stimmte Laura zu. „Friedi hat sicherlich eine passende Antwort darauf, wenn der Kerl ihn mitnehmen möchte. Richtig, Friedi?“
Der Dackel würdigte sie keines Blickes, sondern schmachtete weiter Marek an. „Eigentlich müsstest du den Hund nehmen. Er hat eine klare Präferenz für dich.“
Der Detektiv lachte. „Das bildest du dir ein. Er ist nur freundlich. Wo sind übrigens die anderen? Hast du für heute freigegeben und ich habe es nicht mitbekommen?“
„Könnte man meinen, ist aber nicht so. Drake schreibt jetzt schon seit einem Monat wie verrückt an seinem Buch, wird aber vielleicht später reinschauen. Er möchte die Eindrücke aus unserem letzten Fall verarbeiten, solange sie noch frisch sind.“
Der zweite Detektiv, Drake Tomlin, war ein unter dem Pseudonym Connor D. Love international bekannter und erfolgreicher Autor von Liebesromanen, doch er hatte sich zunehmend in dem Genre gelangweilt und beschlossen, Thriller zu schreiben. In der Detektei Peters hatte er angeheuert, um das Geschäft kennenzulernen und Inspiration für seine Bücher zu kriegen. Dabei hatte er sich als studierter Historiker und Psychologe mit breitem Allgemeinwissen als Gewinn für das Team entpuppt. Jedenfalls in Lauras Augen.
Marek sah das anders. „Sag ihm, er soll zu Hause bleiben. Im Moment gibt es keinen Auftrag, bei dem er sich nützlich machen kann. Gab es eigentlich noch nie.“
Laura seufzte. „Hör auf mit der Stichelei. Drake hat mit seinen Ideen wesentlich dazu beigetragen, dass wir die beiden letzten großen Fälle lösen konnten.“
Marek kniff die Augen zusammen: „Beim letzten Mal hat er gar nichts beigetragen, sondern nur Verwirrung gestiftet. Ohne ihn wären wir schneller zum Ziel gekommen.“
„Das stimmt nicht und das weißt du. Jedenfalls kannst du nicht abstreiten, dass seine gewinnende, irische Art uns oft weitergeholfen und einige Türen geöffnet hat.“ Bei den letzten Worten hätte sie sich am liebsten auf die Zunge gebissen.
Doch zu spät: „Ich stimme dir zu mit einer kleinen Korrektur: Seine gewinnende Art hat IHM schon viele Türen geöffnet. Und zwar die Schlafzimmertüren der Damen in der Nachbarschaft.“
Wider Willen musste Laura kichern. „Er genießt das Leben. Nothing wrong with that. Jeder kann privat machen, was er möchte. Es geht uns nichts an.“
„Wenn es denn privat wäre. Aber der Kerl ist in etwa so diskret wie eine Elefantenherde, die durch einen Vorgarten trampelt.“
Laura zuckte die Achseln. Zwischen den beiden Männern kam es immer wieder zu Reibereien, doch wenn es darauf ankam, begruben sie das Kriegsbeil und standen für das Team ein.
„Und der Rest? Wo sind die?“
„Justin ist in der Schule. Die Karnevalsferien sind vorbei, sehr zu seinem Leidwesen. Aber er kommt heute Nachmittag, um in deinem Büro den Computer zu belagern.“
„Soll er ruhig. Schreibtischarbeit ist sowieso nichts für mich.“
„Ja, du bist der, der besser mit den Muskeln arbeitet. Sorry, das war ein Elfmeter ohne Torwart, den Ball musste ich einfach versenken.“
Marek nahm es ihr nicht übel. „Wenigstens einer, der es in diesem Laden mit den Schurken aufnehmen kann. Aber wo ist Gilda? Sie ist doch sonst immer die Erste im Büro?“
„Sie hat mir am Freitag gewhatsappt, dass sie Urlaub braucht, und ist weggefahren.“
Marek zog eine Augenbraue hoch.
„Mehr weiß ich nicht. Ich habe ihr alle möglichen Fragen gestellt, wohin, wie lange und so weiter, aber sie reagiert nicht.“ Laura reichte ihm das Smartphone und er überflog den Chatverlauf. Als er es ihr wortlos zurückreichte, wurde sie unsicher: „Was ist? Glaubst du, da stimmt etwas nicht?“
„Schwer zu sagen. Es erscheint mir ungewöhnlich, dass sie so von einem Tag auf den anderen verschwindet. Und auch, dass sie dir nicht antwortet. Es kann natürlich sein, dass sie keine Netzverbindung hat. Aber heutzutage muss man weit fahren, um solche Orte zu finden.“
Laura wollte etwas antworten, als es an der Tür klingelte.
„Erwartest du einen Kunden?“
„Eigentlich nicht.“
Marek stand auf und ging zur Glastür, die auf die Veranda führte. „Kümmer du dich um den Besuch, ich finde mal heraus, wo Gilda abgeblieben ist, okay? Und keine Sorge, sie wird schon keine Dummheiten machen.“
„Dummheiten? Was für Dummheiten?“ Laura sah ihm hinterher, wie er aus dem Büro in den Garten verschwand, und versuchte, das zunehmend mulmige Gefühl zu ignorieren.
4 Italienisches Restaurant Bad Honnef
In diesem Job ist das Team die Familie.
Marek drückte aufs Gas, der Sportwagen machte einen Satz und röhrte über die Autobahn. Auf der Südbrücke war wenig Verkehr und nach Bad Honnef war es ein Katzensprung. Vor allem, wenn man ein solches Auto fuhr. Er genoss es, schnell zu fahren, doch jetzt hielt er es auch für notwendig. Er hatte das Gefühl, dass Gefahr im Verzug war. Zwischendurch kontrollierte er immer wieder das Display seines Smartphones. Vor der Abfahrt hatte er eine Nachricht verschickt, um einem Verdacht nachzugehen, aber die Antwort ließ auf sich warten.
Als er den Ort erreichte, schaltete er runter und fuhr in gemäßigtem Tempo an den prachtvollen Villen vorbei. Bad Honnef war früher ein berühmter Luftkurort gewesen, in dem Ärzte und reiche Patienten residiert hatten. Die imposanten Bauten kündeten immer noch von dieser glanzvollen Ära, doch insgesamt hatte sich das Städtchen verändert, wirkte an manchen Stellen fast schäbig und zeigte deutlich, dass die prunkvollen Zeiten der Vergangenheit angehörten.
Er steuerte den Wagen auf den asphaltierten Kundenparkplatz eines Restaurants und stieg aus. Es war Lauras und sein Lieblingsitaliener. Nicht nur wegen der original sizilianischen Küche, sondern auch, weil es Gildas Eltern gehörte. Um die Uhrzeit war das Lokal noch geschlossen, aber durch das auf Kipp stehende Fenster hörte er, dass bereits die Vorbereitungen für den Abend getroffen wurden. Er klopfte und von drinnen näherten sich schwerfällige Schritte. Die Tür wurde geöffnet und Gildas Vater sah durch den Spalt.
„Marek. So eine Freude! Komm rein, mein Freund.“ Er strahlte über das ganze Gesicht und breitete die Arme aus.
„Danke. Ich hoffe, ich störe nicht. Sicher habt ihr viel zu tun?“
„Für einen Caffè hat man immer Zeit und für gute Freunde auch. Komm rein, komm rein.“
Marek folgte dem kleinen Italiener durch einen schmalen Flur in die Küche. Auf dem Herd dampften Töpfe und Pfannen vor sich hin und verbreiteten einen köstlichen Duft, an der Arbeitsplatte stand ein Koch mit Schürze, der in rasendem Tempo Kräuter hackte. Ohne seine Tätigkeit zu unterbrechen, sah er auf und nickte Marek freundlich zu.
„Das ist Santo“, stellte Gildas Vater ihn vor. „Seit er die Küche übernommen hat, könnten wir jeden Tag doppelt so viele Gäste bewirten, wenn wir den Platz hätten. Alle lieben seine Pasta alla Nonna.“
Der Koch tat, als hätte er das Lob nicht gehört, doch Marek schien es, als hackte er die Kräuter noch schneller als zuvor.
Gildas Vater füllte eine Metallkanne mit Kaffeepulver und Wasser und stellte sie auf den Gasherd. „Und? Wie geht es Laura? Und Drake? Und der hübschen Musikerin?“ Die dunklen Augen über den geröteten Wangen funkelten.
„Allen gut.“ Marek lehnte sich an einen Küchenschrank.
„Das ist schön. Und wie geht es der Familie?“ Der Restaurantchef nahm die Kanne vom Feuer, holte zwei kleine Tassen aus einer Vitrine und füllte sie mit dem schwarzen Gebräu. Er stellte Zucker und einen Caffè vor Marek auf die Arbeitsplatte der Kücheninsel und sah erwartungsvoll hoch.
Der Detektiv merkte, dass er auf eine Antwort wartete, und beschäftigte sich angelegentlich mit dem Süßen des Kaffees. „In meinem Job ist das jeweilige Team, mit dem man arbeitet, die Familie.“
„Ich verstehe. Aber das ist auf Dauer nicht gut. Ein Mann braucht ein Zuhause und eine Frau, die für ihn sorgt. Und Kinder, viele Kinder.“
„Wo ist Ihre Frau eigentlich?“, wechselte Marek das Thema.
„Sie macht Einkäufe auf dem Markt. Wir bereiten hier alles frisch zu. Nur beste Zutaten, frisch aus der Region.“
„Und Gilda ist verreist ...“, platzierte Marek das Stichwort und trank den Caffè in einem Zug.
„Ja, seit Freitag. Eigentlich brauchen wir sie im Restaurant. Seit Santo kocht, haben wir sehr viel zu tun.“ Er wiegte sich auf den Fußsohlen hin und her und warf einen zufriedenen Blick auf den Koch, der mittlerweile zum Teigkneten übergegangen war.
„Aber sie ist trotzdem gefahren ...“
„Ja, das Kind ist ja noch jung. Es ist schön, dass sie etwas von der Welt sehen kann. Wir konnten uns das früher nicht leisten. Ich freue mich für sie.“
„Von der Welt?“ Marek spürte Unheil heraufdämmern und täuschte sich nicht.
„Ja, Johannesburg.“
Klirrend stellte der Detektiv das Tässchen auf den Unterteller zurück. „Ist sie allein unterwegs?“
„Nein. Mit einer Freundin. Die Mädchen werden viel Spaß haben.“
„Das glaube ich auch.“ Marek bekam den Satz kaum über die Lippen. Und obwohl er die Antwort bereits kannte, stellte er die Frage trotzdem: „Wer ist diese Freundin?“
Ein Strahlen kam in die Augen des kleinen Italieners, breitete sich auf dem ganzen Gesicht aus. „Oh, ein nettes Mädchen. Sympathisch und freundlich. Und trägt Leder, von oben bis unten.“ Er machte eine Handbewegung, die sehr deutlich zeigte, welcher Körperteil ihn am meisten beeindruckt hatte. „Sieht fast aus wie eine Italienerin. Aber ist aus Polen.“
Mehr brauchte Marek nicht zu wissen, um seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt zu sehen.
5 Detektei Rüngsdorf
Es geht nicht um Inszenierung, Rituale und Sex, nur um Gewalt, Schmerzen und Qual.
Die Klingel ertönte. Dann wieder und ging schließlich in Sturmläuten über. Derjenige, der vor der Tür stand, hatte es eilig. Friedi missfiel das Geräusch und er bellte wie rasend dagegen an. Laura presste die Hände auf die Ohren, kämpfte sich durch das Bombardement aus Lärm zur Tür und riss sie auf: „Ja bitte?“
Vor ihr stand ein Mann, der sich hektisch an der Klingel zu schaffen machte. „Sie klemmt.“
Laura trat neben ihn und bemühte sich, zu helfen, doch der Krach machte sie so konfus, dass sie nichts ausrichten konnte.
„Lassen Sie mich noch mal.“ Der Besucher schob sie sanft zur Seite. In der Hand hielt er ein Taschenmesser, mit dem er den festgeklemmten Knopf zu lösen versuchte. Endlich trat wohltuende Stille ein.
„Tut mir leid. Sonst trete ich dezenter auf.“ Dunkle Augen und ein Grübchen im Kinn. Immer noch verwirrt von der Lärmattacke schüttelte Laura die Hand, die ihr entgegengestreckt wurde.
„Mein Name ist Silvio Petrescu. Ich habe Ihnen auf Band gesprochen.“
„Stimmt. Ich bin Laura Peters. Kommen Sie herein. Den Mantel können Sie an die Garderobe hängen.“ Sie trat vor ihm in die Wohnung und er folgte ihr, nachdem er sich seiner Jacke entledigt hatte, in das Büro. „Setzen Sie sich. Möchten Sie einen Kaffee oder ein Wasser?“
„Nein, danke. Oh, wen haben wir denn da?“
Der Dackel, der sich sicherheitshalber unter den Schreibtisch verzogen hatte, kam misstrauisch hervor, schnüffelte an den Sneakers des Besuchers und zog sich dann würdevoll zurück.
„Das ist Friedi. Ich hoffe, Sie haben keine Angst vor Hunden?“
„Nein, gar nicht.“
„Was kann ich für Sie tun?“ Laura musterte den Besucher. Dunkle Haare, die in die Stirn fielen, schwarzer oversized Hoodie mit einem Aufdruck, der ihr nichts sagte – entweder ein Mode-Label, der Name einer Metal Band oder der eines Gamerteams – und lange Beine in engen Jeans, die umgekrempelt waren und die Knöchel freigaben. Es wirkte lässig, doch die unter dem Ärmel hervorblitzende iced out Rolex verriet, dass es mehr als nur ein Look war, es war ein Style. Wenn die Uhr kein Fake aus der Türkei war, und so sah sie nicht aus, musste er eine Menge Geld besitzen.
Er setzte sich in einen Besuchersessel, lehnte sich vor, stützte die Arme auf die Oberschenkel und verschränkte die Hände. „Ich habe in der Presse über Ihren letzten Fall gelesen, den Missbrauch im Kinderheim in Bad Godesberg. Gut, dass Sie den Kerlen das Handwerk gelegt haben. Ihre Detektei ist sehr erfolgreich.“
„Ja, das hat Aufsehen erregt. Die Polizei ist immer noch dabei, weitere Opfer und vor allem Täter zu suchen und das gesamte Ausmaß der Vorfälle zu ermitteln. Es ist ein Moloch.“
„Es war sehr mutig von Ihnen, sich dem Thema zu stellen. Nicht viele wagen es, sich mit der katholischen Kirche anzulegen. Ich bewundere das.“
„Das ist ein bisschen übertrieben, ganz so war es nicht. Wir haben einer Gruppe von Kinderschändern das Handwerk gelegt, nicht der gesamten Institution. Wer allerdings die Nachrichten der letzten Jahre verfolgt hat, weiß, dass der Missbrauch von Kindern systemimmanent ist.“
„Trotzdem, ich habe allergrößten Respekt vor dem, was Sie geleistet haben.“
„Vielen Dank. Aber was können wir für Sie tun?“
Silvio Petrescu schien einen Augenblick zu überlegen, wie er anfangen sollte. „Es geht um eine Freundin, Rebecca Lehmann. Ich mache mir Sorgen um sie und frage mich, ob sie okay ist. Wir haben zusammen studiert. Jedenfalls bis kurz vor dem Bachelor. Sie war eine der wenigen weiblichen Studenten, IT ist eher eine Männerdomäne, deshalb ist sie mir gleich aufgefallen. Wir haben uns angefreundet. Sie war gut. Richtig gut. Aber es war schnell klar, dass irgendetwas mit ihr nicht stimmte.“
„Was meinen Sie?“ Laura sah, dass er die Hände fester umeinander krampfte, als fiele es ihm schwer, darüber zu sprechen.
„Ich weiß, dass wir ITler als Nerds verschrien sind und viele halten uns für sonderbar. Dass wir nächtelang Chips essend vor dem Computer sitzen, keine Sozialkontakte haben, ungepflegt sind. Aber das ist ein Klischee. Die meisten von uns gehen ins Gym, treffen sich mit Kumpels auf ein Bier und manche haben sogar eine Freundin, die nicht virtuell ist.“ Er grinste und wurde dann wieder ernst. „Mit Rebecca stimmte etwas im Kopf nicht. Sie konnte sehr merkwürdig sein und es gab Wochen, in denen sie irgendwelche Schübe hatte und sich nicht an der Uni blicken ließ. Kurz vor dem Abschluss, das war vor fünf Jahren, ist sie ganz verschwunden. Von einem Tag auf den anderen. Ich habe erst später erfahren, dass sie in eine Anstalt gekommen ist.“
Laura nickte langsam, um zu signalisieren, dass sie zuhörte.
„Ich hätte sie gerne besucht, aber da ich damals nicht wusste, wo man sie hingebracht hatte, ging das nicht.“
„Ich verstehe. Möchten Sie, dass wir sie finden?“
„Nein, ich weiß mittlerweile, wo sie ist. Sie ist in Falkennest.“ Er zog ein zerknittertes Papier aus der hinteren Jeanstasche und warf es auf den Tisch. „Hier ist die Adresse.“
Die Detektivin nahm den Zettel und strich ihn glatt. „Wo liegt dann das Problem?“
Silvio Petrescu presste die Lippen aufeinander und starrte auf seine Hände. Dann sah er sie direkt an: „Wissen Sie, was Red Rooms sind?“
„Nein.“
„Wenn Sie es googeln, werden Sie lesen, dass Red Rooms zu den Urban Legends gehören. Man geht davon aus, dass es sie nicht gibt. Oder vielleicht hofft man es auch nur, denn der Mythos ist weit verbreitet und hält sich hartnäckig.“
Laura legte den Kopf schief und kniff die Augen zusammen. „Und worum genau handelt es sich bei dieser Legende?“
„Ein Red Room ist ein Folterraum, in dem eine Kamera installiert ist. Nutzer, also die Zuschauer, müssen angeblich ein aufwendiges Registrierverfahren durchlaufen, dann zahlen sie eine Gebühr in Bitcoins und erhalten zum gegebenen Zeitpunkt einen Link zugeschickt, der zu einer Adresse im Darknet führt.“ Er räusperte sich. „Man kann zusehen, wie eine Person gequält wird, laut den Legenden bis zum Tode. Die Nutzer können außerdem während der Prozedur gegen weitere Zahlungen Vorschläge machen, was dem Opfer angetan werden soll, und das wird dann umgesetzt.“
„Ist das so ein SM-Ding?“ Lauras Stimme wurde rau. Bei einem früheren Fall war sie in die Hände eines Sadisten gefallen und er hatte nicht nur auf ihrem Körper tiefe Narben hinterlassen. Es gab immer noch Nächte, in denen sie schreiend aufwachte.
„Nein. Es geht nicht um Inszenierung, Rituale und Sex. Nur um Gewalt, Schmerzen und Qual.“
„Nur ...“, echote Laura.
„Sorry. Das war blöd formuliert.“ Er fuhr sich verlegen durch die Haare.
Sie schüttelte den Kopf. „Nein, gar nicht. Ich verstehe schon. Aber zum Glück existieren diese Räume ja nicht.“ Sie lächelte schief. „Allerdings frage ich mich dann, was Sie zu mir führt.“
„Stimmt. Ich habe Hinweise darauf, dass es vielleicht doch einen Red Room gibt. Und möglicherweise sogar ganz in der Nähe. Jemand hat mir einen Link zugespielt und ich habe für sehr kurze Zeit einen Livestream gesehen, in dem eine Person gequält wurde. Allerdings kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob es echt war oder ein Fake.“
Er zog sein Handy aus der Tasche, tippte auf dem Display herum und hielt es Laura entgegen.
„Darf ich?“ Sie nahm das Smartphone, betrachtete das Bild und zoomte es dann größer. Ein rot beleuchteter Raum, in der Mitte schemenhaft eine Gestalt auf einem Stuhl. Seltsam verkrümmt, die Arme nach hinten gedreht. Dahinter eine weitere Person, maskiert, in den Händen ein Instrument mit zwei langen Hebeln, das an einen Bolzenschneider erinnerte. Der Raum schien ansonsten leer zu sein, außer einer Tür gab es nur kahle Wände. „Ist das ein Keller? Der Putz ist an einigen Stellen abgeblättert.“
„Ja, möglich.“
Laura betrachtete das Bild erneut. „Und was hat diese Folterszene mit Ihrer Freundin zu tun? Man sieht zwar fast nichts von dem Opfer, nur die Umrisse, aber es scheint mir ziemlich sicher ein Mann zu sein. Und er ist nicht gerade klein.“
„Ja, das Foto ist Mist. Ich war zuerst so geschockt, dass ich zu spät reagiert habe. Ich hätte besser ein Video machen sollen. Und Sie haben natürlich recht, das ist nicht Rebecca, sondern ein Mann, den ich nicht kenne. Aber zusammen mit dem Link bekam ich die Botschaft, dass Rebecca die Nächste sein wird.“
„Was?“ Laura starrte ihn an.
„Ja. Es war ein Zettel, den mir jemand Samstag am frühen Abend vor die Tür gelegt hat. Unter die Matte. Darauf stand der Link. Und das mit Rebecca. Reiner Zufall, dass ich zu Hause war und ihn gefunden habe. Zwei Stunden später, und ich wäre weg gewesen, denn samstags treffe ich mich immer mit ein paar Kumpels auf ein Bier. An dem Abend allerdings nicht mehr. Diese Red-Room-Scheiße hat mich ziemlich aus dem Konzept gebracht.“
„Hm.“ Laura tippte sich mit dem Zeigefinger an die Oberlippe. „Oder derjenige kennt Ihre Gewohnheiten und wusste, dass Sie noch da sein würden.“
„Sie meinen, er beobachtet mich?“, fragte er alarmiert.
„Nicht auszuschließen. Sogar wahrscheinlich. Ist Ihnen in letzter Zeit jemand gefolgt?“
„Nein.“ Silvio Petrescu schüttelte heftig den Kopf.
„Okay. Denken Sie noch mal darüber nach. Und behalten Sie Ihre Umgebung im Auge. Vielleicht fällt Ihnen ja doch etwas auf. Haben Sie die Nachricht dabei?“
„Ich weiß, das ist jetzt blöd, aber nein, habe ich nicht.“ Er nahm eine andere Sitzposition ein und stützte die Arme auf die Lehnen. „Ich habe keine Ahnung, wo das Papier ist. Vielleicht habe ich es verlegt. Oder verloren. Obwohl mir so etwas nie passiert.“
Laura runzelte die Stirn.
„Wirklich. Ich habe schon alles abgesucht. Er ist wie vom Erdboden verschwunden.“
„Okay ... Sind Sie zur Polizei gegangen?“
Er schüttelte den Kopf. „Ich habe es natürlich überlegt, mich dann aber dagegen entschieden. Vielleicht ist es ja nicht echt, sondern eine grausige Inszenierung, mit der mich jemand verarschen will. Und ich habe ja nur diesen Screenshot. Der beweist nichts. Aber ich weiß, was ich gesehen habe, es war real. Deshalb bin ich zu Ihnen gekommen. Ich brauche Ihre Hilfe.“
Laura nickte langsam. „Sie haben sicherlich versucht, mit Rebecca Kontakt aufzunehmen?“
„Natürlich. Ich habe sofort in der Anstalt angerufen und sie sagten, es gehe ihr gut. Also den Umständen entsprechend, wie es einem eben so geht, wenn man in der Geschlossenen sitzt. Aber ich habe nicht persönlich mit ihr sprechen dürfen und man will mich auch nicht zu ihr lassen. Angeblich wünscht sie keinen Besuch. Immerhin habe ich erfahren, dass es eine Tante gibt und dass sie eine Betreuerin hat.“
„Eine Betreuerin? Wurde sie entmündigt? Was ist mit ihren Eltern?“
„Die sind schon vor vielen Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen, deshalb regelt diese Frau die medizinischen Dinge für Rebecca. Also Krankenkassenthemen und Anträge für Therapien, aber auch alle anderen administrativen Sachen, die so anfallen. Sie heißt Theresa Müller, nennt sich Tes.“
„Die Betreuerin ist Rebeccas Vormund?“
„Nein, die Vormundschaft liegt bei der Tante, die in Frankfurt wohnt und sich oft im Ausland aufhält. Wahrscheinlich wurde deshalb die Betreuerin eingeschaltet, um die Dinge vor Ort zu regeln.“
„Ich verstehe“, murmelte Laura, dann kniff sie die Augen zusammen. „Sie haben viel herausgefunden. Solche Anstalten sind meist nicht so auskunftsfreudig.“
Er zuckte mit den Schultern und sah aus dem Fenster. „Da haben Sie recht. Und ich verrate jetzt nicht, wie ich an die Informationen gekommen bin. Aber Sie sind ja Detektivin und wissen, was ich studiert habe.“
„Alles klar. Dann haben Sie sicher versucht, die Person zu identifizieren, die hinter dem Red-Room-Link steckt?“
„Logisch.“ Er verzog den Mund zu einem kläglichen Grinsen. „Aber das Darknet hat seinen Namen nicht umsonst. Ich konnte bisher nicht mehr herausfinden. Natürlich werde ich es weiter probieren.“
„Das wird nicht einfach.“
„Helfen Sie mir? Ich habe Angst, dass Rebecca die Nächste ist, die in diesem Red Room gequält wird.“
Laura runzelte die Stirn. „Zuerst brauche ich weitere Informationen von Ihnen, denn ich verstehe die Geschichte noch nicht ganz. Sie bekommen einen Zettel mit einem Link und dem Hinweis, Rebecca sei die Nächste. Ist das wirklich alles? Oder stand da noch mehr?“
„Das war alles.“
„Keine Anweisung, was Sie tun können, um Rebecca zu retten? Keine Lösegeldforderung oder etwas in der Art?“
Er schien einen Moment zu zögern, dann schüttelte er entschlossen den Kopf: „Nein, nichts dergleichen.“
„Das ist merkwürdig.“ Laura musterte ihn. „Welche Motivation steckt dahinter, Ihnen das anzutun? Und natürlich Rebecca. Vielleicht möchte sich jemand rächen? An Ihnen beiden. Sie wurden sicher nicht zufällig ausgewählt. Sie sollten überlegen, wem Sie irgendwann mal etwas angetan haben.“
„Der Gedanke kam mir auch schon. Aber bisher habe ich nicht die geringste Idee, wer oder was das sein könnte.“
„Keine Feinde? Keine Neider? Eifersüchtige Ehemänner?“
Ein amüsierter Ausdruck huschte über sein Gesicht, dann zuckte er die Schultern. „Ich habe ein erfolgreiches Unternehmen. Der Wettbewerb ist hart und gelegentlich bleibt ein Konkurrent auf der Strecke. Das ist nicht lustig und natürlich hängen persönliche Schicksale oder sogar Existenzen daran. Und vielleicht wollte sich auch mal jemand an mir rächen. Aber doch nicht auf diese Art. Das wäre absurd. Völlig durchgeknallt. Ich wüsste keinen, dem ich das zutrauen würde. Und glauben Sie mir, ich bin kein Traumtänzer, ich habe mein geschäftliches Umfeld und auch meine eigenen Mitarbeiter genau im Auge. Bitte, übernehmen Sie den Fall? Helfen Sie mir?“
Laura sah ihn eine Weile prüfend an, dann lächelte sie: „Okay. Ja. In Ordnung.“
„Ein Glück!“ Die Erleichterung war ihm anzusehen. „Ach ja, Sie brauchen sicher den Namen von Rebeccas Tante. Sie hat einen Spanier oder Südamerikaner geheiratet und heißt Martina Schneider de Molina. Hier, ich habe Ihnen die Kontaktdaten aufgeschrieben.“
Laura nahm den Zettel entgegen. „Okay. Dann werde ich als Erstes herausfinden, dass Rebecca wohlauf ist und nicht von einem Sadisten in einem Red Room gefangen gehalten wird, richtig?“
„Genau. Meine Möglichkeiten sind auf das Virtuelle begrenzt, aber in die Datenbanken und Dateien kann die Anstalt viel eintragen, wenn der Tag lang ist. Wie soll ich wissen, ob es wahr ist? Für die reale Welt brauche ich einen Profi. Bitte stellen Sie fest, dass es Rebecca wirklich gut geht. Ich werde derweil versuchen, eine Spur zu dem Red Room zu finden.“
Laura nickte, wollte den Termin beenden, doch dann zögerte sie. „Eine Frage habe ich noch: Ist dem Opfer in dem Stream etwas angetan worden? Also nicht nur, dass er gefesselt war, sondern ... Sie wissen schon.“
Silvio Petrescu wurde blass. Räusperte sich. „Ich bin nicht ganz sicher, die Übertragung wurde plötzlich abgebrochen. Vielleicht war das gar nicht so, wie ich dachte, und ich habe mich getäuscht ...“
„Was ist passiert?“
Er schüttelte den Kopf, schien nicht antworten zu wollen.
„Bitte, das ist wichtig. Was haben Sie gesehen?“