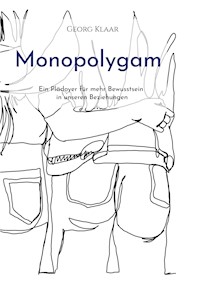
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In liberalen Gesellschaften halten Beziehungen zwischen Paaren immer seltener ein Leben lang. Dafür wird häufig die traditionell geführte, monogame Beziehungsform mitverantwortlich gezeichnet, weil sie dauerhaft nicht alle Bedürfnisse erfüllen könne. Nicht-monogame Beziehungsformen scheinen einen Ausweg aufzuzeigen, um zumindest einigen Gründen für Trennungen entgegenzutreten. Dieses Buch wägt die Vor- und Nachteile der bekanntesten Beziehungsformen ab und beleuchtet insbesondere die Wesenszüge der monogamen, offenen und polyamoren Beziehung. Dafür trägt es die Erfahrungen von Therapeuten und Coaches zusammen, die sie mit Paaren gesammelt haben, die sich in den unterschiedlichen Beziehungsformen befinden bzw. befanden. Darüber hinaus fließen die Inhalte von Büchern, Aufsätzen, Vorträgen, Interviews sowie wissenschaftliche Erkenntnisse über unsere zumeist unbewusste Partnerwahl mit ein. Im Ergebnis arbeitet dieses Buch Tendenzen heraus, welche Bedürfnisse von welcher Beziehungsform am günstigsten erfüllt werden können. Es wirft einen genaueren Blick auf die psychologischen Muster und die gesellschaftlichen, kulturellen und evolutionären Prägungen, welche die Wahl des Partners und der Beziehungsform unbewusst beeinflussen können. In diesem Buch wird unserer Sexualität besondere Aufmerksamkeit gewidmet, weil viele Paare insbesondere dann in Krisen geraten, wenn sie mit ihr unzufrieden sind. Das Bedürfnis Sex zu erleben, gehört für den weit überwiegenden Teil eines (jüngeren) Paares bzw. eines Partners zu einem der wichtigsten Inhalte ihrer Beziehung, weshalb dieses Buch die zumeist unbewussten Gründe für unser sexuelles Verhalten - das auch zu Untreue führen kann - stärker beleuchtet. Auszug einiger im Buch berücksichtigten Buchautoren: Anna Zimt, Andrea und Veit Lindau, Christian Hemschemeier, David M. Buss, David Schnarch, Erich Fromm, Esther Perel, Gary Chapman, Holger Lendt, Jiddu Krishnamurti, John Gottman, Jordan B. Peterson, Lisa Fischbach, Marshall B. Rosenberg, Oliver Schott, Raphael Bonelli, Ricardo Coler, Richard David Precht, Robert Betz, Stefanie Stahl, Thich Nhat Hanh, Ulrich Clement, Vanessa Görtz-Meiners. Und viele weitere Autoren aus Web-Artikeln und Youtube-Videos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
In liberalen Gesellschaften halten Beziehungen zwischen Paaren immer seltener ein Leben lang. Dafür wird häufig die traditionell geführte, monogame Beziehungsform mitverantwortlich gezeichnet, weil sie dauerhaft nicht alle Bedürfnisse erfüllen könne. Nicht-monogame Beziehungsformen scheinen einen Ausweg aufzuzeigen, um zumindest einigen Gründen für Trennungen entgegenzutreten.
Dieses Buch wägt die Vor- und Nachteile der bekanntesten Beziehungsformen ab und beleuchtet insbesondere die Wesenszüge der monogamen, offenen und polyamoren Beziehung. Dafür trägt es die Erfahrungen von Therapeuten und Coaches zusammen, die sie mit Paaren gesammelt haben, die sich in den unterschiedlichen Beziehungsformen befinden bzw. befanden. Darüber hinaus fließen die Inhalte von Büchern, Aufsätzen, Vorträgen, Interviews sowie wissenschaftliche Erkenntnisse über unsere zumeist unbewusste Partnerwahl mit ein. Im Ergebnis arbeitet dieses Buch Tendenzen heraus, welche Bedürfnisse von welcher Beziehungsform am günstigsten erfüllt werden können. Es wirft einen genaueren Blick auf die psychologischen Muster und die gesellschaftlichen, kulturellen und evolutionären Prägungen, welche die Wahl des Partners und der Beziehungsform unbewusst beeinflussen können.
In diesem Buch wird unserer Sexualität besondere Aufmerksamkeit gewidmet, weil viele Paare insbesondere dann in Krisen geraten, wenn sie mit ihr unzufrieden sind. Das Bedürfnis Sex zu erleben, gehört für den weit überwiegenden Teil eines (jüngeren) Paares bzw. eines Partners zu einem der wichtigsten Inhalte ihrer Beziehung, weshalb dieses Buch die zumeist unbewussten Gründe für unser sexuelles Verhalten - das auch zu Untreue führen kann - stärker beleuchtet.
Über den Autor
Der Autor heißt im wahren Leben anders. Er studierte Anfang der 1990er Jahre Bauingenieurwesen und kam über seinen Freundeskreis mit dem Thema der Beziehungsformen in Berührung. Monogame Beziehungen zu führen empfand er selbst schon als sehr anspruchsvoll und so wurde sein Interesse geweckt, wie denn polygam lebende Paare mit den Herausforderungen ihrer Beziehungen umgingen. Daraufhin begann er genauer zu recherchieren und stellte fest, dass es nur wenige Bücher und Artikel gibt, die sich sehr detailliert mit den Vor- und Nachteilen der Beziehungsformen befassen. Als Ingenieur entschied er, sich dieses Themas aus wissenschaftlicher Sicht zu nähern - um dann festzustellen, dass es ohne eine transzendentale Betrachtung nicht vollständig beleuchtet wäre. Ihm persönlich hat sein Buch, in das er in unregelmäßigen Abständen über 2 Jahre Recherche- und Schreibarbeit steckte, mehr Klarheit in das komplexe Thema der Beziehungsformen gebracht. Sein Buch hat ihm außerdem geholfen, sich eine fundierte Meinung über die Beziehungsformen zu bilden. Es wünscht sich, anderen Lesern eine Orientierungshilfe sein zu können, damit sie für sich die Beziehungsform herauszufinden, in der sie - aus vollem Herzen - leben wollen.
Inhalt
Vorwort
Teil I Einleitende Betrachtungen
Das Dilemma
Beziehungsformen im kurzen Überblick
Prägungen
Kommunikation
Freiheit
Freude und Vergnügen
Patriarchat versus Matriarchat
Erfahrung und Entwicklung
Teil II Überlegungen zu den Beziehungsformen
Regeln und Gefühle
Sexuelle Fantasien und Spielarten
Stabilität
Treue und die Bedeutung von Sex
Aufteilung von Bedürfnissen
Sexuelle Intimität
Evolutionäres Erbe
Eifersucht
Red Pill
Liebe
Freilassen und Einlassen
Sich freilassen
Sich einlassen
FOMO und Overchoice
Verlangen und Konsum
Spirituelles Wachstum
Beziehungsformen im Vergleich
Monogamisch
Offenheit
Auswege aus dem Dilemma
Ich- und Wir- Erfahrungen
Symmetrie und Synthese
Teil III Das innere Universum erfahren
Gedanken und Gefühle wahrnehmen
Wut und Ängste
Individuelle Prägungen erkennen
Teil IV Persönliches Beziehungsprofil
Wesenszüge der Beziehungsformen
Polygame Beziehungen
Monogam geprägte Beziehungen
Integre Werte und Bedürfnisse erfahren
Sich die „richtigen“ Fragen stellen
Zusammenfassende Schlussbetrachtungen
Quellen
Vorwort
Unsere Gesellschaft ist in den letzten Jahrzehnten liberaler geworden. Mit dieser Entwicklung geht einher, dass wir unsere Lebensweise immer stärker hinterfragen. Das betrifft auch unsere Erwartungen und Wünsche, die wir von unseren Beziehungen erfüllt bekommen wollen.
Bis Mitte des letzten Jahrhunderts war selbstverständlich, dass Paare heiraten, eine monogame Beziehung eingehen, eine Familie gründen, der Mann die Familie versorgt und die Frau sich um die Kinder und den Haushalt kümmert. Diese Rollenverteilung zwischen den Partnern hat sich mit der Zeit immer mehr angeglichen bzw. aufgelöst, sodass sich auch die Regeln dieser traditionellen Beziehungsform verändert mussten. Die in unserer Gesellschaft verwurzelte monogame Beziehungsform wurde zunehmend hinterfragt und es entstanden alternative Beziehungsformen, die einen offeneren Umgang mit der Sexualität ermöglichten. Heute können wir zwischen unterschiedlichen Beziehungsformen wählen. Doch der Zugewinn an Wahlmöglichkeiten führt gleichzeitig zu einem Verlust an Orientierung.
Auf den sozialen Medien wird das Für und Wider der Beziehungsformen mittlerweile sehr ausgiebig diskutiert. Influencer und selbsternannte Experten geben Ihre Meinungen und Tipps zum Besten. Da die Meinungen teilweise weit auseinandergehen, schafft das kaum Orientierung, sondern stiftet im Gegenteil mehr Verwirrung als Klarheit. Am fundiertesten erscheinen die Erfahrungen von Therapeuten und Coaches zu sein, die sie mit den Paaren sammeln, welche in den unterschiedlichen Beziehungsformen leben.
Nach den Erfahrungen von Ulrich Clement haben sich die Inhalte in der Sexualtherapie in den letzten 30 Jahren verschoben. Während früher die Frage im Vordergrund stand, warum es in der Beziehung kriselt, gehe es heute immer öfter um die Frage, welche Art von Beziehung überhaupt gewollt wird. Die Menschen würden sich heute sexuell nicht mehr eingeschränkt fühlen, sondern seien angesichts der fast grenzenlosen Möglichkeiten vielmehr überfordert zu entscheiden, welche Art von Sexualität sie tatsächlich leben wollen („individuelles sexuelles Profil“).
Es wird zunehmend hinterfragt, ob die in unserer westlichen Gesellschaft verwurzelte monogame Paarbeziehung alle unsere Bedürfnisse erfüllen kann. Dass ein Paar ein Leben lang zusammenbleibt, wird immer unwahrscheinlicher. Vor der Entscheidung, mit einem bestimmten Partner eine lebenslange Beziehung einzugehen, bestanden in den weit überwiegenden Fällen sexuelle Kontakte mit anderen Partnern (serielle Monogamie). Und selbst der anfangs bestehende Wille, mit einem Partner gemeinsam durchs Leben zu gehen, hält in den überwiegenden Fällen nicht an. Rund die Hälfte der Ehen werden wieder geschieden und es werden ebenso häufig heimlich oder offen Affären mit einem anderen Partner eingegangen.
Die zunehmende Befreiung von äußeren Einflüssen, Erwartungen und Zwängen erlaubt jedem von uns, die Gefühle und Bedürfnisse nicht mehr verbergen zu müssen. Für Menschen mit besonderen sexuellen Veranlagungen und Wünschen ist diese Befreiung ein Segen, weil es beispielsweise bisexuellen Männern und Frauen tendenziell schwerfallen wird, in monogamen Beziehungen ihre Erfüllung zu finden.
Es soll vorweggenommen werden, dass es im Ergebnis dieses Buches keine „richtige“ oder „falsche“ Beziehungsform gibt, sondern dass wir genau die Beziehungsform führen, die gerade zu uns passt. Es werden Tendenzen herausgearbeitet, welche Beziehungsform welche Bedürfnisse am besten befriedigen kann, welche Vor- und Nachteile es gibt und welche unbewussten Muster - insbesondere die unserer persönlichen und evolutionären Prägungen - uns bei der Wahl beeinflussen können. Dieses Buch verfolgt das Ziel, die Wesenszüge der Beziehungsformen genauer zu beleuchten und unsere Beweggründe deutlicher vor Augen führen, die uns für oder gegen eine Beziehungsform entscheiden lassen. Dann können wir eine Beziehung, die nur möglicherweise zu uns nur passt, in eine überführen, die uns wirklich erfüllt.
In diesem Buch wird unserer Sexualität besondere Aufmerksamkeit gewidmet, weil viele Paare insbesondere dann in Krisen geraten, wenn sie mit ihr unzufrieden sind.1 Viele Partner einer monogamen Beziehung gehen gerade dann eine heimliche Affäre ein, um das Bedürfnis nach Sex im Außen zu befriedigen. Oder ein Partner stellt nach einer ehrlichen Innenschau fest, dass er lieber eine polygame Beziehungsform eingehen möchte. Das Bedürfnis nach Sex gehört für den weit überwiegenden Teil eines (jüngeren) Paares bzw. eines Partners zu einem der wichtigsten Merkmale ihrer Beziehung, weshalb dieses Buch unser sexuelles Verhalten und den darin liegenden, zumeist unbewussten Anteil stärker beleuchtet.
Vordergründig werden in diesem Buch die Dynamiken heterosexueller Paarbeziehungen betrachtet. Es möchte aber auch gleichgeschlechtliche und diverse Paare ansprechen, denn auch bei diesen Paaren nimmt in den überwiegenden Fällen der eine Partner mehr den weiblichen und der andere Partner mehr männlichen Part in deren Beziehung ein. Dadurch treffen die Betrachtungen überwiegend auch für diese Paare zu.
Dieses Buch verzichtet zugunsten eines besseren Leseflusses auf eine Genderung, wovon insbesondere der Begriff „Partner“ betroffen ist. Nicht gegenderte Substantive umfassen sowohl das weibliche, das männliche als auch das diverse Geschlecht („Partner“ umfasst „der Partner“ bzw. „die Partnerin“). Die Bezeichnungen Mono- und Polygamie werden nicht im Sinne einer Ein- und Vielehe verwendet, sondern im Sinne des Auslebens von Sexualität innerhalb und außerhalb einer Paarbeziehung. Darüber hinaus wird die Bezeichnung Polygamie frei von Beziehungskonzepten wie der Polygynie (Vielweiberei - ein Mann mehrere Ehefrauen) oder der Polyandrie (Vielmännerei - eine Frau mehrere Ehemänner) verwendet, sie beschreibt - unabhängig von Konstellationen - das zeitgleiche bzw. parallele Führen und Pflegen von mehr als einer Beziehung. Des Weiteren wird der Begriff „Affäre“ im Zusammenhang mit einer Nebenbeziehung verwendet, die ein Partner mit oder ohne Wissen des anderen Partners zu einem weiteren Partner unterhält. In diesem Sinne gehen Singles (weil sie ohne Partner leben) keine Affäre, sondern ein Verhältnis oder eine Liaison ein, wenn sie unverbindliche, sexuelle Kontakte mit anderen unterhalten.
Dieses Buch berücksichtigt die Aussagen vieler Autoren, die sich mit Beziehungen überwiegend aus beruflichen Gründen beschäftigen und diese in YouTube-Videos, Webartikeln und Büchern veröffentlicht haben. Bei den YouTube-Videos und den Webartikeln wurde darauf geachtet, dass sie die Erfahrungen von langjährig tätigen Coaches und Therapeuten sowie spirituellen Lehrern wiedergeben. Diese Erfahrungen werden in diesem Buch strukturiert und einsortiert. Es möchte in erster Linie informieren und strukturieren, weshalb es tendenziell sachliche Formulierungen benutzt, wie sie auch in wissenschaftlichen Arbeiten verwendet werden.
1 Dominik Borde meint in einem Video sogar, dass Sex für eine Paarbeziehung wichtiger als Liebe sei: „Leider geil gewinnt“. Aus „Warum Sex für Beziehungen wichtiger ist als Liebe (0:40)“ 28.11.2022, Dominik Borde, http://www.youtube.com/user/dominikborde
Teil I
Einleitende Betrachtungen
Das Dilemma
In seinem Buch „Dynamik des Begehrens“ schreibt Ulrich Clement: „Das ist das Dilemma: Wir wollen einerseits eine emotionale Heimat, ein Gefühl der Zugehörigkeit, Berechenbarkeit und Sicherheit, auf der anderen Seite wollen wir Freiheit, Autonomie und Neues, Lebendigkeit spüren und Grenzen überschreiten. Das legt nicht nur die kulturelle Erzählung von der großen Liebe nahe. Viel persönlicher suggeriert der Beginn einer jeden Liebesgeschichte, dass beides vereinbar sei. Deshalb tun wir so überrascht, wenn das passiert, was alles andere als neu ist und was sich auf einen Satz komprimieren lässt, der das erotische Paradox auf den Punkt bringt: Man kann nicht jemanden begehren, der schon da ist.“2
Zu einer ähnlichen Einsicht kommt Esther Perel. In ihrem Buch „Was Liebe braucht“, schreibt sie: „In meiner langjährigen Praxis als Therapeutin habe ich immer wieder die Beobachtung gemacht, dass viele Paare, die in ihrem Verhältnis auf Sicherheit bedacht sind, Liebe mit Verschmelzung verwechseln, was ein schlechtes Omen für Sex ist. […] Für Erotik ist Distanz unabdingbar. Oder anders formuliert: Erotik entfaltet sich im Freiraum zwischen der eigenen Person und der anderen. […] Erotik lebt vom Unvorhersehbaren.“3
In diesen Spannungsfeldern zwischen Bindung und Autonomie, Vertrautheit und Neugier, Sicherheit und Unvorhersehbarkeit finden unsere Beziehungen statt. Zu welchen Polen dieser Spannungsfelder wir uns tendenziell mehr hingezogen fühlen, entscheidet mit über die Beziehungsform, in der wir zu leben wünschen.
Wie wir unsere Sexualität und unsere Beziehungen leben und ausgestalten, sagt immens viel über unsere Persönlichkeit aus. Wir können viel über unsere verborgenen Ängste, Wünsche, Muster und Glaubenssätze erfahren. Deshalb ist es für unsere Entwicklung so wichtig, sich mit den Spannungsfeldern zu beschäftigen, in denen wir unsere Beziehungen und unser Leben verbringen - oder verbringen wollen.
2 Ulrich Clement - Dynamik des Begehrens, Carl Auer Verlag, Dritte Auflage 2021, Seite 97
3 Esther Perel - Was Liebe braucht, HarperCollins Verlag, 2. Auflage 2021, Seite 11
Beziehungsformen im kurzen Überblick
Unsere Beziehungsformen können im Wesentlichen in monogam und polygam geführte untergliedert werden. In monogamen Beziehungen soll der sexuelle Kontakt zwischen zwei Partnern exklusiv bleiben. Mit monogamen Beziehungen wird mittlerweile fast ausschließlich die serielle Monogamie in Verbindung gebracht, d.h. eine neue Beziehung wird erst eingegangen, wenn sich beide Partner in keiner anderen Beziehung befinden. In polygamen Beziehungen bestehen demgegenüber sexuelle Kontakte zu mehreren Partnern. Polygame Beziehungen werden im Wesentlichen in offene und polyamore Beziehungen unterteilt.
Bei offenen Beziehungen gibt es eine Erst- bzw. Hauptbeziehung, die Partner bezeichnen sich als Erstpartner bzw. Hauptpartner. Im weiteren Verlauf dieses Buches wird nur noch von Erstbeziehung und Erstpartner gesprochen. Beide Erstpartner erlauben sich gegenseitig sexuelle Kontakte zu weiteren Partnern, sodass sie Nebenbeziehungen eingehen dürfen. Über die Art der sexuellen Kontakte mit anderen Partnern außerhalb der Beziehung stellen die Erstpartner einvernehmlich Absprachen und Regeln auf, deren Einhaltung für beide Erstpartner als eine Art Treue- und Vertrauensbeweis angesehen wird. Bei einer offenen Beziehung soll der Kontakt mit anderen Partnern auf die sexuelle Begegnung beschränkt bleiben, die Liebe und die emotionale Exklusivität soll uneingeschränkt dem Erstpartner gelten.
Bei polyamoren Beziehungen bestehen gleichzeitig mehr oder weniger gleichwertige Liebesbeziehungen mit mehreren Partnern. Es wird nicht nur der zeitweilige sexuelle Kontakt gesucht, sondern mit jedem Partner eine verbindliche Beziehung geführt mit allem, was dazugehört. In diesem Sinne gehen die Partner keine Nebenbeziehungen ein, sondern führen gleichzeitig mehrere Erstbeziehungen, wobei keine Beziehung bevorzugt oder vernachlässigt wird.
Eine weitere Form des Zusammenseins wird Mingle genannt. Mingle steht für die englische Abkürzung „mixed and single“ und bedeutet, dass keine offizielle Beziehung besteht, sondern temporär und wiederholt mit jemandem unverbindliche sexuelle Kontakte eingegangen bzw. unterhalten werden. Offiziell bleibt der Single-Status eines Mingles bestehen. Diese Form des Zusammenseins kommt der Beziehungsform „Freundschaft Plus“ oder „Freundschaft mit gewissen Vorzügen“ nahe, mit dem Unterschied, dass zum Sexpartner keine „Freundschaft“ bestehen muss. Geprägt ist das Mingle-Dasein von Unverbindlichkeit, nicht zu viel Nähe und von einer Freiheit, die nicht aufgegeben werden möchte, gepaart mit Momenten der Zweisamkeit, die sich nicht stark von denen eines „normalen“ Paares unterscheiden. Mingles treffen sich, unterhalten sich, unternehmen gemeinsam etwas, gehen zusammen aus und haben Sex miteinander. Als Mingle können sich Partner exklusiv treffen, also eine Art temporär monogames Zusammensein führen, allerdings führen sie aufgrund der Unverbindlichkeit zueinander überwiegend eine Art polygame Form des Zusammenseins. Mingles verabreden sich oft parallel mit anderen Mingles, sodass sie überwiegend mehrere unverbindliche, temporäre sexuelle Kontakte gleichzeitig eingehen.
Mingles gehen den Herausforderungen, die eine verbindliche Beziehung an die Partner stellen, bewusst aus dem Weg. Sie wollen das sexuelle Vergnügen, ohne die Verpflichtungen einer Beziehung eingehen zu müssen. Für das Mingle-Dasein kann es verschiedene Gründe geben, beispielsweise möchten einige nach einer Trennung nicht gleich wieder eine neue verbindliche Beziehung eingehen oder sie möchten zuerst sexuelle Erfahrungen mit unterschiedlichen Partnern sammeln, um dann vielleicht eine Beziehung mit „dem richtigen Partner“ einzugehen. Für wieder andere bleibt das Mingle-Dasein dauerhaft die Erfüllung ihrer sexuellen Bedürfnisse.
Es kann darüber hinaus auch Mischformen innerhalb der Beziehungsformen geben. Eine klare Abgrenzung ist nicht immer möglich.
Prägungen
Zuerst sollten wir uns vor Augen führen, dass bevorzugte Beziehungsformen geprägt sind und schon im Kindesalter angelegt werden. In unserer westlichen Kultur werden überwiegend monogame Beziehungen eingegangen, polygame Beziehungen genießen gesellschaftlich nicht die gleiche Anerkennung, die Vielehe ist sogar verboten. In weiter östlichen Kulturkreisen sind polygame Beziehungen hingegen gesellschaftlich anerkannt und die Vielehe erlaubt.
Unser Verhalten wird maßgeblich durch das unserer Eltern geprägt. Als Kinder bekommen wir sehr genau mit, wie unsere Eltern nicht nur mit uns, sondern auch miteinander und mit anderen umgehen. Insbesondere die Art und Weise, wie unsere Eltern mit Konflikten und Krisen umgegangen sind, hinterlässt tiefe Spuren in uns.4 Je nachdem, ob wir mit dem Verhalten unserer Eltern gute oder schlechte Emotionen verbunden haben, werden wir dieses später als Erwachsene übernehmen, ausweichen oder ablehnen. Solange uns unsere Familiendynamiken nicht bewusst sind, wird es uns schwerfallen zu erfahren, welches Verhalten „zu uns gehört“, integer ist und uns wirklich guttut. Bis dahin wissen wir auch nicht sicher, inwieweit wir die Beziehung unserer Eltern als Blaupause für unsere eigenen verwenden.
Unsere eigene Prägung entscheidet maßgeblich darüber, welche Beziehungsform wir akzeptieren und für „normal“ halten. Eine Beziehungsform spiegelt die gesellschaftlichen Wertvorstellungen („Moral“) und unsere eigene Prägung. Sprechen wir mit unseren Freunden über die Beziehungsformen, um Hinweise für die zu uns passende Beziehungsform zu bekommen, steht am Ende häufig die Antwort: „Du musst wissen, was du willst!“ . Freunde können uns bei der Frage, was uns im Leben wichtig ist, begleiten - doch die Antwort müssen wir allein herausfinden.
Die Beantwortung der Frage, was wir wirklich wollen, ist herausfordernd. Oft versuchen wir Fragen alleine mit unserem Verstand „im Kopf“ zu beantworten, wir wägen das Für und Wider ab, vergleichen die Vorteile mit den Nachteilen. Die Abwägung ist aber nie ganz frei von Mustern und Prägungen, die wir insbesondere in unserer Kindheit erfahren haben. Unser Verstand übergeht gerne unser Gefühlsleben. Viele stellen ihren Verstand über ihr Gefühlsleben, der Verstand hat „das letzte Wort“.
In seinem Buch „Lob der offenen Beziehung“5 zeigt Oliver Schott auf, wie sehr die Gründe unserer gelebten monogamen Beziehungsform gesellschaftlich geprägt sind. Er führt an, dass die Regeln des monogamen Beziehungsmodells nicht immer alle unsere Bedürfnisse erfüllen können. Ein Liebesmonopol, wie es bei der monogamen Beziehungsform unterstellt wird, sei nur ein gesellschaftsmoralischer Konsens, denn wir können durchaus gleichzeitig mehrere Menschen lieben. Sein Buch betrachtet genau genommen nicht nur die offene, sondern auch die Grundzüge einer polyamoren Beziehungsform, weil er das Statusdenken in Beziehungen grundsätzlich ablehnt und damit auch eine formale Erstbeziehung. Der Vorsatz der „emotionalen Exklusivität (emotionale Treue)“, wie sie bei einer offenen Beziehung dem Erstpartner gegenüber als Status versprochen wird, hält er für eine Illusion.
Dass unser monogames Beziehungsmodell gesellschaftlich geprägt ist, wird ebenfalls im Buch „Treue ist auch keine Lösung“6 von Holger Lendt und Lisa Fischbach hervorgehoben. Ähnlich wie Oliver Schott zeigen die beiden Autoren die Schwächen der monogamen Beziehungsform auf und berichten von ihren Erfahrungen mit Paaren, bei denen monogame Beziehungen gerade am starren Festhalten an ihrer Regel der bedingungslosen sexuellen Treue zerbrechen würde. Die beiden Autoren rufen dazu auf, dass wir „mehr Liebe wagen“ und als selbstbestimmte Menschen einvernehmliche und liebevolle Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen sollten.
Neben unserer gesellschaftlichen und familiären Prägung führt Stefanie Stahl in ihrem Buch „Jeder ist beziehungsfähig“7 an, dass wir über ein genetisches Programm verfügen würden, welches langfristige Beziehungen von monogamem Charakter mit gelegentlichen Seitensprüngen vorsehe. Für das Gedeihen unserer Kinder sei eine monogame Bindung zwischen den Eltern wichtig, um Stabilität und Kontinuität in die Familie einzubringen. Die anfängliche Verliebtheit schaffe Bindung und Nähe zwischen dem Paar, die Häufigkeit von Sex nehme zu und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann der Vater des Kindes wird und seine Vaterschaft anerkenne. Dies sei wiederum für die Frau wichtig, damit der Mann sie beim Aufziehen des Kindes unterstütze. In der Elternrolle verändere sich im günstigsten Fall die Verliebtheit hin zur Liebe, die für die längerfristige Bindung von Mutter und Vater wichtig sei8. Unsere gesellschaftliche und familiäre Prägung wird offensichtlich noch um eine evolutionäre ergänzt, die über die Jahrtausende in unser genetisches Programm geschrieben wurde.
Wissenschaftler sind sich heute weitestgehend einig, dass wir nicht monogam im Sinne von „ein Partner ein ganzes Leben lang“ veranlagt sind, sondern bei jedem von uns der Umfang variiert, in welchem Maße wir mit wechselnden Partnern sexuelle Kontakte pflegen. Dieser Umfang reicht von der seriellen Monogamie (zeitgleich einen Partner) bis hin zur Polygamie (zeitgleich mehrere Partner), wobei es innerhalb der Polygamie ein großes Spektrum an Möglichkeiten gibt, wie diese Beziehungsform gelebt werden kann.
Es ist bekannt und Inhalt zahlloser Bücher, dass unsere Kindheitserfahrungen und unsere gesellschaftlich religiösen Wertvorstellungen uns prägen und unsere Beziehungsformen beeinflussen („das gehört sich nicht“). Weniger bekannt ist, dass auch unsere Ökonomie uns prägt und unsere Beziehungsformen ebenfalls beeinflussen kann („Konsum macht glücklich“). Zusätzlich scheint unsere evolutionäre Entwicklung die Finger im Spiel zu haben, warum wir Beziehungen eingehen. In diesem Buch wird auch auf die ökonomische und evolutionäre Prägung eingegangen und es wird angerissen, welche Rolle sie bei der Wahl unserer Beziehungsform unbewusst spielen kann.
4 Auch wie unsere Eltern mit vielleicht eingegangenen Affären - heimliche und verabredete - umgegangen sind, hat uns geprägt. Kinder nehmen sehr sensibel nicht nur die offensichtlichen, sondern auch die unausgesprochenen Spannungen zwischen ihren Eltern wahr.
5 Oliver Schott - Lob der offenen Beziehung; Bertz-Fischer Verlag, 9. Auflage 2020
6 Holger Lendt & Lisa Fischbach - Treue ist auch keine Lösung; Piper Verlag, 5. Auflage 2019
7 Stefanie Stahl - Jeder ist beziehungsfähig; Kailash Verlag, 6. Auflage 2017
8 Aus „Stahl aber herzlich, Folge 1: Ist Monogamie eine Utopie? (15:38)“, 21.01.2021 Lit-Lounge.tv, http://www.youtube.com/c/LitLoungeTV
Kommunikation
Eine lebendige und vertrauensvolle Beziehung wird ohne eine offene und ehrliche Kommunikation auf Dauer nicht funktionieren können. Wir sollten uns bewusst sein, dass Kommunikation nicht gleich Kommunikation ist. Solange wir in einer Beziehung im Wesentlichen nur über „Dinge“ und „Organisation“ des Alltages sprechen und nicht über unsere Gefühle und Bedürfnisse, wird die Beziehung nicht ehrlich und erfüllend sein können.
Marshall B. Rosenberg hat uns mit der Gewaltfreien Kommunikation - kurz GFK genannt - eine sehr wertvolle Technik gegeben, die eine empathische, einfühlsame und vorwurfsfreie Kommunikation ermöglicht. Im Mittelpunkt der GFK stehen die Elemente:
Beobachten, ohne zu bewerten,
Gefühle ausdrücken,
Bedürfnisse formulieren und
Bitten.
Dabei ist wichtig, dass jeder Partner die Verantwortung für seine Gefühle übernimmt und deren Ursache nicht im anderen Partner sieht. Unser Partner holt mit seinem Verhalten die Gefühle in uns hervor, er „triggert“ sie, aber es sind und bleiben unsere eigenen Gefühle. Wenn uns das bewusstwird, dann können wir auf „Du“- Botschaften verzichten, bei denen wir unsere Gefühle in der Regel vorwurfsvoll auf unseren Partner übertragen bzw. projizieren und stattdessen „Ich“- Botschaften verwenden. Anstatt beispielsweise zu sagen: „Ich bin wütend, weil Du dieses Verhalten hast“, können wir sagen: „Ich bin wütend, weil ich möchte bzw. mir wichtig ist, dass dieses Verhalten nicht eintritt“. Mit diesem Bewusstsein, dass jeder von uns der Schöpfer seiner eigenen Gefühle ist, kann eine offene, ehrliche und vorwurfsfreie Kommunikation gelingen und die Beziehung festigen.
Einen sehr ähnlichen Ansatz wie die GFK nach Marshall B. Rosenberg verfolgt Katie Byron. Durch die Technik der Umkehrung sollen sich die Partner zuerst bewusstwerden, welche der eigenen Gefühle, Gedanken und Glaubenssätze ihr Verhalten dem anderen Partner gegenüber beeinflussen. Der Gedanke „Mein Partner sollte mich verstehen“, kann umgekehrt werden in „Ich sollte mich verstehen“ oder in „Ich sollte meinen Partner verstehen“ oder auch in „Mein Partner sollte mich nicht verstehen“ . Beim Nachfühlen können wir erfahren, ob diese Umkehrung auf uns zutrifft und unser Partner mithin einen eigenen Mangel spiegelt. Dann können wir in unserer Kommunikation darauf verzichten, unseren Partner anzuklagen und können Möglichkeiten entdecken, die uns Gelassenheit bringen.
Eine weitere Möglichkeit, mit dem Partner über seine Gedanken und Gefühle zu sprechen, ist eine Art innerer Monolog. Das Paar vereinbart eine Zeit, in der sie abwechselnd dem Partner insbesondere ihre Sorgen, Selbstkritiken, Ängste, Bedürfnisse und Wünsche mitteilen. Bei dieser Art des inneren Monologs ist wichtig, dass er in der Ich-Form vorgetragen wird, keine Vorwürfe an den Partner und keine Zitate enthält sowie keine Bewertung vorgenommen wird. In dieser Zeit hört der andere Partner aufmerksam zu, ist still, sagt nichts und fragt auch nicht nach. Er nimmt die Gedanken und Gefühle des Partners aufmerksam wahr und notiert sich ggf. etwas. Danach ist der andere Partner an der Reihe. Abschließend spricht das Paar über die geäußerten Gefühle des anderen. Wie bei der GFK ist auch bei dieser Technik Grundvoraussetzung, mit seinen Gefühlen in Kontakt treten und sich verletzlich zeigen zu können.
In seinem Buch „Liebesglück ist keine Glücksache“, empfiehlt Robert Betz, sich seiner Schöpferverantwortung bewusst zu werden: „Wenn dich etwas an deinem Partner stört oder aufregt, dann spüre genau hin, welches Gefühl sich gerade bei dir meldet. Es ist dein (!) Gefühl, das schon lange verdrängt und ungeliebt in dir war. Es wurde vor langer Zeit von dir erschaffen und wünscht sich deine Annahme und Liebe, wie all deine Schöpfungen. Der andere hat es nur ausgelöst, aber nicht verursacht. […] Hab den Mut zur Wahrhaftigkeit, und zeig deinem Partner dein wahres Gesicht. Sprich zu ihm von dem, was dich wirklich bewegt. Und prüfe ehrlich, wo du vielleicht eine Rolle spielst oder etwas lebst, was du gar nicht bist. […] Ohne den Mut, sich verletzlich zu zeigen, entsteht keine wahre Nähe.“9
Eine einfühlsame Kommunikation wird sehr häufig als Voraussetzung genannt, um erfolgreich eine polygame Beziehung führen zu können. Sie ist aber mindestens ebenso in monogamen Beziehungen wichtig. Monogamie wird immer noch für zu selbstverständlich angesehen, so selbstverständlich, dass auf eine ehrliche und gefühlvolle Kommunikation wenig geachtet wird. Streit und Affären sind ein Anzeichen dafür, dass es in Beziehungen an einer verständnisvollen und offenen Kommunikation mangelt - oder die Beziehung einem Veränderungsdruck unterliegt. Mit der GFK können wir die angstvollen Gefühle bei uns belassen, die unser Partner hervorruft. Mit etwas Übung können wir schneller mit unseren Gefühlen in Kontakt treten und müssen unseren Partner nicht für unsere Gefühle die Verantwortung geben. Die Verantwortung für unsere Gefühle zu übernehmen, beinhaltet auch, dass wir neugierig bleiben oder uns klarer abgrenzen können. Neugier und Abgrenzung kommt dann aus einer inneren, integren Überzeugung heraus, die wir vorwurfsfrei kommunizieren können.10
Wenn wir mit unseren Gefühlen in Kontakt stehen, können wir auch erfahren, mit welcher Liebessprache wir nonverbal kommunizieren. Gary Chapman weist in seinem Buch „Die 5 Sprachen der Liebe“11 auf die am weitesten verbreiteten Verhaltensweisen hin, die als Ausdruck von Liebe verstanden werden:
Zweisamkeit,
Lob & Anerkennung,
Geschenke,
Hilfsbereitschaft und
Zärtlichkeit.
Die Reihenfolge der 5 Liebessprachen variiert von Mensch zu Mensch und kann mit einem Test im Buch herausgefunden werden. Weiß ein Partner um die Liebessprache des anderen, so kann er auf die Bedürfnisse eingehen, die dem Partner als Liebesbeweis dienen. Alle Liebessprachen fördern die Bindung zwischen den Partnern, wobei die beiden Liebessprachen Zweisamkeit und Zärtlichkeit, die körperliche Nähe und das Bedürfnis nach Bindung besonders zu betonen scheinen.
Eine weitere Möglichkeit der nonverbalen Kommunikation ist das sogenannte „Eye Gazing“. Das Paar schaut sich dabei eine längere Zeit direkt in die Augen und beschreibt die Eindrücke und Gefühle, die dabei empfunden werden.
Veit Lindau empfiehlt uns, unsere Bedürfnisse radikal ehrlich mit dem Partner zu kommunizieren. Auch wenn das im Augenblick unangenehm sei und vom Partner nicht verständnisvoll aufgenommen werden müsse. Aber wir werden langfristig belohnt, weil wir viel mehr über unsere und die Werte unseres Partners erfahren. In seinem Buch „Liebe radikal“, schreibt er: “Wenn Du aus Angst wesentliche Informationen, Impulse oder Gefühle zurückhältst, schwächst du eure Beziehung. Der Kommunikationsfluss zwischen euch gerät ins Stocken. Distanz, Zähigkeit, kleinkarierte Grabenkämpfe eingeschlafener Sex sind die Nebensymptome zurückgehaltener Kommunikation.“12 Das Zurückhalten von Informationen, Impulsen und Gefühlen dem Partner gegenüber bezeichnet Veit Lindau bereits als Lüge. Erst durch eine radikal ehrliche Kommunikation (auch mit uns selbst) werden wir aufgefordert zu prüfen, ob unsere Handlungen und Werte integer sind. Unsere integren Werte sollten wir unserem Partner dann nicht als Forderung, sondern als Wunsch mitteilen. Er schreibt: „Forderung: ‚Ich fordere von dir Ehrlichkeit und Treue! Das schuldest Du mir,‘ Wunsch: ‚Ich habe gewählt, mein Leben mit Menschen zu verbringen, die bereit sind, ehrlich und treu zu sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn du einer davon bist, denn du bist mir wertvoll. Natürlich bist du frei. Falls es dir nicht möglich ist, respektiere ich deine Wahl.
Ich werde dich weiterhin lieben, aber keine Zeit mehr mit dir verbringen, denn diese Werte sind mir heilig.‘ […] Du wirst erstaunt sein, wie viele Wünsche du erfüllt bekommst, wenn du auf Forderungen verzichtest.“13
Auch Esther Perel schreibt in ihrem Buch „Was Liebe braucht“14 über zahlreiche Klienten, die mit ihrem Partner ihre echten Gefühle und Bedürfnisse aus Angst vor Ablehnung nicht kommunizieren würden. Stattdessen würden sie ihre erotischen Fantasien vom Partner abtrennen, weil sie es nicht für möglich halten, dass der Partner beide Bedürfnisse erfüllen kann: Dass er nicht einerseits das Vertraute, die Zuverlässigkeit und Liebe und andererseits Erotik, Abenteuer, Lust spenden könne. Eine offene und ehrliche Kommunikation über Gefühle und Bedürfnisse zwischen den Partnern ist Voraussetzung, um die Erotik und das Verlangen in einer Langzeitbeziehung aufrecht halten zu können.
Für Alain de Botton sollte die Kommunikation zwischen den Partnern insbesondere dafür benutzt werden, um den Ärger aufeinander anzusprechen und zu lösen. Anhaltender Ärger würde die Beziehung schwächen, selbst wenn er nur gering zu sein scheint. In einem Interview führt er aus: „Der Grund, warum die Liebe zwischen Partnern erlischt, ist oft Ärger. Insgeheim ärgert sich ein Partner über den anderen. Nicht, dass man ihn anschreien wollte, es ist ein stiller Ärger, weil man sich nicht verstanden oder verletzt fühlt. Der Herzstrom der Liebe ist blockiert, deshalb haben die beiden keinen Sex mehr, sie ertragen keine Berührung, weil sie eingeschnappt sind […]. Sie führen einen stillen Krieg. Solche Paare [...] brauchen etwas gemeinsame Zeit, um die blockierten Liebeskanäle wieder zum Fließen zu bringen.“15 Die Liebeskanäle, davon ist Alain de Botton überzeugt, könnten die Partner mit einer sensiblen Kommunikation offen halten bzw. wieder öffnen, die geeignet sei, schwelenden Ärger zu löschen und gegenseitiges Verständnis zu erzeugen.
Weiter meint Alain de Botton, dass uns das verklärte Bild der „romantischen Liebe“ daran hindern würde, aufrichtig miteinander zu kommunizieren. Er sagt: „Der Romantizismus gaukelt uns vor, Liebe sei einfach […]. Faszinierend ist, dass wir nur wegen Menschen schmollen, denen wir vertrauen und von denen wir erwarten, dass sie uns verstehen, es aus irgendeinem Grund aber nicht tun. Wenn man jemanden liebt, denkt man, er oder sie müsse einen voll und ganz verstehen […]. Denn als Romantiker sind sie davon überzeugt, ihr Liebespartner müsste ihre Seele lesen können, ihre Seelen würden ohne Worte kommunizieren. Wenn sie ihm also erklären müssen, warum sie verstimmt sind, hieße das, dass er sie nicht liebt. Sie glauben, wahre Liebe zeige sich darin, dass man sich ohne Worte versteht. Das wollen uns die Romantiker glauben machen, doch natürlich ist das Unsinn […]. Wir müssen einander erklären, was in uns vorgeht und warum wir verstimmt sind. Wir kommen nicht darum herum zu kommunizieren.“16 Eine Kommunikation, in der sich die Partner ihr Seelenleben zeigen, scheint für eine erfüllende Beziehung sehr wichtig, wenn nicht sogar unabdingbar zu sein.
Wollen wir doch mal Kritik an unserem Partner üben, dann sollten wir diese niemals (!) auf seinen Charakter, sondern immer auf sein Verhalten beziehen. Anstatt ihm vorzuwerfen: „Du bist unordentlich“ sollten wir ihm zu denken geben: „Du hast nicht aufgeräumt“ . In erfüllenden Beziehungen gesteht sich das Paar einen Toleranzbereich zu, innerhalb dessen der eine Partner auch Charakterzüge des anderen Partners annehmen kann, die nicht immer mit seinen eigenen Werten im Einklang stehen. Je größer der Toleranzbereich eines Paares, desto weniger Konflikte hat es tendenziell auszutragen.
9 Robert Betz - Liebesglück ist keine Glücksache; Heyne Verlag, Originalausgabe 2021, Seiten 76, 89 und 49
10 Beispielsweise kann mit Kartenspielen für Paare, welche u.a. Fragen zu den Gefühlen stellen, eine einfühlsame Kommunikation geübt werden.
11 Gary Chapman - Die 5 Sprachen der Liebe; Franke Verlag, 40. Auflage 2020
12 Veit Lindau - Liebe radikal; Kailash Verlag, 4. Auflage 2014
13 Veit Lindau - Liebe radikal; Kailash Verlag, 4. Auflage 2014, Seiten 307 und 308
14 Esther Perel - Was Liebe braucht, HarperCollins Verlag, 2. Auflage 2021
15 Aus „Liebe, Romantik und Alltag - Alain de Botton im Gespräch (18:58)“, 13.02.2017 SRF Kultur Sternstunden, http://www.youtube.de/c/srfkultur
16 Aus „Liebe, Romantik und Alltag - Alain de Botton im Gespräch (22:11)“, 13.02.2017 SRF Kultur Sternstunden, http://www.youtube.de/c/srfkultur
Freiheit
Die eigene Freiheit auszuleben und autonom bleiben zu können, wird sehr häufig als Grund genannt, eine polygame Beziehung zu führen. Sich die Freiheit der Partnerwahl und des zeitweisen Partnerwechsels zu nehmen, erscheint vielen polygam lebenden Paaren die Erfüllung ihrer Sexualität zu sein.
Oft wird Freiheit als Befreiung im Sinne von „be-freit“ von etwas zu sein angesehen. Befreiung von Verantwortung, Fürsorge, Arbeit, Aufgaben und Entscheidungen. Doch bei genauerer Betrachtung umfasst das nur einen sehr kleinen Wesenszug von Freiheit.
Freiheit beinhaltet vor allem Entscheidungsfreiheit (Wahlfreiheit). Sich in Freiheit für eine Arbeit oder Aufgabe oder Partner zu entscheiden, ist ein wesentlicher Aspekt von Freiheit. Dieser Aspekt der Freiheit bedeutet für den Partner insbesondere Fürsorge und Verantwortung zu übernehmen. Es ist wundervoll zu erfahren, wie sich an eine in Freiheit getroffene Entscheidung bald weitere Entscheidungsfreiheiten anschließen. Die Entscheidung, sich beispielsweise zu bilden und sich zu entwickeln, eröffnet später Freiheiten, die ohne diese Entscheidung zuvor getroffen zu haben, nicht bestünden. Aus jeder Entscheidung oder Nichtentscheidung entstehen Konsequenzen. Wenn wir sie mit Freude annehmen, ist die Entscheidung aus vollem Herzen richtig - und andernfalls nicht.
Freiheit beinhaltet auch frei zu sein von Zwängen, sowohl äußeren als auch inneren. Äußere Zwänge können sich aus den gesellschaftlichen Normen ergeben, innere Zwänge entstehen aus dem unbewussten Einfluss der Muster und Prägungen. Auch sexuelle Praktiken können zwanghaft sein. Ohne Zwänge eine bewusste Wahl zu treffen und ihre Konsequenzen mit Freude zu erwarten, ist integer und hinterlässt ein stimmiges Gefühl.
Freiheit beinhaltet auch Ausgewogenheit. Die eigene Freiheit soll nicht zur Unfreiheit des Partners führen. Freiheiten in Anspruch zu nehmen und zu erkennen, dass der Partner darunter leidet, ist unausgewogen. Von einem Partner nur die geliebten und angenehmen Eigenschaften zu wollen und sich nicht mit den ungeliebten und unangenehm empfundenen Eigenschaften beschäftigen zu wollen, ist unausgewogen („Rosinen picken“). Diese Freiheit zu leben kann dazu führen, dass wir die Summe unserer Bedürfnisse auf verschiedene Partner aufteilen, wir puzzeln uns unsere Bedürfnisse zusammen. So könnten wir von einem Partner unser Bedürfnis nach Sicherheit und Heimat und von einem anderen Partner unser Bedürfnis nach Sex und Abenteuer erfüllen lassen. Wenn das beide Partner so handhaben, sich dabei wohlfühlen und gleichermaßen einen „good deal“ damit eingehen, ist das ausgewogen.
Nach Ansicht von Jiddu Krishnamurti erfahren wir erst dann wirkliche Freiheit, wenn wir uns von allen Autoritäten befreit haben. Autoritäten können in unserem Innern beispielsweise durch unsere Gedanken, Gefühle, Prägungen und Muster, aber auch im Außen durch andere Menschen entstehen. Weil Jiddu Krishnamurti selbst keine Autorität ausstrahlen wollte, lehnte er die Rolle eines Gurus ab. Seine Vorträge führte er deshalb im Wesentlichen als Gespräch im Dialog mit den Anwesenden.
Erich Fromm führt in seinem Buch „Haben oder Sein“17 aus, dass das Brechen sexueller Tabus an sich nicht zu größerer Freiheit führen würde. Das gelte auch für den Versuch, Freiheit zu erlangen, indem das „Verbotene“ ausgelebt werde. Nur die Errichtung innerer Unabhängigkeit öffne die Tür zur Freiheit und beseitige den Drang nach fruchtloser Rebellion. Er führt aus, dass eine große Anzahl von Naturvölkern keinerlei sexuelle Tabus hätte. Diese sexuelle Freiheit führe jedoch nicht zu sexuellen Exzessen, sondern es würden sich nach einer relativ kurzen Phase lockerer Begegnungen Paare zusammenfinden, die kein Verlangen nach Partnerwechsel hätten und ungehindert auseinandergehen könnten, sobald die Liebe erloschen sei. In unserer westlichen Gesellschaft würde Sex oft Haben-orientiert gelebt, wir „haben“ Sex, Sex wird zur Konsumware, welche die eigene Lust am „Haben“ befriedigt und das eigene Selbstwertgefühl steigere. Erich Fromm spricht in diesem Zusammenhang auch von „Sexgier“, welche als Konsequenz des Strebens, nach immer mehr Konsum, Profit und Macht in unserer Habenorientierten Gesellschaft entstünde und die zu einer teils gewaltvollen Sexualität führe. Demgegenüber würde eine Sein-orientierte Sexualität aus der tiefen Freude am Erlebnis heraus praktiziert werden.
Erich Fromm zeigt auf, dass die „wirkliche“ Freiheit aus der inneren Unabhängigkeit entstehe und ohne Zwänge auskomme. In der Existenzweise des Habens finde der Mensch sein „Glück“ in der Überlegenheit gegenüber anderen, in seiner Machtausübung und in letzter Konsequenz im Erobern, Rauben und Töten. In der Existenzweise des Seins finde der Mensch das Glück im Lieben, Teilen und Geben.
Wenn wir Freiheiten auskosten, kann das nicht nur einen Zugewinn, sondern auch einen Verlust mit sich bringen. Das trifft auch auf die Beziehungsformen zu. In einem Artikel wird Gertrud Wolf mit folgender Aussage zitiert: „Wir können nicht beliebig in die Breite gehen, wenn wir in die Tiefe gehen wollen.“18 Auf der einen Seite steht demnach das quantitative Ausleben der sexuellen Freiheit mit oft wechselnden Partnern, das tendenziell oberflächliche Erlebnisse verspricht. Auf der anderen Seite steht das qualitative Fokussieren der Sexualität auf einen oder sehr wenige Partner, das tendenziell tiefere Gefühle verspricht. Unsere Zeit bzw. Energie ist begrenzt und wenn wir sie auf mehrere Partner aufteilen, dann bleibt für den einzelnen Partner weniger Zeit übrig. Um Tiefe mit einem Partner erleben zu können, müssen wir auf einige Freiheiten verzichten. Wenn wir ihm unsere „Frei“- Zeit widmen, können wir uns auf ihn einlassen und eine emotionale Nähe zu ihm aufbauen, erhalten und vertiefen. Wir können oftmals nicht etwas gewinnen, ohne etwas anderes zu verlieren.
Viele polygam lebende Paare berichten, dass sie es als Freiheit empfinden, wenn die Erfüllung der sexuellen Bedürfnisse des Partners nicht von ihnen alleine erwartet wird. Sie empfinden es als Freiheit, wenn sowohl sie selbst als auch ihr Partner nicht diese Erwartungshaltung in die Beziehung legen. Dass einige sexuelle Bedürfnisse auch außerhalb der Beziehung befriedigt werden können, empfinden beide Partner als befreiend und entlastend. Diese Betrachtung ist ausgewogen, solange beide Partner die Bedürfnisse, die der andere Partner ihnen nicht geben kann oder will, in Außenbeziehungen stillen.
Jede Beziehungsform gibt Freiheiten, denn kein Partner gehört dem anderen. Sich bewusst in Freiheit für eine Beziehungsform zu entscheiden, frei von Mustern, Prägungen und Zwängen, hat die besten Voraussetzungen, Freude zu bereiten. In einer verbindlichen Beziehung kann Liebe wachsen. Liebe gibt den Partner frei und ist dankbar, wenn der andere Partner aus seiner freien Entscheidung heraus bleibt oder wiederkommt. Ohne Liebe steht ein Partner dem anderen gleichgültig gegenüber und auf dem Feld der Gleichgültigkeit wächst bzw. besteht keine Liebe. Ein Zitat besagt: „Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit“ .





























