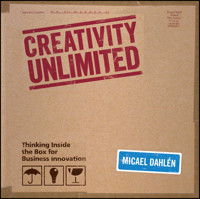Micael Dahlén
Monster
Rendezvous mit fünf Mördern
Aus dem Schwedischen von Max Stadler und Annika Ernst
Campus Verlag Frankfurt/New York
Über das Buch
Wer sich mit Mördern trifft, muss um seine Haut fürchten. Micael Dahlén hat es gewagt: Fünf weltberühmten Mördern saß er Auge in Auge gegenüber. Um aufzudecken, was nach ihren Taten geschah. Um ihren Mythos zu ergründen. Und um zu verstehen, wie sie aus ihren Taten ein Mordsgeschäft machen konnten. »Monster« ist der Bericht eines fanatischen Professors, der zu ergründen versucht, woher unsere Faszination für das Böse stammt.
Über den Autor
Als Micael Dahlén mit 34 Jahren einen Lehrstuhl an der Stockholm School of Economics ubernahm, war er einer der jungsten Professoren Schwedens. Sein unkonventioneller Stil machte ihn nicht nur in der akademischen Welt bekannt, er wurde auch zum Medienliebling in Print, TV und Radio. Sein Buch Nextopia: Freu dich auf die Zukunft, du wirst ihr nicht entkommen! erschien 2013 im Campus Verlag.
Ihr sollt nie vergessen sein
Mein tiefster Respekt gilt jenen, die allzu leicht in Vergessenheit geraten. Denen, die in der Berichterstattung und in Märchen immer zu Statisten degradiert werden, während das Monster stets die Hauptrolle spielt. Denen, an deren Leben, Träumen, Hoffnungen, Schrecken und Verzweiflung wir niemals teilhaben.
Leona Carpenter, Vera Faye Martin, Benjamin Fink, Abigail Folger, Voytek Frykowski, James Gallop, Galen Gibson, Everson Gillmouth, Renée Hartevelt, Leno LaBianca, Rosemary LaBianca, Alvaro Montoya, Betty Palmer, Dorothy Miller, Steven Earl Parent, Brian Pedersen, Dennis Pedersen, Marianne Pedersen, Ñacuñán Sáez, Anna Schaftner Lundin, Jay Sebring, »Shorty« Shea und Sharon Tate.
Ihnen und allen anderen, die nicht mehr unter uns weilen; Menschen, die durch die Hand eines anderen starben. Und den Hinterbliebenen, ihren Familien, Geliebten und Lieben. Denen, die das verloren haben, was niemand verlieren dürfte. Denen, die wir vergessen oder in unserem Wahn niemals sehen.
Möge man eurer immer gedenken. Mögen unsere Gedanken mit euch sein.
ZUR HÖLLE
»Hört auf, mir Liebesbriefe zu schicken.«
»KEINE ANGST, ICH WERDE DICH NICHT TÖTEN«, höre ich ihn hinter meinem Rücken flüstern. Ich drehe mich um, und er lächelt mich hinter seinen großen, getönten Brillengläsern an. Ich kann seine Hände kaum in der Dunkelheit erkennen: Es sieht so aus, als halte er ein Gewehr.
Bei seinen Worten frage ich mich kurz, ob er meine Gedanken gelesen hat. Dann wird mir klar, dass es ziemlich offensichtlich ist, was ich denke. Immerhin stehe ich mit ihm allein hier in seinem dunklen Flur, wo uns niemand sehen oder hören kann und wo ich getötet und zerstückelt werden könnte, ohne dass irgendjemand es je erführe. Immerhin hat er das ja schon einmal getan. Das ist der Grund für seine Berühmtheit.
Dennoch hält meine Furcht nur eine Sekunde lang an. Vielleicht, weil seine Worte mich beruhigen. »Ich töte keine Männer«, erklärt er mit einem aufrichtigen Gesichtsausdruck, um dann breit grinsend hinzuzufügen: »Mir schmeckt nur Frauenfleisch.«
Er heißt Issei Sagawa und ist einer der größten Stars Japans. Ein großes Idol in seinem Heimatland und in der ganzen Welt bekannt. Bekannt dafür, eine niederländische Frau zu sich nach Hause eingeladen, ihr mit einem Kleinkalibergewehr in den Hinterkopf geschossen und anschließend ihren Körper zerstückelt und lustvoll verspeist zu haben. Fast buchstäblich von dem Moment an, als er das Besteck nach dem letzten Bissen beiseitegelegt hatte, verdiente er seinen Lebensunterhalt damit, der Welt von seinem kaltblütigen Mord und den darauffolgenden warmblütigen Mahlzeiten zu erzählen.
Wir stehen im Flur seiner geräumigen Wohnung in Kawasaki, in der Bucht von Tokio, und sind auf dem Weg in sein Atelier. Dort will er mir die vielen Zeitungen aus aller Welt zeigen, in denen sein Gesicht auf der ersten Seite prangte; die Bücher, die über ihn geschrieben wurden; die Bücher, die er selbst geschrieben hat; die Gemälde, inspiriert von seinem niederländischen Sukiyaki-Fest; und nicht zuletzt seine geliebte Sammlung von Fotografien, die Frauen von sich selbst machen und ihm schicken.
Vielleicht habe ich keine Angst, weil ich den Eindruck habe, dass Issei mehr oder weniger alles hat, was er sich wünscht. Ein blutiges Gemetzel an meinem Körper kann er in seinem gemütlichen Zuhause wohl kaum gebrauchen, wo er Medienvertreter und Freunde aus aller Welt empfängt, aus Ländern, von denen die meisten Japaner noch nicht einmal gehört haben.
Aber vielleicht sollte ich mich dennoch nicht so sicher fühlen, denke ich, als ich ein paar Stunden später auf dem Polstersofa in seinem Wohnzimmer sitze. Mit einem stillen Seufzer erzählt er mir, in seinem großen wuchtigen Sessel sitzend, dass er das Gefühl habe, sein Stern sei dabei zu sinken. »Die japanischen Medien haben kein Interesse mehr an mir«, erklärt er. »Ich will wieder etwas Großes tun.«
Er erzählt mir, dass er gern einen richtig leckeren Sukiyaki-Eintopf machen würde, wofür er eine Menge Fleisch bräuchte. Deshalb hat er vor, wieder zu töten. Ich lache. Und ich überrasche mich selbst dabei, in sein Kichern einzustimmen, als er ein Loblied auf den Geschmack von Menschenfleisch anstimmt, dass es an feinen Thunfisch erinnere und die allerbesten Stücke gar keinen Geruch hätten.
Ich muss mich daran erinnern, wie bizarr Isseis Geschichte eigentlich ist, wie absurd es ist, dass ich hier in seinem Wohnzimmer sitze und den blutrünstigen Details über den Mord lausche, den er begangen hat, wie grauenhaft das eigentlich ist. Mir wird klar, dass ich mir keine Sorgen darum mache, in den Hinterkopf geschossen oder mit Messer und Gabel in mundgerechte Stücke zerteilt zu werden, weil meine eigenen Gedanken inzwischen so abgestumpft sind.
Für mich klingt zu diesem Zeitpunkt keine Geschichte mehr besonders merkwürdig oder schauderhaft. Ich habe bereits zu viel gehört und gesehen.
♦ ♦ ♦
Meine Reise begann vor einigen Jahren am anderen Ende der Welt in meinem Heimatland Schweden. Und zwar aufgrund der Überschrift eines Zeitungsartikels. »Hört auf, mir Liebesbriefe zu schicken«, hieß es in großen schwarzen Lettern. Darunter war das Foto eines Mannes abgedruckt, der auf der Straße wohl kaum viele begehrliche Blicke auf sich ziehen würde. Er sah vollkommen unauffällig aus.
Er hieß Tony Olsson, ein 33-jähriger Kleinkrimineller, der in einer Fabrik in Södertälje am Fließband arbeitete. Nicht gerade das, was man sich unter einem Herzensbrecher vorstellt. Ganz zu schweigen davon, dass er sich sechs Jahre zuvor bei einem Bankraub so dumm angestellt hatte, dass ihm die Polizei schon auf den Fersen war, kaum dass er die Bankfiliale verlassen hatte. Und nun war er für den Mord an den zwei Polizisten verurteilt worden, die bei der Verfolgungsjagd umgekommen waren.
»Mich stört das«, las ich in dem offenen Brief, den er an Aftonbladet geschickt hatte und der unter dem Foto von ihm veröffentlicht wurde. »Ich will keine Briefe mehr von Menschen bekommen, die mich lieben, ohne mich je getroffen zu haben.«
Auch mich störte das. In dem Artikel stand, dass der Mann stapelweise Liebesbriefe bekam. Wofür? Weil er etwas noch Schlimmeres zu seiner bereits langen Liste an schlimmen Taten hinzugefügt hatte, weil er zwei Menschen das Leben genommen hatte. Der Kerl war ein Monster. Ein Monster, das sich in meinem Kopf einnistete. Ich hasste ihn, weil er zwei Menschen das Leben genommen und obendrein die Herzen all dieser Frauen erobert hatte. Ich hasste ihn für seine Frechheit, die Zeitung zu kontaktieren und sich über all die Liebesbriefe zu beklagen, die er öffnen musste.
Nachdem sich das Monster einmal in meinen Schädel eingenistet hatte, war es schwer, es wieder daraus zu verbannen. Immer wieder kam seine hässliche Fratze zum Vorschein, in den Nachrichten, in irgendeinem Dokumentarfilm, auf dem Cover der Bestseller-Biografie eines Mörders im Buchhandel. Menschen, denen Titelüberschriften gewidmet wurden, weil sie jemanden umgebracht hatten. Monster, die Briefe erhielten, weil sie gemordet hatten.
Ich fing an, Zeitungsausschnitte zu sammeln. Mit der Zeit wurde ich mehr oder weniger besessen davon. In manchen Nächten konnte es passieren, dass ich die Schachteln, die ich in meinem Büro verbarg, öffnete, einige Ausschnitte herausnahm und mich an den monströsen Taten ergötzte, die diese Menschen begangen hatten. Dass ich in der gigantischen Aufmerksamkeit und der verstörenden, beleidigenden und geradezu blasphemischen Verehrung schwelgte, die ihnen die Morde verschafft hatten.
Ich weiß nicht genau, wann es passierte. Ich nehme an, dass es nach und nach heranwuchs, während ich die Zeitungsausschnitte immer wieder las. Aber es dauerte nicht lange, bis meine Besessenheit die Abscheu in Faszination verwandelte. Was sind das für Menschen? Wie können sie die grauenhaftesten Taten begehen, die man sich vorstellen kann, und dafür geliebt werden? Wie kann es sein, dass sie dafür sorgen, dass die Auflagen der Zeitungen in Rekordhöhen schießen? Wie können Mörder teuflische Handlungen begehen und als Helden dastehen, die Hauptrolle in Büchern, Computerspielen und Filmen einnehmen?
Ich war gefesselt. Vielleicht war es meine persönliche Variante des Stockholm-Syndroms, dieses wohlbekannten Begriffes, der in den 1970er Jahren in meiner Heimatstadt nach der berühmten Geiselnahme geprägt wurde, bei der die Opfer anfingen, ein persönliches Band zu ihren Kidnappern zu knüpfen. Denn ich verspürte das Bedürfnis, die Menschen zu treffen, die mein Bewusstsein mehr und mehr in ihren Bann gezogen hatten.
So kam es, dass ich anfing, mit den Monstern zu wandern.
♦ ♦ ♦
Und so kommt es, dass ich nach Dänemark fahre, um mich mit einem Dämon in einem Raum einschließen zu lassen. Obwohl die Gefängniswärter gleich nebenan auf der anderen Seite der Mauer sind, zittern mir die Knie. Ich weiß, dass er die Diagnose Psychopath erhielt; ich habe gehört, dass er 39 von 40 möglichen Punkten auf einer Checkliste zur Klassifizierung psychopathischer Störungen erhalten hat. Ich habe seine psychologische Beurteilung gelesen, die im Prinzip besagt, dass seine Persönlichkeit stark gestört ist, er nicht viel mit geläufigen Moralvorstellungen anfangen kann, kein Mitgefühl kennt und von primitiven Idealen beherrscht wird. Er selbst hat mir die Beurteilung gegeben.
Sein Name ist Peter Lundin, und er ist Dänemarks meistgehasster Mann. Ich bin zu ihm gefahren, um die Artikel über ihn zu begreifen, die ich gesammelt und in meiner heimlichen Schachtel verborgen habe; in denen steht, dass Frauen zu ihm ins Gefängnis pilgern, um dort, wo wir jetzt sitzen, Sex mit ihm zu haben.
Im Vergleich zu ihm wirkt Tony Olsson wie ein Schuljunge. Den Nachrichten, Zeitschriften, Büchern, Fernsehsendungen und Facebook-Gruppen zufolge, die sich mit ihm beschäftigen, hat er vier Menschen mit bloßen Händen getötet (zumindest wurde er für diese Anzahl von Morden verurteilt) und sie danach verscharrt oder in kleine Stücke gehackt. Und im Gefängnis verbringt er seine Zeit mit Marathonsex.
»Es gibt so viele hübsche Schwedinnen«, schreibt er in einem seiner Briefe. Und das ist wohl der Hauptgrund, warum er mich überhaupt treffen will, warum er eine seltene Ausnahme von seiner Regel macht, nie fremde (männliche) Besucher zu empfangen: Für ihn bin ich möglicherweise der Schlüssel zu einem Land voll mit neuen Sexgespielinnen. Nach einer etwa ein Jahr andauernden Briefkorrespondenz und Planung hat er mich in sein Leben eigeladen. Und nun bin ich hier.
»Geld machen und Bräute flachlegen, darum geht es doch im Leben, oder?«, erinnert er sich an seine Jugendträume, als wir im Besucherraum des Gefängnisses sitzen. Und obwohl er von einem ganzen Volk gehasst wird und seit vielen Jahren hinter Gittern sitzt, hat sein heutiges Leben doch gewisse Ähnlichkeiten mit den Fantasien eines Teenagers. Sein Gesicht ist auf Buchumschlägen, Zeitungen und Plakaten zu sehen, er bekommt sehnsüchtige Briefe von Frauen, und es gibt Fanseiten über ihn im Internet.
Sehr oberflächlich betrachtet scheint Peter fast das Leben eines Rockstars zu haben. Während die Gitarren, auf denen ich in meiner Jugend spielte, inzwischen unter einer dicken Staubschicht verschwinden, klingt sein Gitarrenspiel lauter als je zuvor. Ich habe es selbst auf der Website einer dänischen Abendzeitung gehört. »Ich habe fünftausend Dollar für das Lied bekommen, also bin ich ein professioneller Musiker«, sagt er und lacht.
Er läuft nervös im Besucherraum auf und ab, während er von all den Frauen erzählt, die er treffen möchte, und von all den Projekten, denen er sich widmen will. »Aber der Tag hat nur vierundzwanzig Stunden, die Zeit reicht nicht für all das, was ich vorhabe.« Es fühlt sich fast so an, als wären wir auf dem Schulhof, und Peter ist der quirlige Typ, der ausschweifend von den vielen coolen Dingen erzählt, die er tun möchte, während ich nur auf der Bank sitzen kann, um ihm bewundernd und mit großen Augen zuzuhören.
Beschämt überrasche ich mich dabei, wie ich mit dem Gedanken spiele, dass mein Schulhof-Ich wohl gerne hätte, was er zu haben scheint. Der Gedanke macht mir Angst. Er hat die abscheulichste Tat begangen, zu der ein Mensch fähig ist. Viermal. Mindestens.
Getreu meiner Gewohnheit, niemals etwas als gegeben hinzunehmen, habe ich mehrere Studien gelesen, die besagen, dass Mord als das schlimmste aller menschlichen Verbrechen angesehen wird. Unabhängig davon, welche Kontinente, Epochen oder Kulturen man untersucht. Egal wann oder wo man jemanden fragt – was Forscher getan haben –, die Antwort lautet immer, dass es nichts Abscheulicheres gibt, als einen anderen Menschen umzubringen. Mord ist unakzeptabel: Diese Tat sollte dich auf ewig aus der Gesellschaft verbannen. Jemanden zu ermorden bedeutet, eine Todsünde zu begehen; das sollte dich in der Hölle schmoren lassen. Wie können dann Monster zu Rockstars werden?
Ich kam zu Peter, um eine Antwort zu finden, aber als ich ihn verlasse, habe ich mehr Fragen als zuvor. Und diese Fragen zwingen und locken mich, meine Reise in die Hölle fortzusetzen.
♦ ♦ ♦
Oftmals, ob in einem Flugzeug über dem Meer oder allein in einem Mietwagen in der pechschwarzen Wüstennacht, kommt mir in den Sinn, wie bizarr meine Reise rund um die Erde ist. Sie führt mich an Orte, von denen die meisten Menschen noch nie gehört haben und die sie schon gar nicht je zu Gesicht bekommen wollen, ich bin unterwegs zu Treffen mit einer berüchtigten Person nach der anderen, jede Person davon merkwürdiger und erschreckender als die zuvor, um Geschichten zu hören, die auf meinen Schlaf und meine Träume von dem Augenblick an, in dem ich sie vernommen habe, einwirken – und noch jahrelang danach. Ich merke das, als ich neben einer heiteren Familie mit zwei Kindern in einem Flugzeug nach Japan sitze; als der siebenjährige kleine Bruder begeistert erzählt, dass er nach Tokio ins Disneyland darf und mich dann fragt, wohin ich unterwegs bin. Ich merke es, als der amerikanische Zollbeamte am internationalen Flughafen von Los Angeles fragt: »Privat oder geschäftlich?«, und ich nicht weiß, was ich antworten soll. Ich merke es, wenn ich umgehend alle Termine absage und das Büro verlasse, sobald die Besuchserlaubnis für einen Gefängnisbesuch eingetroffen ist. Warum tue ich das? Was stimmt nicht mit mir?
Aber es gibt auch Augenblicke, in denen ich spüre, dass meine Reise alles andere als bizarr und absurd ist. Auf den Reisen zwischen berüchtigten Mördern in verschiedenen Teilen der Erde vergesse ich meine tägliche Routine, ich überrasche mich dabei, wie ich dieselbe Kleidung mehrere Tage hintereinander trage, was sonst nie passieren würde. Ich überprüfe tagelang meine E-Mails nicht, was normalerweise dafür sorgen würde, dass ich vor Stress umkäme. So viele Dinge und Fragestellungen, die sonst mein Leben anfüllen, erblassen daneben. Sie wirken auf einmal so trivial. Das Alltagsleben verliert einen Teil seiner Farbe, als würde ich es auf einem Schwarz-Weiß-Bildschirm betrachten. Die Treffen und das Leben mit kaltblütigen Mördern schälen all das weg, was eigentlich nicht so wichtig ist im Leben: alles außer dem Leben selbst – und dem Tod.
Wenn ich neben jemandem sitze, der einer Frau in den Kopf geschossen und ihr Fleisch gegessen oder vier Menschen mit seinen bloßen Händen umgebracht hat, ist mir klar, dass ich selbst einen Augenblick später tot sein könnte. Ganz offenkundig; die Leute, die ich besuche, haben ja eindeutig dokumentiert, dass es möglich ist. Manchmal überwältigt mich die Demut vor der Zerbrechlichkeit des Lebens. Aber noch mehr quält mich die Frage nach dem Warum. Nicht nur, warum die Mörder ihre grauenhaften Morde begangen haben, sondern auch, warum es sie überhaupt gibt. In einem Gefängnis in Kalifornien wird mir klar, dass nicht nur ich mir darüber den Kopf zerbreche.
»Ich glaube an Gott, ich bin katholisch. Oder jedenfalls glaube ich, dass es eine höhere Macht gibt. Aber wie kann diese Macht zulassen, dass ich etwas tue, was mich an solch einen Ort bringt?«, fragt Dorothea Puente.
Ich bin zu ihr gefahren, um zu begreifen, warum man in den Augen anderer so interessant und begehrenswert wird, indem man neun Menschen vergiftet, zerstückelt und in seinem Garten vergräbt. Ich habe ihr Gesicht auf den Buchumschlägen von ziegelsteindicken Romanen und sogar einem populären Kochbuch gesehen. In stundenlangen Fernsehsendungen habe ich ihre Geschichte erzählt bekommen. Inzwischen ist sie Anfang Achtzig und sitzt seit zwanzig Jahren im Gefängnis. Sie scheint zwar das Leben hinter Gittern leid zu sein, aber nicht, ihre Geschichte zu erzählen. Nachdem ich über ein Jahr darauf gewartet habe, sie treffen zu dürfen, nachdem ich ein weiteres Buch versprochen habe, das ihre Geschichte erzählt, und nachdem ich meine »aufrichtige Hochachtung« vor ihr ausgedrückt habe, treffen wir uns endlich.
»Meine Jury hat dreiundzwanzig Tage lang beraten«, berichtet sie mir und fügt mit kaum verhohlenem Stolz hinzu: »Einen Tag länger als bei den Brüdern Menendez.« Ich erinnere mich an die beiden Brüder, die während ihres Studiums ihre Eltern umbrachten und mit einem scheinbar endlosen Prozess dafür sorgten, dass die Zuschauerzahlen der Nachrichtensendungen in die Höhe schossen (im Verlauf des Prozesses wurde einer der beiden von einem Fotomodell kontaktiert, das er später heiratete). »Zweimal«, fährt Dorothea fort, »sagte die Jury dem Richter, dass sie sich nicht entscheiden könnten. Aber er zwang sie, ihre Beratungen fortzusetzen.«
Zwanzig Jahre nach der Urteilsverkündung hat Dorothea noch in keiner Weise für sich hingenommen, dass sie schuldig ist. Aber sie liebt es weiterhin, ihre Geschichte zu erzählen. Nachdem sie ihr ganzes Leben lang auf der Jagd nach einer guten Geschichte war und immer interessant sein wollte, immer versuchte, außergewöhnlich zu sein, hat sie nun etwas zu berichten, womit sie das meiste übertrifft. Es ist offensichtlich, dass sie es genießt, mir ihr Leben zu erzählen; ihr Gesicht leuchtet, sie sieht geradezu selig aus. Gesegnet mit einer giftigen Geschichte, die sie von ihrem Gott erhalten hat, oder jedenfalls von dem, was sie eine Art höhere Macht nennt.
Zufrieden erzählt sie: »Fünf Leute haben auf mich gezeigt, seit ich mit Ihnen hier sitze.« Sie sieht das sofort, sie ist daran gewöhnt. Oft kommen die Leute, die während ihres Besuchs bei anderen Gefangenen in dem gemeinsamen Besucherraum sitzen, dann zu ihr, weil sie die Berühmtheit aus den Zeitungen und dem Fernsehen aus der Nähe sehen wollen, und sind teilweise regelrecht entzückt, weil sie die Möglichkeit haben, mit ihr persönlich sprechen zu können.
Neun Leichname haben genau das erfüllt, was ihr früheres Leben mit eleganten Kleidern, extravagantem Make-up, teuren Parfüms und Gesichtsliftings ihr nicht geben konnte. Sie haben sie genau so begehrt gemacht, wie sie es sich immer erträumt hat. Neun Morde haben ihr mehr gegeben als all die Lügen und Fantasien, die früher ihre Tage füllten. Sie haben ihr eine faszinierendere Geschichte geschenkt, als sie selbst sie je hätte erfinden können. Sie ist zu einer Großmutter geworden, von der sich Jugendliche Postkarten wünschen und die für so etwas via Internet ihr ganzes Taschengeld ausgeben.
Dorothea glaubt an Gott oder eine andere höhere Macht und fragt sich, wie diese es zulassen kann, dass sie hier eingesperrt gehalten wird. Sie fragt sich, warum sie hinter Gittern sitzen muss, wo sie doch endlich eine Position erreicht hat, die sie stets erlangen wollte; schließlich verfügt sie über eine Giftgeschichte, und die Augen und Ohren der Welt richten sich auf sie.
Ich zerbreche mir auch den Kopf über Gottes Plan oder den Plan dieser anderen höheren Macht. Ich frage mich, wie diese Macht es zulassen kann, dass eine Person, die das abstoßendste und abscheulichste aller menschlichen Verbrechen begehen kann, Gegenstand der Bewunderung und Vergötterung wird. Ich frage mich, wieso wir uns um diese Menschen scharen und uns sogar zu ihnen hingezogen fühlen, während wir doch eigentlich so schnell und so weit wie möglich vor ihnen fliehen müssten. Wenn die Mörder sich in der Hölle befinden, warum sind wir dann so scharf darauf, ihnen dort Gesellschaft zu leisten?
Vielleicht kann Charles Manson eine Antwort auf diese Frage liefern. Ganz egal, wie man rechnet, er ist eine der berühmtesten Personen der Welt und zieht Millionen von Menschen an. Für manche ist er größer als Jesus. Aber das hält Charlie für einen lächerlichen Vergleich. Als ich ihn treffe, meint er: »Ich bin Jesus!«
Es gibt Menschen, die ihr Leben lang nach Jesus suchen, sage ich mir immer wieder in der schier endlosen Zeit, die verstreicht, bevor ich Charles Manson erreiche. Ich kenne seinen Namen, seit ich denken kann. Es ist ein Name, an den ich wie viele andere so sehr gewöhnt bin, dass ich gar nicht an ihn gedacht habe, bevor meine Besessenheit von Monstern richtig weit gediehen war. Ein Name, der so berühmt ist, dass ich nie zu hoffen gewagt hätte (denn so schlimm wurde meine Besessenheit), tatsächlich jemals die Möglichkeit zu haben, denjenigen zu treffen, der ihn trägt.
Obwohl es vierzig Jahre her ist, dass er die neun blutrünstigen Morde begangen hat, für die er verurteilt wurde, ist er noch immer ein wichtiger Teil der Allgemeinkultur. Fast alle Amerikaner kennen den Namen Charles Manson, und überall ist sein Gesicht auf Pullovern, Plakaten und Plattencovers zu sehen. Man hört seinen Namen und seine Worte in der Popmusik. In anderen Teilen der Welt ist sein Gesicht mitunter bekannter und lebendiger als das von Uncle Sam – Charles Manson ist Amerika von seiner besten und schlimmsten Seite, das Land, in dem jeder ganz nach oben gelangen kann.
Ich komme nicht umhin, an das Sprichwort zu denken, dass Gottes Wege unergründlich sind, als Manson testet, wie stark mein Wunsch ist, ihn zu treffen, und mich zwingt, meine guten Absichten zu beweisen. Bewacht und geleitet von den Personen, die ihm am nächsten stehen, und angespornt von rätselhaften Tonaufnahmen und Kritzeleien, die er mir geschickt hat, suche ich monatelang nach einem sehr ungewöhnlichen Instrument, das er haben will; in endlosen Nächten kontaktiere ich verschiedene Leute, präsentiere sein Anliegen den örtlichen Behörden, kassiere eine Ablehnung und versuche es erneut, kassiere noch eine Ablehnung und versuche es wieder. Er kann es sich leisten, meinen Willen zu testen, ja, vielleicht ist es für ihn absolut notwendig, das zu tun, denn es zeigt sich, dass sehr viel mehr Leute ihn treffen und kennenlernen wollen, als ich mir in meinen wildesten Fantasien hätte vorstellen können.
Charles Manson ist eine Industrie mit Millionenumsatz. Jedes Jahr werden rund um die Welt neue Bücher, Filme, Fernsehsendungen, Platten, Hemden, Becher, Handtücher und Bildschirmschoner produziert und verkauft. Neue Bilder von ihm und Schlagzeilen zu unbekannten oder unveröffentlichten Fakten und Zitaten füllen Nachrichtensendungen, Tageszeitungen und Boulevardblätter.
Ich fahre zu Charles Manson, um zu erfahren, wie Mord jemanden zu etwas machen kann, das viele als größer empfinden als das Leben, zu einer ganzen Industrie. Ich fahre zu ihm, um die Bedeutung von Mansonomics, der Manson-Ökonomie, zu lernen. Ich lerne, dass es keine Rolle spielt, wer die Tat begangen hat oder was exakt geschehen ist – viele verdienen dennoch daran. Es gibt keine Rechte an dem schlimmsten Unrecht; und das bedeutet, dass jeder darauf Anspruch erheben und diese schreckliche Tat und das Monster, das sie ausgeführt hat, kommerziell nutzen kann. Sobald das Rad dann in Bewegung gesetzt wurde, gibt es nichts, was den Verlauf noch aufhalten kann. Das Interesse von Menschen in der ganzen Welt ist geweckt, und wie auf dem Aktienmarkt steigt der Wert immer weiter. Die Manson-Ökonomie wächst seit vierzig Jahren.
Wie man es auch sieht, Charles Manson ist eine Ikone. Sein Name bedeutet etwas für Menschen auf der ganzen Welt, sein Gesicht als Hemdaufdruck ist eine schreiende Botschaft für sich. Und sein Ikonenstatus hat sich zu einer Religion entwickelt. »Sie haben mich zu jemandem gemacht, ich brauchte ein Ventil, einen Zufluchtsort«, erzählt er mir und beschreibt den riesigen Druck, den Menschen aus der ganzen Welt auf ihn ausübten, weil sie nach verborgenen Symbolen in den Morden suchten und von seiner weltberühmten, geheimnisvollen Person angezogen wurden. Und auf seine typische rätselhafte, bildhafte Art fährt er fort: »Manson wurde zu groß, deshalb habe ich meinen Namen geändert.«
Sein neuer Name wurde ATWA, ein Akronym aus den Wörtern Luft (Air), Bäume (Trees), Wasser (Water), Tiere (Animals), und so lautet auch der Name einer Bewegung, deren Arm in fast alle Ecken der Welt reicht. Es ist eine Bewegung, die alle Merkmale einer Religion besitzt: eine Lebensphilosophie, einen allgemeinen und moralischen Verhaltenskodex, eine Menge leidenschaftlicher Anhänger in der ganzen Welt und nicht zuletzt eine vergötterte Lichtgestalt.
Eine Lichtgestalt, die mir erklärt: »Wir müssen die Bevölkerung loswerden. Etwas in die Treibstofftanks der Flugzeuge stopfen, das dann über Kalifornien verteilt wird, puff!, über Nevada, puff!, über Chicago, und weg damit!« Wie jedes mächtige, religiöse Idol hat er bereits bewiesen, dass er bereit ist, sehr weit zu gehen. Auf seine eigene furchtbare Weise hat er schon vorgelebt, was er lehrt.
In Charles Mansons Nähe ist es schwer, nicht in existenzielles Grübeln und seelisches Suchen zu verfallen; vielen ist es so ergangen, die im Laufe der Jahre seinen Weg gekreuzt haben. Ich tadele sie nicht, auch ich spüre das. Ich spüre das nicht nur, wenn ich bei Charles Manson bin, sondern auch, als ich Peter und Dorothea treffe. Und ich spüre es, als ich Issei treffe, dessen Name mir in den seltsamen Kreisen, in denen ich mich inzwischen bewege, ständig begegnet, bis ich merke, dass ich ihn unbedingt treffen muss. Vergöttert, ein Star mit Kultstatus. Wenn diese Menschen in der Hölle sind, warum sollte man nicht auch dorthin reisen wollen?
♦ ♦ ♦
»Mit dem Internet und dem Zugang zu allen möglichen Nachrichten wäre die Wirkung heute viel stärker als damals im Jahr 1992«, erzählt mir Wayne Lo, als ich ihn im Gefängnis in Boston an der amerikanischen Ostküste besuche. Hingerissen von den Möglichkeiten fährt er fort: »Heute haben die Leute Mobilkameras, die von allem, was geschieht, Bilder übermitteln können.«
So war es nicht, als er seine Höllentat beging. Er tötete zwei Menschen und verletzte vier lebensgefährlich, als er ein Schulmassaker anrichtete, bevor das Wort überhaupt existierte. Bevor es ein Teil der Allgemeinkultur wurde und ehe Schulkinder anfingen, eigenes Pressematerial am Computer zu entwerfen und dann mit Bomben und Maschinengewehren zur Schule zu gehen. Wayne Lo hat aus nächster Nähe die Entwicklung eines Gesellschaftsphänomens beobachtet, das inzwischen Teil unseres Lebens ist; die meisten von uns haben in irgendeiner Form einen Amoklauf an einer Schule miterlebt, das ist heute ein Teil unseres Wortschatzes. Ich bin zu Wayne gefahren, um zu verstehen, wieso das so ist.
»Heutzutage gibt es Nachrichtensender, die rund um die Uhr berichten und die jeder empfangen kann, nicht nur die Leute mit Pay-TV. Und das Internet ist ja auch den ganzen Tag zugänglich, jede Woche, dreihundertfünfundsechzig Tage im Jahr!« Der Amokläufer Wayne Lo wird auf ewig für den Schaden büßen, den er einer großen Anzahl von Menschen zugefügt hat. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass er sich auch grämt, weil die Welt, als er seine Tat beging, nicht so aussah wie heute. »Schau dir das ganze Phänomen der Massenmorde oder Amokläufe an Schulen und das Interesse daran doch an – man hat fast den Eindruck, die Leute warten nur darauf, dass der nächste passiert!«
Vielleicht interpretiere ich zu viel in seine Worte hinein, er sagt nie ausdrücklich, dass er heutzutage gern an einer Schule ein Massaker anrichten würde. Aber wenn es so wäre, dann wäre er bei weitem nicht der einzige mit solchen Überlegungen. Jeden Tag taucht auf Youtube oder ähnlichen Seiten ein neuer Videoclip mit der Bezeichnung school shooter, »Amokläufer an einer Schule«, auf. Jugendliche aus allen Ecken des nordamerikanischen Kontinents und aus Ländern in der ganzen Welt – Finnen, Deutsche, Kanadier, Engländer, Franzosen, ich finde sogar einen Clip aus einer konservativen amischen Gemeinde – begehen Amokläufe an Schulen. Ihre Taten werden mit Video- oder Handykameras gefilmt und direkt ins Netz gestellt, auf Youtube und anderen Internetplattformen gespeichert und somit zugänglich für Millionen von Zuschauern.
Bei weitem nicht alle Clips mit Amokläufern zeigen echte Amokläufe. In vielen Filmen lesen Jungen und Mädchen nur ihre vorbereiteten Texte vor, schimpfen und drohen improvisiert oder posieren dramatisch mit Waffen. Und bei weitem nicht alle Personen in den Clips machen ihre Drohungen wahr, aber sie alle haben eines gemeinsam: Sie wollen als Amokläufer angesehen werden.
Inmitten der Filme von Leuten, die wie ihre Popmusik-Idole posieren und zu den neuesten Hits Playback singen, werden viele der Amokläuferclips unmittelbare Erfolge, die Millionen von Zuschauern anziehen. Wenn ich Rihanna-Imitatoren Seite an Seite mit Amokläufern in der Liste von aktuellen Clips auf der Startseite von Youtube sehe, fällt mir auf, wie sehr sie sich ähneln: Alle sind sie Kinder, die gesehen, verehrt, geliebt werden wollen, die jemand sein wollen. Und ich bekomme den Eindruck, dass hier Vergangenheit und Zukunft aufeinanderprallen: eine Vergangenheit, in der Wayne Lo und ich noch in die Schule gingen und sich die meisten Jugendlichen kleideten und benahmen wie ihre Lieblingsstars aus Film und Musik, und eine Gegenwart, in der manche über eine Datei den Weg zur Berühmtheit entdeckt haben, indem sie sich mit einer Waffe in den Händen zeigen.
»Jedes Mal, wenn sich ein neuer Vorfall ereignet, werde ich paranoid und fürchte, dass sie vielleicht irgendwie meine Tat kopiert haben«, gesteht Wayne mir. Aber auch wenn sein Amoklauf nicht so viel Aufmerksamkeit wie die nachfolgenden an Schulen wie der Columbine High School oder der Virginia Tech erregte, ist er noch immer einer der bekanntesten Fälle. Und im Laufe der Jahre wanderte Waynes Name um die Welt, und alte Zeitungsausschnitte und Fernsehreportagen haben im Internet ein neues Publikum erreicht.
Jener Wayne, der zu seiner Schulzeit nie gespürt hat, dass er irgendwo dazugehörte, wirkt bei unserem Treffen recht selbstsicher. Er scheint sich mit seinem Image als gemarterter Amokläufer recht wohlzufühlen und steht in ständigem Kontakt mit Freunden aus allen Ecken der Welt, die ihn im Netz gefunden haben und sich nun auf Facebook, Twitter und allen anderen digitalen Entsprechungen eines Schulhofs, an dessen Rand er einst stand, um ihn scharen.
♦ ♦ ♦
Bei meiner Wanderung mit Monstern habe ich fünf verschiedene Menschen getroffen, getrennt durch Zeit und Raum, unterschiedlich in Alter, Hautfarbe, Geschlecht und Hintergrund. Aber eine Sache haben sie alle gemeinsam: Sie haben getötet. Oder besser gesagt: Sie wurden alle für Mord verurteilt. Dorothea und Charlie haben nie gestanden, dass sie jemanden von eigener Hand getötet haben. Aber ihnen allen ist gemein, dass die Welt sie als Mörder ansieht. Und dafür sind sie bekannt und berühmt.
Ihre Geschichten spannen sich über drei Kontinente, von Nordamerika mit Dorothea und Charlie weit drüben an der Westküste und Wayne an der Ostküste über Peter in Europa bis zu Issei in Japan. Die abscheulichen Taten, für die sie verurteilt wurden, erstrecken sich über fünf Jahrzehnte – von Mansons blutigen Gemetzeln in den Sechzigern, über Dorotheas knochendurchsetzten Garten und Isseis blutrünstiges Festmahl in den Achtzigern, Waynes grausamen Amoklauf in den Neunzigern bis hin zu Peters unmenschlichem Morden in den ersten Jahren nach der Jahrtausendwende.
Ihr Modus Operandi, die Art und Weise, mit der sie das Leben ihrer Opfer beendeten, variiert von Vergiften, Erstechen und Genickschuss mit einem Gewehr bis hin zum Nackenbruch des Opfers oder dem Akt, es mit einem Maschinengewehr umzumähen. Aber alle Taten haben zu demselben Ergebnis geführt: Sie haben Stars geschaffen. Fünf ziemlich anonyme Menschen wurden durch ihre Morde zu Berühmtheiten, attraktiven Partnern und profitablen Industrien. Was sagt das eigentlich über die Welt aus, in der wir leben?
Issei, Peter, Wayne, Dorothea und Charlie sind das Zeugnis von etwas Fundamentalem in uns allen und in der ganzen Gesellschaft, das schon immer existierte – schon seit Jack the Rippers erstem Brief mit der Unterschrift »Aus der Hölle«, der eine Gewaltorgie in der Presse auslöste, welche das Heranwachsen der gesamten englischen Medienindustrie befeuerte. Der Brief zauberte eine Menge Leute hervor, die die Morde gestanden und hofften, einen Teil der Ehre und des Geldes zu erhalten, das damit verbunden war. Jack the Ripper inspirierte zahlreiche Trittbrettfahrer in ganz Europa, deren Taten wiederum ähnliche Auswirkungen hatten. Diese Faszination gab es schon früher; beispielsweise wurden im Frankreich des 18. Jahrhunderts spezielle Drucksachen über aktuelle Mordprozesse hergestellt und an jene verkauft, die nicht das glückliche Los hatten, einen Platz in den Gerichtssälen zu ergattern. Und wenn wir das Rad der Geschichte noch weiter zurückdrehen, in die Zeit der unerhört beliebten öffentlichen Hinrichtungen von Mördern im antiken Rom, sehen wir, das schon damals sich alle mit großer Begeisterung versammelten und Naschereien und Erinnerungsstücke kauften wie heutzutage bei den Rockkonzerten.
Issei, Peter, Wayne, Dorothea und Charlie sind ein Teil unserer langen, blutigen Geschichte. Und sie sind ein Teil unserer Gegenwart; unserer Kultur, unserer Ökonomie und einer Gesellschaft mit Trieben, die sich in der Dunkelheit besonders wohlfühlen.
Hier sind ihre Geschichten.
DER JAPANISCHE RIESE
ISSEI SAGAWA
»A friend of mine was this Japanese. He had a girlfriend in Paris. He tried to date her in six months and eventually she said yes. You know he took her to his apartment, cut off her head. Put the rest of her body in the refrigerator, ate her piece by piece. Put her in the refrigerator, put her in the freezer. And when he ate her and took her bones to the Bois de Boulogne, by chance a taxi driver noticed him burying the bones. You don’t believe me? Truth is stranger than fiction. We drive through there everyday.«
»DU MAGST ES NICHT.« Issei Sagawa ist enttäuscht. Er stellt das hübsch gerahmte Foto von der Vagina einer Frau zurück auf das Fensterbrett, wo es sich den begrenzten Platz teilt mit Porträts von Familienmitgliedern und Freunden und Glückwünschen zu seinem Geburtstag, den er vor kurzem gefeiert hat. Er lässt den Blick ein paar Sekunden darauf ruhen.
Wir befinden uns in Isseis Atelier, wo er seine Werke aufbewahrt und sich inspirieren lässt. Er hat das Foto der Vagina aus einem Schrank geholt. Darin gibt es eine ganze Sammlung von Vaginaablichtungen, die ich gern bewundern darf, wenn ich möchte. Offenbar hängt Issei sehr an seiner Sammlung, daher trifft und wundert ihn meine passive Reaktion.
Im Nachhinein wird mir klar, dass ich mich wie Alice benahm, als sie im Wunderland landete und sich mitten in einem Märchen wiederfand, überwältigt und stumm. Auch ich befand mich in einer solch irrealen Welt, als ich in diesem Atelier in Kawasaki in der Bucht von Tokio stand.