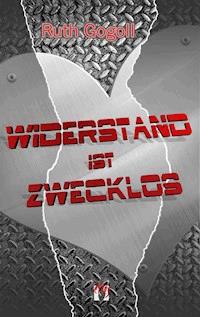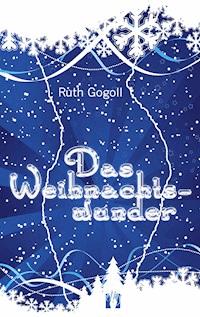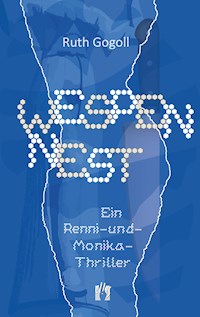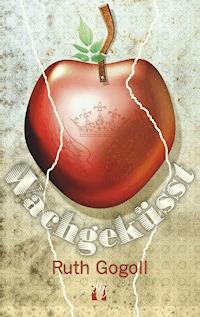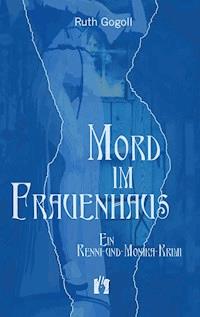
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: el!es-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Renni-und-Monika-Krimis
- Sprache: Deutsch
In einem Haus für geschlagene Frauen wird eine Leiche gefunden. Kommissarin Renni nimmt schnell den Ehemann fest, der verdächtig zu sein scheint, aber da geschieht ein zweiter Mord. Allem Anschein nach hat es Renni mit einem Serienmörder zun tun, doch wer könnte ein Interesse daran haben, unschuldige Frauen reihenweise umzubringen? Renni und Monika stehen vor einem unlösbar erscheinenden Rätsel - bis der nächste Mord geschieht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ruth Gogoll
MORD IM FRAUENHAUS
Der zweite Renni-und-Monika-Krimi
Originalausgabe: © 2000 ePUB-Edition: © 2013édition el!es
www.elles.de [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-95609-028-8
Coverfotos: © StefanieB. – Fotolia.com
»Wenn du mich jetzt anfasst, werde ich zur reißenden Bestie. Ich kann mich kaum noch zurückhalten«, wisperte ich mit heiserer Stimme in ihr Ohr.
Monika lachte geschmeichelt und erregt. »Dann komm, du Bestie . . .«, flüsterte sie verführerisch. Sie ließ ihre Hand an meinem Arm abwärts gleiten und zog sich langsam von mir zurück. Immer noch rückwärts gehend bewegte sie sich auf das Schlafzimmer zu. »Komm . . .«, wiederholte sie und streckte eine Hand verlangend nach mir aus.
Mein Mund wurde so trocken wie die Sahara kurz vor Beginn der Regenzeit – wenn es dort so etwas wie Regen überhaupt gibt. Mein Regen sammelte sich jedoch nicht in den Wolken, sondern weit mehr südlich. Trotzdem konnte ich mich nicht bewegen. Meine Muskeln schienen wie gelähmt. Während Monika einen Schritt nach dem anderen hinter sich setzte und fast schon aus meinem Gesichtsfeld entschwunden war, stand ich immer noch da und starrte ihr nach.
Nach einer Minute endlich konnte ich meinen Beinen den Befehl übermitteln, sich vorwärts zu bewegen. Wie ein Roboter folgte ich Monikas Spuren, steif und ungleichmäßig setzte ich meine Schritte. Ein Glück, dass ihre Wohnung nicht so groß war! Als ich durch die Schlafzimmertür trat, sah ich sie auf dem Bett liegen, nackt und wie eine Rubensfigur quer über das Laken drapiert. Etwas Verführerischeres hatte ich noch nie gesehen. Ihre Beine hatte sie ebenso leicht und unauffällig geöffnet wie ihren Mund. Beides lockte mich, es näher zu untersuchen.
»Monika!« hauchte ich nur überwältigt.
Sie lächelte. »Gefällt es dir so?« Obwohl sie sich ja nun bestimmt nicht unabsichtlich so hingelegt hatte, enthielt ihre Frage mehr als einen Hauch von Unsicherheit.
»Oh ja«, stotterte ich fast. Meine Stimme gehorchte mir nun vor Trockenheit und Überraschung beinahe überhaupt nicht mehr. »Sehr.« Ich ging langsam auf sie zu und beugte mich zu ihr hinunter. Sie öffnete schon erwartungsvoll die Lippen, bevor ich sie erreicht hatte. Wie in Zeitlupe senkte ich meinen Mund auf ihren und suchte mit meiner Zunge die warme, weiche Nässe auf der anderen Seite. Sehr vorsichtig genoss ich die zarte Sanftheit ihrer Lippen und ihre Zungenspitze, die mich einlud näherzukommen. »Ich habe dich vermisst«, flüsterte ich an ihrem Mund.
Sie löste sich ein wenig und sah mich an. »Ich dich auch.« Ihre Lippen fuhren leicht geöffnet über meine Wange, so dass es überall kribbelte – nicht nur in meinem Gesicht . . . »Aber ich konnte nicht. Du hast –«
»Psch«, machte ich und legte einen Finger über ihre Lippen. »Lass uns ein andermal darüber reden, einverstanden? Jetzt bin ich zu sehr . . .«, ich grinste auf sie hinunter, ». . . abgelenkt.«
Sie lächelte in ihrer höchst femininen Art zurück, die sie nur zeigte, wenn wir allein waren. Sonst spielte sie ja eher die Harte, Unnahbare. »Ach ja? Wovon denn?« fragte sie hinterlistig mit einem belustigten Funkeln in den Augen.
Ich ließ mich auf sie hinuntersinken. »Das weißt du ganz genau«, knurrte ich gespielt. Ich nahm ihren Mund und saugte an ihren Lippen, während meine Zungenspitze dagegenstieß. Wie immer stöhnte sie nicht auf. Ich hätte es getan an ihrer Stelle, aber für sie waren Geräusche nicht selbstverständlich. Sie musste sich dazu zwingen. Obwohl ich es vermisste und so den Stand ihrer Erregung erraten musste, wollte ich nicht, dass sie das tat. Es würde sie verunsichern, wenn ich sie darauf ansprach, das wusste ich. Wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen. Also verzichtete ich darauf und küsste sie weiter. Jetzt war meine Zunge ganz in ihren Mund eingedrungen und hatte sie erobert. Sie wehrte sich nicht.
Ihre Hände wanderten zu meiner Brust und begannen, mein Hemd aufzuknöpfen. Im Gegensatz zu ihr musste ich dabei aufstöhnen, als sie meine Haut berührte, und verließ deshalb kurz ihren Mund, um Luft zu holen. »Du machst mich verrückt«, flüsterte ich dann in ihr Ohr. »Allein nur dadurch, dass du mich berührst.«
»Schön«, wisperte sie zurück und schob mir das Hemd von den Schultern. Als sie es mir ganz ausgezogen hatte, glitten ihre Hände tiefer und öffneten mit einer schnellen Bewegung meine Hose. Im gleichen Moment glitt auch schon ihre Hand hinein und suchte den heißen Punkt zwischen meinen Beinen.
»Monika!« stöhnte ich gequält auf. »Du bist zu schnell. Ich will noch nicht . . .«
»Ich will aber«, erklärte sie energisch und erregt. »Ich will hören, wie du kommst.« Ihre Hand bewegte sich in immer schneller werdendem Rhythmus zwischen meinen Schenkeln.
»Nicht!« stöhnte ich noch einmal, aber ich hatte keine Chance gegen ihre Entschlossenheit. Im nächsten Moment spürte ich, wie sich mein Unterleib zusammenzog und mich die heiße Welle überschwemmte.
Monika ließ mir keine Zeit, mich zu erholen; sie öffnete die Beine und umschlang mich mit ihren Schenkeln.
»Ich würde mich gern ausziehen«, wagte ich einzuwenden, als sie begann ihre Hüften von unten gegen mich zu stoßen.
»Später.« Sie keuchte ein bisschen von der Anstrengung, aber ihre Bewegungen wurden dennoch immer härter und schneller. »Jetzt will ich dich so, wie du bist. Das ist schöner.«
Vielleicht für sie! Ich fand meine Hose eher störend. Dennoch erhitzte es mich erneut, wie ich sie unter mir arbeiten sah. Das hatte sie so noch nie getan. Sie musste sehr erregt sein, obwohl sie es kaum zeigte. Allein ihre Bewegungen sprachen eine deutliche Sprache. Die einzigen Geräusche waren ihr schweres Atmen und das Reiben der beiden Seiten meines offenen Reißverschlusses aneinander, ein rhythmisches metallisches Klicken, das mit jeder ihrer Bewegungen schneller und abgerissener wurde. Ich hatte bis heute nicht gewusst, wie erotisch ein Reißverschluss klingen konnte, wenn er schon geöffnet war.
Sie schwang unter mir vor und zurück, stieß gegen mich und murmelte immer wieder meinen Namen. Ich bewegte mich mit ihr mit, und meine Brustwarzen wurden hart vor Erregung. Ich wollte nackt sein, um sie ebenso nehmen zu können! Plötzlich keuchte sie auf: »Renni!« und erstarrte. Ihre Schenkel umklammerten mich so fest, dass ich fürchtete, demnächst keine Luft mehr zu bekommen. Als ich glaubte, es schon fast nicht mehr aushalten zu können, ließ sie endlich los und sank zurück.
Ich atmete tief ein, als ich es wieder konnte, und beugte mich zu ihr hinunter, um ihr einen sanften Kuss zuerst auf die Lippen und dann auf ihre geschlossenen Augenlider zu hauchen. »Ich wusste nicht, dass du mich so sehr vermisst hast«, bemerkte ich lächelnd.
Da sie nicht gleich antwortete, betrachtete ich weiter ihre geschlossenen Lider mit den dichten, dunklen Augenwimpern. Wunderschön. Ihr Gesicht wirkte entspannt, aber eindeutig musste sie sich erst noch von der eben vollbrachten Anstrengung erholen. Dann schlug sie die Augen auf. »Oh ja«, erwiderte sie leise, »das habe ich.« Sie blickte ernst. Ich wusste nicht, ob das nur ihrer Erschöpfung zuzuschreiben war oder etwas anderem. Bedauerte sie, was sie eben getan hatte?
»Du hast es nie . . . ich meine, du hast nie gezeigt . . .«, stotterte ich etwas ungeschickt herum. Wir hatten uns schließlich des Öfteren bei der Arbeit gesehen, und nie hatte sie auch nur eine Andeutung gemacht, dass es ihr etwas ausmachte, dass wir uns nicht mehr privat trafen.
»Tue ich das je?« fragte sie jetzt wieder ein wenig schmunzelnd.
Ich blickte auf sie hinunter, und ich fühlte mich sehr zu ihr hingezogen. Sie war so liebenswert! Ich schüttelte den Kopf. »Nein, wohl nicht«, bestätigte ich. Das einzige, was sie normalerweise sofort offen zeigte, waren ihre Wut oder ihr Ärger. Mit positiven Gefühlen oder dem Äußern eigener Bedürfnisse hingegen hatte sie so ihre Probleme, das wusste ich ja. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie es ihr möglich war, sich so zu beherrschen.
Sie lachte leise auf. »Dir hat man es jedenfalls sofort angesehen«, meinte sie.
»Ja?« Ich war überrascht. Schien bei mir denn alles so offensichtlich?
»Ja«, bestätigte sie. »Jedes Mal, wenn wir zusammen mittags in der Kantine saßen, hast du mich mit Blicken verschlungen. Ich hatte manchmal schon Schwierigkeiten, trotzdem ganz ruhig weiterzuessen.« Sie lächelte ein wenig schelmisch.
Geringfügig beleidigt schmollte ich leicht vor mich hin. Gequält hatte ich mich, ihr gegenüber neutral zu wirken, um unsere Vereinbarung einzuhalten, und dann hatte es gar nichts genützt? Und sie hatte es auch noch genossen, mich leiden zu sehen! »Aber du hast nie reagiert«, rebellierte ich schwach.
»Nein«, sagte sie. »Wie sollte ich?«
Das war eine Frage, die ich nicht beantworten konnte. In der Beziehung waren wir einfach viel zu verschieden. Für uns galt wohl eher Gegensätze ziehen sich an als Gleich und gleich gesellt sich gern.
Alles, was bei mir sofort ins Auge fiel, was ich gar nicht verstecken konnte, war bei ihr unsichtbar, wenn sie es wollte. Obwohl sie es in keiner Weise darauf anlegte, war sie eine geheimnisvolle Frau, deren Tiefen man kaum auszuloten in der Lage war. Das einzige, was eine spontane Reaktion bei ihr hervorrief, schien eine Provokation zu sein, die ihre Wut hochschnellen ließ. Dann plötzlich konnte sie sich nicht mehr beherrschen, und zwar von jetzt auf gleich. Aber ich wollte sie ja nicht immer nur wütend erleben, um ihre Spontaneität zu genießen. Obwohl – ich konnte mich ja jetzt im Moment auch nicht beklagen, denn das war doch recht spontan gewesen, was sie da eben getan hatte, und es hatte nichts mit Wut oder Ärger zu tun. Sie entwickelte sich . . .
Ich glitt zwischen ihren Beinen hinunter und küsste schnell ihre heißeste Stelle, die jetzt nach dem Orgasmus noch heißer und verführerisch nass pulsierend zwischen ihren Schenkeln hervorblitzte. Purpurrot öffnete sich ihre wundervolle Blume vor mir, als ich mit meiner ganzen Zunge der Länge nach darüberfuhr. »Renni!« hörte ich sie flüstern, nicht stöhnen, nicht seufzen, nur leise und unterdrückt flüstern, das war alles. Aber dass sie ihre Erregung überhaupt so zeigte, war schon ein Fortschritt.
Ich glitt wieder nach oben und sah auf ihr Gesicht hinunter. »Ich wollte nur kurz Guten Tag sagen«, scherzte ich.
»Du bist gemein!« quetschte sie zwischen den Zähnen hervor. »Du weißt genau, dass ich schon genug Schwierigkeiten habe, das überhaupt zuzulassen, und dann . . .« Sie drehte verlegen den Kopf zur Seite.
»Und dann?« fragte ich nach. »Was ist dann?«
Sie schlug mit der Faust nach mir. Nicht sehr fest, aber der Schlag, der auf meinem Arm landete, würde sicher einen blauen Fleck hinterlassen. Ich war da sehr empfindlich.
»Ich weiß«, lenkte ich friedlich ein. »Ich weiß ja, was los ist.« Ich beugte mich wieder zu ihr hinunter und wanderte mit meinen Lippen über ihre Wange zu ihrem Mund, den sie zur Seite gedreht hatte. »Ich möchte mich nur ausziehen, darf ich das?«
Sie blinzelte mir mit einem Auge zu – mit dem, das ich sehen konnte – und drehte dann ihren Kopf zurück, um sich küssen zu lassen. Hingebungsvoll drang ich noch einmal in ihren Mund ein und genoss ihre Süße, bis ich fast nicht mehr atmen konnte. Am liebsten hätte ich gar nicht mehr aufgehört. Als ich mich dann doch zurückzog, schnappten wir beide ein wenig nach Luft. »Den Kuss hätten wir stoppen sollen«, bemerkte sie spitzbübisch. »Ich fühlte mich fast wie unter Wasser und meilenweit von der Oberfläche entfernt. Als ob ich nicht mehr rechtzeitig nach oben kommen würde, um zu atmen. Aber es war mir egal.«
Ich lächelte sie liebevoll an. »Ja, so fühlte ich mich auch. Ich wollte dich einfach nicht mehr loslassen. Du warst so wundervoll süß.«
Ihr Blick kehrte sich nach innen, als ob ich etwas Falsches gesagt hätte, dann merkte ich, wie ihre Augen feucht wurden. Bevor ich jedoch zu viel sehen konnte, umarmte sie mich fest und zog meinen Kopf an ihre Schulter. An meinem Hals spürte ich, wie sie schluckte. Als sie sich wieder gefangen hatte, ließ sie mich los. Jetzt durfte ich sie anscheinend wieder ansehen. »Du bist einfach süß«, wiederholte ich noch einmal. »Lass dir das doch ruhig von mir sagen. Warum ist das so schlimm für dich?« Ich verstand nicht ganz, was das Problem war.
Sie schüttelte den Kopf und presste die Lippen etwas aufeinander. Darauf schluckte sie erneut. »Es ist ja gar nicht schlimm«, entgegnete sie dann flüsternd. Ihre leise Stimme drang kaum an mein Ohr. »Es ist nur so schön. Du weißt, dass ich es nicht gewöhnt bin, dass jemand so nett zu mir ist – im Bett.«
»Ja, ich weiß.« Ich beugte mich wieder zu ihr hinunter und küsste sie leicht auf die Lippen, bis sie sich entspannte. Ihre nicht sehr schönen Erfahrungen mit Männern würden wohl noch lange nachwirken. Während ich sie beobachtete, um zu erkennen, ob sie sich wieder erholt hatte, richtete ich mich auf und schob meine Hosen von den Hüften, um mich endgültig auszuziehen.
»Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir uns auf diesem Terrain noch einmal wiedersehen würden«, lächelte sie jetzt wieder. »Eigentlich hatte ich beschlossen, dass ich . . . dass du –« Anscheinend schien sie das Thema plötzlich nicht mehr zu interessieren, denn sie hob die Hände und griff nach meinen Brüsten, als wolle sie sie wiegen.
»Nicht so schwer wie deine«, grinste ich fast ein wenig entschuldigend.
»Das macht nichts«, murmelte sie, als wäre sie nicht in der Stimmung, sich zu unterhalten, was sie sicher auch nicht war. »Es ist nur . . . es ist immer noch so neu für mich, das zu spüren. Ich möchte . . . ich möchte –« Sie brach ab und betrachtete meine Brüste mit forschenden Blicken, mit forschenden, verschleierten Blicken, müsste ich eigentlich sagen; es sah so aus, als ob allein der Anblick sie erregte.
Ich wagte nicht, mich zu rühren bei so viel Bewunderung ihrerseits, und außerdem ließ die Abtastung meiner Brüste, die Monika vollführte, mich nicht kalt. Sie hatte die Brustwarzen noch nicht berührt, aber ich merkte, wie sie sich immer mehr hervorreckten, um von ihr entdeckt zu werden. Es tat fast schon weh. Die Haut reichte nicht mehr aus, es schien, als könne sie sich nicht mehr dehnen, sondern würde im nächsten Moment aufplatzen.
»Was möchtest du?« presste ich mühsam hervor. Es fiel mir bereits schwer, mich überhaupt aufs Sprechen zu konzentrieren. Und obwohl ich sehr genaue Vorstellungen davon hatte, was ich wollte, beabsichtigte ich, ihr den Vortritt zu lassen. Sie hatte ihre Wünsche in dieser Beziehung zu selten äußern können, weit seltener als ich jedenfalls, so gut wie nie, wenn man einmal von unser beider Beisammensein vor einiger Zeit absah. Jetzt sollte sie das Recht dazu haben, dieses Ungleichgewicht zu ihren Gunsten zu verschieben.
»Ich kann nicht«, flüsterte sie. »Ich kann es nicht sagen.«
»Was?« Ich wusste nicht, was sie wollte, sonst hätte ich ihr ihren Wunsch auch unausgesprochen erfüllt, aber so . . . »Was kannst du nicht sagen?« fragte ich noch einmal und strich mit meiner Hand über ihr Haar, das etwas wirr nach vorn hing und halb ihr Gesicht verdeckte.
Sie drehte ihren Kopf in meine Handfläche und ließ sich streicheln. Während sie mit ihren Lippen an meiner Haut knabberte, versuchte sie, sich zu sammeln. »Ich stelle mir vor . . .« Sie konnte nicht weitersprechen. Eine heiße Röte schoss in ihr Gesicht. Ich streichelte weiter ihre Wangen, in der Hoffnung, dass sie das beruhigen würde. »Ich stelle mir vor«, begann sie wieder mühsam, »wie es wäre, auf dir zu sitzen, auf deinen Brüsten, und sie unter mir zwischen meinen Beinen zu spüren. Sie sind so weich, so anders . . .« Sie brach wieder verlegen ab. Sie wusste, dass ich es hasste, mit einem Mann verglichen zu werden, aber ich konnte sie verstehen. Auf einem Mann zu sitzen, war ganz sicher extrem anders, und weich war da wohl auch nichts . . .
Ich legte mich zurück. Meine Hose behinderte mich immer noch, weil ich sie nicht endgültig hatte ausziehen können. Das sagte ich ihr.
»Das ist schön«, lächelte sie zufrieden. »So habe ich dich besser im Griff, und du kannst nicht weglaufen.«
»Ich laufe nicht weg«, widersprach ich etwas indigniert. Zu diesem Zeitpunkt? Wie kam sie darauf?
»Das habe ich aber anders in Erinnerung«, neckte sie mich. Würde sie das denn nie vergessen?
Ich seufzte ergeben. Als ich endgültig auf dem Rücken lag, begann sie, sich an mir hochzuschieben. Ihre Schenkel umschlossen zuerst meine Beine, dann meine Hüften, quetschten meine Rippen etwas zusammen und kamen dann in meinen Achselhöhlen zur Ruhe. Weiter traute sie sich anscheinend nicht.
»So kannst du aber höchstens auf meinem Bauchnabel sitzen«, lockte ich sie. Sie hatte mich heiß gemacht, und ich wollte sie jetzt genauso spüren, wie sie es beschrieben hatte.
Sie beobachtete mich aufmerksam, als ob sie erwarten würde, dass ich ihr irgend etwas antat. Im Bett misstrauisch zu sein war ihr zur zweiten Natur geworden.
Langsam ließ ich meine Arme zu ihren Hüften wandern und streichelte sie. »Noch ein bisschen höher«, bat ich sie rau. Meine Stimme glich eher einem rostigen Nagel. Ich hätte sie am liebsten ergriffen und mich auf sie geworfen. Meine Beine begannen bereits, unter ihr zu zucken. Ich wusste, dass sie das noch unsicherer machen würde – das war auch letztes Mal so gewesen –, aber ich konnte es nicht verhindern. »Dann kannst du alles spüren, was du möchtest«, versprach ich ihr.
Sie sah hinter sich auf meine Beine, wie ich vermutet hatte.
»Ich tue dir nichts«, versicherte ich ihr. »Das weißt du doch.«
Sie blickte wieder auf mein Gesicht hinunter und nickte. »Ja«, hauchte sie, »ich weiß.« Dann schob sie langsam einen Schenkel über meinen Arm und ließ sich zurücksinken. Schlagartig hielt sie die Luft an.
Ich konnte sie jetzt nicht mehr festhalten, weil sie meinen Arm unter sich festgeklemmt hatte, aber ich hätte es gern getan, denn ich befürchtete, sie würde umfallen, so wackelig sah sie aus. Sie hatte die Augen geschlossen und schwankte wie eine Turmspitze über mir hin und her. »Monika?« fragte ich leise.
Sie atmete aus, als ob sie fürs Tiefseetauchen geübt hätte. »Nichts«, wisperte sie immer noch mit geschlossenen Augen. »Es ist ein wundervolles Gefühl, Renni. So weich, so voll, so unsagbar sanft.« Sie bewegte ihren Unterleib ein wenig gegen meine Brust und biss sich auf die Lippen, wahrscheinlich, um das Stöhnen zu unterdrücken. Warum tat sie es nicht einfach? Warum beherrschte sie sich so?
»Ich weiß«, bestätigte ich immer noch leise. »Ich mag das auch.«
Sie griff mit beiden Händen an sich hinunter und hob ihren Po und ihre Schenkel ein wenig an, um zu versuchen, meine Brust fast in sich hineinzuschieben. Das ging natürlich nicht, also ließ sie sich wieder darauf nieder, aber sie hatte meine Brustwarze – zufällig oder auch nicht – so positioniert, dass sie zwischen ihren Schamlippen lag. Jetzt biss ich mir auf die Lippen, um nicht zu schreien. »Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal freiwillig tun würde«, flüsterte sie. »Freiwillig etwas in mich hineinwünschen würde.« Sie öffnete erschrocken die Augen und sah auf mich hinunter. »Entschuldige«, meinte sie peinlich berührt. »Ich wollte das eigentlich nicht aussprechen, nur denken.«
»Aber Monika!« Ich hob den einen Arm, den ich noch freihatte, und streichelte wieder ihr Gesicht. »Warum denkst du immer, du darfst nicht sagen, was du fühlst – wenn es etwas Schönes ist?«
Sie lächelte verunsichert. »Es ist ja nicht einfach nur schön, es ist . . .«
»Sex?« vollendete ich für sie. Und weil Sex bis vor kurzem in ihren Augen etwas Schmutziges und Demütigendes gewesen war, glaubte sie, dass sie ihr Vergnügen jetzt auch nicht zeigen dürfte. Dass sie es vielleicht erst gar nicht empfinden dürfte.
Sie nickte.
Ich schob meine Brust noch ein bisschen mehr zwischen ihre Beine, und sie zog scharf die Luft ein. Gleichzeitig fuhr mir ein Blitz durch den ganzen Körper bis hinunter in die tiefsten Tiefen meines Unterleibs. Meine Brustwarze lag genau da, wo sie am meisten gereizt wurde. Ich presste meine Lippen so sehr zusammen, dass meine Zähne von innen die obere Hautschicht durchschnitten. Nur leicht natürlich, aber es schmeckte nach Blut. Sie begann ihre Hüften auf meiner Brust vor und zurück zu bewegen und legte den Kopf in den Nacken, als sie die Luft ausstieß, die sie so lange angehalten hatte.
Jetzt konnte ich nicht mehr. Ich stöhnte auf. »Oh Himmel – Monika! Das ist mehr als . . . mehr als schön!« keuchte ich zum Schluss nur noch unter Schwierigkeiten. Ihre Schamlippen hielten meine Brustwarze umklammert, als wollten sie sie nie wieder loslassen. Ich hatte selten etwas so Berauschendes gefühlt. Viel intensiver, als wenn sie es mit dem Mund gemacht hätte. Die klebrige Nässe, das Geschwollene ihrer Schamlippen und ihre Bewegung beförderten mich in einen Zustand höchster Ekstase. Mehr und mehr fühlte ich, wie ihre Schamlippen pulsierten, wie ihre Klitoris sich immer mehr hervorwölbte, immer härter wurde und in meine Brusthaut eindrang, wie ihre Scheidenmuskeln sich zusammenzogen und meine Brustwarze wie mit einer Vakuumpumpe in die Tiefe der Höhle hineingezogen und wieder ausgestoßen wurde, ohne sich befreien zu können. Sie massierte meine halbe Brust gleichzeitig mit, und der Reiz an der Brustwarze wurde so unerträglich, dass ich mich ihr am liebsten entzogen hätte. »Mo-!« Ich schaffte es nicht mehr, ihren Namen auszusprechen, denn im gleichen Moment wölbte sie sich mit ihrem ganzen Körper nach hinten und versteifte sich wie ein Brett, während die Muskeln zwischen ihren Beinen meine Brustwarze einklemmten und so sehr zusammenquetschten, dass mich der Orgasmus trotz der langen Aufregungsphase fast unerwartet überfiel. Ich schrie. Sie sagte keinen Ton, gab keinen Laut von sich. Ich konnte es nicht fassen.
Als sich die Spannung in uns beiden löste, fiel sie auf mich herunter, unterdrückt keuchend, mit kleinen Pausen zwischen jedem Atemzug, als ob sie selbst das nicht zeigen wollte. Aber in diesem Fall nahm sich ihre Lunge einfach das Recht, atmen zu dürfen, und sie konnte es nicht verhindern. Sie hob ihren Schenkel von meiner Schulter und kuschelte sich an meine Brust.
»Du bist aber eine wilde Stierin«, grinste ich in Anspielung auf ihr Sternzeichen, nachdem wir eine Weile so gelegen und uns wieder erholt hatten.
»Hab ich doch gesagt«, lächelte sie zurück. »Allerdings wusste ich nicht . . . ich wusste nicht, dass sich das auch in dieser Beziehung so auswirkt. Ich meine, ich wusste es nicht, bis ich dich . . .«
»Das freut mich«, lächelte ich sie beruhigend an. Sie konnte einfach nicht offen über dieses Thema reden und brach jedes Mal ab, wenn sie sich ein Stückchen weit vorgewagt hatte. »Es freut mich, dass du dich wohlfühlst.«
»Oh ja, das tue ich«, wisperte sie nur noch kaum vernehmbar. Dann war sie auch schon eingeschlafen.
Ich beobachtete noch eine Weile ihr entspanntes Gesicht, dann schlief ich auch ein und träumte von einer weiten Landschaft, auf der ich mir wie gefangen vorkam. In der Ferne sah ich Tiere näherkommen, und nach einer Weile erkannte ich, dass es große graue Rinder waren. Ihre Hörner erschienen immer länger und gefährlicher, je mehr sie sich mir näherten, und ihre Körper wuchsen bei jedem Schritt, den sie in meine Richtung taten, um gigantische Höhen an. Als sie nur noch wenige Meter von mir entfernt waren und es mir schon so erschien, als würden sie gleich über mich hinwegtrampeln, wachte ich auf.
Ich schüttelte den Kopf. Was für ein merkwürdiger Traum! Dann sah ich auf Monika hinunter, die immer noch schlief, obwohl es draußen bereits hell war, und zog meine Schulter, auf der sie lag, vorsichtig unter ihr hervor. Es war ihre Wohnung, und ich kannte mich nicht besonders gut hier aus – kein Wunder, wir beide kannten uns ja wirklich noch nicht lange und hatten die meiste Zeit im Bett verbracht –, aber Tee oder Kaffee zum Frühstück würde ich sicher finden. Ihre Küche war kein eigener Raum, sondern nur eine große Ecke, die vom Wohnzimmer abgeteilt war. Als ich die verschiedenen Schränke dort öffnete, fand ich sogar mehrere Teesorten zur Auswahl. Ich entschied mich für einen grünen Tee, der mich wachmachen würde, und nahm die Tasse mit hinaus auf die kleine Terrasse, die ebenfalls vom Wohnzimmer abging.
Zwei Gartenstühle und ein kleiner Tisch sahen recht einladend aus und wiesen darauf hin, dass die Besitzerin die Terrasse wohl nicht nur als Abstellraum benutzte. Ich setzte mich. Obwohl die Wohnung mitten in der Stadt lag, gab es nach hinten hinaus einen kleinen Garten, der zwar leicht verwildert, aber dennoch benutzt aussah. Etwas buntes Kinderspielzeug lag herum, und ein paar Stühle und Sonnenschirme waren regengeschützt unter ein Vordach geschoben. Diese Art Wohnungen war gar nicht so selten in dieser Stadt, in der es Stadtviertel gab, die Paradies hießen. Man wohnte in der Stadt und doch gleichzeitig fast im Grünen. Das hatte mich total fasziniert, als ich von Köln hierher gekommen war. Dort kannte ich so etwas nicht oder nur von reichen Leuten. Hier war es für viele selbstverständlich.
Der Herbst hielt langsam Einzug, das konnte man an den Blättern der Bäume erkennen, die begannen, sich auf ihren farbigen Tod vorzubereiten, und an der Luft bemerken, die bereits diesen Hauch von Nebel in sich trug, der die Monate zwischen Oktober und März hier am See so sehr kennzeichnete.
Da Monikas Wohnung im Erdgeschoß lag, konnte man von ihrer Terrasse aus direkt den Garten betreten. Es führten nur ein paar Stufen hinunter. Im Moment fühlte ich mich dazu nicht veranlasst, aber ich stellte mir vor, wie gemütlich es sein könnte, an einem lauen Sommerabend mit Monika hier im Garten zu sitzen und Campari Orange zu trinken . . .
Ich erschrak vor meinen eigenen Gedanken. Ich stellte mir eine Beziehung mit Monika vor? Ich, die ich alle Frauen immer nach kürzester Zeit wieder aus meinem Bett geworfen hatte? Aber warum hatte ich das getan? Doch nur, weil Nora immer in meinem Kopf herumspukte, weil ich mich nicht von der Vorstellung lösen konnte, dass es meine Bestimmung war, mit ihr zusammenzusein, dass sie die einzige Frau war, mit der eine Beziehung überhaupt denkbar schien. Alle anderen hatte ich von vornherein ausgeschlossen.
»Du hast den Tee gefunden, wie ich sehe?« hörte ich Monikas flüsternde Stimme an meinem Ohr, und gleich darauf landete ein gehauchter Kuss auf meinem Ohrläppchen.
Ich fuhr erschrocken herum und versetzte ihr fast einen Kinnhaken. Sie war so leise von hinten an mich herangetreten, dass ich sie nicht gehört hatte und fast instinktiv abwehrend handelte. Ein reiner Reflex aus der Polizeiarbeit.
Sie fuhr hoch, um mir auszuweichen, und trat einen Schritt zurück. »Danke«, bemerkte sie mit spöttisch herabgezogenen Mundwinkeln. »Ich freue mich auch, dich zu sehen.«
»Oh Monika«, entschuldigte ich mich verwirrt. »Es tut mir leid. Das war nur ein Reflex. Das hatte nichts mit dir zu tun.« Ich lächelte um Verzeihung bittend. Dann betrachtete ich sie etwas genauer und bemerkte, dass sie nur ein T-Shirt übergezogen hatte, das ihre vollen Brüste mehr hervorhob als verdeckte, und darüber hinaus nichts trug. Das T-Shirt war nicht sehr lang. Mein Blick blieb zwischen ihren Schenkeln haften. »Hast du gut geschlafen?« fragte ich höflich.
»Fragst du das mich oder den Punkt zwischen meinen Beinen?« erwiderte sie immer noch spöttisch.
Ich verzog etwas gequält das Gesicht. Wie peinlich – und das am frühen Morgen! »Ich fürchte, ich bin noch nicht ganz wach«, entschuldigte ich mich erneut, während ich mich wieder auf den Gartenstuhl fallen ließ und nach meiner Teetasse griff, die jedoch mittlerweile leer war und somit keinerlei glaubwürdige Beschäftigung bot.
»Ich eigentlich auch noch nicht«, gab Monika freundlicherweise zu und ging damit nicht weiter auf mein peinlich unangemessenes Benehmen ein. »Ich mache mir erst einen Tee, und dann können wir ja noch mal von vorn anfangen.« Sie drehte sich um und trat zurück durch die Terrassentür in das kleine Küchenareal.
Ich stand auf und folgte ihr. Während sie den Teekessel aufsetzte, trat diesmal ich von hinten an sie heran. »Machst du mir auch noch einen?« fragte ich zärtlich an ihrem Ohr, indem ich sie umfasste.
Sie drückte ihren Rücken leicht gegen meine Brüste. »Hm, gern«, sagte sie etwas verträumt. »Wenn du deine Hände zwischen meinen Beinen wegnimmst, kann ich mich vielleicht darauf konzentrieren.«
Ich tat nicht gleich, was sie verlangte, sondern strich noch einmal zwischen ihren Beinen hindurch. Sie zuckte ein wenig. »Auf den Tee oder auf etwas anderes?« fragte ich anzüglich.
Sie lachte leise und ungeheuer erotisch. »Egal auf was«, erwiderte sie. »Ich brauche zuerst meinen Tee, sonst bin ich zu nichts zu gebrauchen.«
»Zu nichts?« fragte ich weiterhin anzüglich, verführt von dem erotischen Ton in ihrer Stimme, und strich mit meinen Lippen hauchzart ihren Nacken entlang.
»Zu nichts«, lachte sie wieder leise und drehte sich in meinen Armen um.
Ich hielt sie fest und zog sie an mich. »Das habe ich aber anders in Erinnerung«, sagte ich leise und küsste sie vorsichtig.
Sie schob mich nicht sehr energisch, aber doch eindeutig entschieden weg, als unsere Lippen sich trennten. »Ausnahmen bestätigen die Regel«, lächelte sie liebevoll. »Es kommt auf die Situation an. Aber heute möchte ich zuerst mein ganz normales Morgenritual vollziehen, wenn du nichts dagegen hast.« Der Kessel hinter ihr fing an zu blubbern. »Und dazu gehört mein Morgentee auf der Terrasse«, schloss sie ihre Erklärung, um sich wieder dem Teekessel zuzuwenden.
Ich seufzte, aber ich hielt sie weiterhin fest, und während sie in meinen Armen mit Teetasse und Kessel hantierte, begannen meine Hände, wieder abwärts zu wandern, bis sie genau dort lagen, wo sie an diesem Morgen schon einmal gewesen waren.
»Bitte, Renni, hör auf«, verlangte Monika nun doch schon ziemlich entschieden. »Das war mein Ernst.«
»Lass dich doch ein bisschen verwöhnen«, schmeichelte ich mit meiner Zunge an ihrem Hals.
Mit einer fast schon ärgerlichen Bewegung schüttelte sie mich ab. »Aber nicht vor dem Tee«, bemerkte sie etwas gereizt. Sie machte sich ganz von mir los und hielt mir meine Tasse entgegen. »Lass uns nach draußen gehen.« Ohne auf mich zu warten, ließ sie mich stehen und setzte sich draußen auf der Terrasse in den anderen Gartenstuhl, der dem, in dem ich eben gesessen hatte, gegenüberstand.
Ich ging etwas irritiert hinterher und setzte mich ebenfalls. »Entschuldige«, sagte ich zum mindestens dritten Mal an diesem Morgen. »Ich wollte dich nicht belästigen.« Was hatte sie nur? Ich konnte mir ihre Reaktion nicht erklären.
Sie trank ihren Tee und ignorierte mich einfach. Vielleicht sollte ich gehen? Wollte sie mir das damit sagen? Während sie über ihre Teetasse in den Garten hinaussah, seufzte sie plötzlich. »Ich glaube, ich muss mich entschuldigen.« Sie wandte ihren Blick zu mir und lächelte. »Das ist noch eine Stiereigenschaft, auf die ich dich vielleicht hätte hinweisen sollen: Wir können es absolut nicht leiden, wenn wir in unserer gewohnten Routine gestört werden.«
»Oh, das hätte ich wissen sollen«, meinte ich etwas verlegen.
Sie lächelte noch ein wenig mehr. »Ja, das hat man gemerkt, dass du das nicht weißt. Du hast mich ganz schön oft gestört.«
War sie deshalb oft so aggressiv mir gegenüber gewesen, besonders am Anfang? Wenn ich mir all die Situationen ins Gedächtnis rief, an denen ich ganz sicher ihre Routine gestört hatte . . . Oh je! »Nun . . . ähm . . .« Ich räusperte mich. »Ich werde versuchen, mich wenigstens ab jetzt daran zu halten«, versprach ich ihr. »Jetzt weiß ich es ja. Und heute morgen hast du nichts mehr von mir zu befürchten«, schloss ich etwas unsicher.
Sie nippte an ihrer Tasse und sah über den Rand auf den Garten hinaus. »Wer hat gesagt, dass ich das will?« fragte sie, ohne mich anzusehen. Dann drehte sie den Kopf und lächelte wieder, diesmal aber sehr erotisch. Lockend und verführerisch wäre vielleicht der passendere Ausdruck gewesen. Sie wusste genau, dass sie mich durcheinandergebracht hatte, und offensichtlich mochte sie das. »Der Morgen ist noch jung«, fuhr sie vielversprechend fort, »und mein Tee ist gleich alle.«
Ich schluckte etwas nervös. »Monika, du bringst mich noch zur Raserei«, vermeldete ich nicht ganz unbeleidigt. »Ich mag solche Spiele nicht.«
»Es ist kein Spiel«, entgegnete sie ernst. »Ich habe dir nur die Wahrheit gesagt. Und jetzt . . .« Sie setzte ihre Tasse ab und stand auf. ». . . können wir wieder von vorn beginnen, wie ich es vorhin vorgeschlagen habe.« Sie lachte. »Mit einem kleinen Unterschied: Ich komme lieber von vorn zu dir, sonst habe ich noch ein Veilchen, bevor ich’s mich versehe.« Sie war schon bei mir angekommen, während sie sprach, und setzte sich auf meinen Schoß. Ein kleiner Kuss gab mir zu verstehen, dass jetzt wohl keine ablehnenden Bescheide von ihrer Seite mehr zu erwarten waren.
»Ich mag es von hinten aber eigentlich lieber«, sagte ich anzüglich. »Nur solltest du dich vorher ankündigen.«
Sie hatte ihre Lippen schon wieder zu einem Kuss gesenkt, verharrte aber bei meinen Worten augenblicklich und sah mir tief in die Augen, während sie sich ein Stück zurückzog. Sie musterte mein Gesicht mit einem Ausdruck, den ich nicht deuten konnte.
»Ich habe es nicht so gemeint«, entschuldigte ich mich sofort fast panisch. »Es ist mir so rausgerutscht. Bitte nicht böse sein.« Wie konnte ich nur vergessen, was sie mir erzählt hatte?
»Es muss schrecklich für dich sein, immer auf alles achten zu müssen, was du sagst«, meinte sie erstaunlich friedlich, aber sehr ernst. »Nur weil ich . . . weil ich Dinge mit mir habe machen lassen, die ich eigentlich nicht wollte.«
»Ich möchte, dass du nicht mehr daran denkst«, sagte ich leise. »Deshalb sollte ich es auch nicht erwähnen. Ich muss einfach besser aufpassen, was ich sage.«
»Nein, ich sollte einfach keinen Anstoß daran nehmen. Für dich war es sicher immer ganz normal, mit einer Frau . . .« Sie brach schon wieder ab, weil sie etwas nicht aussprechen konnte.
»Mit einer Frau ist es sowieso anders, sowohl von hinten als auch von vorn«, sagte ich lachend. Ich wollte das ganze nicht wieder zu ernst werden lassen. Das konnte dazu führen, dass sie in Depressionen verfiel, und das wollte ich vermeiden. »Aber du weißt, dass ich mich da ganz nach dir richte. Nur von vorn ist auch schön.«
»Es ist gar nicht so schlimm, wie du vielleicht denkst«, schränkte sie überraschenderweise ein. »Wenn du diejenige bist . . .« Ihre Stimme hatte wieder den Hauch von Erotik zurückgewonnen, den sie schon vor einer Weile ausgestrahlt hatte. »Ich möchte jetzt wirklich nicht mehr darüber reden. Lass uns lieber etwas tun.« Die letzten Worte dehnte sie, bis sie mit ihren Lippen meinen Mund erreicht hatte und in ihn eindrang. »Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich du mich machst, Renni«, flüsterte sie dann nach einem langen und zärtlichen Kuss. »Ich glaube, ich habe mich schrecklich in dich verliebt. So etwas ist mir noch nie passiert.«
Ich erstarrte bei ihren Worten und zögerte, jedoch diesmal war nicht Nora der Grund wie früher schon so oft. Ob ich sie immer noch liebte, darüber wollte ich mir jetzt gar keine Gedanken machen. Ich war der Grund. Ich wusste immer noch nicht, ob ich Monika liebte oder ob ich es je würde tun können. Ihr das zu sagen, wäre mehr als barbarisch gewesen, aber war es nicht genauso barbarisch, hier bei ihr zu sein, sie zu genießen, ohne es ihr zu sagen? Sie hatte mich trotz meines Ausrutschers mit Nora wieder aufgenommen, obwohl sie so eifersüchtig war und es kaum ertragen konnte, und das alles nur aus Liebe. Wie konnte ich nur so unfair sein?
Für diesmal nahm sie mir die Entscheidung ab, von der sie im Moment sicher meilenweit entfernt war, auch nur etwas zu ahnen. Sie rutschte von meinem Schoß herunter und zog mich von der Terrasse mit sich in die Wohnung hinein. »Es ist Samstag«, lachte sie. »Gleich kommen die Kinder angeschossen. Da sollten wir uns vielleicht nicht gerade als Studienobjekt zur Verfügung stellen.«
Ich nickte, aber während ich das tat, hing sie schon in meinem Arm und begann mich zu streicheln. Kaum hatte ich mich ihren Berührungen hingegeben, löste sie sich schon wieder von mir und schloss mit einer schnellen Bewegung die Verriegelung an der Terrassentür, während sie gleichzeitig mit der anderen Hand die Befestigung des Stoffrollos löste, so dass es herunterfiel. »So«, bemerkte sie zu meiner Verwunderung schon wieder in meinem Arm, kaum, dass ich alle ihre Aktionen mitbekommen hatte, »jetzt werden sie uns nicht mehr stören.« Gleichzeitig begann sie, an mir abwärts zu gleiten . . .
~*~*~*~
Am Sonntag morgen musste ich leider zum Dienst, da ich in Unkenntnis der Dinge, die da kommen würden, mit einem Kollegen getauscht hatte, der zu einem Familienfest eingeladen war und ursprünglich gleichzeitig Wochenenddienst gehabt hätte. Wir hatten uns geeinigt, dass er den Samstag und ich den Sonntag übernehmen würde, und so saß ich also heute hier im Büro, nachdem ich den Samstag nur noch als ein einziges rauschhaftes Ritual mit Monika in Erinnerung hatte.
Ich konnte mich kaum mehr an Einzelheiten erinnern. Ich wusste nur, dass wir die ganze Wohnung zum Spielplatz unserer Lüste gemacht hatten, ohne Rücksicht auf Verluste oder Bequemlichkeit. Selbst heute morgen hatte ich mich fast davonschleichen müssen – natürlich höchst ungern, denn nichts hätte mir mehr gefallen als nicht nur ein Samstag, sondern ein ganzes Wochenende mit Monika –, denn als sie und ich fast gleichzeitig erwachten, hätte es nur des geringsten Funkens bedürft, und ich hätte den Dienst Dienst sein lassen. Aber pflichtbewusste Beamtinnen, die wir nun einmal beide waren, hatten wir uns bewusst voneinander ferngehalten und uns kaum berührt, um nicht in Versuchung zu geraten.
Wenn ich die Augen schloss, sah ich sie jetzt noch vor mir, wie sie im Bett lag, an ihr Kissen gekuschelt und mit einem Auge zu mir hochblinzelnd, während sie ein nacktes Bein wie unabsichtlich unter der Decke hervorstreckte und ich mir den Rest ihres vollen nackten Körpers sehr gut vorstellen konnte.
Wenn in diesem Moment nicht gerade das Telefon mit seinem nervend Aufmerksamkeit fordernden Geräusch gestört hätte, hätte es gut sein können, dass ich meine Dienstpflicht vergessen hätte und wieder zu Monika geeilt wäre, um da weiterzumachen, wo wir in der Nacht – oder eher wohl sehr früh am Morgen – aufgehört hatten . . . Aber das Telefon erinnerte mich daran, dass es noch etwas anderes gab als den aufregend schönen Sex mit einer aufregend schönen Frau wie Monika. Ich umklammerte den Telefonhörer einen Moment, um mich zu beruhigen, bevor ich abhob. Dann meldete ich mich mit der offiziell vorgeschriebenen Formel: »Mordkommission, Dezernat I, Kommissarin Schneyder.«
So, als ob die Person am anderen Ende eine falsche Nummer gewählt hätte und nun überrascht wäre, meine Stimme zu hören, trat eine kleine Verzögerung ein. »Kann ich Ihnen helfen?« fragte ich deshalb noch einmal freundlich nach. Vielleicht wollte da jemand nur die Verkehrspolizei sprechen und musste nun erst einmal den Schock des Begriffes Mordkommission überwinden. Hatte es alles schon gegeben.
Ein tiefes Einatmen am anderen Ende zeigte an, dass die Person, die anrief, nun anscheinend beabsichtigte zu sprechen. Ich wartete. Das war etwas, das ich bei der Polizeiarbeit gelernt hatte. Warten war ein enormer Bestandteil davon. Warten auf Zeugen, auf Verdächtige, auf Ergebnisse der Spurensicherung, auf die Lösung . . .
»Hier ist Dana«, sagte die Stimme am anderen Ende leise und kaum verständlich.
Dana? Wer war Dana? Kannte ich eine Dana? Ich ging schnell meinen Bekanntenkreis durch, der ja nun wahrlich nicht besonders groß war, und scheiterte. Ich konnte kein Gesicht mit dem Namen Dana verbinden. »Ja?« fragte ich deshalb zuvorkommend.
»Ich habe Ihre Visitenkarte gefunden, und da dachte ich . . .« Die Stimme brach wieder ab, als ob sie sich nicht entscheiden könnte.
Visitenkarte! Das Stichwort bedeutete mir, dass es sich nicht um einen privaten Anruf handeln konnte, wie ich zuerst angenommen hatte. Meine Visitenkarte mit der Nummer meines Büros bei der Mordkommission verteilte ich eigentlich nicht im privaten Bereich. Und plötzlich fiel es mir wieder ein: Dana, natürlich! Dana war die Prostituierte, die ich als Zeugin im Mordfall Regula Meyer vernommen hatte. Auf einmal passte zu dem Namen auch ein Gesicht. Aber was wollte sie von mir? Das letzte Mal hatte ich sie gezwungen, zu mir in die Dienststelle zu kommen, weil ich sie vernehmen wollte, aber sie war nicht sehr begeistert davon gewesen. Dass sie mich nun freiwillig anrief, musste einen besonderen Grund haben – den ich nicht kannte und auf den ich demzufolge auch nicht eingehen konnte. »Die haben Sie noch?« scherzte ich deshalb ein wenig unbeholfen. Was sollte ich schon sagen?
»Ja, ich hatte sie noch«, kam die leise Antwort. »Gott sei Dank.«
Das klang so fatalistisch und todtraurig, dass ich einfach nachfragen musste. »Was ist passiert?«
»Oh, eigentlich gar nichts«, behauptete sie plötzlich. »Ich hätte Sie nicht anrufen sollen. Entschuldigen Sie, bitte.«
Ich hielt sie schnell davor zurück aufzulegen. »Warten Sie, Dana. Sie haben mich sicherlich aus gutem Grund angerufen, das glaube ich bestimmt. Wollen Sie mir nicht erzählen, was es ist?«
»Ich weiß nicht«, wand sie sich herum. »Am Telefon ist das sowieso schwierig. Ich kann das nicht.«
»Dann kommen Sie doch bei mir im Präsidium vorbei«, schlug ich vor, weil ich das Gefühl hatte, sie würde das Gespräch gleich beenden. »Sie kennen den Weg ja schon. Ich habe heute den ganzen Tag Dienst. Ich werde hier sein«, versuchte ich, ihr eine Alternative anzubieten. Ich hatte sie zwar nur kurz kennengelernt bei meinen Ermittlungen, aber meine innere Stimme sagte mir, dass sie nicht leichtfertig zum Hörer griff, um eine Polizistin anzurufen.
»Eigentlich kann ich hier nicht weg. Und wahrscheinlich sind Sie sowieso nicht zuständig«, redete sie sich weiter ein.
»Wofür zuständig?« versuchte ich herauszubekommen, aber sie ließ sich nicht überzeugen.
»Ich denke, ich muss selbst damit fertig werden«, schloss sie ihre Ausführungen, die nicht sehr ergiebig gewesen waren. »Aber ich danke Ihnen für Ihre Geduld.«
»Oh, gern geschehen«, antwortete ich etwas verwirrt. Welche Geduld und wofür? Sie legte auf, bevor ich etwas hinzufügen konnte. Eigenartig. Was hatte sie nur gewollt? Wenn sie mich für nicht zuständig hielt, handelte es sich wahrscheinlich nicht um einen Mord, denn dafür war ich zuständig. Aber was konnte es statt dessen sein? Ich grübelte kurz darüber nach, aber kam zu keinem Ergebnis. Sie hatte mir zu wenig Informationen geliefert, um den Grund ihres Anrufs beurteilen zu können. Da das Telefon nun erst einmal schwieg, zog ich seufzend ein paar Akten heran, die schon länger der Bearbeitung harrten. Bereitschaftsdienst am Wochenende gestaltete sich so gut wie immer gähnend langweilig, aber irgend jemand musste es ja tun. Die Ablenkung, die die Anwesenheit der Kolleginnen und Kollegen in der Woche bot, das Einerlei und die Routine der Abläufe an den üblichen Arbeitstagen und die Gespräche, wie banal sie auch immer sein mochten, mit irgend jemand über irgend etwas fehlten am Samstag und Sonntag und ließen die Zeit bis zum Dienstschluss endlos erscheinen.
Langsam vertiefte ich mich in die eine oder andere Akte und konnte sogar ein paar davon nach kurzer Zeit dem Kasten für die ausgehende Kurierpost überantworten. Ab ins Archiv damit – endlich! Wie lange hatte ich zum Teil an diesen Fällen gearbeitet, und nun waren sie entweder gelöst oder es gab keine Chance mehr weiterzukommen, und die Ermittlungen mussten demzufolge eingestellt werden. Das tat ich nicht gern, denn bei einem Kapitalverbrechen wie Mord sollte es immer eine Aufklärung geben und der Schuldige gefunden werden. Das war meine Überzeugung, und in den meisten Fällen klappte es ja auch. Die Aufklärungsquote bei Mord war immer noch die höchste unter allen Verbrechen. Allerdings nur deshalb, weil Mord meistens eine persönliche Motivation hatte, weil Täter und Opfer sich kannten und deshalb unausweichlich eine Verbindung festgestellt wurde, die zur Entlarvung des Täters führte.
Piep! machte es auf meinem Schreibtisch, und unter all dem Aktengewirr, das sich chaotisch darauf ausgebreitet hatte, blinkte eine kleine Lampe auf. Das war der interne Summer, der von der Pforte aus bedient wurde. Der Pförtner war einer der wenigen, der ebenfalls heute im Hause sein musste. Ich wühlte mich durch die Akten hindurch, die das piepende Gerät bedeckten, und drückte einen Knopf. »Ja, was ist?«
»Kommissarin Schneyder, hier ist jemand für Sie«, teilte mir der Pförtner etwas lustlos mit. Er hielt wohl auch lieber ein Schläfchen am Sonntag.
»Wer denn?« fragte ich etwas überrascht, denn ich erwartete eigentlich niemand. Zumindest hatte ich niemand bestellt.
»Eine gewisse Dana. Den Nachnamen will sie mir nicht sagen.«
»Lassen Sie sie herein. Ich hole sie ab«, beschied ich dem Mann und machte mich auf den Weg. Dana stand außen vor der Glastür, die den Eingangsbereich vom Innenteil des Gebäudes trennte. Weiter hatte der Pförtner sie nicht vorgelassen, das war Vorschrift.
Ich öffnete ihr die Tür. »Kommen Sie herein«, bat ich sie und ließ sie an mir vorbei in den Flur. Von ihrer Gestalt war kaum etwas zu erkennen. Sie trug einen weiten Mantel und um den Kopf ein Tuch, wie es Musliminnen tragen, um sich so weit wie möglich zu verhüllen. Außerdem hatte sie eine Sonnenbrille aufgesetzt, die auch noch einen großen Bereich ihres Gesichtes verdeckte. Wollte sie nicht, dass jemand sah, dass sie zu mir kam? Was hatte sie zu verbergen?
Nachdem ich die Tür wieder hinter ihr geschlossen hatte, ging ich den Gang entlang ihr voran in mein Büro, und sie folgte mir. Bislang hatte sie kein Wort gesprochen. In meinem Büro angekommen, schob ich ihr einen Stuhl vor meinen Schreibtisch. »Nun sind Sie ja doch noch gekommen«, begann ich ein Gespräch, von dem ich nicht wusste, was es beinhalten sollte.
Sie hatte sich nicht gesetzt, sondern stand immer noch hinter dem Stuhl, den ich einladend vor sie hingestellt hatte. Ich sah sie fragend an. Mehr, als ich getan hatte, konnte ich nicht tun. Sie hatte mich vor ein paar Stunden angerufen, und nun war sie persönlich erschienen, aber ich wusste immer noch nicht, warum. Das musste sie mir sagen. »Ich weiß nicht – ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier tue«, begann sie wiederum so leise wie zuvor schon am Telefon.
»Das weiß ich auch nicht«, erwiderte ich, während ich hinter meinem Schreibtisch Platz nahm. »Setzen Sie sich doch.« Erneut wies ich mit einer einladenden Handbewegung auf den Stuhl, der immer noch verwaist vor mir stand. »Dann redet es sich leichter.« Ich lächelte aufmunternd, aber ihr Gesicht blieb starr.
Dann setzte sie sich langsam auf die Kante des Stuhls. »Ich sollte Sie nicht damit belästigen«, wisperte sie. Ich musste mich vorbeugen, um sie zu verstehen.
»Belästigen? Womit?« fragte ich, während ich meinen Blick über ihre vermummte Gestalt schweifen ließ. »Wollen Sie nicht ablegen?« bot ich ihr an. »Hier ist ziemlich gut geheizt, keine Angst.« Ich grinste ein wenig, um ihr zu zeigen, dass ich es gut mit ihr meinte, aber das alles schien keine Wirkung auf sie zu haben.
»Davor habe ich keine Angst«, sagte sie jetzt mit einer Stimme, die zwar immer noch leise klang, aber vor Anstrengung zu zittern schien. »Es gibt nur einen Grund für mich, Angst zu haben. Diesen hier!« Sie nahm ihre Sonnenbrille ab und zog sich das Tuch vom Kopf.
Ich hob heftig die Augenbrauen. Das sah nicht gut aus. »Du meine Güte!« stieß ich ziemlich betroffen hervor. »Wer hat das getan?« Ihre Augenbrauen waren aufgeplatzt wie bei einem Boxer nach der zehnten Runde. Das Blut hatte sie zwar abgewischt, aber danach war es wieder geflossen und über ihren Augen angetrocknet, so dass sich dicker Schorf gebildet hatte. Die Augen selbst waren angeschwollen, und rundherum schienen sich blaue Ringe in verschiedenen Schattierungen zu befinden, die fast das ganze Gesicht bedeckten. Auch ihre Lippe wirkte aufgeplatzt und geschwollen, ebenso wie ihre Wangen und ihr Kinn.
»Das ist nur mein Gesicht«, erklärte sie. »Da hat er nicht so heftig zugeschlagen, damit es schnell wieder abheilt und ich wieder arbeiten kann. An meinem Körper war er nicht so vorsichtig.« Sie öffnete langsam ihren Mantel und schob den Pullover an ihrem Arm nach oben. Ich sah eine eiternde kreisrunde Wunde. Ich wusste, was das war. Es musste höllisch wehtun, aber sie zuckte nicht einmal zusammen. Da hatte jemand eine Zigarette auf ihrem Arm ausgedrückt. »Wollen Sie noch mehr sehen?« fragte sie.
»Nicht unbedingt«, entgegnete ich. »Aber Sie sollten unbedingt einen Arzt aufsuchen. Damit ist nicht zu spaßen. Die Wunde hat sich schon entzündet.« Ihr Aussehen erschreckte mich, aber ich hatte mich an vieles gewöhnt in meinem Beruf. Andernfalls hätte ich sicher nicht so ruhig reagiert. Innerlich jedoch sammelte sich in mir einiges an Wut. Ich wusste schließlich, welchen Beruf sie ausübte, und ich konnte mir vorstellen, wer ihr das angetan hatte.
Sie nickte. »Ja, das sollte ich. Aber er lässt mich nicht. Er hat Angst, dass etwas herauskommt.«
»Wie kommen Sie dann jetzt zu mir?« fragte ich erstaunt. Das klang ja so, als ob jemand sie eingesperrt hätte.
»Ich bin durch das Badezimmerfenster geklettert. Er hat wohl nicht damit gerechnet, dass ich mich das traue – im zweiten Stock.«
»Im zweiten Stock?« fragte ich auch etwas erstaunt. Wie war sie da heruntergekommen?
»Ich hatte Glück. Ein Absatz führt zum Garagendach des Nebenhauses. Da habe ich mich herumgehangelt.« Sie beschrieb ihre Flucht – denn das war es schließlich – so ruhig wie einen Einkaufsnachmittag in der City. Es klang, als ob sie schon Schlimmeres erlebt hätte, obwohl ich mir das kaum vorstellen konnte. Aber ich erinnerte mich im nächsten Augenblick daran, dass das nicht stimmte. Sie hatte in Serbien während des Krieges vielleicht wirklich Schlimmeres erlebt. Als Nicht-Serbin, die in Serbien lebte, konnte ihr wer-weiß-was zugestoßen sein. Schließlich hatte sie so etwas angedeutet bei der letzten Vernehmung, bei der wir uns gesehen hatten.
»Ich kann nicht mehr.« Sie senkte den Kopf, und es kam so etwas wie ein Schluchzen aus ihrer Kehle, das sie aber gleich wieder unterdrückte. »Ich dachte, nichts kann so schlimm sein wie nach Serbien zurück zu müssen, aber wenn ich zu ihm zurück muss –« Sie brach immer leiser werdend ab, als ob ich gar nicht da wäre.