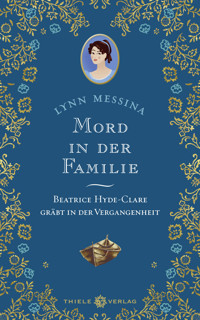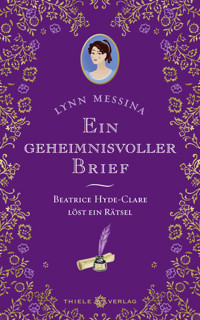Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Thiele & Brandstätter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Regency-Krimi-Serie
- Sprache: Deutsch
Ende der Langeweile einer idyllischen Landpartie. Als Beatrice Hyde-Clare kurz nach Mitternacht in der Bibliothek von Lakeview Hall über die Leiche eines Gastes stolpert, ist es mit ihren hehren Vorsätzen weiblicher Zurückhaltung vorbei. Offiziell wird als Todesursache Freitod angegeben, Beatrice aber weiß es besser. Schließlich hat sie den eingeschlagenen Schädel des unglückseligen Mr. Otley gesehen. Ebenso wie der provozierend arrogante Duke of Kesgrave, der seltsamerweise alles daransetzt, den brutalen Mord als Selbstmord erscheinen zu lassen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LYNN MESSINA
Mord in bester Gesellschaft
LYNN MESSINA
Mord in bester Gesellschaft
Beatrice Hyde-Clare tritt auf den Plan
Aus dem Englischen übersetztvon Karl-Heinz Ebnet
Für Joyce, ohne deren sorgfältiges Korrektorat ich mich ständig blamiert hätte.
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Während des gesamten Dinners stellte sich Miss Beatrice Hyde-Clare vor, wie sie Damien Matlock, den Duke of Kesgrave, mit Essen bewarf. Die Wurfgeschosse variierten je nach den aufgetragenen Gängen von Fischfrikadellen mit Olivenpaste über gefüllten Tomaten, Kalbskoteletts und pochierten Eiern bis hin zur Meringue mit Kompott, doch der Impuls blieb derselbe. Als der Duke ihren Gastgeber, Lord Skeffington, hinsichtlich der Zahl der Schiffe korrigierte, die unter Nelson an der Seeschlacht bei Abukir teilgenommen hatten, malte sie sich aus, wie sie diesem arroganten Menschen eine ganze Platte mit Aal à la tartare an den Kopf schleuderte. Der Gedanke daran, wie er sich indigniert die Petersilie aus den goldblonden Locken zupfen würde, amüsierte sie königlich, und sie unterdrückte ein Grinsen bei der Vorstellung, dass die Croutons an seinem strengen, kantigen Kiefer hängen blieben.
Alles am Duke war von einer gewissen Strenge, angefangen von den breiten Schultern, die seine elegante, fein gearbeitete Garderobe so vortrefflich zur Geltung brachte, wenn er seine Meinungen kundtat und diese gern mit einem spöttischen Lächeln garnierte, bis hin zu seiner imposanten Größe – er reichte an die eins neunzig heran und blickte mit gelangweilter Gleichgültigkeit auf seine Mitmenschen herab, ganz so, als studiere er eine besonders uninteressante Ameisenkolonie.
Sein Gebaren verwunderte kaum, wenn man bedachte, wie die feine englische Gesellschaft in seiner Gegenwart katzbuckelte. Einem Mann in seinen Verhältnissen – von stattlichem Auftreten, hohem Stand, exorbitantem Vermögen – wurde jedes Fehlverhalten nachgesehen. Beatrice hatte keinen Zweifel, dass Lord Skeffington, würde der Duke ihn versehentlich mit seinem Schwert durchbohren, sich prompt dafür entschuldigen würde, die Klinge mit seinem Blut besudelt zu haben.
In der Tat hatte Beatrice noch nie einen solch unausstehlichen Menschen kennengelernt wie den Duke of Kesgrave. Nach nur wenigen Minuten in seiner Anwesenheit war er bereits ins Zentrum ihrer glühenden Abneigung gerückt.
Und achtundvierzig Stunden später musste sie schon sehr an sich halten, um nicht einen Löffel Zitronensorbet in seine Richtung schnellen zu lassen.
Was für sie doch ziemlich ungewöhnlich war, denn Beatrice Hyde-Clare war eine gesittete junge Dame, deren Verhalten selten die Grenzen der Schicklichkeit überschritt. Sie hatte den Tod ihrer Eltern zu beklagen, als sie noch ein kleines Mädchen gewesen war, sie ehrte ihre Tante und ihren Onkel, die sie gnädig aufgenommen hatten und mit Großzügigkeit, wenn nicht sogar Freundlichkeit behandelten, und respektierte ihren Cousin und ihre Cousine, deren jugendlichen Überschwang sie mit Alter und Erfahrung zu mäßigen suchte. Noch nie hatte sie jemandem einen solch augenblicklichen Widerwillen entgegengebracht, noch nicht einmal dieser Miss Otley, einer klassischen englischen Schönheit – blasse Haut, rosige Wangen, Schmollmund und hellblaue, durch dunkle Wimpern betonte Augen –, die zwei Tage zuvor den Salon betreten hatte wie eine Königin, die ihre Untertanen begrüßt. Als die junge Frau, die in dem Ruf stand, Erbin eines bedeutenden Vermögens zu sein, eine schnippische Bemerkung über Miss Hyde-Clares unvermählten Stand im hohen Alter von immerhin schon sechsundzwanzig Jahren fallen ließ, bedachte Beatrice sie nur mit einem freundlichen Lächeln und beglückwünschte sie zu dem ausladenden Gebilde, das sie auf dem Kopf balancierte. Tatsächlich war das mit Federn verzierte, in Seidenschwaden gehüllte hochaufragende Werk die Errungenschaft einer begnadeten Putzmacherin und viel zu grandios, um schlicht als Haube bezeichnet zu werden. Beatrice, deren eigene Kollektion über einige praktische Morgenhauben nicht hinausging, hatte sich laut gefragt, ob es auf der Insel nun wohl überhaupt noch einen einzigen Strauß mit Federkleid gebe.
Erfreut über das Kompliment und stolz auf die luxuriöse Pracht auf ihrem Kopf, hatte Miss Otley ihr versichert, dass das in der Tat fragwürdig wäre.
Wie immer übten solch extravagante Kleidungsstücke auf ihre Cousine Flora einen großen Reiz aus, so dass sie sich augenblicklich als dienstbarer Geist anerbot und sich dazu bereit erklärte, alles zu besorgen, was die junge Dame nur wünschte.
Beatrice war darüber kaum überrascht. Ihre Cousine war ja erst neunzehn und durch eine derartige Zurschaustellung von Reichtum und Selbstbewusstsein leicht zu beeindrucken. Floras Bruder Russell, um zwei Jahre älter und ein bisschen klüger, fand diese unvermittelte Ergebenheit lachhaft und bedachte seine kleine Schwester mit einer Reihe ironischer Kommentare.
Na großartig, hatte Beatrice gedacht, als die beiden sich zankten. Mit der unterwürfigen Flora, dem spöttischen Russell und dem herablassenden Kesgrave konnte das auf dem Landsitz der Skeffingtons ja eine heitere Woche werden.
Als sie sich dazu bereit erklärte, ihre Tante auf das Anwesen von deren alten Schulfreundin im Lake District zu begleiten, hatte sie sich eine friedliche Woche erwartet, die sie mit Lesen und langen Spaziergängen in den allmählich ins Kühle sich wendenden September-Temperaturen zu füllen gedachte. Natürlich wusste sie um das reizbare Verhältnis ihres Cousins und ihrer Cousine, hatte aber angenommen, Russell würde zu sehr mit der Jagd und dem Angeln beschäftigt sein, um Flora zu piesacken.
Was sie allerdings nicht in Betracht gezogen hatte, war die Möglichkeit, dass es drei Tage hindurch regnen könnte. Hätte sie geahnt, dass sie widrigen Wetterverhältnissen ausgeliefert sein würde, hätte sie die Einladung höflich abgelehnt – so wie ihr Onkel, der vorgab, Dringlicheres zu tun zu haben.
Der Gerechtigkeit halber muss gesagt werden, dass Lakeview Hall mit seiner ausladenden jakobinischen Architektur und seinen Kolonnaden äußerst luxuriös war. Beatrice hatte die Führung durch das Anwesen genossen, fast ebenso sehr wegen Lady Skeffingtons amüsanten Geschichten zu den diversen Räumen wie wegen der Erhabenheit des Bauwerks. Und sie hätte sich kaum freundlichere Gastgeber wünschen können. Seine Lordschaft war ein überaus liebenswürdiger Mann von fünfundfünfzig Jahren, dessen stattliche Erscheinung und die auf den ersten Blick etwas einschüchternden schwarzen Brauen doch nicht sein freundliches Herz zu verbergen vermochten, und Ihre Ladyschaft – nur wenige Zentimeter kleiner und von beängstigender Selbstsicherheit – war reizend unprätentiös und großzügig mit ihrer Zeit und ihrem Zuhause.
Diese Annehmlichkeiten entschädigten aber nicht für das Wetter, das die Gäste zu verhöhnen schien. Auch an diesem Nachmittag klarte der Himmel gerade so lange auf, dass die Gentlemen ihre Sachen packten, zum See aufbrachen und ihre Ruten auswarfen, um einen einzigen Fisch zu fangen, bevor es sich wieder zuzog und in Strömen goss. Nachdem die einzige Beute des Tages dem unausstehlichen Kesgrave zugefallen war, schien sich selbst die Natur mit dem Duke verbündet zu haben und ihn in seiner hohen Meinung von sich zu bestätigen, was Beatrice gehörig ärgerte.
Hätte sie sich geweigert, an der Hausgesellschaft teilzunehmen, hätte das bei Tante Vera, deren spitzes Kinn, krumme Nase und wolkengraue Augen ihr einen immerwährenden Ausdruck der Missbilligung verliehen, allerdings kaum verfangen. Als verarmte Verwandte hatte Beatrice dorthin zu gehen, wohin sie geschickt wurde, und das zu tun, was man ihr sagte. Natürlich war sie herzlich dazu eingeladen, frei und unabhängig zu agieren, dann aber musste sie ihren eigenen Weg in der Welt einschlagen.
Ihre Tante und ihr Onkel waren ihr zugetan, sicherlich, so wie es die familiären Bindungen vorschrieben, nie aber hätten sie ihrer Nichte einen eigenen Hausstand finanziert, und Beatrice hätte dies auch nie von ihnen erwartet. Eine unverheiratete Frau ihres Alters galt unleugbar als gescheitert und verdiente es nicht, mit Ruhe und Behaglichkeit belohnt zu werden. Stattdessen bestand ihre Pflicht darin, sich als Gesellschafterin für ihre Tante oder später dann als Gouvernante für die Kinder ihrer Cousine und ihres Cousins dienstbar zu machen.
Beide Aussichten hatten wenig Verlockendes, dennoch hatten die düsteren Zukunftsaussichten nicht gereicht, um sie von der lähmenden Schüchternheit zu befreien, die ihre erste Saison zu solch einer Katastrophe gemacht hatte. Wie jede Miss, die frisch von der Schulbank kam, hatte sie ihrem Debüt in der Gesellschaft mit einiger Bangigkeit und Aufregung entgegengesehen. Obwohl sie sich bezüglich ihres Aussehens keinen Illusionen hingab – sie hatte unscheinbare Gesichtszüge, eher stumpfe Haare und war von dünner Statur –, so glaubte sie dennoch, dass die Sommersprossen um die Nase ihrem sonst so unauffälligen Gesicht etwas reizend Keckes verliehen.
Wie falsch sie damit gelegen hatte!
Nur wenige Wochen hatten genügt, um ihr klarzumachen, dass ihre reizenden Sommersprossen so fad waren wie alles andere an ihr.
Ja, fad.
Das war das Wort, mit dem sie in ihrer Debütsaison am häufigsten bedacht worden war. Miss Brougham, eine hinterhältige Person und Erbin eines großen Vermögens, deren Eitelkeit Opfer forderte, hatte den Ausdruck geprägt, der dann schnell von der Hautevolee übernommen wurde. Nachdem Beatrice sowieso zur Schüchternheit neigte, hatte sie danach kaum noch einen Ton herausgebracht und fing an zu stottern, sobald sie etwas sagen sollte. Wobei es keine Rolle spielte, welche Art von Erwiderung von ihr gefordert wurde: Harmlose Beobachtungen verunsicherten sie ebenso wie Bonmots.
Sogar jetzt noch, Jahre später, erstaunte sie das Ausmaß ihres Versagens, denn in ihrer Vorstellung hielt sie sich für ziemlich interessant: für intelligent, entschlossen, von scharfem Verstand. Der Unterschied zwischen der Person, die sie zu sein glaubte, und der, die alle anderen in ihr sahen, schien enorm, und hätte sie auch nur einen Funken Widerspruchsgeist in sich gehabt, hätte sie es sich selbst sehr übelgenommen, wie leicht sie sich den niedrigen Erwartungen an ihre Person beugte. Leider hatte sie schon vor langer Zeit den letzten Rest an Eigensinn aufgebraucht, den sie einst von ihren Eltern mitbekommen hatte. Und deshalb saß sie jetzt auch in Lady Skeffingtons elegant ausgestattetem Speisezimmer, warf dem aufgeblasenen Duke of Kesgrave düstere Blicke zu und stellte sich vor, wie die Crème-Füllung der Schokoladen-Windbeutel von seinem gutaussehenden Gesicht tropfte.
Doch wie es aussah, war sie nicht die Einzige im Raum, die sich woandershin wünschte. Lord Skeffingtons Sohn Andrew – versehen mit den furiosen Brauen seines Vaters und den sanften Augen seiner Mutter –, hatte, seitdem die kleine Gesellschaft Platz genommen hatte, mit den Fingern auf das Tischtuch getrommelt, als zählte er die Sekunden, bis er endlich aufstehen konnte. Sein Freund Amersham, ein Earl, dessen weiche Gesichtszüge und geistesabwesende Miene auf ein friedliches Wesen schließen ließen, konnte es ebenfalls kaum erwarten, sich zurückzuziehen, auch wenn er seine Ungeduld auf subtilere Weise zum Ausdruck brachte, indem er den Blick gelegentlich zur Tür wandte.
Lord und Lady Skeffington hingegen waren erfreut über das grässliche Wetter, rühmten sie sich doch nur allzu gern ihrer Gastfreundschaft, zu welcher der Regen ihnen nun ausdauernd Gelegenheit bot. Erst an diesem Nachmittag hatten sie der kleinen Tischgesellschaft ein neues, von Seiner Lordschaft ersonnenes, entfernt an Baccarat erinnerndes Kartenspiel beigebracht sowie die Aufführung eines Schauspiels vorgeschlagen, das Ihre Ladyschaft verfasst hatte.
Beatrice hatte sich innerlich gewunden bei der Aussicht auf eine Laiendarbietung durch die Hausgäste. Flora und Russell waren für solche Darbietungen nicht zu gebrauchen, da ihre Worte gestelzt klangen, sobald sie Ausgedachtes von sich geben sollten. Ihre Mutter, obwohl sehr viel versierter in der Kundgabe von Bemäntelungen und Halbwahrheiten, hatte die irritierende Angewohnheit, vor Verlegenheit zu glucksen, wenn ein Gentleman ihr seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkte. Nur die hinreißende Miss Otley schien über das richtige Maß an Theatralik zu verfügen, vermutlich war sie aber so sehr von sich eingenommen, dass sie sich kaum dazu herablassen würde, jemand anderes zu sein als sie selbst. Außerdem war es unwahrscheinlich, dass ihre Eltern einer solchen Scharade zugestimmt hätten, denn Mrs. Otley war nur aus einem einzigen Grund hier: Es sollte eine Verbindung zur Familie geknüpft werden. Ihr Gemahl, ein Gentleman mit verkniffener Miene und einer Vorliebe für bunte Farben – heute trug er eine smaragdgrüne Weste –, der mit dem Gewürzhandel ein gewaltiges Vermögen verdient hatte und dem die Spuren seines Gewerbes unter den Fingernägeln zu kleben schienen, gab sich ebenso zielgerichtet. Andrew, Sohn und Erbe der Skeffington sollte und würde um die Hand ihrer Tochter anhalten, und wenn sie dazu die nächsten zehn Monate auf dem vom Regen durchnässten Land verbringen mussten.
Beatrice wagte es nicht, irgendwelche Vermutungen über Mr. Skeffingtons schauspielerische Talente anzustellen, noch über die seines Freundes, aber es erschien ihr unwahrscheinlich, dass sich die beiden jungen Männer freiwillig auf eine Theateraufführung einließen. Schon am Nachmittag hatten sie jeden Vorschlag, die armselige Version von Baccarat zu spielen, verächtlich abgetan und im Arbeitszimmer gegenüber dem Empfangszimmer ihr eigenes Spiel aufgebaut. Nach einer Weile hatte sich der Cousin Seiner Lordschaft zu ihnen gesellt – Michael Barrington, Viscount Nuneaton, ein Dandy mit exquisitem Geschmack und der distinguierten Aura größten Desinteresses, was Beatrice zu der Frage bewog, ob dieser Mann überhaupt wusste, dass sie sich im Lake District aufhielten. Mit seinem untadeligen Bedford-Haarschnitt, dem Stehkragen und seinen Satinhosen schien Michael Barrington sich nach wie vor in Mayfair zu wähnen. Festzustellen, dass er sich nicht nur in der Wildnis von Cumbria befand, sondern auch noch an einem Schauspiel von zweifelhafter Qualität teilnehmen sollte, dürfte dem Viscount mit dem geistesabwesenden Blick eine unliebsame Überraschung sein.
Blieb nur der Duke of Kesgrave, der dann wohl gleich mehrere Rollen übernehmen müsste, eine Aufgabe, die sicher weit unter seiner Würde lag. Tatsächlich war seine Verachtung für das Theater-Projekt so augenfällig, dass Beatrice einen Moment überlegte, sich dafür starkzumachen, nur um ihn sich winden zu sehen. Zweifellos würde der Duke seine Rolle ganz grauenvoll spielen, weshalb sie sich bereits an der Vorstellung ergötzte, wie die aufgebrachten Zuschauer ihm verfaulte Tomaten an den Kopf warfen.
Beatrice lächelte. Sie war so in Gedanken, dass sie erst bemerkte, dass die Tafel aufgehoben war, als sich die Damen erhoben.
Der Salon in Lakeview Hall war ebenso opulent eingerichtet wie das Speisezimmer. Anmutig präsidierte Lady Skeffington über ihrem Teeservice, während sie Komplimente über die eleganten Möbel entgegennahm.
»Meine Güte, wie dieser Brokat schimmert«, bemerkte Mrs. Otley und strich bewundernd über das blaue Sofa. Wie Ihre Ladyschaft war sie im fünften Lebensjahrzehnt und färbte ihre Wangen mit Rouge, um davon abzulenken. Im Gegensatz zu ihrer geschätzten Gastgeberin war sie aber nur gut eins fünfzig groß und fülliger, als ihrem runden Gesicht mit den blassblauen Augen gutgetan hätte. »Und er fühlt sich so seidig an, ich staune. Auch dieser Tisch ist ganz exquisit, meine Liebe, ich erkenne erstklassige Handwerkskunst sofort. Natürlich werde ich dir die Verlegenheit ersparen, dich nach seiner Herkunft zu fragen, aber du solltest wissen, dass wenigstens ich es zu schätzen weiß, dass du keine Kosten scheust, um einen Raum stilvoll zu gestalten. Viele sehen sich ja heutzutage gezwungen, ihre Pennys zusammenzuhalten, und geben dafür nichts mehr aus.«
Obwohl Mrs. Otley keine bestimmte Person im Sinn zu haben schien, war Beatrice nicht entgangen, wie sich die Schultern ihrer Tante versteiften ob dem unausgesprochenen Vorwurf, sie würde extravagantem Design keine Wertschätzung entgegenbringen.
Als wäre es zu einem gröblichen Missverständnis gekommen, beeilte sich Tante Vera gegenüber ihrer Gastgeberin hervorzuheben, dass auch sie wahre Qualität zu schätzen wisse. Nichtsdestotrotz, zögerte sie nicht hinzuzufügen, achte sie Bequemlichkeit aber ebenso hoch. »Meiner Meinung nach genügt es nicht, sich so sehr dem Luxus zu verschreiben, dass man seinen Besitz gar nicht mehr genießen kann. Welchen Sinn hat es, einen kostbaren Axminster-Teppich zu haben, wenn man ihn unter dem Drogett nie zu Gesicht bekommt?«, fragte sie und spitzte die Lippen, als wäre eine solche Missetat soeben begangen worden.
Mrs. Otley stimmte zu und listete anschließend all die wunderschönen Läufer auf, die durch Schlamm und Rhabarberkuchen verdorben wurden. »Ein gutgelegter Drogett ist manchmal keineswegs fehl am Platz.«
Tante Vera nickte zustimmend und meinte, dass man die Hausangestellten besser schulen solle, damit die Schuhe angemessen vom Lehm gesäubert würden, bevor man die Räumlichkeiten betrat, um den Kuchen ordnungsgemäß im Speisezimmer oder am Frühstückstisch zu servieren, dort, wohin er gehöre.
So ging es in einem fort, die Damen gaben mit falscher Herzlichkeit ihre Zustimmung oder ihr Missfallen kund, und Beatrice wunderte sich sehr, dass sich die beiden Frauen als Freundinnen bezeichneten, obwohl sie so beharrlich um Lady Skeffingtons Gunst wetteiferten. War das auch schon so gewesen, als sie drei Jahrzehnte zuvor gemeinsam Mrs. Crawfords School of Girls besucht hatten, oder war es eine neuere Entwicklung? Vielleicht rührte die Rivalität auch daher, dass Tante Vera, die in ihrer typischen Bescheidenheit ganz zufrieden damit war, das gesellschaftliche Leben eher von der Seitenlinie aus zu beobachten, nicht so viel Zeit mit Lady Skeffington verbrachte wie ihre ehemalige Schulfreundin, die nicht müde wurde, darauf hinzuweisen, wie häufig sie sich in London sahen.
Und nun war Mrs. Otley offenbar entschlossen, die beiden Familien durch die Heirat ihrer Tochter mit dem Sohn Ihrer Ladyschaft noch enger zu verbinden. Natürlich war das sinnvoll, denn nichts war natürlicher, als Reichtum und Schönheit mit Reichtum und Rang zusammenzuschließen. Dass Tante Veras Entscheidung, die Einladung nach Lakeview Hall anzunehmen, wohl dem gleichen Beweggrund entsprang – die beiden neuen, völlig überflüssigen Kleider, die sie Flora für diesen Besuch gekauft hatte, zeugten davon –, minderten in keiner Weise ihre Abneigung gegen Mrs. Otleys unverfrorenen Versuch des gesellschaftlichen Aufstiegs. Tante Veras Mutter war immerhin die Tochter eines Earls gewesen, was um einiges achtunggebietender war als der niedrige Baron, der ihre Schulfreundin gezeugt hatte. Wenn sich daher jemand einen adeligen Gemahl sichern sollte, dann war das Flora, und nicht Miss Emily Otley.
Soweit Beatrice es beurteilen konnte, war Mr. Skeffington, der gerade sein vierundzwanzigstes Lebensjahr angetreten hatte, sich seines Status als Ehetrophäe nicht bewusst, denn er schien an den beiden jungen Damen weder ein Interesse noch Angst vor ihnen zu haben. Beatrice war der Meinung, ein wenig gesunde Furcht hätte dem jungen Mann gut zu Gesicht gestanden. Ihre Tante Vera jedenfalls schreckte vor keiner List zurück, um ihre Ziele auf dem Heiratsmarkt zu erreichen. Auf welche Schändlichkeiten Mrs. Otley noch verfallen würde, konnte Beatrice natürlich nicht beurteilen, doch angesichts des bislang an den Tag gelegten Verhaltens war sie sich ziemlich sicher, dass diese ihrer Tante durchaus das Wasser reichen oder sie sogar noch übertreffen könnte.
Die Mütter ließen ihre Töchter also gegeneinander antreten, Flora und Emily aber weigerten sich, deren Wünschen zu entsprechen. Obwohl Flora mit ihren glatten, kastanienbraunen Haaren, ihren haselnussbraunen Augen, den ebenmäßigen weißen Zähnen und einer Mitgift, die als großzügig, wenn nicht gar als verschwenderisch beschrieben werden konnte, auf unaufdringliche Weise hübsch war, hatte sie doch viel zu große Ehrfurcht vor Emily, um in ihrer Gegenwart irgendetwas anderes zu tun, als sie stumm zu bewundern und darauf zu warten, dass diese das Wort an sie richtete. Gerade in diesem Moment saß sie auf der Polsterbank gegenüber dem offenen Kamin und wartete gespannt, was Emily als Nächstes sagen würde. Als sich Miss Otley schließlich zu einer Äußerung hinreißen ließ, stellte sie jedoch nur fest, dass der Blauton des Salons ihrem Teint tatsächlich so sehr schmeichelte, wie sie es vermutet hatte.
»Mir ist nie ein schmeichelhafterer Blauton untergekommen«, antwortete Flora darauf allen Ernstes, bevor ihr bewusstwurde, dass der Kommentar der falschen Partei das Verdienst für das glücklich gewählte Arrangement zuschrieb. »Ich meine, mir ist noch kein Gesicht untergekommen, dem Blau so sehr schmeichelt wie dem Ihren.«
Beatrice verdrehte die Augen und verbuchte diesen Austausch unter »das Geistloseste, was ich jemals gehört habe«. Hätte sie Unfug im Sinn gehabt, hätte sie versucht, die Aufmerksamkeit der beiden auf den Duke zu richten, den ihre Bewunderung zweifellos äußerst verdrießlich gestimmt hätte.
Nein, dachte sie, als ihr ein noch besserer Gedanke durch den Kopf schoss. Sie sollte den Duke zum Ziel von Tante Veras und Mrs. Otleys Interessen machen. Fraglos war er ein Preis, der es wert war, dafür dreißig Jahre Freundschaft zu opfern.
Allerdings hatte Beatrice keinen Unfug im Sinn. Das konnte sie sich nicht leisten. Schon im Alter von sieben Jahren war ihr eines klar geworden: Von der Güte einer Familie abhängig zu sein hieß im Grunde nur, ihrer Gnade ausgeliefert zu sein. Ihre Tante und ihr Onkel, obwohl nachsichtig mit Flora und geduldig mit Russell, erwarteten von ihr unbedingte Folgsamkeit, und da sie praktisch veranlagt war, kam sie dem widerspruchslos nach. Ihre Fähigkeit, Vorgänge zu verstehen und rasch die Ursache von Problemen zu erfassen, machte sie für ihre Verwandten zu einer unerlässlichen Hilfe. Und auch wenn Beatrice ihnen ihre Anmaßung manchmal übelnahm, so war sie doch immer dankbar für das leibliche Wohlergehen, das sie ihr zuteilwerden ließen. Ihr Magen war immer gefüllt, ihr Bett immer weich, ihre abgetragene Kleidung hinkte der Mode nur ein oder zwei Jahre hinterher, was sie nicht wirklich schlimm fand.
Wenn sie gewollt hätte, hätte sie wohl einiges gefunden, worüber sie hätte unzufrieden sein können, denn es war doch viel Ungerechtigkeit in der Welt, angefangen vom tragischen Tod ihrer Eltern, die bei einem Bootsunglück ertrunken waren, als Beatrice fünf gewesen war. Doch sah sie keinen Sinn darin, sich über Dinge zu beklagen, die sie nicht ändern konnte. Einfacher war es, zu tun, was von ihr verlangt wurde, und sich anschließend in die Privatsphäre ihrer Gedanken zurückzuziehen, so wie sie es auch jetzt tat, während sich Tante Vera mit ihrer alten Freundin zankte und Flora ihre neue Freundin anhimmelte.
Sie hätte lieber ein Buch gelesen, aber ihr Abendkleid hatte keine Taschen, in denen man nützliche Gegenstände hätte schmuggeln können, und der Salon hielt nur Modemagazine bereit. Im ersten Stock, das wusste sie, gab es eine Bibliothek, gegenüber dem Musikzimmer, darauf hatte Ihre Ladyschaft hingewiesen, als sie sie gleich nach ihrer Ankunft durch das Herrenhaus geführt hatte. Allerdings hatte das Tempo der Führung es nicht zugelassen, die einzelnen Titel in Augenschein zu nehmen. Beatrice war jedoch recht zuversichtlich, die Bibliothek bald wieder aufsuchen zu können, etwas, das sie sich für die nächstbeste Gelegenheit vorgenommen hatte.
Die Gentlemen hielten sich nicht lange bei ihrem Port auf und gesellten sich in ausgelassener Stimmung zu den Damen. Voller Vorfreude sprachen sie über den für den nächsten Tag geplanten Ausflug, da es ihnen unvorstellbar schien, dass der Regen weiterhin anhalten würde.
»Es weht ein frischer Wind heut Abend«, erläuterte Amersham, »der die Wolken mit Sicherheit fortblasen wird.«
Beatrices Meinung nach offenbarte diese Beobachtung ein grundlegendes Missverständnis darüber, wie das Wetter funktionierte, aber Lord Skeffington und sein Sohn stimmten Amersham zu. Viscount Nuneaton erging sich in Spekulationen über die ideale Windgeschwindigkeit, die es brauche, um die Wolken zu vertreiben, und Mr. Otley erzählte von einer Flussreise auf dem Ganges, die durch starke Windböen sehr unangenehm geworden war.
Der Duke of Kesgrave, der sich beim Dinner an diesem Abend und auch schon beim Tee am Nachmittag oder beim morgendlichen Frühstück geweigert hatte, auch nur die kleinste Ungenauigkeit unkommentiert stehen zu lassen, sagte seltsamerweise nichts. Statt anzunehmen, der ansonsten stets so berüchtigt gut informierte Lord wisse nichts über die Elemente, schrieb Beatrice sein Schweigen einer vorübergehenden Geistesabwesenheit zu, die auch seine Miene widerspiegelte. Seine blauen Augen, sonst so klar in ihrer Zielgerichtetheit, wirkten trüb vor Zerstreutheit.
Wahrscheinlich langweilen wir ihn zu Tode, dachte sich Beatrice. Geschieht ihm recht, nachdem er sich den ganzen Tag als öder Pedant erwiesen hat.
Es hatte sie überrascht, dass ein Mann seines Ranges sich veranlasst fühlte, andere überhaupt zu korrigieren. Wäre sie eine Duchess, würde sie die Privilegien ihres Standes so sehr genießen, dass sie andere überhaupt nicht mehr registrieren würde. Sie würde dann nur noch tun, was ihr Freude machte, lesen, Pianoforte spielen, lange Spaziergänge unternehmen, das Küchenpersonal aufscheuchen, damit sie ihr rout-cakes mit Rosenwasser für die Abendgesellschaften backten, oder sie würde Neues lernen wie zum Beispiel einen Vierspänner fahren. Sie hatte den Umgang erfahrener Kutscher mit den Pferden schon immer bewundert und konnte nur mutmaßen, wie aufregend es sein musste, die Kontrolle über solch ein Gefährt zu haben. Leider beschränkte sich ihre eigene Erfahrung mit Pferden auf ein paar müde Sprünge, zu denen sie die alten Gäule, die halbherzig vor den Stallungen der Hyde-Clares grasten, ermuntert hatte.
Offensichtlich war Kesgrave mit seinen zweiunddreißig Jahren so sehr an seine Privilegien gewöhnt, dass er sie gar nicht mehr wahrnahm, was Beatrice noch mehr entrüstete.
Warum war dieser Mensch überhaupt hier?, dachte sie aufsässig.
Bei den anderen Gästen waren die Gründe nachvollziehbar. Nuneaton gehörte zur Familie, die Otleys hofften darauf, einmal zur Familie zu gehören. Amershams Anwesenheit diente dazu, den Erben von Skeffington bei Laune zu halten, denn kein junger Mann, der fast volljährig war, ließ sich ohne Verbündeten aufs Land locken. Tante Veras Motive, sie alle nach Cumbria zu bringen, beruhten auf einer Mischung aus Neugier und Geiz, denn zweifellos war ihre Tante ebenso sehr daran interessiert, den Landsitz ihrer alten Freundin zu sehen wie Floras Glück und Vermögen zu sichern.
Für die Anwesenheit des Dukes allerdings gab es keine wirkliche Erklärung. Beatrice kam es fast so vor, als ob er nur eingeladen worden war, um sie zu ärgern.
Natürlich war eine solche Schlussfolgerung absonderlicher Unsinn. Beatrice Hyde-Clare stand nicht auf der Stufe jener, die man zu ärgern suchte – eine Erkenntnis, die die unglückselige Wirkung hatte, sie noch mehr zu ärgern. Obwohl diese Reizbarkeit absurd war für eine junge Frau, die sich längst damit abgefunden hatte, ein Nichts zu sein, konnte sie weder diese Regung noch ihre Verärgerung wegen des Dukes oder des Regens unterdrücken.
Nein, dachte sie bei näherer Überlegung, nur wegen des Dukes.
Nicht lange nach Ankunft der Gentlemen verkündete Lady Skeffington, dass sie sich nun zurückziehen werde, und Beatrice, dankbar für die Gelegenheit, den Abend zu beenden, ließ sich ebenfalls entschuldigen. Der ereignislose Tag mit seinem nicht enden wollenden Geplauder und unzähligen Tassen Tee hatte sie erschöpft, daher erwartete sie, sofort einzuschlafen, sobald ihr Kopf das Kissen berührte.
Stunden später lag sie immer noch wach.
Nachdem sie Schafe gezählt, komplizierte mathematische Gleichungen im Kopf berechnet und sich die Handlung jedes Shakespeare-Stücks vergegenwärtigt hatte – der Komödien, Tragödien und der Historien –, gab sie es auf. Sie stieg aus dem Bett, zündete eine Kerze an und ging ihre begrenzten Lektüremöglichkeiten durch. Am Abend zuvor hatte sie eine faszinierende Biographie von Viscount Townshend beendet, die scheinbar Unmögliches geschafft und bei ihr das Interesse am Anbau Weißer Rüben geweckt hatte. Daneben hatte sie auch einen Roman mitgenommen, den Pfarrer von Wakefield, seltsamerweise konnte sie sich aber nicht dazu aufraffen, ihn zu beginnen.
Die Biographie hatte ihr so gut gefallen, dass sie liebend gern eine weitere lesen wollte, vorzugsweise eine, die ebenfalls von den landwirtschaftlichen Fortschritten in Britannien handelte.
Ein abseitiger Wunsch, sicherlich, aber die ausladende Bibliothek mit ihren vom Boden bis zur Decke reichenden Regalen, vollgestopft mit Büchern, würde ihn bestimmt erfüllen können. Nachdenklich nahm sie die Kerze und hielt sie vor die Uhr. Es war fast zwei. Kaum zu glauben, dass sie drei Stunden lang versucht hatte, einzuschlafen, doch hier hatte sie den Beweis.
Eine radikale Lösung war nötig.
Sie schlüpfte in ihren Morgenrock und überlegte, wer im Haus noch wach sein und sie überraschen konnte. Der junge Mr. Skeffington und sein Freund Amersham vielleicht, die auch am Abend zuvor noch lange aufgewesen waren, Brandy getrunken und Karten gespielt hatten. Russell, für den die jungen Männer leuchtende Vorbilder waren, leistete ihnen vielleicht Gesellschaft, obwohl ihm sein Vater das Kartenspiel strikt untersagt hatte. Wenn sie noch Piquet spielten, hatten sie es sich vermutlich wieder im Salon bequem gemacht, der auf einer anderen Etage lag.
Auch würde sie kaum den Otleys über den Weg laufen, denn alle drei Familienmitglieder erachteten den gesunden Schlaf als essentiell für Emilys Schönheit. Ihre Mutter hatte beim Frühstück ausführlich ihre Meinung diesbezüglich ausgebreitet, um zu erklären, warum sie und ihr Mann so spät aufgestanden waren.
»Wir halten uns weder an die Gepflogenheiten der Stadt noch an die des Landes, sondern nur an die der Otleys«, hatte sie gesagt, während sie den dritten Zuckerwürfel in ihre Teetasse plumpsen ließ.
Blieben nur noch Nuneaton und Kesgrave, dachte sie, als sie die Tür öffnete und im Schein ihrer Kerze in den tiefschwarzen Gang hinausspähte. Aber wie es schien, waren alle alleinstehenden Gentlemen in einem anderen Flügel untergebracht. Der Korridor war leer, der Teppich schien dick genug, um ihre Schritte zu dämpfen. Sollte tatsächlich noch jemand in seinem Zimmer wachliegen, würde er nichts hören.
Lautlos durchquerte sie den Gang zur Treppe und huschte in der Dunkelheit so rasch wie möglich die Stufen hinunter. Unten blieb sie kurz stehen, um sich zu orientieren. Wenn sie sich richtig an den Grundriss des Hauses erinnerte, befand sie sich am nördlichen Ende der Halle und in unmittelbarer Nähe zum Musikzimmer, dem Nähzimmer Ihrer Ladyschaft und der Bibliothek. Es gab auch Schlafzimmer im ersten Stock, doch die lagen an der Südseite.
Beatrice hielt die Kerze vor sich, damit sie so viel Licht wie möglich hatte, und ging mehrere Schritte in den Korridor hinein. Umhüllt vom Dämmerlicht, versuchte sie sich zu erinnern, wie dieser Weg am helllichten Tag ausgesehen hatte. Heiter, dachte sie, mit Gipsstuckaturen und einem Gemälde des Parks an der Ostseite.
Sie hörte die Diele leise knarren, ihr Herz machte einen Satz. Dann wurde ihr bewusst, dass das Geräusch von ihr selbst stammte.
»Um Gottes willen«, murmelte sie leise, »hier ist niemand. Benimm dich also nicht so, als wärst du noch nie in stockdunkler Nacht durch ein fremdes Haus geschlichen.«
Was sie in Wahrheit aber tatsächlich noch nie getan hatte. Sie war oft nachts mit einer Kerze durchs Welldale House gegangen, aber dort kannte sie jede lose Diele und jeden Riss in der Wand.
Das hier war etwas anderes.
Dennoch sollte sie ihrer Phantasie nicht freien Lauf lassen. In der Ecke des Gangs verbarg sich nichts – außer Staubflusen vielleicht, die den Stubenmädchen bei ihren Bemühungen entgangen waren.
Die Bibliothek musste irgendwo in der Mitte des Gangs liegen, erinnerte sie sich, daher blieb sie auf halbem Weg stehen, hob die Kerze und ging zur nächstgelegenen Tür, die, als sie sie öffnete, den beeindruckenden Schatten des wundervollen Pianofortes der Skeffingtons zum Vorschein brachte.
Ausgezeichnet, dachte Beatrice. Ich habe das Musikzimmer gefunden.
Das bedeutete, dass die Bibliothek gegenüber lag.
Als sie die Kerze in die andere Richtung drehte, bemerkte sie, dass die Tür auf der gegenüberliegenden Seite bereits offen stand. Sie trat ein und stellte rasch fest, dass es sich tatsächlich um die Bibliothek handelte. Schwaches Mondlicht – vielleicht stimmte des Earl of Amershams Windtheorie doch – fiel durch eine Reihe hoher Bogenfenster auf das Parkett und beleuchtete die Bücherregale an den Wänden. In der Mitte des Hauptraums standen sich zu beiden Seiten eines auf Hochglanz polierten Mittelfußtisches aus Walnussholz zwei Sofas gegenüber. Links vom Eingang führten Stufen zu einem Zwischengeschoss mit freistehenden Regalen und einer gemütlichen Lesenische, die so einladend aussah, dass Beatrice sich dort am liebsten sofort in den Armsessel gekuschelt hätte.
Der prächtige Bibliotheksraum begeisterte sie. Das hier übertraf die Bibliothek von Welldale bei Weitem, die, wenn man es genau nahm, nur ein weiteres Zimmer war, das Tante Vera zum Servieren des Afternoon-Teas benutzte. Es fanden sich darin natürlich auch Bücher, unter anderem mehrere bedeutende Erstausgaben, aber ihm fehlte die Großzügigkeit von Lakeview Hall. Ihre Sammlung, eine vernachlässigenswerte Auswahl der Literatur der vergangenen hundert Jahre, nahm sich im Vergleich zur hiesigen Bibliothek dürftig aus, ein Glas Wasser gegenüber dem Meer.
Beatrice war überzeugt, dass sie hier genau das finden würde, was sie suchte.
Also, wo waren die Biographien?
Die erste Abteilung, die sie näher in Augenschein nahm, waren Romane aus dem achtzehnten Jahrhundert. Obwohl sie Samuel Richardson und Jonathan Swift sehr bewunderte, ging sie schnell weiter zum nächsten Regal. Sie las die Buchrücken: Das verlorene Paradies … Die Prinzessin von Clèves … Don Quixote … Dann John Donne, George Herbert, Robert Herrick, Ben Jonson, Henry King.
Nachdem ihr klar wurde, dass das Hauptgeschoss ganz der Prosa und der Dichtung vorbehalten war, stieg sie die Stufen zur Galerie hinauf und überflog die Regale: Geographie, Religion, Geschichte. Je tiefer sie in die Gänge eintauchte, desto dunkler wurde es, da die Regale das Mondlicht aussperrten. Sie hob die Kerze und las die Beschriftung der Abteilung – Ägyptologie –, bog um die Ecke und trat auf etwas so Hartes, dass es sich durch den Pantoffel hindurch in ihre Fußsohle bohrte.
Überrascht gab sie einen japsenden Laut von sich, dessen Atemhauch das Kerzenlicht löschte.
Na, großartig, dachte sie, beugte sich zu Boden und hob den anstößigen Gegenstand auf.
War das ein Kerzenständer?
Wirklich?
Wer würde so unachtsam sein und mitten auf dem Boden einen Kerzenständer liegen lassen? Sie konnte sich nicht vorstellen, dass Lady Skeffington so schludrige Dienstmädchen beschäftigte.
Als sie die Finger um den schweren Ständer legte, spürte sie etwas Klebriges. Irgendein Gelee vielleicht? Sie versuchte in der Dunkelheit die Substanz näher in Augenschein zu nehmen. Vergebens allerdings, nachdem ihre Kerze erloschen und das Mondlicht zu schwach war, um in den Gang vorzudringen.
Abgelenkt durch die seltsame Vertrautheit der klebrigen Substanz – vielleicht Holundermarmelade –, schlich Beatrice zum Ende des Gangs, wo große Fenster einen schwachen, aber irisierend-glänzenden Schein hereinließen. Den Schatten-Regalen entkommen, bog sie um die Ecke, und dort, im vollen Schein des Mondlichts, die golden schimmernden Locken in der Stirn, stand mit zu Boden gerichtetem Blick der Duke of Kesgrave.
Und vor ihm lag der Leichnam von Mr. Otley.
2
Nicht schreien. Nicht schreien. Nicht schreien.
Still skandierte Beatrice die Worte im Geiste vor sich hin, während ihr Herz wie ein Dutzend galoppierende Pferde raste und sie den Toten in seiner smaragdgrünen Weste anstarrte. Er lag mit dem Gesicht nach unten und hatte die Nase gegen den Läufer gepresst, der Hinterkopf war voller Blut – es strömte aus einem Loch, das ihm in den Schädel geschlagen worden war. Mit einem …
O Gott!
Als ihr dämmerte, was passiert war, wich ihr mit einem Mal jede Kraft aus den Fingern, die immer noch den Kerzenständer umfasst hielten. Entsetzt ließ sie die Waffe fallen, die das Leben des armen Mr. Otley beendet hatte. Dumpf, mit einem hallenden Knall landete der Ständer auf dem Boden, worauf der Duke den Kopf hob.
»Sie!«, entfuhr es ihm erschrocken.
Ja, ich, dachte sie, während ihr alles mit schrecklicher Klarheit vor Augen stand. Ich bin Zeugin Ihrer Schurkentat.
Was würde er ihr antun? Ihr den Schädel einschlagen, wie er es beim Gewürzhändler getan hatte? Sie erdrosseln? Mit einem Buch ersticken?
Er konnte alles tun, was er wollte, denn er war mehr als einen Kopf größer und mit vortrefflichen Muskeln ausgestattet. Nach den vielen Nachmittagen, die er wie ein richtiger Korinther beim Sparring mit Gentleman Jackson verbracht hatte, wäre es ihm ein Leichtes, ihr den Garaus zu machen.
Was würde er mit ihrer Leiche anstellen? Sie in der Bibliothek zurücklassen, damit ein Dienstmädchen oder ein Diener sie fand? Im Park verscharren? Im See versenken, damit ihre Familie nie erfahren würde, was ihr zugestoßen war? Würde er in ihrer Handschrift einen gefälschten Brief aufsetzen, der verkündete, sie habe die Hyde-Clares für immer verlassen und ihr Glück auf dem Kontinent oder in Amerika versuchen wollen?
Würde ihre Tante einen solchen Unsinn glauben? Sicherlich hatte Beatrice in zwanzig Jahren niemals so viel Tatkraft aufgebracht, die eine solche Geschichte plausibel erscheinen ließe. Das Weiteste, wohin es sie bislang allein verschlagen hatte, war die nördliche Grenze ihres Anwesens in Sussex gewesen, und das auch nur …
Lauf, du Dummkopf! Wirf die Regale um! Schreie!
Sie wusste, sie musste etwas tun, war vor Angst aber wie gelähmt. Das Lamm, das freiwillig zur Schlachtbank ging.
Adieu, grausame Welt.
»Sie rühren sich nicht vom Fleck«, befahl Kesgrave.
Oh, welche Ironie! Beatrice spürte, wie ein hysterisches Lachen in ihrer Kehle aufstieg.
Aber der Schrecken ging ihr durch und durch, so dass sie nicht einmal zu dieser kümmerlichen Reaktion fähig war. Ihre eigene Tatenlosigkeit widerte sie an. Zwei Jahrzehnte unter der Fuchtel ihrer Tante hatten sie zu einem fügsamen Wesen gemacht, ja, aber wenn es um ihr Leben ging, könnte sie sich doch wenigstens noch zu einer Erwiderung aufraffen.
Ein Wort des Protestes, um Gottes willen!
Das unerträgliche Gefühl, dass das Letzte in ihrem Leben, was sie empfinden sollte, diese kraftlose Feigheit war, spornte sie schließlich an zur Tat. Rasch hob sie den Kerzenständer wieder auf, hielt ihn in drohendem Winkel von sich gestreckt und sagte: »Sie rühren sich nicht vom Fleck.«
Wie schwach ihre Stimme klang. Wäre sie der mordlüsterne Duke gewesen, der ihr gegenüberstand, hätte sie vor Vergnügen gegluckst, bevor sie dieser bebenden jungen Frau den Garaus gemacht hätte. Daher hob sie den Kerzenständer noch ein Stück höher, damit er im Mondlicht glänzte.
»Sie werden mich nicht auch noch umbringen«, erklärte sie, nun mit fester Stimme, und in diesem Moment sagte sie es nicht nur, sie meinte es auch. Sie würde hier nicht sterben, nicht in dieser verlassenen Bibliothek in diesem stillen Winkel Cumbrias, mitten in der Nacht.
Aber der Duke hörte sie gar nicht, denn er hatte im exakt gleichen Augenblick gesagt: »Wollen Sie mich etwa auch noch umbringen?«
Obwohl seine Worte überhaupt keinen Sinn ergaben, erfasste sie den Tonfall, in dem sich Amüsement und Skepsis vermischten. Offenkundig glaubte er, sie wäre nicht in der Lage, die Gerätschaft mit derselben Wirksamkeit handzuhaben wie er, eine Annahme, bei der sich ihr sofort die Haare sträubten. Sein Selbstbewusstsein war unerträglich. Warum war er so von sich überzeugt? Weil sie kleiner war an Größe und Rang, ein Nichts, ohne bedeutsame Bekannte, während er, der große, gebieterische Duke, alle Privilegien genoss, die man sich nur vorstellen konnte? Bei allen selbstgefälligen, blasierten, dünkelhaften Vorstellungen in der …
Dann drang die Bedeutung seiner Worte zu ihr durch.
Er hatte auch gesagt.
Was meinte er damit?
Wen hatte sie denn noch umgebracht?
Sie blickte auf den toten Mr. Otley, aus dessen Haaren immer noch das Blut sickerte, dann starrte sie, von neuem Schrecken gepackt, zum Duke.
Er konnte doch nicht meinen, dass sie … dass sie …
»Ich war es nicht«, sagte sie.
Wieder hatten sie gleichzeitig gesprochen, auch Kesgrave hatte etwas von sich gegeben, das genauso geklungen hatte wie ihre Worte.
Ein Trick, wie Beatrice sofort vermutete. Er versuchte sie zu verwirren, damit er sie entwaffnen und die Oberhand gewinnen konnte. Hielt er sie für einen solchen Einfaltspinsel, dass er glaubte, sie fiele auf seine billige Masche herein?
Sie packte den Kerzenständer wieder fester und schwang ihn drohend über dem Kopf.
Kesgrave sah sie an, dann lächelte er trocken und schüttelte den Kopf. »Ich verstehe Ihre Vorsicht, Miss Hyde-Clare, denn die Lage ist für Sie so belastend wie für mich. Ich habe den Toten gefunden, Sie aber die Waffe. Sie haben ebenso wenig Grund, an meine Unschuld zu glauben, wie ich an Ihre, aber ich bin ein vernunftbegabter Mensch und kann mir den Sachverhalt vergegenwärtigen und zu der logischen Schlussfolgerung gelangen, dass Sie für Otleys bedauerlichen Zustand nicht verantwortlich sind.« Er sprach ganz ruhig und gelassen, als wäre er darauf bedacht, die wilden Tiere in der königlichen Menagerie nicht zu reizen. »Ich vertraue darauf, dass Sie ebenfalls ein vernunftbegabter Mensch sind und sich den Sachverhalt vergegenwärtigen und ebenfalls zu dem Schluss kommen, dass auch ich nicht dafür verantwortlich bin.«
Da sie weder ein Leopard noch ein Grizzlybär im Tower of London war, nahm sie Anstoß an seinem Ton. »Sachverhalt?«, fragte sie und legte den Kopf schief.
»Ich bin der Duke of Kesgrave«, sagte er nur.
»Tatsächlich?« Beatrice zog die Augenbrauen hoch. Seinen Adelstitel als Beleg für seine Unschuld anzuführen war so ziemlich das Absurdeste, was sie jemals gehört hatte. Glaubte dieser Mann allen Ernstes, allein sein Rang wäre Ausweis einer grundlegenden Lauterkeit? Beatrice hätte fast gelacht, doch Leichtsinn war der Situation ganz und gar unangemessen. Außerdem ahnte sie, wie der Duke ein hysterisches Gekicher interpretieren würde – als Beweis dafür, dass sie eine willensschwache Frau wäre, die dem Druck der Situation nicht gewachsen war. Sie war überzeugt, dass er von ihr bereits eine nicht sehr hohe Meinung hatte, und bezweifelte, dass er Vertreterinnen ihres Geschlechts überhaupt für vernunftbegabte Wesen hielt.
»Und ich wollte mir ein Buch holen«, sagte sie und lieferte damit eine Erklärung für ihre Anwesenheit in dem dunklen Bibliotheksraum. »Nachdem ich über mehrere Stunden nicht einschlafen konnte, wollte ich mich mit neuer Lektüre versorgen. Ich hatte zwar selbst einen Roman mitgebracht – den Pfarrer von Wakefield –, war dafür aber nicht recht in Stimmung, denn die Mühen einer Familie, der im Leben übel mitgespielt wird, entsprechen nicht meiner Gemütslage. Ich suchte nach einer Biographie und war überzeugt, in einer so gut bestückten Bibliothek wie dieser das Richtige zu finden.«
Falls der Duke darüber verärgert war, dass seine bedeutsame Stellung allein nicht ausreichte, um ihn von jedem Verdacht zu befreien, ließ er es sich jedenfalls nicht anmerken.
»Ich wollte mir ebenfalls etwas zum Lesen suchen«, sagte er nur.
Das war eine vage Antwort, die Beatrice kaum zufriedenstellen konnte. Sie selbst hatte immerhin einige Details angeführt, um ihrer Aussage Glaubwürdigkeit zu verleihen.
»Und was oder wen, wenn ich fragen darf?«, hakte sie misstrauisch nach.
»Sir Philip Sidney«, entgegnete er wie aus der Pistole geschossen.
Die umgehende Erwiderung war beruhigend, der Inhalt jedoch ließ sie aufschrecken. »Die Dichtung befindet sich im Zwischengeschoss«, erklärte sie und runzelte die Stirn. »Zusammen mit den Romanen und den Erzählbänden.«
»Ich suchte aber A Defense of Poetry«, stellte er klar. »Literarische Abhandlungen befinden sich hier unten, neben den Gesetzestexten und der Gartenbaukunst.«
Beatrice zögerte. Sie hätte sich von der Präzision seiner Antwort gern überzeugen lassen – genau das hatte sie sich doch gewünscht –, allerdings war sie mit der Einrichtung der Bibliothek nicht so vertraut, dass sie den Wahrheitsgehalt seiner Aussage hätte überprüfen können. Und ein gerissener Mörder würde, ungeachtet aller Tatsachen, doch ebenso sehr im Brustton der Überzeugung sprechen, oder etwa nicht?
Als er ihre Skepsis wahrnahm, blaffte er: »Meine liebe Miss Hyde-Clare, ich hatte Geduld mit Ihnen, denn Sie standen unter Schock, außerdem war Ihr Argwohn gerechtfertigt, aber Sie strapazieren meine Nachsicht. Welches Motiv sollte ich denn haben, um dieses Verbrechen zu begehen? Weder habe ich geschäftlich mit diesem anmaßenden Nabob aus Kent zu schaffen, noch bin ich im Mindesten daran interessiert, mit ihm zu verkehren. Die Unterstellung, ich könnte mich dazu aufraffen, das Leben dieses Mannes zu beenden, während ich ihn doch lediglich in seine Schranken weisen müsste, ist ebenso absurd wie beleidigend. Ich wäre Ihnen also sehr verbunden, wenn Sie mich von diesen lächerlichen Verdächtigungen freisprechen und sich auf die größere Sache konzentrieren würden, nämlich, wer wirklich hinter dieser ungeheuerlichen Schandtat steht.«
Das war ein exzellenter Tadel – sarkastisch, verächtlich und mit dem genau richtigen Maß an Gereiztheit vorgetragen, um anzudeuten, dass es unter seiner Würde sei, sich überhaupt darüber auszulassen. Vor der Entdeckung des leblosen Mr. Otley hätte die Aussicht, zum Ziel seines beißenden Spotts zu werden, sie mehr geängstigt als die Möglichkeit, sich in der Gesellschaft eines Mörders aufzuhalten, aber die Angst hatte ihr den Mut der Verzweiflung verliehen, und mit dem Mut kam die Einsicht, dass sie nichts zu verlieren hatte. Außer dem Leben selbst stand für sie nichts auf dem Spiel, und wenn der Duke of Kesgrave sie zum Gespött der Saison machen wollte, dann, bitte sehr, stand es ihm frei. Allerdings bezweifelte sie, dass er ihr mehr schaden konnte als Miss Brougham, die sie damals als fad bezeichnet hatte.
Sie hob das Kinn und sagte: »Bedaure, Eure Durchlaucht, dass es Ihnen ungelegen kommt, sich um meine Sicherheit zu sorgen. Natürlich steht Ihre Bequemlichkeit über meinem Seelenfrieden.«
War Kesgrave bestürzt gewesen, sie mit der Mordwaffe in der Hand in der verlassenen Bibliothek anzutreffen, so war er jetzt offensichtlich verblüfft, selbst zum Ziel solch ungezähmten Sarkasmus zu werden. Wie konnte ein so kleines, von der Wohltätigkeit anderer abhängiges Mauerblümchen ohne jede Beziehung es wagen, ihn mit so wenig Respekt zu behandeln?
Beatrice war selbst ein wenig erschreckt über ihr wagemutiges Vorpreschen. Doch dann – was wusste dieser Duke schon über sie? Sicher nicht, dass ihre Eltern seit Langem tot waren und dass sie geduldeterweise bei ihrer Tante und ihrem Onkel lebte. Er würde bloß wissen, dass er, was sie anging, überhaupt nichts wissen musste.
»Nun gut, Miss Hyde-Clare«, meinte er da auch schon spöttisch, »dann sagen Sie mir doch, was ich zu Ihrem Seelenfrieden beitragen kann, damit Sie mich nicht mehr so anstarren müssen, als wollte ich jeden Moment meine Hände um Ihren Hals schließen und zudrücken. Instruieren Sie mich, ich bin ganz der Ihre.«
Oh, daran hatte sie die größten Zweifel.
Dennoch ging sie auf seine Bitte ein und überlegte, wodurch sie von seiner Unschuld vollständig überzeugt werden könnte. Der Gerechtigkeit halber musste sie sich eingestehen, dass es in hohem Maße unwahrscheinlich war, dass er durch irgendwelche Umstände zu diesem Mord getrieben worden war, denn er hatte doch alles, was ein Gentleman zu einem befriedigenden Leben brauchte: Status, Vermögen, gefälliges Benehmen, den Respekt von seinesgleichen. Aber nur, weil etwas unwahrscheinlich schien, hieß es ja noch nicht, dass es völlig ausgeschlossen war. Vielleicht hatte Mr. Otley geheime Informationen über Kesgrave aufgedeckt, was den Duke dazu veranlasst hatte, die Bedrohung auf extremste Weise unschädlich zu machen? Ja, natürlich. Jemand, der so gezielt seine spöttischen Pfeile abschoss, hatte offensichtlich wenig Respekt vor dem Wohlergehen und den Sorgen anderer. Glaubte sie wirklich, dass es so gewesen sein konnte? Nein, das glaubte sie nicht. Wenn, dann konnte sich Beatrice vorstellen, dass der Duke den vermeintlichen Skandal – oder was immer auch dahinterstehen mochte – eher breittreten und Mr. Otley zum Opfer seiner scharfzüngigen Lästerreden machen würde.
Sie gab einen tiefen Seufzer von sich und spürte, wie ein Teil ihrer Angst entwich.
Doch den Kerzenständer hielt sie nach wie vor fest umklammert, während sie wieder auf Mr. Otleys eingeschlagenen Schädel schaute. Nachdem sie nun nicht mehr um ihr eigenes Leben fürchtete, überkam sie die Trauer für dieses andere, das auf so brutale Weise beendet worden war. Sie hatte mit Mr. Otley persönlich nicht viel zu tun gehabt, abgesehen von einem Wortwechsel über dem Teetablett am Tag zuvor, der so angenehm wie kurz gewesen war, aber er war ein geliebter Vater und Ehemann und ein angesehener Gentleman, über dessen Geschäftserfolge in Indien stets ehrfürchtig gesprochen wurde. Man würde ihn vermissen.