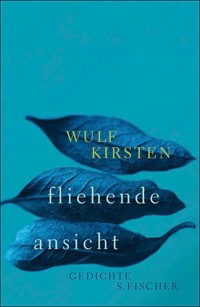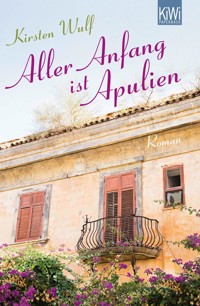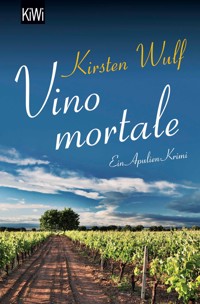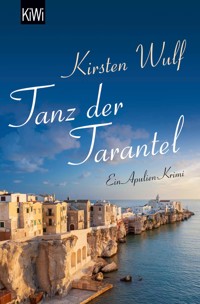14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Mörderisches Italien: Drei Krimis aus drei Regionen – drei Mörder, drei Ermittler! Tauchen Sie ein in die faszinierenden Landschaften Italiens und begleiten Sie scharfsinnige Ermittler bei der Aufklärung rätselhafter Mordfälle. In Apulien liegt der berühmte Pizzica-Musiker Nicolà Capone tot in einer Kapelle. Commissario Cozzoli und die Hamburger Journalistin Elena Eschenburg stoßen bei ihren Ermittlungen auf eine Mauer des Schweigens. In Südtirol entdeckt Skipisten-Toni nachts auf einem Gletscher die Leiche eines Einsiedlers – getötet wie einst die Mumie Ötzi. Commissario Grauner und sein Ispettore Saltapepe stehen vor einem Rätsel. Und am Lago Maggiore glaubt der ehemalige Polizeipsychologe Matteo Basso nicht an einen Unfall, als Gisellas Leiche am Seeufer gefunden wird. Seine Ermittlungen führen ihn bis ins mondäne Mailand und tief in die Vergangenheit der Region. Lassen Sie sich von den atmosphärischen Schauplätzen und spannenden Fällen in Tanz der Tarantel von Kirsten Wulf, Der Tote am Gletscher von Lenz Koppelstätter und Die Tote am Lago Maggiore von Bruno Varese in den Bann ziehen. Drei fesselnde Italien-Krimis in einem E-Book-Bundle zum Spitzenpreis!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1107
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Kirsten Wulf / Lenz Koppelstätter / Bruno Varese
Mörderisches Italien
(3in1-Bundle)
Tanz der Tarantel -Der Tote am Gletscher -Die Tote am Lago Maggiore
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Kirsten Wulf / Lenz Koppelstätter / Bruno Varese
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Kirsten Wulf / Lenz Koppelstätter / Bruno Varese
Kirsten Wulf, geboren 1963 in Hamburg, arbeitete als Journalistin in Mittel- und Südamerika, Portugal und Israel. Seit 2003 lebt und schreibt sie in Italien.
Lenz Koppelstätter, Jahrgang 1982, ist in Bozen geboren und in Südtirol aufgewachsen. Nach dem Studium der Politik in Bologna und der Sozialwissenschaften in Berlin absolvierte er in München die Deutsche Journalistenschule. Als freier Autor hat er u. a. für den Tagesspiegel und Zeit Online gearbeitet, als Textchef für zitty – außerdem als Kolumnist und Medienentwickler für verschiedene Verlage, Magazine und Zeitungen. »Der Tote am Gletscher« ist sein erster Roman.
Bruno Varese lebt im Valle Vigezzo und in der Schweiz. »Die Tote am Lago Maggiore« ist sein erster Kriminalroman.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Drei Regionen – drei Morde – drei Ermittler
»Tanz der Tarantel«
Am dritten Tag des Festes zu Ehren von Santo Paolo, dem Schutzheiligen der kleinen Stadt Galatina in Apulien, liegt eine Leiche in der Kapelle des Heiligen: Nicola Capone, der erfolgreichste junge Pizzica-Musiker aus dem Salento, der zwei Tage zuvor noch einen umjubelten Auftritt hatte.
Der brummige Commissario Cozzoli, der gerade in Mailand in einem Antimafiaprozess aussagt, kommt Hals über Kopf zurück und trifft auf Elena von Eschenburg. Die Hamburger Journalistin, die sich in Apulien niedergelassen hat, um ein neues Leben zu beginnen, hat den Musiker in den Tagen zuvor für eine Reportage begleitet. Gemeinsam beginnen sie zu ermitteln; die Nachforschungen führen sie in malerische Städte und uralte Steindörfer, zu Nicolas Familie und zu seinen Verehrerinnen. Aber sie stoßen auf Schweigen und stellen fest, dass in Apulien manche Geschichten nur die Musik erzählen kann.
»Tanz der Tarantel« ist der spannende Auftakt einer neuen Krimireihe aus dem tiefen Süden Italiens: Weitere Fälle mit einem ungewöhnlichen italienisch-deutschen Ermittlerpaar sind in Vorbereitung.
»Der Tote am Gletscher«
Nachts auf dem Gletscher, da gehört der Mensch nicht hin. Da sind nur die Geister der Toten und der Sturm und der Schnee. Trotzdem entdeckt Skipisten-Toni im Dezember hoch oben ein seltsames Licht – und wenig später die Leiche eines Einsiedlers. Mit einer Pfeilspitze in der Schulter. Fast am gleichen Ort, an dem viele Jahre zuvor Ötzi, der weltberühmte Steinzeitmensch, gefunden wurde, der mittlerweile im Bozner Museum liegt. Commissario Grauner, der an manchen Tagen lieber nur »Viechbauer« wäre, macht sich im tief verschneiten Schnalstal an die Ermittlungen. Unterstützt wird er von Saltapepe, seinem jungen Ispettore aus Neapel, der noch immer nicht versteht, was die Einheimischen an den Bergen finden. Zwischen Dorfintrigen, wortkargen Bewohnern, glühweinseligen Touristen, den kriminellen Machenschaften eines Skiliftunternehmers und kuriosen Ötzi-Spuren entwickelt sich ein hochspannender Fall, der weit in die Vergangenheit führt und die Ermittler vor immer neue Rätsel stellt.
»Die Tote am Lago Maggiore«
Am italienischen Ufer des Lago Maggiore, wo die Frühlingssonne das klare Wasser wärmt, versucht Matteo Basso vergeblich, seinen ersten Fisch zu fangen. Der ehemalige Mailänder Polizeipsychologe hat seinen Job an den Nagel gehängt und ist zurückgekehrt nach Cannobio, um die Macelleria seiner verstorbenen Eltern zu übernehmen. Am Wochenende soll das große Oldtimer-Rennen stattfinden und Gisella ihm bei den Salsiccia-Kreationen helfen, die ihm leider noch regelmäßig misslingen. Doch dann wird Gisellas Leiche am Ufer des Sees gefunden. Man vermutet, sie sei ertrunken. Matteo glaubt nicht an einen Unfall, denn Gisella war eine exzellente Schwimmerin. Er ermittelt auf eigene Faust. Warum wollte sie ihn in der Nacht zuvor so dringend sprechen? Und was hatte sie mit Maldini, dem windigen Gran Signore aus Stresa, zu tun? Als es beim Autorennen zu einem mysteriösen Unglück kommt und Matteo selbst in Gefahr gerät, ahnt auch Kommissarin Zanetti, dass sie es mit einem verzwickten Fall zu tun haben.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2014, 2015, 2016, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Gestaltung Bundle-Cover: Rudolf Linn, Köln
Wulf, Tanz der Tarantel
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Peter Adams / Getty Images
Koppelstätter, Der Tote am Gletscher
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © plainpicture/Magnum, the plainpicture edit/Jonas Bendiksen
Karten Südtirol-Übersicht und Schnalstal: Oliver Wetterauer
Varese, Die Tote am Lago Maggiore
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © plainpicture/cultura
ISBN978-3-462-31792-3
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Kirsten Wulf - Tanz der Tarantel
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
Epilog
Grazie!
Lenz Koppelstätter - Der Tote am Gletscher
Hinweis
Karten über das Schnalstal (Südtirol)
Prolog
21. Dezember
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
22. Dezember
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
23. Dezember
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
24. Dezember
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Epilog
Danke
Bruno Varese - Die Tote am Lago Maggiore
Karten zum Lago Maggiore
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Kirsten Wulf
Tanz der Tarantel
Ein Apulien-Krimi
meinem Geliebten,
Roman
Prolog
Ein gellender Schrei zerschnitt die heiße Luft über den Tabakfeldern. Rosaria! Die junge Rosaria! Von der Tarantel gebissen. Una tarantata!
Die Tabakarbeiterinnen stürzten kreischend zwischen den Pflanzen hervor, Männer eilten zu der ohnmächtigen jungen Frau, trugen sie den Weg hinunter ins Dorf, in das Haus ihrer Eltern. Holt die Musiker! Beeilung! Una tarantata! Den Geiger, Gitarristen, Akkordeonspieler und Gianni! Gianni, der noch jung war, aber wie kein anderer mit den wilden Rhythmen und Rasseln des Tamburins das Gift der Spinne aus den Frauen heraustrommelte.
In einem weißen Hemd lag Rosaria besinnungslos auf einem Leintuch, das schwarz gekleidete Frauen vor dem Bett ausgebreitet und auf das sie Bilder von Santo Paolo verteilt hatten, des Heiligen, der vor Spinnen, Schlangen und Skorpionen schützte.
Mit Giannis ersten Schlägen, den Schellen des Tamburins begann Rosaria stöhnend über den Boden zu robben. Sie wälzte sich, warf den Kopf hin und her, stützte sich auf Hände und Knie, gebärdete sich, als ob die Spinne in ihr lebte, sich mit ihrem Gift Rosarias Körpers bemächtigt hatte.
Die Musiker beschleunigten ihre Rhythmen, Rosaria richtete sich auf und begann, sich zu drehen. Wirbelte bald durch die Kammer, blickte irr, schrie und stampfte barfuß auf den Boden, als wollte sie das Insekt zertrampeln. Drehte sich abermals, hob die Hände, griff nach einem roten Tuch, schwang es durch die flirrende Luft, bis sich die Musik in einem Meer aus Farben auflöste.
Als sie bewusstlos zusammenbrach, fiel sie in die Arme der Umstehenden. Sie legten Rosaria auf das Bett. Bis sie erneut zu zucken begann. Ein neuer Tanz in die Besinnungslosigkeit, gejagt von den Tönen der Geige, den Läufen des Akkordeons und den Schellen des Tamburins. Unter allem lag die tiefe Stimme des jungen Gianni, die Rosaria trug.
Drei Tage und zwei Nächte spielten die Musiker. Gianni mit zerfetzter Haut an Daumen und Handballen, er spürte es kaum. Als er das Blut sah, das über sein Tamburin rann, zerriss er sein Hemd und umwickelte seine Hand mit einem Fetzen Stoff. Er trommelte weiter, während sich Rosaria die Seele aus dem Leib tanzte.
Im Morgengrauen des dritten Tages fiel Rosaria in tiefen Schlaf. Die Männer und Frauen gingen zurück auf die Felder. Gianni schwor sich, er würde diese wundervolle Frau heiraten.
1
In einem Atemzug hatte der heiße Scirocco die Blütenpracht des Frühlings verdorren lassen. Der Wind aus Afrika war die Ankündigung des Sommers auf der salentinischen Halbinsel gewesen.
Ein Brummen riss Elena aus dem Schlaf. Michele! Ihr Herz stolperte. Sie tastete nach ihrem Handy und las die SMS: »Buongiorno! Erwarte dich vor der Kapelle Santo Paolo! Gegen 5.30 Uhr. Bring deine Kamera mit! Nicola«
Nicola, Nicola. Gestern waren sie verabredet gewesen! Wer war nicht aufgetaucht, ohne Entschuldigung, nicht erreichbar? Der große Künstler, typisch. Er musste sich für unwiderstehlich halten, sie jetzt aus dem Bett zu zitieren. Nicht einmal Michele … oder? Doch, gestand sich Elena ein, Michele dürfte sich vieles erlauben.
Nicola jedoch nicht. Elena schob das telefonino zurück auf die Marmorplatte des Nachttisches, zog sich das Laken über die Schulter und schloss die Augen.
Eine Mücke sirrte. Elena warf sich auf den Rücken und starrte auf die Putte, die ihr aus der Stuckrosette in der Zimmerdecke gewohnt freundlich zulächelte.
Porca miseria. Elena riss das Laken weg und setzte sich auf. Kurz vor fünf. Sie tappte die Stiege von der Zwischendecke herunter, auf der ihr Bett in dem fünf Meter hohen Raum thronte, und schlüpfte in das weite orange gemusterte Baumwollkleid, das sie seit Tagen im Wechsel mit dem blau gestreiften trug. Seitdem diese afrikanische Hitze über den italienischen Stiefelabsatz hergefallen war, machte sie sich noch weniger Gedanken als sonst über ihre Garderobe. Diese wehenden Kleider waren das Einzige, was sie auf ihrer Haut ertrug.
Im Bad schimmerte der beginnende Tag durch das Oberlicht. Elena warf sich eine Handvoll kaltes Wasser ins Gesicht, schüttelte ihre dichten braunen Locken und band sie mit einem Gummiband zusammen. Ein Lächeln in den Spiegel, kleiner Psychotrick statt Yoga am Morgen, als Einstieg in den Tag. Eine Gewohnheit noch aus Hamburg, wo das Lächeln ungleich verkrampfter ausgefallen war. Seitdem sie in Lecce bei Onkel Gigi lebte, hatte es sich entspannt. Noch etwas Creme, Wimperntusche? Also bitte, tadelte sie sich, du wirst immer italienischer, von wegen nie ungeschminkt auf die Gasse. Zu dieser Tageszeit ist sowieso noch niemand unterwegs. Bis auf Nicola. Na, so weit kommt’s noch! Sie lächelte. Los jetzt!
Elena ging weiter in Bens Zimmer. Der Sechsjährige mit den rotblonden Locken schlummerte engelsgleich zwischen seinen Rittern und Rennwagen. Die Schiebetür, die Bens Zimmer mit der Wohnung ihres Onkels verband, stand offen. Sie ging durch den open space-eeh, wie zio Gigi stets englisch italianisierte, einen hohen Raum mit gewölbten Decken, Kamin und einigen antiken Möbeln, bog in das Esszimmer ab in Gigis heilige Küche. Dort hinterließ sie einen Zettel auf dem Tisch und griff im Flur nach der Kameratasche. Sie wollte sich beeilen und rechtzeitig zurückkommen, um Ben wenigstens in die Vorschule bringen zu können.
Die Gassen der Altstadt lagen im Schatten, die Luft hatte noch ihre Morgenfrische, doch über den eng stehenden sandfarbenen Palazzi strahlte schon der Himmel.
Sie stieg in ihr Auto, schlängelte sich aus den Gassen des centro storico und durch die Straßen der Vorstadt auf die Landstraße, die sich schnurgerade durch die Ebene zog. Einzelne letzte Mohnblumen leuchteten am Straßenrand. Der Horizont ein gerader Strich. Sie ließ das Seitenfenster herunter und drehte den CD-Spieler lauter, seit Tagen hörte sie nichts anderes als Pizzica, diese furiose Musik des Salento.
E lu Santu Paulu meu de le tarante
ca pizzichi le caruse e le fai Sante …
Santo Paolo, mein Heiliger der Taranteln,
stichst die Mädchen und machst sie zu Heiligen …
Dann setzten die Tamburine ein. Santu Paulu, wie der heilige Paulus im salentinischen Dialekt hieß, schützte vor den Bissen von Spinnen, Skorpionen und Schlangen. Er war der Patron des Landstädtchens Galatina, das heute den dritten Tag des Festes zu Ehren des Heiligen feiern wollte. Früher waren Frauen, die von der Tarantel gebissen worden waren, zu dem Fest gepilgert. Die tarantate hatten Lu Santu um ihre Heilung gebeten und in seiner Kapelle Wasser aus einer Quelle getrunken, die er gesegnet haben sollte. Genau an dieser Kapelle wollte sich Nicola mit Elena treffen.
Elena parkte nahe dem Kloster Santa Caterina, wo eine Gasse in das verkehrsberuhigte Zentrum führte.
Als sie die Autotür öffnete, spürte sie schon die drückende Wärme. Mittags würde die Hitze unerträglich sein.
Sie lief vorbei an der aus Sandstein gebauten romanischen Klosterkirche Santa Caterina und bemerkte die Rundbögen am Portal und das Relief von Jesus und den zwölf Aposteln darüber. Die prächtigen Wandmalereien im Inneren der Kirche erzählten von der einstigen Bedeutung des Landstädtchens, das wie eine Spinne mitten auf der salentinischen Halbinsel saß. Einst zentraler Marktflecken, umgeben von Weizen- und Tabakfeldern, war der Ort der Nabel des Salento gewesen. Galatinas hübsche Altstadt war kaum restauriert. Touristen kamen vor allem für die Fresken von Santa Caterina hierher, einige inzwischen auch zu der dreitägigen festa di Santu Paulu. Trotzdem war das Fest noch immer vor allem eine lokale Veranstaltung.
Wo sich im Zentrum das Gassengewirr zu einer Piazza weitete, erhob sich monströs die Barockfassade der Pfarrkirche, die den Heiligen Paulus und Petrus geweiht war. Haushohe Lichterbögen mit Tausenden bunter Glühbirnchen schmückten die Piazza und ließen sie in den Festnächten glamourös erstrahlen.
Elena blieb stehen und setzte einen Moment ihre schwere Kameratasche ab. Das Fest der vergangenen beiden Tage, die Gesänge und Liturgien der Prozession, die Töne der Gitarren, Geigen und Flöten, die schrägen Stimmen der Pizzicasänger, der Duft von Zuckerwatte und gegrillten Würsten, alles schwang noch in der Stille des Morgens.
Nur eine Ape, eine Biene, ein winziger, dreirädriger Lieferwagen, der noch durch jede Toreinfahrt und Gasse passte, zuckelte über die Piazza. Dann klang das helle »ting … ting …« einer Kirchenglocke durch das Städtchen, sechs Uhr. Elena war – für süditalienische Verhältnisse – pünktlich. Nicola konnte froh sein, dass sie überhaupt auftauchte.
Die Kapelle des Santu Paulu lag nur wenige Schritte entfernt von der Piazza. Sie war Teil eines Palazzo aus dem 18. Jahrhundert, reihte sich unauffällig in die Fassade ein. Eine schmale Tür mit einem runden Fenster darüber war der Eingang von der Straße aus, es gab einen weiteren im Patio des Palazzo, der sich hinter dem breiten Tor verbarg. Durch diesen Nebeneingang hatte Elena die Kapelle vor zwei Tagen betreten. Nur für diesen Festtag und die Nacht war die halb verfallene Kapelle geöffnet worden.
Seit Jahren kamen keine tarantate mehr, die Santu Paulu um seine Gnade gebeten hätten, die Kapelle war entweiht und der Brunnen zugemauert worden. Den Kirchenmännern war das Treiben wohl zu bunt geworden, hatte Nicola ihr erzählt. In der Kapelle habe es Exzesse gegeben. Die tarantate hatten das Wasser getrunken und sich danach in den Brunnen übergeben. Nun gut, das gehörte zum Ritual. Aber karnevaleske Feiern an einem heiligen Ort? Auf dem Altar herumklettern? Urinieren?
Den Kirchenoberen war die Pizzicca Taranta immer ein Übel gewesen – ein heidnisches Ritual, das Frauen mittels Musik und Tanz vom Gift der Spinne heilte. Diesen volkseigenen Exorzismus hatten sie versucht, seit dem 18. Jahrhundert mit der Sage von Santu Paulu, zu bändigen. Zumindest waren die Frauen nach der Pizzica-Taranta auch in die Kapelle gekommen. Doch das Quellwasser, das Santu Paulu einst als Dank für die Gastfreundschaft in Galatina gesegnet haben sollte, war irgendwann – ob heilig oder nicht – nicht mehr trinkbar gewesen.
2
Elena stand vor der Kapelle, die um die Quelle mit dem heilenden Wasser gebaut worden war. Sie schaute die Gasse hinunter. Kein Nicola, kein Mensch. Nur der warme Wind, der zwischen den Häusern hindurchstrich.
»Nicola?«, rief Elena zögernd. Sie drehte sich zum Palazzo. Die schmale Tür zur Kapelle war wie immer verschlossen, doch das halbrunde Tor zum Patio des Palazzo war nur angelehnt.
Sie schob es behutsam ein Stück weiter auf, schaute in das Halbdunkel des Innenhofes. Ein merkwürdiges Gefühl kroch in ihr hoch, irgendetwas stimmte nicht.
Was wollte Nicola hier? Um diese Zeit? Und was sollte sie sehen und vermutlich fotografieren?
Sie blieb noch einen Moment vor dem halb offenen Tor stehen, dann begann sie in der Kameratasche nach ihrem Handy zu kramen. Als sie Nicolas Nummer wählte, hörte sie das Freizeichen – und zugleich ein Tamburin, einen Trommelwirbel, noch einen Trommelwirbel … noch einen … sein selbst komponierter Klingelton tönte aus dem Patio.
Elena trat in den Innenhof. »Nicola?« Sie rief erneut seinen Namen, folgte dem Trommeln zum Nebeneingang der Kapelle. Auch diese Tür war nur angelehnt. Elena ließ ihr Handy in die Tasche ihres Kleides fallen und drückte die Tür mit beiden Händen langsam auf. Sie zuckte vor dem Knarren zurück, schob sich dann aber vorsichtig in die Kapelle.
Zwei Kerzen flackerten auf einem Steinsockel, der einst der Altar gewesen war. Dazwischen blinkte und trommelte Nicolas telefonino.
Erst auf den zweiten Blick entdeckte sie auf dem Boden das lange weite Hemd, schlichtes Leinen, ausgebreitet auf den Stufen vor den Resten des Altars. In Zeitlupe setzten sich die Teile des Bildes zusammen, formte sich ein Körper. »Eine tarantata!«, schoss es Elena durch den Kopf.
Sie presste sich gegen die Wand, blickte auf die nackten Beine, den Rücken, die verklebten Haare, die Arme, zum Altar ausgestreckt. Flehend? Sie traute sich nicht, genauer hinzuschauen. Die Tamburine aus dem Klingelton wummerten noch immer durch die Kapelle.
Warum zum Teufel klingelte dieses Ding weiter? Elena griff nach Nicolas Telefon, fummelte daran herum, dieses Tamburingetöne machte sie wahnsinnig! Als sie das Telefon gerade gegen die Wand schleudern wollte, verstummte es.
Elena hockte sich hin und beugte sich langsam über den zur Seite geneigten Kopf. Haarsträhnen verdeckten das Gesicht. Nur einen Moment lang sah sie den halb geöffneten Mund, die eingefallenen Augenhöhlen. Sie spürte keinen Atem, tastete mit den Fingerspitzen kalte, lederne Haut – dann hörte sie ihren Schrei durch die Kapelle hallen.
Elena erhob sich zitternd, setzte einen Fuß nach dem anderen zurück, konnte den Blick nicht abwenden von dem leeren Gesicht, dem leblosen Körper, bis dieser im Schatten versank.
Dann tat sie etwas, das sie später nicht erklären konnte. Vielleicht war es der Schock im Angesicht des Todes. Sie zog die Kamera aus der Tasche.
3
Elena hatte Nicola zum ersten Mal an ihrem letzten Abend mit Michele gesehen. Nach dem Tag an der schroffen Felsküste im Süden, wo das Meer glasklar und abgrundtief war. In der Dämmerung waren sie zurückgefahren, auf schmalen Straßen, die sich durch das verdorrte Land wanden. Am Rande eines Dorfes hatten sie vor einem Schild angehalten: »Antica Osteria di Clemente«. An der Hauswand und über der Terrasse mit den Tischen hatte eine rote Bougainvillea geleuchtet, Zikaden hatten in der Luft gesirrt. Es war Micheles dreißigster Geburtstag gewesen.
»Allora, wird das Leben nun ernst?« Michele lächelte Elena ein wenig spöttisch an, als sie mit einem Glas kalten Rosato die Antipasti probierten. Manchmal war sie immer noch die ernsthafte Vierzigjährige, wie damals, als sie Michele in Lecce kennengelernt und sich einfach nicht getraut hatte, sich in den zehn Jahre jüngeren ragazzo zu verlieben. Ihm war der Altersunterschied egal gewesen und ihr war nach seiner Charme-Offensive nichts anderes übrig geblieben, als sich in diesen gut aussehenden römischen Maler zu verknallen. Und als der nun 30-jährige Michele sie an diesem Sommerabend mit seinen Grübchen angrinste, konnte sie nicht anders, als ihn auf den Mund zu küssen. »Sciocchezze, Blödsinn!«
Er lebte inzwischen als Dauergast bei Elena und Ben, gern gesehen von ihrem Onkel Gigi. Michele war ein angenehmer Anblick und außerdem für Elena hoffentlich mehr als ein kleiner Trost nach dem normalen Ende ihrer normalen Ehe.
Am nächsten Morgen wollte Michele nach Rom fahren. Eine Ausstellung vorbereiten, ein Kinderbuch fertig illustrieren – die erste Hitzewelle hatte ihn nicht mehr arbeiten lassen in seinem provisorischen Atelier, einer Mansarde auf Gigis Dachterrasse.
»Was willst du, dort hast du Licht!«, hatte Gigi versucht, ihn aufzuhalten.
»Gigi, la luce non è il problema!«, hatte Michele gereizt erklärt, »warst du mal länger dort oben? Im Winter ist die Bude feuchtkalt, im Sommer eine Sauna.«
Es war das erste Mal gewesen, dass Michele Gigi angegiftet hatte. Ein halbes Jahr nachdem Michele nach Lecce gekommen war, schien ihm alles zu eng zu werden in dem Städtchen am Ende von Italien. Er musste offensichtlich mal wieder nach Rom, in seine große Stadt, wo er aufgewachsen war. In sein kleines Atelier, Kumpels auf Pizza und Bier treffen. Wen noch? Elena hatte keine Ahnung. Versuchte einfach zu vertrauen. Eine Woche oder zwei ohne Michele, das war ja nun kein Drama.
Nach dem Essen wollten sie gerade ins Auto einsteigen, als Trommelschläge durch die Nacht hallten. Sie folgten ihnen durch belebte Gassen, ließen sich mitziehen und fanden sich auf einer tanzenden Piazza wieder. Zwischen Mädchen in Kleidchen, älteren Ehepaaren und bunten Freaks – alle hüpften und drehten sich umeinander und warfen sich leidenschaftliche Blicke zu. Von der Bühne klangen schnelle Rhythmen rasselnder Tamburine zu ausgelassenen Melodien von Geige, Gitarren und Akkordeon. Über allem erklang eine Stimme, die aus dem zierlichen Körper einer jungen Sängerin drang. Von den anderen Musikern im Halbdunkel umrahmt, wiegte sie sich in einem weißen Kleid mit knöchellangem, schwingendem Rock – sie erstrahlte in einem Lichtkegel auf der Bühne wie eine Madonna.
»Was ist das für Musik?«, hatte Elena eine Frau in langem Rock gefragt, die am Rand der Piazza nach Atem rang.
»Pizzica!«, hatte die gerufen, »dazu kann man einfach nicht still sitzen, oder?«, und war wieder im Getümmel verschwunden.
Dann hatte Elena zum ersten Mal Nicola gesehen, schräg hinter der Sängerin. Das Tamburin aufrecht in der linken Hand, die rechte wirbelte über das Ziegenfell. Sein Ohr über den Holzrahmen mit den Schellen geneigt, als ob er hineinkriechen wollte in das Tamburin. Die Augen halb geschlossen, in Trance trommelnd, während die Piazza wie ein Vulkan in der Nacht sprühte.
»Un classico«, konstatierte Gigi am nächsten Morgen, als Elena ihm von der Magie auf der Piazza erzählte. Wie ein Arzt, der eine banale Grippe diagnostiziert, lächelte er verständnisvoll: »Hat es dich also auch erwischt, das Pizzica-Tamtam. War ja zu erwarten.«
Sie standen am Tresen des Caffè Alvino an der zentralen Piazza Sant’Oronzo in Lecce. In dem ehrwürdigen Caffè war es angenehm kühl, es duftete nach Espresso und süßem Gebäck. Verschiedene Kekssorten lagen zu Pyramiden aufgehäuft in einer Vitrine. Wenn Ben mitkam, öffnete der barista Salvatore regelmäßig das Glastürchen und drückte dem hübschen biondino zwei cartouche, kleine gerollte Kekse aus weichem Mandelteig, mit einer Serviette in die Hände. Zwei, natürlich, eine für die rechte, eine für die linke Hand. Elena hatte längst jeden pädagogischen Widerstand aufgegeben.
»Caffè?«, rief Salvatore hinter dem Tresen.
»Due, grazie!«, antwortete Gigi und hob zwei Finger zur Bestätigung.
»Caldo o freddo?«, echote es, und wem es bisher noch nicht klar gewesen wäre, wusste es jetzt: Der Sommer war definitiv ausgebrochen! Man bestellte nicht mehr einfach caffè, sondern wahlweise heißen oder kalten.
»Wie viel Zucker?«
»Eineinhalb Löffel!«, warf Gigi zurück.
»Einen halben«, seufzte Elena, die gerade erst Michele nach einer viel zu kurzen Nacht in den Zug nach Rom geschoben hatte. Ihr Onkel war unterdessen mit Benjamin in die katholische Vorschule geschlendert.
Bevor er seinen Trödel- und Antiquitätenladen öffnete, pflegte er einen zweiten, mehr oder weniger schnellen caffè mit seiner geliebten Nichte im Caffè Alvino zu nehmen. Ein Ritual, das Elena sehr genoss, auch wenn sie an diesem Tag leider nicht präsent war, sondern der vergangenen Nacht noch nachhing.
Salvatore verrührte sorgfältig die jeweilige Zuckermenge mit caffè in Tässchen und schüttete die Mischung in Gläschen über knackende Eiswürfel. Eine kräftige, kalte Mischung, die Elena den Dunst aus ihrem Kopf vertreiben sollte.
»Meine-Schwester-deine-Tante hat übrigens mal wieder klare Worte gesprochen«, erzählte Gigi mit säuerlichem Unterton. Elena hob kurz fragend den Blick, dann wandte sie sich wieder dem Eiswürfel zu, der im caffè langsam schmolz. Seine Schwester Benedetta war Nonne, lebte im Kloster und arbeitete tagsüber als Pförtnerin in der katholischen Schule ihres Ordens. Seit dem Winter besuchte Ben – dank Benedetta – dort die Vorschule und würde nach den Sommerferien in die erste Klasse wechseln. Zwar war weder Elena katholisch noch Ben getauft, aber das war der Schulleitung angeblich egal gewesen. Zumindest hatte sich Ben schnell eingelebt und Italienisch gelernt, es gab eine Mensa und Nachmittagsbetreuung. Elena würde also wieder arbeiten können. Zudem unterrichteten die Nonnen nur Religion, überließen normalen Lehrerinnen die anderen Fächer und beschränkten sich – im Wesentlichen – auf klare Worte auf dem Pausenhof.
»Benedetta hat dafür gesorgt, dass Ben eine tragende Rolle bei der Vorführung am Ende des Schuljahres bekommt«, berichtete Gigi.
»Das ist ja toll! Davon hat Ben ja gar nichts erzählt!«
»Sollte ja auch eine Überraschung für uns sein.«
»Gelungen, würde ich sagen!«, lächelte Elena.
»Benedetta konnte natürlich nicht dichthalten, sie ist vor Stolz über ihre Heldentat geplatzt und musste sie mir unter die Nase reiben.«
»Und die wäre?«, Elena begann sich zu amüsieren.
»Ein freundliches Gespräch mit seiner Lehrerin, kurze Erinnerung, dass Ben ihr Großneffe sei, und so weiter und so weiter …«, höhnte Gigi, »als ob die Lehrerin unserem Ben nicht sowieso eine schöne Rolle gegeben hätte.«
Das eigentlich Interessante war etwas vollkommen anderes: Derlei Kommunikation zwischen den Geschwistern deutete auf ein Ende ihrer Eiszeit hin. Benedetta hatte ihren Bruder jahrelang geflissentlich ignoriert. Gigi hatte sein schwules Leben zwar nie an die große Glocke gehängt, aber auch nicht verheimlicht. Sein Palazzo lag im centrostorico zwar ihrem Kloster gegenüber, doch das höchste der Gefühle war ein Gruß auf der Gasse gewesen, wenn sie quasi übereinander stolperten. Nun schien der kleine Ben, das einzige Kind ihrer einzigen Nichte, ein Wunder zu bewirken. Großonkel und -tante schenkten sich keinen Meter, wenn es um Benjamins Wohl ging. Keiner wollte dem anderen das Feld überlassen. Aber immerhin sprachen sie wieder miteinander.
»Ich werde mit Ben natürlich üben«, sagte Gigi.
»Was denn üben? Die proben doch in der Schule bestimmt schon seit Wochen«, entgegnete Elena.
»Bisschen Unterstützung kann nicht schaden«, sagte Gigi bestimmt, »oder kannst du salentinischen Dialekt singen?« Elena schüttelte verwundert den Kopf.
»Ecco!«
Warum sollte der kleine deutsche Junge, der gerade erst Italienisch gelernt hatte, eigentlich unbedingt in einem salentinischen Dialekt singen? Weil der schwule Onkel und die fromme Tante allen Ernstes in den Ring steigen wollten, um einander ihre guten Taten für den Neffen um die Ohren zu hauen? Na, halleluja!
Aber das war nichts gegen die Überraschung, mit der der Onkel nun rausrückte.
»Bella mia, weißt du, mit wem ich gestern mal wieder ausführlich telefoniert habe, als du am Meer turteln warst?« Wenn Gigi so anfing, ahnte Elena, hatte er etwas zu verkünden. »Gloria!« Elenas italienische Mutter, die mit Elenas Vater in Hamburg lebte. Das konnte nicht alles sein.
»Wie geht’s?«, fragte Elena harmlos.
»Bene, benissimo! Zumindest nach unserem Telefongespräch, denn ich habe sie auf die wunderbare Idee gebracht, uns im Sommer zu besuchen!«
Elena stutzte. »Aber Ben sollte doch nach Hamburg zu meinen Eltern und …«.
»Wie kommst du denn auf die Idee?«, rief Gigi aus. »Hast du mal auf die Wetterkarte geguckt? Deine-Mutter-meine-Schwester war vollkommen depressiv! Winterwetter plus fünf bis zehn Grad im Juni – das willst du deinem Sohn nicht antun, schon mal gar nicht in seinem ersten italienischen Sommer! Gloria ist so verzweifelt, sie würde sich am liebsten scheiden lassen und zurückkommen.«
Er lachte und schüttelte den Kopf. »Aber dein alter Vater scheint immer noch irgendeine Wunderwaffe zu haben. Wie auch immer … Ich hatte eine exzellente Idee!«
Nun kommt er zum Punkt, dachte Elena und wappnete sich.
»Wir richten meinen Landsitz her!«
Elena stockte der Atem. »Das meinst du nicht ernst. Nicht mit mir!« Sie lachte auf, wedelte sehr italienisch mit dem Zeigefinger vor seiner Nase herum. »Nicht renovieren. Nicht schon wieder, nicht mit mir …«
Dieser Winter hatte ihr gereicht. Elena hatte in ihrer angeblich bezugsfertigen Wohnung genug Wände verputzt und gepinselt.
Gigis sogenannter Landsitz war ein kleines Haus in den weit geschwungenen Wiesen nahe der Adriaküste. Früher war dieser »Landsitz« die Unterkunft eines Schäfers gewesen, in dem verwilderten Garten gab es noch die verfallenen Stallungen – dringend renovierungsbedürftig. Elena war als Mädchen gern in ihren Ferien beim Onkel auf dem Land gewesen. Aber ihr war klar, dass auch das Wohnhaus lange nur Gigis Lagerraum gewesen war. Er hatte genug zu tun gehabt mit seinem Palazzo in Lecce. Elena mochte sich nach ihren Erfahrungen im Winter keine Details einer möglichen Renovierung vorstellen. Waren alles immer …
»… nur Kleinigkeiten, es sind nur Kleinigkeiten zu erledigen!«, warf der Onkel den gefürchteten Satz genau in dem Moment ein.
»Nicht schon wieder Kleinigkeiten! Nein, nicht mit mir.«
»Aber ein Sommer im Haus am Meer, mit Oma und Enkel, deinem geliebten Michele, mit mir und vielleicht ja auch Ettore. Tutta la famiglia!«
Das versprach gute Laune. Gigis Freund Ettore stammte aus Norditalien, ein bislang eher erfolgloser Tenor, aber er feilte unverdrossen an seinem Durchbruch. Seit Jahren. Gigi versprach ihm ebenfalls seit Jahren eine Karriere im Süden, wenn er sich dort niederließe. Doch der Süden, das war eines der Themen, die die beiden miteinander besser umschifften, denn die Diskussionen endeten in der Regel mit großer Oper und der überstürzten Abreise des Freundes in den Norden.
»Fehlt noch deine Schwester Benedetta zum Familienglück …«, meinte Elena schnippisch und stellte sich vor, wie Ettore mit Schwester Benedetta morgens vor der einzigen winzigen Toilette Schlange stand.
»Haha!«, lachte Gigi und verschluckte sich fast an seinem Eiswürfel. Er war beseelt von seinem Patchwork-Idyll, während Elena allein die Vorstellung der geballten Familie samt mehr oder weniger schrillen Lebenspartnern reichte, schleunigst das Thema zu wechseln.
Gigi nahm seinen letzten Schluck kalten caffè, kramte einige Münzen aus der Hosentasche und ging zur Kasse. »Ciao Salvatore, a domani!« Elena folgte dem Onkel hinaus auf die Piazza. Wie jeden Tag kaufte Gigi gegenüber im Kiosk eine lokale und eine überregionale Zeitung, dann machten sie sich, vorbei am Amphitheater und quer über die Piazza, auf den Weg in Richtung seines Ladens. Bevor er das Thema Landsitz noch einmal vertiefen konnte, kam Elena auf die Pizzica zurück.
»Hör mal, das war der helle Wahnsinn auf der Piazza! Da hat die Oma mit ihrem pubertierenden Enkel getanzt, alle, wirklich alle, haben mitgemacht – ist das normal?«
»Normal? Bella mia, das kommt auf deinen Begriff von normal an«, seufzte Gigi. »Die aus Norditalien fanden uns hier unten im Mezzogiorno noch nie normal, sondern ein lästiges Anhängsel ihrer reichen Kulturnation. Frag mal Ettore nach Pizzica – dann kriegst du einen Vortrag, den willst du nicht hören …«
Damit schien das Thema für Gigi beendet. »Und wie war dein Abschied von Michele?« Sonst ließ Gigi kaum eine Gelegenheit aus, die Traditionen des Salento samt seinen Genüssen aus Küche und Weinkeller mit einer Eloge zu rühmen. Pizzica, die Musik, schien nicht dazuzugehören.
»Eigentlich wollte ich anfangen, Olivenbäume zu fotografieren«, setzte Elena erneut an, »diese knorrigen Denkmäler, die hier seit Jahrhunderten stehen …«
»… und neuerdings nachts ausgebuddelt und in den Norden verkauft werden?«, fiel Gigi seiner Nichte aufgebracht ins Wort. »Scandaloso! Genau, das solltest du machen!«
Gigi, erörterte sämtliche Skandale und jeden Klatsch, von dem er in der Zeitung las oder im Laden hörte, brühwarm mit Freunden, Kunden und Passanten. Der neuste Skandal war der verbotene Handel mit alten Olivenbäumen aus dem Süden, die in den Ziergärten des Nordens wie exotische Tiere im Zoo verkümmerten.
»… Aber gestern Nacht dachte ich, diese Dorffeste mit Pizzica-Musikern – die sind irrsinnig fotogen und stimmungsvoll.«
»Ich hab’s geahnt«, seufzte Gigi, »jetzt fängst du auch damit an.« Er begann, pathetisch mit den Händen zu gestikulieren: »Die Musik des Volkes, der Biss der Spinne, das Wiederbeleben eines Rituals … blablabla. Wird immer schlimmer, dieses mystische Brimborium um die paar immer gleichen Lieder. Mir geht das inzwischen auf die Nerven.«
Elena fasste ihn am Arm. »Was bist du denn so giftig?« Aber Gigi war mit seinem Lamento noch nicht fertig.
»Egal, welcher Schutzpatron geehrt wird – San Luigi, Giuseppe oder Gianni, eine Madonna oder das Herz Jesu Christi – erst kommt die brave Prozession, dann donnern die Tamburine durchs Dorf. Den ganzen Sommer geht das so. Aber ich bin dort aufgewachsen, in so einem kleinen dreckigen Dorf, in dem sie an den Pizzica-Kram geglaubt haben. Das hatte nichts mit guter Laune und lustiger Hopserei zu tun. Das waren Frauen, die haben ihr Leben lang keine einzige Zeile lesen können, die hausten mit ihren vier und mehr Kindern und Mann in einem Zimmer, hatten weder Strom noch Toilette oder fließendes Wasser. Die waren froh, wenn sie als Tagelöhner irgendwo schuften durften. Das war ein Leben im Dreck, hier unten im Mezzogiorno.«
Elena wusste, dass sie ihren Onkel leer laufen lassen musste, bevor sie insistieren konnte.
»Und von wegen Magie«, schnaubte Gigi, »heute würde ein Arzt den tarantate vermutlich ganz banal ein Antiallergikum spritzen, notfalls noch ein Beruhigungsmittel – und basta.«
Elena ließ ihn noch einige Meter weiterschimpfen, dann knuffte sie ihren Onkel in die Seite.
»Komm schon, ich brauche einen Kontakt in die Szene, um einzusteigen, und du kennst hier doch jeden.« Elena wusste natürlich, dass Gigi auf der Suche nach Trödel und Antiquitäten wie ein Maulwurf den Salento kreuz und quer durchwühlte und dabei die verrücktesten Leute kennenlernte. »Die Olivenbäume laufen nicht weg …«, sagte sie versöhnlich, »aber die Dorffeste, die sind jetzt, im Sommer. Tolles Thema, meine alte Redaktion kauft die Bilder sofort.«
Gigi schüttelte immer noch den Kopf.
»Viele von den Musikern kenne ich nicht. Sind ja vor allem junge Leute, die seit einigen Jahren die alten Lieder wieder ausgraben. Der Typ, der Lu Ientu gegründet hat, diese Gruppe, die du gestern gehört hast, der gehörte auch zu diesen Pionieren der sogenannten ›Wiedergeburt‹.«
»Und den kennst du?«, fragte Elena hastig, »also, wie der auf dem Tamburin …«
»Oh, Elena, basta! Fotografiere Olivenbäume, erzähl von diesen arroganten Geldsäcken aus dem Norden, die den Süden wie eine Kolonie behandeln, und hör auf mit diesem Touristen-Tamtam.«
»Ich habe gestern eigentlich keine Touristen gesehen – aber kennst du den nun?«
»Wen?«
»Gigi! Basta! Den Tamburinspieler!«
»Zio, meine Liebe, zio Gigi …«
Es reichte Elena. Ja klar, er war ihr Onkel, zio Gigi, und er war stolz darauf, aber konnte er die Frage nicht einfach beantworten?
»… und von Nicola solltest du dich fernhalten«, fügte der Onkel hinzu, »er ist einer der besten Pizzica-Musiker, spielt erstklassig Gitarre und Tamburin, kein Zweifel. Aber er weiß ziemlich genau, wie das auf Frauen wirkt. Aphrodisiaka pur.«
Aha, dachte Elena, darum geht es. Gigi mochte Michele sehr und seine Nichte sollte keine Dummheiten machen. Das war nun wirklich lächerlich.
»Ich kenne seine Frau Luciana«, fuhr Gigi versöhnlicher fort, »die wiederum ist eine hervorragende Konditorin, außergewöhnlich, sehr kreativ … durchaus aphrodisierend auch sie und, was mich betrifft, vor allem ihre süße Kunst.«
Bei dem Thema lockerte sich Gigis Laune schlagartig: traditionelle dolci und ihre modernen Varianten. Während sie durch die Fußgängerzone zu seinem Laden in der Nähe des Domplatzes schlenderten, wurde aus dem Onkel wieder der alte, gut gelaunte Genießer. Elena filterte aus dem Redeschwall über pasticciotti, eine süße Delikatesse, die für sie interessante Information: Lucianas Konditorei befand sich in dem Landstädtchen Galatina an der Piazza vor der Kirche der Santi Pietro e Paolo.
4
Elena starrte auf den toten Körper im weißen Hemd. Das ist Nicola, wiederholte sie in Gedanken, als müsste sie sich selbst erklären, was sie nicht glauben konnte. Das dort ist Nicolas Leiche. Er ist tot. Verstehst du? Tot.
Nein, sie verstand nicht. Blieb stehen, mit der Kamera in der Hand. Hockte sich langsam hin, Nicola auf Augenhöhe, der Autofokus stellte scharf, sie löste aus. Änderte die Perspektive, auslösen. Nicola – was wolltest du in der Kapelle? Seit wann liegst du hier? Ich sehe kein Blut – warum bist du gestorben?
Sie nahm Abstand, um den ganzen Raum in dem staubigen Licht aufzunehmen, mit dem Altar, vor dem dieser Körper lag. Was tat sie hier eigentlich? Für wen machte sie diese Fotos?
Sie musste etwas tun.
Luciana! Der Name von Nicolas Frau schoss Elena wie eine Leuchtkugel durch den Kopf. Oh Gott, natürlich, sie musste Luciana anrufen. Aber nein, das konnte sie ihr doch nicht am Telefon sagen: Dein Mann ist tot. Doch, glaub mir. Ich stehe vor ihm, er liegt auf der Stufe vor dem Altar in einem weißen Kleid. Wie eine tarantata. Er bewegt sich nicht. Atmet nicht. Dein Mann, Nicola, er ist kalt. Tot.
Sie musste Luciana verständigen, aber was sollte sie ihr nur sagen? Sie war seine Frau, sie war diejenige, die ihr Leben mit Nicola geteilt hatte – trotz allem.
5
Das erste Treffen mit Luciana hatte abrupt und unerfreulich geendet.
Ihre Pasticceria lag an der zentralen Piazza von Galatina, schräg gegenüber der Kirche der Santi Pietro e Paolo. Es war später Vormittag, ein Lieferwagen rollte vorbei und über ein Megafon brüllte jemand: »Matratzen! Matratzen zum halben Preis! Kommen Sie, schauen Sie – Matratzen!« Vor ihrer Pasticceria standen einige kleine Tische und Stühle im Schatten heller Sonnenschirme. Ältere signori saßen an der Hauswand und schauten schweigend über die Piazza.
Als Elena vorbeiging, wurde sie kurz gemustert, ein unbekanntes Gesicht, dann setzten die Gespräche wieder ein. In der Glastür hing ein Plakat mit Feuerwerk, in dessen Mitte eine Heiligenfigur erstrahlte: festa di Santu Paulu, Galatina. Darunter das ausführliche Programm, drei Tage, unterteilt in religiöse Veranstaltungen mit Messen und Prozession und in städtische mit Konzerten und Feuerwerk. Lu Ientu war als Attraktion am ersten Abend angekündigt.
Elena betrat die Pasticceria, schaute in die Auslage unter dem Glastresen und entschied, sie würde Gigi und Ben mit ein paar pasticciotti erfreuen. Schließlich hatte Gigi behauptet, die Schiffchen aus knusprigem Mürbeteig, gefüllt mit Vanille-Creme, seien nirgendwo besser als bei Luciana, vor allem ihre Varianten, die mit Orangenaroma und dunklem Schokoüberzug zum Beispiel. Aber als Elena ihren Blick über die Auslage ziehen ließ, voll mit bunten Kreationen, ahnte sie, dass die pasticciotti nur eine Einstiegsdroge waren.
»Kann ich Ihnen helfen?«, eine freundliche Stimme erklang hinter dem Tresen. Elena schaute in die blauen Augen einer Italienerin, Anfang vierzig, mit einer etwas barocken Figur. Die weiße Schürze mit Teig- und Schokoflecken hatte offensichtlich bereits einen Einsatz in der Backstube hinter sich, und als Luciana sich in die Vitrine bückte, linste ein Stückchen Spitze aus ihrer dunklen Bluse. Runde Formen, lässig zusammengesteckte pechschwarze Haare, aus denen sich Strähnen lösten. Umwerfend sinnlich, fand Elena.
»Mein Onkel schwört auf pasticciotti aus Galatina«, begann Elena, »ich soll ihm dringend welche mitbringen.«
Die Konditorin lächelte geschmeichelt, aber wandte ein: »Ich bin allerdings nicht die Erfinderin. Wenn Sie das Original aus Galatina kaufen möchten, müssen Sie in Richtung des Klosters Santa Caterina gehen. Dort finden Sie eine kleine Pasticceria, in der siebzehnhundert irgendwas der pasticciotto erfunden wurde und das heilige Originalrezept bis heute nur in der Familie weitergegeben wird. Ich spiele mit Varianten herum – was nicht jedem schmeckt.«
»Nein, nein, mein Onkel hält Ihre pasticciotti für die besten des Salento – Sie müssten ihn eigentlich kennen, Sie sind doch Luciana? Mein Onkel ist Gigi Mazzotta.«
»Natürlich! Wie geht es ihm? Ich habe ihn lange nicht gesehen, komme hier ja kaum raus, die ragazza, die eigentlich den Verkauf macht, ist heute nicht aufgetaucht, ich möchte gar nicht wissen, an welchem Strand sie mit ihrem fidanzato rumturtelt. Die andere Aushilfe ist krank – was bleibt mir übrig?«
Sie lachte und setzte verschiedene pasticciotti auf ein Papptablett.
»Basta, basta – grazie!«, Elena versuchte, sie zu stoppen. Oder vielleicht doch noch ein paar dieser winzigen Cremetörtchen? Sie widerstand, zumindest heute.
»Ich hätte noch eine Bitte. Ich war gestern bei einem Konzert Ihres Mannes mit Lu Ientu. Ich bin Fotojournalistin und würde gerne Kontakt zu ihm aufnehmen.«
Luciana, die die pasticciotti in einen Bogen himbeerrotes Papier eingeschlagen hatte und ein dunkelblaues Bändchen darum binden wollte, hielt in der Bewegung inne und musterte Elena. Ihr Gesichtsausdruck wechselte von freundlich auf – bestenfalls – neutral.
»Ich würde gerne mehr über Pizzica wissen und auch Musiker und Tänzer fotografieren«, erklärte Elena. »Ist es möglich, hier Nicola zu erreichen?«
Luciana reichte ihr wortlos das Päckchen über den Tresen, tippte den Preis der pasticciotti in die Kasse und schrieb etwas auf die Rückseite des Kassenzettels.
»Seine Telefonnummer. Sie finden ihn vermutlich auf seinem Landgut. Grüßen Sie ihn von mir.«
Elena zahlte etwas verwundert und wünschte »Buona giornata!«.
»Arrivederci«, sagte Luciana höflich.
6
Nicola, Nicola – warum hast du mir, ausgerechnet mir, deine letzte SMS geschrieben? Warum … ich habe dich doch kaum gekannt. Wie lange liegst du hier schon, in diesem lächerlichen Kleid? Wie eine tarantata! Nicola Capone, der Sohn von Gianni und Rosaria.
Vor genau fünfzig Jahren hatten die beiden geheiratet. Am Tag der festa di Santu Paulu hatten Gianni, der Therapeut mit dem Tamburin, und seine tarantata Rosaria in der Kirche ihres Heiligen den Segen für ein langes gemeinsames Leben bekommen.
Elena sah die Gesichter der beiden Alten vor sich, wie sie sich vor einigen Tagen nebeneinander vor ihre Kamera unter die ausladenden Zweige des Feigenbaumes gesetzt hatten. Eine alte Liebe, die die vielen Jahre des gemeinsamen Lebens bitter und süß gestimmt hatte und vielleicht gnädig, die nur der Tod noch scheiden konnte. Doch der Tod des Sohnes, das Kind, das vor einem selbst stirbt – es musste unerträglich sein. Elena hielt nicht einmal den Gedanken an diesen Schmerz aus.
»Ich war Therapeut«, hatte Gianni ihr während des Interviews erzählt, »und Tischler.« Diese Reihenfolge schien wichtig zu sein. Erstens Therapeut für tarantate, zweitens Tischler, der auch Tamburine gebaut hatte, echte, die für die Tanzheilung geeignet waren.
»Ich habe Rosaria geheilt. Beim ersten Mal. Die meisten Frauen kommen wieder, Jahr für Jahr, viele Sommer. Sie spüren die Symptome, im Juni zu Santo Paolo. Sie werden nervös, können ihre Füße nicht mehr stillhalten, bekommen Bauchschmerzen. Die Tarantel lässt sie nicht los.«
Gianni sprach wenig, nur kurze Sätze. Er hatte dabei Rosaria aus dem Augenwinkel angeschaut und seine Frau hatte stumm, fast unmerklich genickt, ohne sich umzudrehen, während sie mit ihrer Enkelin weiter Feigen pflückte. Nicola hatte seine neunjährige Tochter Teresa mitgebracht, ein strahlendes Mädchen. Sie war in den verschlungenen Zweigen des Feigenbaumes verschwunden und manchmal krähte sie zwischen den Blättern »Schau mal, Oma!« und dann reichte eine kleine Hand zwei oder drei Früchte aus dem Grün heraus.
Bei den Heilungen sei es nie einfach gewesen, den richtigen Rhythmus zu finden, erzählte Gianni. Es sei die Spinne, die ihn bestimme, je nachdem, ob eine schwarze, rote oder gefleckte gebissen habe. Die Musiker müssten ausprobieren, die tarantata beobachten, erspüren, wann der Rhythmus in sie eindringe, sie erobere, bis sich die tarantata dem Sturm der Bewegungen hingebe. Rosarias Leid habe er sofort erkannt.
Und dann geheilt. Fast. Sie habe jedoch mehrere Fehlgeburten gehabt, als ob sie keine Kinder haben sollten. Als ob das der Preis sei, den Gianni und Rosaria für ihre Liebe zu zahlen hatten.
Vater und Sohn hatten sich für Elena mit Tamburinen unter den Feigenbaum gestellt. Nicola, stämmig und kaum größer als sein Vater, sah ihm ähnlich, aber er wirkte neben dem alten Mann schüchtern. Giannis breite Schultern, die derben Hände, das zerfurchte, kantige Gesicht mit dunklen, verwegenen Augen. Einzig die Sonne, die durch die lichten weißen Haare schimmerte, gab dieser Erscheinung etwas Sanftmütiges. Und Rosaria. Deren Augen in dem schmalen, runzligen Gesicht noch immer funkelten.
Die Geheimnisse des Tamburins hatte der Vater an Nicola weitergegeben. Der Sohn würde sie seiner Tochter vermachen.
Er habe niemals aufgehört, Tamburin zu spielen, erzählte Gianni. Es hatte ihn am Leben erhalten, als er in der Schweiz war, weit entfernt von jedem Meer und dem Licht seiner Heimat, der flirrenden Sonne des Salento, die jahrelang nur in seinen Träumen gestrahlt hatte. Der satte Klang seines Tamburins, das Vibrieren des Ziegenfells trug ihn zurück, immer und immer wieder. Als er eine gut bezahlte Arbeit fand, war seine Frau nachgekommen. Ein Jahr später brachte sie Massimo zur Welt und kurz darauf ist sie mit Nicola schwanger geworden. Das Leben in der Schweiz hatte Rosaria endgültig geheilt.
Irgendwann beschloss Gianni, es sei genug. Er hatte genug Geld verdient, um mit seiner Familie zurückzukehren und ein großes Stück Land zu kaufen. Eine verfallene Masseria, mit Olivenbäumen, die schon seit Jahrhunderten dort wurzelten. Eine bessere Absicherung konnte er sich für seine Kinder nicht vorstellen. Das war lange, sehr lange, bevor die Landsitze im Salento schick und teuer wurden.
7
»Pronto!«, hatte Nicola ungeduldig ins Telefon gerufen. Seine Stimme hatte rau geklungen, etwas heiser. Im Hintergrund hatte Elena Tamburine rasseln gehört, eine Geige tanzte kurze Töne.
Elena entschuldigte sich für die Störung, erklärte, sie sei Fotografin, könne aber auch später noch einmal anrufen.
»No, no«, das Stichwort Fotografin schien ihn gnädiger gestimmt zu haben. Das Geklimper im Hintergrund wurde leiser. Elena erklärte, was sie wollte, er sagte freundlich, sicher, sie könne gerne vorbeikommen, später Nachmittag, dann sei Probe mit Lu Ientu auf der Masseria, danach könnten sie miteinander reden. »Ciao, ciao!«
Ein effektives Telefongespräch. Erstaunlich, dachte Elena. Diesen Stil war sie seit ihrer Flucht aus Deutschland nicht mehr gewöhnt.
Im warmen Licht des Nachmittags könnte sie vielleicht schon erste Aufnahmen machen, Elena war begeistert und in diesem Schwung wählte sie gleich noch die Telefonnummer ihrer ehemaligen Chefredakteurin Angela M. Brunkhorst. In der Reisezeitschrift, »Weite Welt«, hatte Elena, früher erfolgreiche Fotoreporterin, nach der Geburt von Ben einen braven Halbtagsjob in der Fotoredaktion angenommen.
Die Sekretärin ließ sie fast ohne Geplänkel zur Chefin passieren, nur ein kurzes Lamento über den üblichen Hamburger Schmuddelsommer, dann der ebenso übliche Neidfaktor, na, ihr in Italien …, woraufhin Elena nicht ernsthaft widersprach, auch wenn zwei, drei Tage erfrischender Nieselregen eine durchaus attraktive Alternative zu permanenten 30 Grad – plus minus fünf – gewesen wären.
»Ciaaaauuu Elena!«, die überdrehte Stimme von Angela M. Brunkhorst katapultierte Elena im Bruchteil einer Sekunde zurück in das Büro der Chefredakteurin, zu ihrem letzten Auftritt einen Monat vor Weihnachten.
Es war ihr 40. Geburtstag gewesen und der Tag, an dem Elena entdeckt hatte, dass ihr Gatte Aron sie mit seiner Sekretärin betrog – mit seiner Sekretärin! Also bitte! Hätte es nicht wenigstens ein kleines bisschen exzentrischer sein können? Egal, dafür hatte Elenas Reaktion überrascht und eine gewisse Originalität gehabt.
Sie war in das gläserne Büro ihrer Chefredakteurin marschiert und hatte ihre Kündigung auf den Schreibtisch gelegt. Kein Antrag auf unbezahlten Urlaub oder ähnliches Gezappel, um erst mal etwas Abstand zu gewinnen. Elenas Fluchtplan stand. Vermutlich hatte sie schon lange daran gefeilt. Das wurde ihr aber – wie immer im Leben – erst hinterher klar.
»Ich muss einfach raus hier. Tapetenwechsel nennt man das gemeinhin«, hatte sie kurz gesagt und aufstehen wollen.
»Meine Liebe, wo willst du denn hin?«
»Nach Italien.«
»Nein! Wirklich? Wohin?«, hatte die Brunkhorst gejauchzt, die selten eine Gelegenheit verpasste, um zu erwähnen, wie italophil sie sei, also quasi mit jedem Stein, Kochtopf und Designerfummel in Italien persönlich bekannt.
»Nach Lecce, in die Heimat meiner Mutter. Ich hab da noch einen Onkel und eine Freundin und war lange nicht da.«
Reichte das jetzt? Nein, natürlich nicht. Elena hatte ihrer Chefin die Vorlage geliefert, eine Hymne auf das italienische Lebensgefühl anzustimmen, auf gelato und Vespa, den Singsang der Sprache und, ach, man lebt da ja doch mehr draußen, nicht? Das Klima, die Sonne und natürlich das Blau, dieses einmalige Blau.
»Ach, wer würde nicht gerne nach Italien gehen, nach … wie heißt das noch?«
»Lecce.« Elena hatte endlich rausgewollt. Weg, einfach nur weg, anstatt in dieser Redaktion weiter zu versauern, während der Gatte bei seiner blöden Sekretärin den Gockel machte.
»Wo ist denn dieses Lecce?« Angela M. von Brunkhorst war inzwischen zu der Italienkarte an der Pinnwand gestöckelt, die dort für das alljährliche Sonderthema »Wo Italien noch Italien ist« hing. Sie fuhr mit dem roten Fingernagel von Mailand nach Genua und Richtung Süden. Florenz, Rom, Neapel.
»Andere Seite«, sagte Elena und blickte aus dem Fenster in das Hamburger Himmelgrau, »Adria und weiter unten.« Sie lehnte sich zurück, löste ihr Haargummi und fuhr sich mit den Fingern durch die Locken. »Siehst du Bari? Noch weiter südlich. Brindisi. Und da drunter ist Lecce. Auf dem Stiefelabsatz. Ganz unten.«
Der rote Fingernagel hatte das Ende von Italien erreicht. »Ach herrje!« Dort, wo die Autobahn von Rimini nach 1000 Kilometern als Schnellstraße endete, dort stand »Lecce«. Auf dem letzten Zipfel von Italien.
»Interessante Lage«, hatte die Chefredakteurin gesäuselt, »das ist ja fast schon Afrika.« Italien war Mailand und Lago Maggiore, war Toskana, war Rom, aber weiter südlich? Sizilien, gut. Aber Apulien? Elena las in ihrem Gesicht, wie sie sich ein Hotelzimmer in diesem Süden vorstellte: Kakerlaken, die durch schmuddelige Betten flitzten, und rostige Duschen, die bei affenartiger Hitze nur tröpfelten. »Was bitte willst du da unten?«
»Meinen Onkel besuchen. Der kann Hilfe in seinem Antiquitätenladen gebrauchen, er restauriert gerade einen barocken Palazzo in der Altstadt.«
»Barocker Palazzo? Da unten?«
»Sicher. Lecce ist voll mit barocken Kirchen und Palästen. Ich würde die Region einen Geheimtipp nennen.«
»Warum hast du das nie erwähnt?«
»Hab ich, aber …«
Die Chefredakteurin hatte das Lächeln für ihre erstklassigen Gedankenblitze aufgesetzt. »Nun haben wir ja bald eine Mitarbeiterin dort.« Angela M. Brunkhorst hatte ihren Blick in eine imaginäre Ferne gleiten lassen. »Wir könnten es ›das unbekannte, versteckte Italien‹ nennen – und du mittendrin. Auf der Piazza, im Café, am Meer. Voller Lebensgefühl. Italien, so wie wir alle davon träumen.«
Damals war Angela M. Brunkhorst von ihrer Themenidee sehr angetan gewesen. Inzwischen war mehr als ein halbes Jahr vergangen und als Elena ihrer ehemaligen Chefin etwas von Pizzica erzählte, war die Begeisterung eher gedämpft. Eine Geschichte über Volksmusik? Na ja. »Elena, versteh mich nicht falsch … Ich lass es mir noch mal durch den Kopf gehen.«
Diese Formulierung war in der Regel das Todesurteil für ein Thema.
8
Polizei. Sie musste die Polizei rufen. Elena klammerte sich an diesen Gedanken, hielt ihr Handy in den zitternden Händen, starrte auf das Display. Hinter diesen dicken Mauern hatte sie keinen Empfang. Raus, ich muss rausgehen, dachte sie. Aber ich kann ihn doch nicht allein lassen …
Sie schüttelte sich. Wach auf! Geh durch die Tür. Wie ferngesteuert verließ sie die Kapelle, ging durch den Patio und schob sich durch das Hoftor zurück in den Tag. Warme Luft strömte ihr entgegen, die Sonne blendete. Reifen quietschten.
Direkt neben ihr bremste ein Polizeiwagen. Zwei Uniformierte sprangen heraus und stellten sich vor Elena auf.
»Was tun Sie hier?«, blaffte einer der beiden, ein athletischer Typ um die vierzig mit akkurat geschnittenem Oberlippenbart und offensichtlich Chef der Streife.
»Ich … ich … wollte Sie gerade anrufen!«, stammelte Elena.
»Tatsächlich?« Der Oberlippenbart musterte Elena. »Waren Sie in der Kapelle?«
Noch ein Polizeiwagen bog um die Ecke, zwei weitere Beamte stiegen aus, begutachteten das offene Hoftor.
»Aufgebrochen.«
Der Oberlippenbart bestimmte: »Wir gehen da rein! Rodolfo, du hältst die Signora fest, nimmst die Personalien auf.«
Der junge Rodolfo nickte eifrig.
Die Polizisten zogen ihre Revolver aus dem Halfter, der Oberlippenbart drückte mit dem Rücken das Hoftor weiter auf, blickte in den Innenhof, den Revolver erhoben.
»Da ist niemand«, sagte Elena, »nur … eine Leiche … in der Kapelle.« Ihre Stimme brach, sie schluchzte auf, wischte sich aber sofort die Tränen ab.
Der Oberlippenbart schaute sie misstrauisch an, dann nickte er den anderen zu und sie verschwanden hinter dem Tor.
»Warum sind Sie eigentlich hier?«, fragte Elena den jungen Rodolfo, der mit gespreizten Beinen vor ihr stand, um einen möglichen Fluchtversuch zu stoppen.
»Anruf eines Nachbarn«, antwortete er kurz. Sie schwiegen.
Der zackige Oberlippenbart stolperte auf die Gasse. Fassungslos.
»Verdammt!«, stöhnte er, »weißt du, wer da drinnen liegt?«
Rodolfo schüttelte den Kopf.
»Nicola Capone! Der von Lu Ientu! Mit dem bin ich zur Schule gegangen.« Er fuhr sich mit der Hand über das Gesicht, verdeckte einen Moment seine Augen. »Tot. Und in einem weißen Hemd, wie eine tarantata«, flüsterte er. »Als ob er von der Tarantel gebissen worden wäre. Wie seine Mutter.«
9
Das Telefon klingelte vor dem Wecker. Commissario Pantaleo Cozzoli hasste das. Sein Schlaf war heilig – wenn er denn endlich mal schlief. Das war selten genug. Meistens brauchte er keinen Wecker. Er lag ohnehin wach. Schlafforscher behaupteten zwar hartnäckig, im Alter brauche man weniger Schlaf, doch Cozzoli hielt das für Humbug. Er lebte einfach mit dem permanenten Schlafmangel, den ihm sein Job, seine Gedanken und Erinnerungen, seine Trauer, Wut, die Rachegelüste und noch einiges andere Nacht für Nacht bescherten. Eines Tages würde er all diese Stunden in einem mehrjährigen Winterschlaf nachholen und den Schlafforschern ihre Studien ruinieren.
Er öffnete die Augen und fand sich in einem zweckmäßigen Mailänder Hotelzimmer wieder, das er seit zwei Tagen bewohnte. Heute würde er wieder umziehen. Wie jeden zweiten Tag. Draußen auf dem Flur stand ein Kollege von der Bereitschaft, der seinen Schlaf sichern sollte. Sehr witzig. Wenn das so einfach wäre. Seit zwei Wochen ging das so. Tagsüber mit den alten Mailänder Kollegen einige Hundert Seiten Untersuchungsergebnisse zu einem seiner Mafia-Prozesse durchgehen. Kokainhandel in großem Stil, zwei, drei Morde, Bestechung, einige Politiker und Industrielle waren mal wieder darin verwickelt.
Essen, schlafen, Sachen packen, Hotel wechseln. Keine Spuren hinterlassen. In drei Tagen würde er endlich im Prozess aussagen, danach könnte er zurück in die Provinz. Er freute sich drauf.
Was? Er griff nach diesem Gedanken, erwischte ihn gerade noch, bevor er verschwinden konnte, und tatsächlich, dieser Gedanke war bemerkenswert: Commissario Pantaleo Cozzoli, Ex-Anti-Mafia-Einheit, freute sich darauf, bald wieder in Lecce an seinem riesigen Schreibtisch in einem winzigen Büro Pfefferminzdrops zu lutschen.
Das Telefon verstummte. Cozzoli griff danach und prüfte auf dem Display, wer angerufen hatte. »Gigi« stand da, nur »Gigi«. Einer der sehr wenigen Menschen, mit denen er bereits per »du« war, als sie Telefonnummern austauschten. Sie mochten die gleichen Weine. Das war viel wert. Cozzoli kannte noch nicht einmal Gigis vollständigen Namen.
Er rief zurück. Besetzt. Was zum Teufel war um diese Zeit bei Gigi los? Ein Piepen, Nachricht von Gigi auf der Mailbox: »Ruf zurück, Pantaleo. Subito! Ti prego! Grazie, Gigi!«
»Verdammt«, fluchte der Commissario vor sich hin, die Nachricht klang nach Ärger. Va bene, va bene, Gigi, Cozzoli schob sich aus der horizontalen in eine vertikale Position, das erschien ihm angemessen. Er griff nach einer flachen Blechdose, schüttelte sie, es klackerte, gut, gut, da waren noch genug Pastillen drin, seine Lieblingssorte Minze mit Lakritz. Er nahm sich zwei. Früher hätte er sich eine Zigarette in den Mundwinkel geschoben. Früher, ach ja. Was hatte man früher nicht alles weggesteckt. Ein schwarzes Frühstück mit Zigarette und caffè hatte noch zu den lässigeren Übungen gehört.
Also Gigi. Rückruf. Beim zweiten Versuch hatte er ihn sofort in der Leitung. Sein salentinischer Freund war aufgelöst.
»Pantaleo, ich bitte dich, hol sie da raus! Sie hat garantiert nichts damit zu tun, gar nichts. Was kann sie dafür, dass die Leiche ausgerechnet vor ihren Füßen …« Wenn Gigi von »ihr« sprach, konnte nur seine überaus neugierige Nichte gemeint sein, die gerne naiv in irgendwelchen Bienennestern rumstocherte.
»Redest du von Elena?«, fragte Cozzoli trotzdem so ruhig wie möglich.
»Von wem denn sonst?«, rief Gigi und schnaufte, »sie hat eine Leiche gefunden, und dann wurde sie verhaftet, von der Polizei in Galatina – nicht zu glauben.«
»Immer mit der Ruhe, Gigi. Eine Leiche findet man nicht alle Tage und dem Finder stellt man gemeinhin einige Fragen.«
Cozzoli bemühte sich, Gigi zu beruhigen, dabei musste er sich selbst beherrschen. Elena von Eschenburg, sehr sympathisch, aber sie hatte ihn bereits im vergangenen Winter mit ihrer Schlaubergerei genervt. Ging das schon wieder los?
»Kannte sie den Toten etwa?«, fragte Cozzoli und ahnte die Antwort.
»Natürlich!«, brüllte Gigi. Klar, dachte Cozzoli. Sie hat ein sonderbares Talent.
»Ich ruf die Kollegen an«, murmelte Cozzoli. »In Galatina, sagtest du?«
Der Wecker klingelte sowieso gleich, Pantaleo Cozzoli würde eine weitere Stunde Schlaf in Rechnung stellen. Wem auch immer.
»Commissario Cozzoli hier. Ich hörte, ihr habt eine Leiche«, blaffte er aus Milano in den Süden. »Warum weiß ich davon nichts?«
»Wir haben auch bereits eine Verdächtige«, versuchte sich der Oberlippenbart zu profilieren. »Eine Deutsche, die in Lecce lebt. Sie ist unerlaubt in die Kapelle eingedrungen, in der auch die Leiche lag. Eine Nachbarin hat sie am frühen Morgen gesehen und uns verständigt.«
»Und die Leiche? Hat diese Nachbarin auch die Leiche gesehen, wie und wann sie in die Kapelle gekommen ist? Tot oder lebendig?«
»Davon ist nichts bekannt«, der Oberlippenbart bemühte sich um Haltung.
»Porca miseria«, donnerte Cozzoli. »Hat der Heilige Geist die Leiche in der Kapelle abgelegt? Um wie viel Uhr? Und woher wisst ihr, dass es Mord war? Wer macht die Spurensicherung?«
Wenigstens auf die letzte Frage konnte der Oberlippenbart eine Antwort geben. Und ja, selbstverständlich, die Verdächtige werde als Zeugin, nicht als Verdächtige behandelt. »Natürlich haben wir ihre Personalien, und sie steht zu unserer Verfügung.«
»Nicht zu unserer. Zu meiner, werter Kollege. Mordfälle ermittele ich. Haben wir das geklärt?«
10
Seit ihrem ersten Treffen mit Nicola schien eine Ewigkeit vergangen zu sein, dieser Nachmittag, an dem sie den Ort besucht hatte, an dem Nicolas Pizzica verwurzelt war.
Die Sonne hatte ihre Strahlen durch das Weizenfeld geworfen und die Ähren schillern lassen. Die Luft roch nach trockener Erde und die Zikaden krächzten ihr atemloses Lied.
Elenas Auto hoppelte über den Feldweg, der den Olivenhain vom Weizenfeld trennte. Im Rückspiegel sah sie, wie der Wind die Staubwolke verwischte, die sie hinter sich herzog. Endlich erhob sich die Schirmpinie neben dem Feld und warf einen gnädigen kreisrunden Schatten. Hier, hatte Nicola ihr erklärt, solle sie abbiegen und dem Weg folgen, bis er sich zwischen Eichen hindurchzwängte, die das natürliche Tor zu Nicolas Masseria, einem salentinischen Landgut, markierten.
Diese Landgüter hatten meist ein befestigtes Zentrum, in dem sich wie in einer Burg Stallungen, Lagerräume und Wohngebäude um einen Hof drängten, oft inklusive Wachturm und Kapelle. Nicolas Masseria hingegen war einfach ein großes Stück Land, mit alten Obstbäumen, Kakteen, Palmen und Olivenhainen, einigen Ruinen und einem halb verfallenen Gebäude mit flachem Dach, dessen einst dunkelrosa Farbe nur noch ein verwaschenes Blassrosa war.
Elena parkte am Rand der baumbestandenen Wiese und stieg aus. Das Erste, was sie hörte, war das jämmerliche »Iaaaah!« eines Esels, der hinter einem blühenden Busch hervortrottete. Dann schwirrten Trommelrhythmen durch die Luft, die hohen Töne einer Geige wehten herüber und mischten sich mit dem Krächzen der Zikaden, die in der Hitze des Nachmittags ihre monotone Melodie aus den zwei immer gleichen Tönen hielten. Die Geige brach ab, ein Akkordeon legte einige lang gezogene Akkorde in die Luft.
Elena ging auf das rosafarbene Gebäude zu, das zwischen den Obst- und Olivenbäumen herumstand. Etwas abseits saßen die Musiker am Rand eines Platzes vor verfallenen Lagerräumen, die von Büschen fast zugewachsen waren. Der Platz war gepflastert mit rund abgelaufenen Platten und eingerahmt von einer mächtigen Korkeiche und einigen uralten Olivenbäumen. In einer blau-weiß gestreiften Hängematte baumelte ein kleiner runder Typ mit kahl rasiertem Kopf und feinen Koteletten und schrammelte auf seiner Mandoline herum, die anderen Musiker von Lu Ientu saßen auf einem Mäuerchen im Schatten.