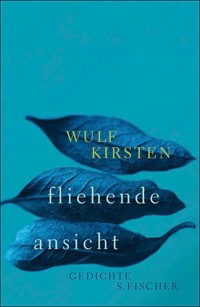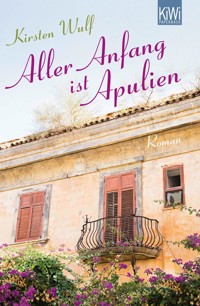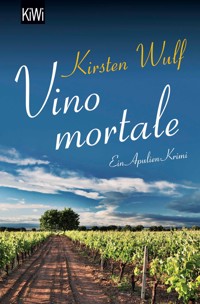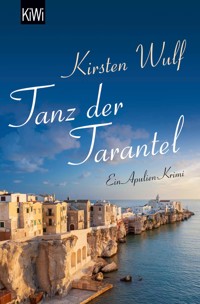9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Die Prinzessinnen im Krautgarten« sind Erinnerungen an seine Kindheit, die Wulf Kirsten in der Gemeinde Klipphausen im Landkreis Meißen verlebt hat. Er erzählt diese Dorfkindheit während der letzten Kriegsjahre, die im Tal der Wilden Sau vielerlei Überraschungen für ihn bereithielt, mit Poesie und Witz und leiser Melancholie. Die Kunst seiner Prosa evoziert für den Leser eine Welt und eine Landschaft, die heute verschwunden sind. »Nichts schöner, als diesem Dichter zu folgen.« Jürgen Verdofsky, Stuttgarter Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Wulf Kirsten
Die Prinzessinnen im Krautgarten
Über dieses Buch
Mit ›Die Prinzessinnen im Krautgarten‹, seinem persönlichsten Werk, erzählt Wulf Kirsten von einer Dorfkindheit in den Jahren zwischen 1939 und 1947, von der archaischen Welt, in der er aufwuchs, der Naziherrschaft und den Russentagen danach, die seine Kindheit beendeten und die Welt umdrehten. Von diesen letzten Kriegstagen im Tal der Wilden Sau berichtet Kirsten mit Poesie und Witz und leiser Melancholie, zeigt empathisch und intensiv, wie die alte Ordnung der neuen Platz machte. Die Kunst seiner Prosa evoziert für den Leser eine Welt, eine Sprache und eine Landschaft, die heute verschwunden sind.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Wulf Kirsten wurde 1934 in Klipphausen bei Meißen geboren. Nach seinem Pädagogikstudium arbeitete er kurzzeitig als Lehrer, war dann von 1965 bis 1987 Lektor des Aufbau Verlags. Seither lebt er als freier Schriftsteller in Weimar. Er war Stadtschreiber in Salzburg, Dresden und Bergen-Enkheim. Für sein literarisches Schaffen wurden ihm zudem u.a. der Peter-Huchel-Preis und der Joseph-Breitbach-Preis verliehen, zuletzt 2015 der Thüringer Literaturpreis.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Erstausgabe erschien 2000 im Ammann Verlag & Co. Zürich
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: kreuzerdesign Agentur für Konzeption und Gestaltung Rosemarie Kreuzer
Coverabbildung: Arno Fischer © Oliver Fischer, Hoppegarten
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490641-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Der Hof
Schule
Der Vogelsprache kund
Das Roggenfeld
Winterfreuden
Der Schandfleck
Die Nacht im Rübenkeller
Die Prinzessinnen im Krautgarten
Der Neulehrer auf dem Schuppendach
Mückenfett
Schulspeisung
Der Hof
Da ich keine falschen Vorstellungen aufkommen lassen möchte, gestehe ich lieber gleich, daß unser Hof in Wirklichkeit gar keiner war. Jedenfalls nicht das, was man gemeinhin mit einem so bezeichneten Ort verbindet. Man kann in dieser Bezeichnung den Wunsch erkennen, der sich in dieser verbalen Aufbesserung zu erkennen gab: einen richtigen Hof zu besitzen. Räumlich, der puren Platznot geschuldet, ließ sich dies jedoch nicht bewerkstelligen. Unser Hof war nur ein halbwegs eben gemachter Gang vor der Längsseite des Hauses von allenfalls doppelter Breite einer Heiste. Eingezwängt zwischen Garten und Schuppen, der nur ein Schauer war. Dieser bescheidene Anbau war im rechten Winkel ans Haus gesetzt worden. Bis in urgroßväterliche Zeiten hatte er als Schmiedewerkstatt gedient. Ein paar vom Rost angenagte Ackerwagenreifen galten als Beweisstücke für diese Behauptung. Das Mauerwerk war quer von stattlichen Rissen durchzogen. Die nicht tief genug gesetzte Grundmauer auf der laufenden Berglehne, die bestrebt war, nach Wettergüssen ins Tal der Wilden Sau zu gelangen, wollte nicht aufhören, sich zu senken. Der zu gewärtigende Einsturz ließ jedoch wunderbarerweise auf sich warten. Jahr um Jahr. Immerhin solange meine Kindheit währte. Zuweilen wurden die Risse, von denen es halb scherzhaft, halb verächtlich hieß, man könne durch sie einen Hut werfen, mittels saftiger Kellenladungen zugeworfen, zugestopft und am Ende einigermaßen geglättet mit der blanken Kellenunterseite und dem Streichbrett, das zur Hand zu sein hatte. Wie sorgfältig auch ausgeschmiert wurde, es blieb auf Dauer ein vergebliches Unterfangen. Denn bald zeigten die Risse ihr Geäder, das sich durch die Bruchsteinwand zog, wieder in alter Schönheit.
Hinter dem auf einer teils meter-, teils mannshohen Trockenmauer stehenden Lattenzaun, der so lawede geworden war, daß er längst einer Erneuerung bedurft hätte, fiel der Berg sogleich ab bis in den Talgrund, aus dem das geschwätzige Gemurmel des Baches heraufdrang, das alle Zuhörer auf eine mildherzige Weise zu beruhigen und zu besänftigen wußte. Für alle Dorfbewohner blieb das über ein steinernes Geröllbett schlürfende Wasser immer und ewig nur die Bach. Dieser stete, festgewordene Genusgebrauch prägte diese Form so hart, daß ich späterhin in anderen Regionen meine Schwierigkeiten haben sollte, mich an den Gebrauch des maskulinen Artikels zu gewöhnen. Und ich muß gestehen, in meinen Ohren klingt die Bach auch heute noch viel passender und schöner als der Bach.
Das normalerweise ausgesprochen friedfertige Nebenflüßchen der Elbe wußte eine beachtliche Fülle vokalisierter Wasserzustands- und Befindlichkeitsformen von sich zu geben. Je nach Wasserführung. Wir verstanden die Sprache des fließenden Wassers, das es unterhalb unseres Hauses ein wenig eiliger hatte als andernorts, ganz gut. So wie bei lang anhaltender Sommertrockenheit die Bach ganz verstummen konnte, ließ sie nach starken Regenfällen ein geradezu leidenschaftliches Rauschen und Gurgeln vernehmen. Ganz zu schweigen von jenen gefährlichen Tagen, an denen sie Hochwasser mit sich führte und zum reißenden Strom wurde, der breit über die Ufer trat und die Brückenbögen zu zerstören trachtete. Dann lag das harmlose Flüßchen den Anliegern im Tale bedrohlich genug in den Ohren, während wir oben auf dem Berge nichts von ihm zu befürchten hatten. Unser Teil war und blieb immer nur sein Gesang.
Der mit Apfel- und Birnbäumen geschmückte Wiesenhang, auf den sich zwei Eichen und eine Salweide selbsttätig eingeschmuggelt hatten, gehörte zur Rittermühle und wurde als Futterfläche genutzt. Nutznießer waren die beiden Pferde, die vor den Brotwagen gespannt wurden und sich als Feldbesteller zu bewähren hatten. Im Mai schäumte die Berglehne zu einem einzigen weißen Blütenmeer auf. Wer würde heutzutage noch an einem solchen Hang die Sense schwingen wollen? Wozu auch? Auf den Bandstegen, die sich in gleichmäßig gewellten Linien am Bergrücken entlangzogen, ließ sich der Schiebbock nur mit großem Geschick bugsieren. Wenn er hoch mit Gras bepackt war, Sense, Gabel, Rechen tief in die Ladung gestochen, mußten der Müller oder seine Viehmagd höllisch aufpassen beim Schieben und Balancieren mittels der beiden Holme, um nicht samt Ladung und Gefährt von der schmalen Fahrbahn abzukommen.
Auf diesem abschüssigen Gelände, in dessen Umzäunung sich immer wieder ein Durchschlupf fand, hatten sich die Kinder der Nachbarschaft unveräußerbare Besitzerrechte eingeräumt. Der Wiesenhang zwischen dem Mühlgraben und unserem Gartenzaun war ein Ort, an dem es sich wunderbar ungestört spielen ließ. Aber auch einfach dazusitzen, zu beobachten, ins Tal und ins Dorf zu blicken, dem blanken Müßiggang zu obliegen, geriet, wenn ich es leibhaftig bin, den ich da in meiner Erinnerung sehe, zu intensiver Weltbetrachtung aus eigenem Anschauen, wo nichts im Husch vorüberflog, wo man vielmehr alles schön langsam in sich einziehen lassen konnte.
Der wettergeschützte Hof wäre ein idealer Ort für Sonnenbäder gewesen. Des öfteren schlugen Besucher meinen Eltern vor, die Freilandterrasse zu überdachen und in eine Veranda zu verwandeln. So dachten Städter. Der Hof blieb ein Arbeitsplatz. So wie er dem Gelände abgerungen und eingerichtet war, schien er die einzig mögliche Fasson zu haben. Die vielen Gegenstände und Materialien, die auf dem Hof ihren Platz finden und halten mußten, warteten darauf, gebraucht zu werden. Schubkarre, Hackstock, Wäscheböcke und gegabelte Wäschesteifen standen auf Armlänge jederzeit griffbereit. Mittendrin noch eine Schattenmorelle. Eine selbstverständliche Ordnung, die sich aus Unordnung zusammensetzte. So wie minus mal minus plus ergibt. Ein phantastisches Ergebnis dieser Umschlag. Enge und Schlichtheit wurden nie als solche wahrgenommen. Etwa mit einem Gefühl des Bedauerns. Großzügigkeit konnte unter solchen Umständen allerdings schwerlich gedeihen. Erst viel später ging mir auf, welcher Reichtum und welche bereichernde Dingfülle in dem so bescheiden dimensionierten Geviert beschlossen lagen und welchen Schutz dieser Platz bot. Nicht nur vor den rauhen Winden, die sich dem Haus auf dem Berge klangreich mitteilten, besonders deutlich, wenn sie im Ofenrohr winselten und wir diese Ankündigung eines Wetterwechsels sehr wohl zu deuten und zu berechnen wußten. Die Enge des zusammengedrückten Hofes, eine Faltschachtel, die sich nicht entfalten ließ, war das alltägliche Maß, an das man von klein auf gewöhnt war und das man widerstandslos hinnahm.
Die Sicht reichte weit über das Tal hinweg. Ins Dorf hinein und bis zum Sachsdorfer Gemeindebusch hinüber, aus dem Kuckuck und Pirol riefen, bis zur Ochsenwiese, auf der wir im Winter rodelten, solo und in Kette. Die sich jenseits des völlig zerfahrenen Schimmricher Weges aufbuckelnden Felder reichten bis zum Horizont und schienen sich in der Unendlichkeit zu verlieren. In diesem Gefühl wurde man vor allem dann bestärkt, wenn die riesigen Getreideschläge eingepuppt standen. Hocke an Hocke, Reihe neben Reihe. Die ansonsten einförmig geglättete Landschaft war dann mit einem grobkörnigen Raster überzogen. Im Mittelpunkt des Gesichtsfeldes thronte das Rittergut mit den Wirtschaftsgebäuden. Einen Flügel davon nahm das Schloß ein, das allerdings nur wenig Ähnlichkeit mit einem der sonst üblichen, meist prächtigen feudalen Landsitze hatte. Jedenfalls architektonisch gesehen. Dieser Herrensitz erinnerte sehr stark an den voluminösen Kornspeicher mit mehrstöckigen Schüttböden, in dem sich nach dem Bauernkrieg zunächst die Herren und Damen von Ziegler und Klipphausen, später im Wechsel eine Reihe anderer dem sächsischen Landadel zugehörige Geschlechter herrschaftsmäßig etabliert hatten, um die Bauern besser im Blickfeld zu haben und leichter dämpfen zu können, wenn es sie noch einmal gelüsten sollte, sich unbotmäßig zu zeigen und an den Herrschaftsverhältnissen zu rütteln. Der Schreck muß tief gesessen haben.
Der zum Schloß umfunktionierte Kornspeicher blieb durch die Jahrhunderte in den auf profane Zweckmäßigkeit ausgerichteten Betrieb eingebunden. So befand sich denn auch im Zentrum des vorderen Gutshofes anstelle eines dekorativen Springbrunnens als einziger Zierat ein bemooster Sandsteintrog. Jederzeit mit klarem Wasser gefüllt, das eine nie versiegende und versagende Röhrfahrt von weither zuführte. Dort tränkten die Kutscher die Ackergäule und Zugochsen, wenn die Tiere den Weg nicht von selbst dorthin fanden. Hoch über der Hofeinfahrt verband ein überdachter Fachwerkbau das Schloß mit dem Inspektorhaus. Diese auf Balken ruhende Brücke mit den vier kleinen Fenstern auf jeder Seite ist in meiner Erinnerung in den Rang eines Triumphbogens aufgerückt, unter dem hindurch die Rittergutskutscher mit angeklatschten Mistfuhren oder tropfenden Jauchefässern auf die Felder zockelten.
Vor dem Schloß duckten sich die Gärtnerei mit den Gewächshäusern, die Mühle, zu der eine Bäckerei gehörte und die gleichzeitig Bauernhof war. Um die Mühle herum wie mit einer Hand verstreut die Häuser des Winkels. Wohnung und Stall unter einem Dach. Am Ende stand das unsere, von der Straße ein Stück zurückgesetzt. Das Stück Land vor dem Haus blieb ein ewiges Streitobjekt. Der Inspektor erklärte es zum Eigentum des Ritterguts. Vater hingegen behauptete steif und fest, es gehöre zum Haus. Diese Fläche wurde als Wendeplatz und Zugang zum Feimenplatz beansprucht, weil benötigt. Über dem Mühlteich erhob sich die ehemalige Brauerei, die halb in den Berg hineingesetzt worden war. Eine hohe Steintreppe führte zum Hauseingang. Darüber gleich eine zweite, die scharf am Haus vorbei auf die Schäferei hinaufführte. Ein zweiflügliges Rundbogentor, gerahmt von einem romanischen Sitznischenportal, führte in den Keller, den zu betreten ich nie Gelegenheit fand. Im Winter sollen darin die Fledermäuse büschelweise gehangen haben. Über der Brauerei und dem von Roßkastanien gesäumten Mühlteich stieg eine schanzenartige Böschung hinauf. Darüber stand, nicht zu übersehen, ein langgestrecktes Gebäude, der Schafstall. Obwohl da oben noch zahlreiche andere Behausungen, Stallungen und Speicher standen, hieß der gesamte Komplex nur »Auf der Schäferei«. Überragt wurde diese Anhöhe von zwei Feldscheunen, deren Fassungsvermögen beträchtlich war. Daneben die allherbstlich neu erbaute gewaltige Strohfeime. Exakt quadriert und mit Hilfe eines Elevators und vieler Gabeln einsturzsicher in die Höhe gezogen. An die Umfassungsmauer des herrschaftlichen Bereichs gelehnt, das Reich des Obstpächters, ein Labyrinth bretterner Bruchbuden, in denen sein Faktotum hauste, der alte Lange, dem es oblag, geflügelte und von kleptomanischen Zwängen beflügelte Obstdiebe zu verscheuchen. Da aber die mit Obstbäumen bestandenen Feldränder und Wiesenpläne von einer Person nicht zu übersehen waren, vermochte er nur wenig auszurichten. Ließ er sich im Revier unserer Diebeszüge blicken, waren wir auf und davon, so daß er fast nie einen zu fassen bekam. Gefährlicher war es da schon, bei den Streifzügen durchs Geäst vom scharfen Auge des Obstpächters erblickt zu werden. Mit ihm war nicht gut Kirschen essen. Ältere Jahrgänge wollten wissen, in Friedenszeiten, auf die so vieles Rühmliche zurückgeführt wurde, habe er mit der Schrotflinte nach Kirschdieben geschossen, ganz gleich, ob ihnen Flügel gewachsen waren oder nicht.
Jeder dieser Blickpunkte war ein Stück meiner Welt. Ausgeforscht bis in den hintersten Brennesselwinkel. Ausgekostet jeder fruchttragende Baum und Strauch. Pferdeställe, Heuböden, Wagenremisen, Schirrkammern durchstöbert. Jedes Schlupfloch durch lebende Hecken und Staketenzäune gefunden. Jedem Fußpfad nachgegangen, die glitschigen Mühlwehre gequert, Koppeln, Lehmgruben, Steinbrüche samt Pulverkammern erkundet. In jedem Tümpel und Tonloch gegründelt, nahezu durch jedes Schleusenloch gekrochen. Kein Flurstück blieb unentdeckt. Wir liefen uns die Heimat an den nackten Fußsohlen ab. Auf Dauer vermochte sich vor uns nicht eines der sechzig Häuser, aus denen das Dorf bestand, zu verstecken.
Kein Tag verging, an dem die Augen nicht wenigstens einmal dieses Blickfeld im Halbkreis abnahmen und durchmusterten. Man hätte am Ende schon gar nicht mehr hinsehen brauchen. Das Auge wußte die Bilder längst im voraus. Dennoch wurde es dieser Okularinspektionen nie überdrüssig.
Sobald der Himmel ein Einsehen mit uns hatte, verwandelte sich der Hof im Handumdrehen in eine Werkstatt unter freiem Himmel. Neben der Haustür standen Holzpantoffeln, Schlappen, von der Gartenarbeit gezeichnete Botten. An der Hauswand, auf deren hellem Graupelputz die Sonne am intensivsten auflag, trieb ein Weinstock am Spalier hoch bis zur Dachrinne. Die frischen, zarten Ranken schmeckten besser als Sauerlump. Jedes Jahr haben wir Kinder aufs neue davon probieren müssen, um den Geschmack nicht zu vergessen. Ehe die Trauben reif waren, hatten wir heimlich alle Beeren, die in erreichbarer Höhe hingen, abgeknipst, mochten sie noch so quietschsauer schmecken. Für die oberen Lagen waren die Vögel zuständig. Fast jedes Jahr fiel der Mehltau auf Trauben wie auf Blätter. Seine Lohe machte alles grau und krätzig, als wäre Zementstaub angeflogen. Selten gab es einen Herbst, der eine richtiggehende Ernte bescherte. Zumeist lohnte es erst gar nicht, die Leiter ans Spalier zu lehnen. Der verknorzte Rebstock wurde in Ehren gehalten wie ein Hausheiliger. Obwohl so ziemlich jedes Gewächs danach taxiert wurde, welchen Ertrag es abwarf. Kein Baum, kein Strauch wurde mit derartiger Geduld und Nachsicht gehegt wie der Wein. Da mochte eine tiefverwurzelte Ehrfurcht im Spiel sein, gegen die das bäurische Nützlichkeitsdenken nicht ankam. Jahr für Jahr wurden die Ranken hoffnungsvoll zurückgeschnitten, der Bewuchs auf Spaliergröße gehalten, der Stock vor Frost geschützt.
In der Hoffront des halb offenen Schauers war der Kaninchenstall gleich einem Einbaumöbel eingelassen. Ein dreiteiliger Wandschrank, je vier Boxen oder Buchten, wie wir sagten, übereinander. Die durchgehenden Türen waren mit verzinktem Netzdraht beschlagen. Die mit Schwartenbrettern ausgeschlagene Rückwand war von den Jauchbahnen versottet und schwarz eingefärbt. Sobald es heiß wurde, begann es aus dem Stall zu stinken. Im Winter wurde eine fast zentnerschwere Planendecke vorgehängt, die vor Frost und Ostwind schützte. Vor der Bodenreform, als wir weder Wiese noch einen Feldrand besaßen, suchten wir das Futter mühsam von den Wegrändern zusammen. Wir sichelten Schafgarbe, Gänsefingerkraut und Spitzwegerich, rissen die großen, haarigen Bärenklaublätter, brachen Haselnußzweige, stachen Disteln, auch jene, die Milch gaben, wie die ebenfalls willkommenen Maistöcke. Was sich im Vorbeigehen fand, wurde mitgenommen, und wenn es Klee war, der den Korb füllen half.
Der Hof war nur notdürftig befestigt, mit grob zugehauenen Granitstücken, wie sie dem Pflasterer gerade zur Hand gewesen waren. Auf den buckligen Steinen konnten wir Kinder uns nach Herzenslust die Knie aufschrammen. Einmal schlug ich mir eine hochkant stehende Betonplatte auf die Beine, an der ich verbotenerweise so lange gerüttelt hatte, bis sie zu kepeln begann und auf mich fiel. Ich wurde kurzerhand im Handwagen verstaut und dem Arzt vorgeführt. Ab in die Stadt mit verbundenen Knien. Ein blutiges Bündel Elend.
In einem ausrangierten Waschkessel weichten jederzeit Kartoffeln. Ehe der Tagesbedarf in den zweihenkligen eisernen Topf gelesen wurde, nahm man einen bis auf den Stumpf abgekehrten Birkenbesen zur Hand und rumpelte damit kräftig in der lehmigen Brühe herum. Hing keine Wäsche auf dem Hof, war gewiß Holz zu sägen oder zu hacken, in den Tragkorb zu lesen und auf den Hausboden zu tragen, wo Scheit für Scheit fein säuberlich eingesetzt werden mußte. Kästeln nannten wir diese subtile Beschäftigung. Oder es war Kalk zu löschen, Sand zu sieben, Mörtel zu mischen, Beton in eine selbstgebaute Form zu stampfen. Eine ergatterte Fichtenstange bekam erst dann ihren vollen Wert als Baumpfahl oder Zaunriegel, wenn sie entrindet worden war. Wenn das Langholz auf zwei Maurerböcken lag, wurde das Schnittemesser angesetzt und gezogen, bis es blank war. Und wie oft mußte eines der Fahrräder repariert werden! Noch ein Flicken auf den Schlauch gesetzt oder unter den Mantel gelegt.
Als wir in den Nachkriegsjahren einmal zwei Schweine großzuziehen suchten, von denen eines zur Selbstversorgung bestimmt war, das andere als »freie Spitze« die Versorgung mit Fleisch aufbessern helfen sollte, machte Vater die böse Entdeckung, daß beide Tiere von auf Schweine spezialisierten Läusen befallen waren. Auf ihren Körpern tummelten sich beträchtliche Populationen dieser aus dem Nichts aufgetauchten Parasiten. Es wimmelte nur so von diesen ungebetenen Mitbewohnern. Vater wußte keinen anderen Rat, als die beiden Hoffnungsträger in den Hof zu locken, sie zuvor dazu zu bringen, nicht vor der Treppe zurückzuschrecken, die von dem Hausanbau in den Hof hinunterführte. Er und ausgerechnet ich, mit Küchenstühlen ausgerüstet, nahmen sich je eines der Tiere vor, klemmten es längs zwischen die Knie und fahndeten nach dem Ungeziefer. Keine Laus sollte und durfte überleben, wenn die Pleinair-Aktion von Erfolg gekrönt sein sollte. Also hatte ich es, Widerwille hin, Widerwille her, Vater einfach gleichzutun und die lieblichen Tierchen zu packen und zwischen zwei Fingernägeln, wozu die nicht alles gut sind, zu knacken. Das Geräusch war nicht zu überhören. Die Prozedur zog sich hin. Denn die Schweine hielten nicht still und versuchten zu entwischen aus ihrer Klemme. Sie versuchten die seltene Gelegenheit eines Freigangs zu nutzen und wollten viel lieber im Hof schnuffeln und mit ihren Rüsselschnauzen im Erdreich wühlen. Also Schwein bändigen, den Knien die Kraft von Schraubzwingen geben, ablesen, knacken. Eine sitzende Beschäftigung, die wohl im Handumdrehen zu erlernen, jedoch weit widerwärtiger war als Mist aufzuladen und dann wieder schön säuberlich gleichmäßig auszubreiten oder Jauche zu tragen und mit gekonnten Armschwüngen aus dem Schöpfer zu verteilen. Halbkreis um Halbkreis.
Unter den wenigen Habseligkeiten, mit denen Vater aus Krieg und amerikanischer Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, befanden sich zwei verchromte Metallbüchsen mit Schraubverschlüssen, randvoll gefüllt mit einer tiefvioletten, metallisch glänzenden Substanz, zumeist aus kristallinen Blättchen bestehend. Übermangansaures Kali sollte bei uns in der Familie rasch zu einem Zauberwort avancieren. Ansonsten auch Kaliumpermanganat geheißen und vornehmlich als Desinfektionsmittel verwendet. In den Jahren, als Medikamente schwer zu erlangen waren, verordnete Vater die leicht lösliche und enorm ergiebige, farbintensive Chemikalie bei jeder Gelegenheit als Allheilmittel so wie auch Luvos-Heilerde. Beides äußerlich und innerlich zu gebrauchen. Sie sollten auch die Tierarztrechnungen sparen helfen, so sehr glaubte Vater an die Heilkraft. Hatte jemand Halsschmerzen, wurde eine Prise in Wasser aufgelöst und mit der nicht sonderlich angenehm schmeckenden Tinktur gegurgelt. Eine Ziege freilich konnte sich dazu nicht verstehen. Aber Umschläge und Bäder waren schon möglich. Mitunter soll übermäßiger Gebrauch das Wasser des Bachlaufs im Tale eingefärbt haben. Von Verfärbungen des ohnehin indefiniten Elbwassers ist indes nie etwas bekannt geworden. Woher Vater seine Feldscher-Weisheiten bezogen hatte, ließ er uns nie wissen. Vielleicht hatte er sich die diversen Anwendungsgebiete nur zusammengereimt oder gänzlich ausgedacht wie so manches andre auch, was er zum besten gab. Der Vorrat war schier unerschöpflich, als ob die Kristalle sich selbsttätig vermehrten. Vermutlich hatte er bei Kriegsende den kompletten Bestand einer Heeresapotheke oder mindestens eines Feldlazaretts erbeutet, für den keiner mehr Verwendung hatte, während er aus allen Gegenständen, die er herrenlos herumliegen sah, einen Nützlichkeitswert für seine Zwecke abzuleiten wußte. So wie er eines Tages auch ein im Straßengraben liegendes leeres Teerfaß nach Hause bugsierte, zweihundert Liter Fassungsvermögen. Da er darin Teichwasser zu transportieren gedachte, um die Gemüsekulturen auf dem Felde versorgen zu können, mußte es erst einmal gesäubert werden. Aber wie die Teerreste beseitigen? Da half seiner Meinung nach nur ausbrennen. Kaum den brennenden Strohwisch hineingehalten, erhob sich das Faß und begann zu fliegen. Fast in Firsthöhe des Hauses wurde die nicht geplante Flugübung abgebrochen, und das Faß donnerte zu Boden. Vater und wir umstehenden Kinder hatten uns eilends in Sicherheit gebracht, da die Flugbahn nicht vorausberechnet worden war. Immerhin war das Faß nach der bedrohlichen Himmelfahrt, die durchaus auf dem Dach hätte zu Ende gehen können, umfunktioniert und konnte fortan als Wasserfaß auf eine zweirädrige Karre geladen werden. Leer ein Pappenstiel, aber gefüllt mehr als vier Zentner Last, die bergauf gedeichselt und gezogen sein wollte auf holpriger Straße.
Unter der Schattenmorelle wurde in einer großen Holzwanne die Wäsche gerumpelt. Mutter stand über das Waschbrett gebeugt. Oft gesehen, nicht vergessen. Einmal erlebte ich bei dieser unvermeidlichen Prozedur einen Zwischenfall. Ich höre und sehe Mutter laut um Hilfe schreiend die aufgeböckte Wanne umkreisen. Großmutter, die uns Kinder so gern hatte, mit einem langen Messer in der Hand immer dicht hinter ihr her. Dabei versicherte sie unablässig, Mutter erstechen zu wollen. Weiß der Himmel, was in sie gefahren sein mochte, so fuchtig zu werden. Ob ein Wutanfall in sie eingeschossen sein mochte aus einer Nichtigkeit heraus oder ob sie tatsächlich, wie behauptet wurde, nicht mehr ganz richtig im Oberstübchen war? Anlaß und Hintergründe blieben mir, damals sechs oder gar schon sieben Jahre alt, verborgen. Ich weiß auch nicht, ob jemand aus der Nachbarschaft dazwischenging, ob Mutter die Flucht vom Hof gelang oder wie sonst Großmutter von ihrem Vorsatz abkam. Jedenfalls blieb Mutter unverletzt, äußerlich. In meinem Erinnerungsspeicher ist nur das Bild eines Wettlaufs gespeichert: Zwei um die Waschwanne rennende Frauen. Großmutter von einer erstaunlichen Behendigkeit und Leichtfüßigkeit, nahezu körperenthoben, plötzlich von allen Altersgebrechen freigesetzt. Sehr merkwürdig. Ausgerechnet dieses Bild, das der Rekonstruktion bedarf, um zu einem faßbaren Kontext zu kommen, ist mir als Lebensausschnitt nachgelaufen. Uns Kindern hat Großmutter nie ein Härchen gekrümmt. Sie saß mit uns auf dem Steinblock vorm Tor, barfuß wie wir oder ihre schwarzen Filzschuhe an den Füßen. Gelegentlich gab sie uns zu essen. Und wenn ihre Speisen auch manchmal bereits verdorben waren, gab sie immer in der Absicht, uns etwas Gutes zu tun. Sie brachte es einfach nicht übers Herz, Lebensmittel wegzuwerfen. Zeitlebens hatte sie sich strengste Sparsamkeit auferlegen müssen. Und davon wollte und konnte sie nicht mehr abgehen. Kurze Zeit nach ihrer Messerattacke wurde Großmutter von zwei Männern in ein Auto genötigt, wohl das erste, das vor unserem Haus hielt, und in ein Altersheim gebracht. Später hörte ich, sie sei unter Kuratel gestellt worden. Ihr Vormund, Lehrer Bancke, der sich ab und an auf unserem Hof hatte blicken lassen, um nach dem Rechten zu sehen, habe die Ausquartierung veranlaßt. Danach habe ich Großmutter nie mehr gesehen. Nur auf ein, zwei Fotos. Nie kam ein Brief oder eine Karte. Wie ich mich überhaupt nicht entsinnen kann, daß sie jemals etwas zu Papier gebracht hätte. Hin und wieder besuchte sie jemand aus der Verwandtschaft. Wir fuhren nicht zu ihr. Die Lebenszeichen blieben spärlich. Bevor der erste Nachkriegswinter einsetzte, ist sie gestorben. Einundachtzig Jahre alt. Auf der Sterbeurkunde war als Todesursache Altersschwäche angegeben. Sicher hat sie in den Jahren ihrer Verbannung nie genug zu essen gehabt. Aber weit schwerer soll sie an Heimweh nach ihrem Oberstübchen gelitten haben, dessen Unordnung ihr kein Mensch auszutreiben vermocht hatte. Das Schiebefensterchen, von dem aus sie auf den Hof geblickt hatte, war gerade so groß, daß sie ihren Vogelkopf hindurchstecken konnte. Von dort aus hatte sie beobachtet, was auf dem Hof und im Dorf, das ihre weite Welt war, vor sich ging, und ihre meschanten Kommentare abgegeben, wenn sie nicht gerade mit ihrem klapprigen Handwägelchen draußen herumzog oder mit uns Kindern einträchtig vor dem Schuppentor saß. Hinter ihrem Rücken besorgten zwei wohlgenährte Katzen, ihre geliebten Mausehaken, den Abwasch.
Zum leidigsten Problem unseres Hauses auf dem Berge gehörte die Wasserversorgung. In meinen frühesten Kindheitsjahren befand sich in der Mitte des Hofes noch ein Brunnen, über zehn Meter tief. Wie andre aus der Nachbarschaft in den Fels gehauen. Er kann hundert, ebenso zweihundert Jahre in Betrieb gewesen sein. Das Wasser schöpfte ein Bottich, der an einem Seil befestigt war, das über eine hölzerne Rolle lief, die mit einer Handkurbel in Bewegung gesetzt werden mußte, wenn Bedarf war. Wehe, wenn das Schöpfgefäß abhakte oder das Seil riß, weil es sich zu oft an einer Felszacke gerieben hatte. Dann war guter Rat teuer. Dann blieb am Ende nichts anderes übrig, als zwei Leitern übereinanderzubinden und einen Mutigen zu suchen, wie in der populären Ballade. Später, als der Brunnen nicht mehr als Wasserspender genutzt wurde, diente er jahrelang als Müllschlucker. Schutt und Asche rutschten immer wieder nach. Inzwischen hatte Vater einen neuen Brunnen im Garten gegraben. Ehe er ans Werk ging, war ein Rutengänger mit seiner Zwille ums Haus herumgelaufen, um die günstigste Wasserstelle herauszufinden dank der erdmagnetischen Kräfte, die seinen Armen und seiner Haselnußgabel, die er waagerecht ausgestreckt in Bauchhöhe vor sich herführte, innewohnen sollten. Je stärker das Wasserreservoir in der Tiefe, desto wilder und konvulsivischer zuckte und schnippte die Zwille auf und ab. Auch in unserem Falle soll sie ihm entsprechende Winke gegeben haben. Ich selbst habe die Zwille, nicht viel größer als unsere Katapulte, Katscher genannt, leider nicht mit eigenen Augen in Bewegung gesehen. Deshalb muß ich mir Zurückhaltung auferlegen. Auf alle Fälle schenkten meine Eltern dem wundertätigen Manne Glauben. Vater hackte, schaufelte, grub. Mit der Brechstange wuchtete er die Kaventsmänner aus dem verkiesten Geröll. Mit Fäustel und Spitzeisen mußten Granitblöcke abgespellt werden, die den Weg in die Tiefe versperrten. Von Meter zu Meter wurde oben über dem Erdloch ein neuer Betonring aufgesetzt, danach hatten die bereits eingelassenen selbsttätig nachzurutschen. Jedenfalls unter idealen Bedingungen. Steigeisen waren einzusetzen. Mutter leierte den Kies und die Steine eimerweise heraus. Das Seil lief über ein eisernes Rad, das in einem Dreibock hing. Erst in dreizehn Metern Tiefe stieß Vater auf Wasser. Viel Freude hatten wir indes an dem Bauwerk nicht. Das mit Hand betriebene Pumpsystem versagte wieder und wieder. In dem Rohrgestänge mußte sich ein Wurm eingenistet haben, der den Wasserfaden reißen ließ, bevor ihn der Schwengel nach oben drücken konnte. Zu allem Übel drainierte der Nachbar seine unter unserem Garten liegenden Wiesen, womit er uns vollends das Wasser entzog und uns trockenlegte. Nach dem Krieg versuchte Vater noch einmal sein Glück. Er vertiefte den Brunnen um weitere zwei Meter. Diesmal ohne Ringe, da sich die Röhre in der Erde festgefressen hatte und an ein Nachrutschen nicht mehr zu denken war. In halber Höhe baute Vater eine Plattform ein, auf die er einen Motor setzte, der aber auch nur kurzzeitig funktionierte, bald zu bocken anfing, ehe er vollends versagte. Der Effekt dieser gefährlichen Plackerei war gleich Null. Das unterirdische Wasserwerk wollte seinen Zweck ganz einfach nicht erfüllen. Der Brunnen wurde aufgegeben. Ich mußte zum Glück danach nie wieder bis auf die Plattform hinunterhangeln, um Vater zu helfen. Allein der bloße Gedanke an diese verflossenen Handlangerdienste weckt ungute Gefühle. Wir waren wiederum gezwungen, das Trinkwasser aus dem Brunnen des Nachbarn zu pumpen und fahrtenweise heranzuschleppen. Sparsamer Verbrauch verstand sich bei dieser mühevollen und zeitaufwendigen Beschaffung von selbst. Aber wie oft mußte der Waschkessel oder eine Wanne gefüllt werden! Wasser marsch! hieß es tagaus, tagein, sommers wie winters. Für jeden im Hause, der zwei Eimer tragen konnte. Wie Blei hingen die gefüllten Wassereimer an den Armen. War über Nacht Schnee gefallen, mußte erst Bahn geschoben oder geschaufelt werden. Erst als das Unterdorf und mit ihm auch unser Häuslerwinkel an das Wassernetz der Gemeinde angeschlossen wurde, hörte die Schinderei endlich auf.
Der Lattenzaun, der eine Grenze zwischen Hof und Garten zog, war erst recht von Altersschwäche gezeichnet. Malerisch garniert mit Gießkannen, Zinkäschen, Töpfen, Scheuerhadern. Eigentlich sollte er die Hühner von den Beeten fernhalten. Diesen Zweck hat er jedoch niemals erfüllt. Ein Schlupfloch fand sich immer zwischen Blechtafeln, Schieferstücken, Pflöcken und dergleichen Zierat. Am Ende flogen die ewigen Unruhestifter gar noch über die Zaunspitzen hinweg. Sogleich wurde beschlossen: Nie mehr Italiener! Nie mehr weiße Leghorn! Schwere Hühner müssen her, auch wenn diese nicht so tüchtige Eierleger sind. Damit endlich wieder Ruhe einkehrt. Was nehmen? Rhodeländer? New Hampshire? Orpington? Gesperberte Mechelner. Alles schon einmal ausprobiert und wieder verworfen. So wurde der Hof, auf dem die Hühner ihr Futter vorgeworfen bekamen und auf dem sie ihr Staubbad nahmen, auch zum Prüfstand der Hühnerzucht. Letztlich machten aber doch wieder die angeblich an Rentabilität nicht zu übertreffenden Weißen Leghorn das Rennen in Hof und Garten. Ungeachtet ihrer Geländegängigkeit und der sträflichen Vorteile, die sie aus den Gemüsekulturen zogen.
Auf dem schmalen Streifen zwischen Mauer und nachbarlichem Wiesenhang, der stillschweigend beiderseitig als Niemandsland hingenommen wurde, gediehen Brennesseln und Pfeifenkraut. Letzteres wucherte in übermannshohen Beständen. Nicht auszurotten. Holundergesträuch hatte sich an einigen Stellen in das poröse Mauerwerk eingekrallt. Aus den Bruchsteinritzen ließ sich das Schöllkraut nicht vertreiben. Mit seinem gelben Saft wurden Warzen betupft. Auf daß sie vergingen. Manchmal lief einer der beiden Anlieger mit einer alten Sense an der Mauer entlang und fällte die verholzten Stengel.