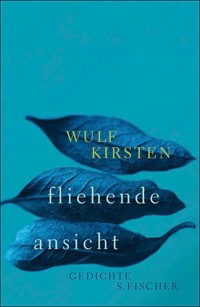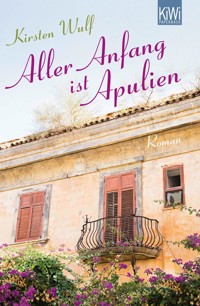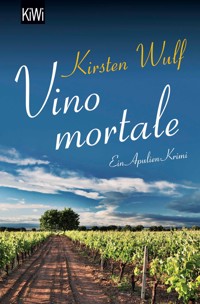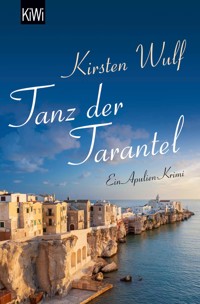9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn schon Krise, dann in Rom. Sie kennen sich nicht, aber der Zufall würfelt sie in Rom zusammen: die trauernde deutsche Lehrerin, die italienische Blues-Sängerin und die Austausch-Studentin aus Amerika. Una storia italiana … Einmal in ihrem Leben hat Laura alles riskiert. Sie folgte Fabio, ihrer italienischen Liebe, nach Rom. Sein plötzlicher Tod stürzt sie in ungekannte Abgründe. Bis mitten in der Nacht die neue Nachbarin klingelt. Ein Wasserrohrbruch. Sie übernachtet auf dem Sofa – und bleibt. Bis der Schaden behoben ist, das kann dauern. Und dann taucht auch noch eine Studentin auf, die in Lauras große Wohnung einziehen will. Unterschiedlicher könnten die drei Frauen nicht sein. Laura will ihre neuen Mitbewohnerinnen so schnell wie möglich wieder loswerden, aber zu spät: Die beiden machen keine Anstalten wieder auszuziehen. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht? Ein wundervoller Roman über Neuanfänge wider Willen, den Mut, im richtigen Moment zu lieben, und Musik, die wie das Leben spielt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Kirsten Wulf
Signora Sommer tanzt den Blues
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Kirsten Wulf
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Kirsten Wulf
Kirsten Wulf, geboren 1963 in Hamburg, arbeitete als Journalistin in Mittel- und Südamerika, Portugal und Israel. Seit 2003 lebt und arbeitet sie in Italien. Ihre Apulien-Krimis über die Abgründe der süditalienischen Provinz sind »fein und sprachlich überdurchschnittlich hochwertig« erzählt (Saarländischer Rundfunk, SR3). Und über ihren Portugal-Roman »Sommer unseres Lebens« schrieb Monika Peetz: »Nach der Lektüre will man sofort seine Freundinnen anrufen und mit ihnen in den Urlaub fahren.«
www.kirstenwulf.com
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Einmal in ihrem Leben hat Laura alles riskiert. Sie folgte Fabio, ihrer italienischen Liebe, nach Rom. Sein plötzlicher Tod stürzt sie in ungekannte Abgründe. Bis mitten in der Nacht die neue Nachbarin klingelt. Ein Wasserrohrbruch. Sie übernachtet auf dem Sofa – und bleibt. Bis der Schaden behoben ist, das kann dauern. Und dann taucht auch noch eine Studentin auf, die in Lauras Wohnung einziehen will.
Unterschiedlicher könnten die drei Frauen nicht sein. Laura will ihre neuen Mitbewohnerinnen so schnell wie möglich wieder loswerden, aber zu spät: Die beiden machen keine Anstalten, wieder auszuziehen.
Ein wundervoller Roman über Neuanfänge wider Willen, den Mut, im richtigen Moment zu lieben, und Musik, die wie das Leben spielt.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2020, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Rüdiger Trebels
ISBN978-3-462-32111-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Prolog
Kapitel 1
Guendalinas Geschichte
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Guendalinas Geschichte
Kapitel 6
Kapitel 7
Guendalinas Geschichte
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Guendalinas Geschichte
Kapitel 17
Kapitel 18
Guendalinas Geschichte
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Epilog
Dank
Für Roman – let’s dance!
The Blues is in everything
Wynton Marsalis
Prolog
Sie waren wieder da. Tipp-tapp tipp-tipp-tapp, mit offenen Augen lag ich in der Dunkelheit und hörte sie über meinem Bett tanzen. Die aufgeregten Schritte von zwei Menschen, die swingenden Rhythmen, Trompeten, Klavierläufe.
Wer schlich sich nachts in die riesige, leer stehende Wohnung im oberen Stockwerk und tanzte heimlich zu der Musik, die die amerikanischen Soldaten mitgebracht hatten? Der Atem der Sommernacht strich durch das schmale Fenster meiner Kammer und erfüllte mich mit fiebriger Neugierde.
Irgendwann wurden die Melodien sanfter, zu gedehnten Phrasen schurrten die Schritte über den Boden. Die Musik wisperte nur noch und verschwand in einer sirrenden Stille.
In diesem schlaflosen Sommer 1945 wurde ich 16 Jahre alt. Aus Rom waren die deutschen Soldaten schon im Jahr zuvor verschwunden. Einfach so, still und heimlich, plötzlich waren sie weg. Wir rieben uns noch die Augen, da kurvten schon amerikanische Jeeps, Panzer und Militärfahrzeuge zwischen Forum Romanum, Kolosseum und Piazza Venezia herum. Wir jubelten wie verrückt unseren Befreiern zu, italienische Flaggen flatterten vor den Fenstern, während im Norden des Landes und im Rest von Europa noch gekämpft, gehungert und gestorben wurde. Die römischen Mädchen holten ihre hübschesten Kleider aus den Schränken und eilten auf die Straßen, ergriffen die Hände der schmucken Soldaten, ließen sich in die offenen Jeeps ziehen und brausten lachend durch die Stadt.
Die Amerikaner hatten Rom kampflos erobert und besetzt, danach wurden aus Soldaten die ersten Nachkriegstouristen. Sie bewunderten die Monumente, genossen unsere Sonne und unser Essen. Wir hingegen wurden von ihrer Musik infiziert: Swing, Jazz und Blues schepperte aus den Trümmern und durch die Gassen. »Die Musik der Freiheit!«, hatte mein Vater gerufen, Mammas Taille umfasst und sie herumgewirbelt. Was für ein Sommerfest!
Wir wohnten 1945 schon in Trastevere, eine Bombe hatte zwei Jahre zuvor unsere Wohnung im Arbeiterviertel San Lorenzo getroffen und das Haus halbiert, während wir in einem Keller hockten. Das Letzte, was ich von unserer kleinen Wohnung erinnere, war der Blick in ein offenes Puppenhaus. Ich stand auf einem Trümmerhaufen und sah, wie die Deckenlampe über unserem Esstisch im Wind schaukelte.
Wir hatten Glück. Irgendein Cousin meines Vaters hatte von dem leer stehenden Palazzo eines Tabakfabrikanten in Trastevere gehört. Der Tiber trennt dieses Viertel von den zentralen Stadtteilen Roms, auf dieser Seite liegt auch der Vatikan, und meine Mutter hoffte, dass die Nähe zum Heiligen Vater uns vor weiteren Bomben schützen möge.
Wir richteten uns in der Dienstbotenwohnung im hoch gelegenen ersten Stock ein. Unten befanden sich Lagerräume. Und über uns? Ich schlich manchmal die breite Treppe hinauf, legte mein Ohr an die Flügeltür des Portals – nichts zu hören. Aber ich hatte nicht geträumt: Ein einsames Paar tanzte in den Sommernächten über meinem Bett zu amerikanischer Musik.
»Die Geschichte da oben geht nicht gut aus«, raunte meine Mutter eines Morgen meinem Vater zu. »Gott, wenn das die Eltern wüssten …«, dann bemerkte sie mich im Türrahmen. Ich öffnete den Mund, »Schht!«, zischte meine Mutter, und ihr drohender Zeigefinger verbot mir jede Neugierde. »Da ist nichts. Wir dürfen in dieser Wohnung bleiben, der Rest interessiert uns nicht.«
Aber natürlich stand meine Mutter mit den Nachbarinnen auf der Piazza und wusste von den Gerüchten. Dass der elegante Sohn des Tabakfabrikanten und seine zukünftige Frau den Palazzo bewohnen sollten. Sie sei eine gewisse Guendalina, bildschön und aus allerbester Familie. Doch der Krieg war ihrer Hochzeit zuvorgekommen, so ein traumhaftes Paar, seufzten die Nachbarinnen. Der Bräutigam hatte bis Kriegsende irgendwo im Norden gekämpft, erst mit den Deutschen, dann gegen sie, wer sollte das noch verstehen? Auch im Sommer 1945 war er noch nicht wieder aufgetaucht, kein gutes Zeichen. Das arme Mädchen, so eine Schönheit, wahrhaftig. Zu schade, nun saß sie im Palazzo ihrer feinen Familie irgendwo hinter der Villa Borghese und sehnte sich nach ihm, ach, es war furchtbar. Meine Mutter hielt sich mit ihren Kommentaren zurück, nickte aber mitfühlend. Alle wussten natürlich, dass wir froh sein konnten. Wir wurden in der hübschen kleinen Dienstbotenwohnung geduldet, aber was, wenn der Verlobte zurückkehrte?
Dann sah ich sie zum ersten Mal. Eines frühen Morgens trat sie mit dem ersten Sonnenstrahl aus dem Palazzo. Ich stand am Fenster, sie drehte sich um, warf einen Blick nach oben und lächelte ihr samtiges, ein bisschen schelmisches Lächeln – umwerfend! Das konnte nur die Braut sein, Guendalina. Für einen Moment trafen sich unsere Blicke. Ich hob schüchtern die Hand. Sie zwinkerte – meinte sie mich? Sie war voller Sonne. Eine verliebte junge Frau.
Es dauerte eine Weile, bis Guenda und ich Freundinnen wurden. Aber sie brauchte eine Komplizin.
Die Geschichte da oben konnte nicht gut ausgehen.
1
Es hatte sich alles richtig angefühlt und war auf ein wundervolles Finish der Nacht hinausgelaufen. Doch Fra hätte die letzten zwei oder drei Whiskey stehen lassen sollen. Dann wäre sie mit Antoine auch im richtigen Stockwerk gelandet.
Nach der Jam Session im BluNight hatte Fra zunächst mit dem neuen Mundharmonikaspieler aus London geliebäugelt, Erics Soli zu ihrer Stimme – zum Heulen schön, aber dann stand Antoine hinter dem Tresen, aufgeräumt und charmant wie schon lange nicht mehr, und Fra setzte ihre Prioritäten neu. Sie sollten es mal wieder versuchen.
Während Antoine die letzten Gäste abkassierte, Fra den herben Duft seiner Zigarillos witterte, schenkte sie sich noch einen letzten und einen allerletzten Whiskey ein, erfreute sich am Anblick seiner schmalen, vielversprechenden Hände und verlor die Orientierung über ihren Alkoholpegel.
An Antoines Arm taumelte Fra durch die Nacht zu ihrer neuen Wohnung, schmetterte »I love the life I live« und Antoine führte sie summend mit einigen Tanzschritten durch den Innenhof, »and I live the life I love!« Sie stolperten die Treppe hinauf, aus purer Gewohnheit bis ganz nach oben.
Endlich war da die Haustür. Fra spürte Antoines warmen Atem in ihrem Nacken, fingerte den Schlüsselbund aus der Handtasche – wie zufällig glitt seine Hand von hinten durch ihren Schal, in den Mantel und unter ihre Korsage. Alles drehte sich, und welches war der richtige Schlüssel? Keiner passte, verdammt. Fra war erst vor ein paar Tagen eingezogen – ihr dämmerte, dass sie nicht mehr im Dachgeschoss wohnte, sondern im ersten Stock! Antoines Zunge kitzelte unter ihrem Ohrläppchen. Fra drehte sich zu ihm, und im gleichen Moment öffnete sich hinter ihr die Haustür. Sie verlor das Gleichgewicht, rutschte aus, fiel – und sah von unten kuhäugige Dalmatiner, die sich auf einem ausgeleierten Pyjama herumtrieben – was war das denn für ein unschlagbar schlampiger Fummel? Dazu dieses verknitterte Gesicht, das oben herausguckte und sie entgeistert anstarrte. War diese Dalmatiner-Lady aus einem Sack der Kleiderspende gekrabbelt? Wie auch immer, die glotzte, als ob ihr eine Außerirdische vor die Füße gefallen wäre. Okay, es war mitten in der Nacht – oder schon früher Morgen?
Allerdings gab es zu jeder Tages- und Nachtzeit genug Gründe, Fra mehr oder weniger erstaunt zu betrachten. Die bunten Tattoos an Armen und Beinen, der pralle Busen, ihre auch sonst üppige Körperfülle und natürlich die Haare, der messerscharf geschnittene Bob mit Pony exakt zwischen Haaransatz und Augenbrauen, stets in unterschiedlichen Tönen des Regenbogens gefärbt. In dieser Nacht frisch waldgrün, das zu den Spitzen metallicblau verlief. Eine gewagte Kreation, sogar für Fras Verhältnisse. Für normal gestrickte Seelen mit normalen Jobs, in normalen Wohnungen, mit normalem Fernsehprogramm war Fras buntes Ganzkörper-Design ein schriller Anschlag auf den gewöhnlich guten Geschmack. Offensichtlich auch für die Lady in der Dalmatiner-Klamotte.
Antoine lächelte dünn, reichte Fra seine elegante Hand und zerrte sie hoch. »Sorry.« Fra stand wieder und grinste die erstarrte Frau im Türrahmen an. Das Treppenhaus wankte, aber Antoine hakte sie unter. »Falsches Stockwerk«, entschuldigte sich Fra und winkte den Dalmatinern zu, streifte mit einem kurzen Blick die Augen dieser Frau im Pyjama – und erschrak. Fra verstand, zumindest in diesem kurzen lichten Moment: Die war im schwarzen Loch. Tiefschwarz. Davon verstand Fra etwas.
Laura war schaudernd in der Badewanne erwacht – das Wasser war kalt. Wie spät mochte es sein? Sie zog den Stöpsel, betrachtete den Wasserstrudel, der um den Abfluss kreiselte, immer schneller und schließlich verschwand. Wie lang dauerte diese Nacht noch? Sie drückte sich hoch, griff nach dem Badehandtuch, wickelte sich ein und tappte über den Flur ins dunkle Schlafzimmer. Knipste das Deckenlicht an. Das Bett war noch so zerwühlt, wie sie es mittags verlassen hatte, der Pyjama lag auf dem Teppich.
Sie machte das Licht wieder aus, zog den Pyjama an und kroch unter das Laken mit den drei Wolldecken. Es war eisig in den letzten Januartagen, hatte vor einigen Tagen sogar geschneit, in Rom! Die schneebedeckten Dächer am Morgen, die Stille der eingehüllten Stadt, das gedämpfte Licht – für einen Augenblick hatte Laura kindliche Freude gespürt. Ein kurzes Glimmen nur.
Laura wartete auf den Schlaf. Warum blieb sie in dieser Stadt? In dieser Wohnung, in der sie sich verlor? Schlief in diesem Bett, das zu groß geworden war? Fabio war gegangen, einfach so. Dann war Lauras Leben auseinandergeflogen, auch einfach so.
Schrilles Lachen einer Frau, eine raue Männerstimme posaunte: »O Schöne der Nacht!« Sie waren im Innenhof. Laura öffnete die Augen. Das flackernde Licht drang durch die Lamellen und malte feine Streifen in die Dunkelheit des Schlafzimmers. Wieder dieses Lachen, dann sang die Frau dunkel dröhnend, »I live the life I love«. Laura verschwand unter den Decken.
Schritte kamen die Treppe herauf. Ein Schlüssel rumorte an ihrer Haustür – Fabio! Laura stolperte aus dem Bett, taumelte barfuß über den langen Flur – tatsächlich, ein Schlüssel klimperte! Sie riss die Tür auf.
Mit einem Juchzer fiel ihr etwas Schweres, Weiches, Warmes entgegen – eine massige Frau, die nach Rauch und Alkohol stank und auf den Boden plumpste. Laura zog ihre Füße zurück. Wer – war – das? Mitten in der Nacht? Laura sah von oben in ein Käthe-Kruse-Gesicht mit himbeerroten Lippen und verschmierter Wimperntusche, umgeben von blaugrün gefärbten Haaren. Und dann begann diese Erscheinung dröhnend zu lachen. Dahinter grinste ein dürrer Kerl in weiten Hosen und Trenchcoat, die Augen dunkel umrandet, der Schnurrbart ein Pinselstrich, die Haare zurückgekämmt und triefend vor Brillantine. Lehnte sich an den Türrahmen, reichte den Wurstfingern dieser Frau seine schlanke Hand. Alles an ihr schwabbelte vor Lachen. Laura öffnete den Mund, wollte sagen, dass … – und blieb stumm. Spürte das innere Zittern wieder. Sie warf die Tür zu, ließ sich auf den Boden sinken und schnappte nach Luft. Schritte entfernten sich, treppab, Stufe für Stufe, das glucksende Lachen wurde leiser. Nach einer Weile stand Laura auf und öffnete die Tür einen Spalt, hörte, wie sich die beiden unten im ersten Stock verabschiedeten.
»Ciao, amore! Ciao!«
»Doch nicht jetzt! Bleib!«
»Zu spät, du weißt …«
»Nur kurz!«
Stille. Flüstern. »Ciao!«
»Ciaociaociao«, dann fiel die Eingangstür ins Schloss, mit diesem Quietschen, über das sich Fabio schon im letzten Winter geärgert hatte. Es war wieder Januar, und die Tür quietschte immer noch.
Wohnte diese betrunkene Nudel tatsächlich unter ihr? War das etwa ihre Nachbarin?
Im ersten Stock passte gleich der erste Schlüssel, doch auf der Fußmatte schaute Antoine auf die Uhr. Zu spät. Viertel nach vier, kurze Knutscherei im Türrahmen, dann war Antoine weg. Der war doch eben noch rattenscharf gewesen – oder hatte Fra das mal wieder alles falsch interpretiert? Nein, sie wusste doch, dass Antoine nie bis zum Sonnenaufgang blieb.
Der Whisky warf immer noch Nebelschwaden in ihrem Kopf. Fra torkelte in den kurzen Flur voller Kartons, ließ auf dem Weg ins Schlafzimmer ihren Mantel fallen, schleuderte die Pumps von den Füßen – und spürte das Desaster, noch bevor ihre Hand den Lichtschalter gefunden hatte. Sie stand in einer Pfütze, nein, in einem See! Fra ließ sich aufs Bett fallen und sprang sofort wieder hoch: klatschnass. Ein Blick zur Decke: Dort hatte sich ein riesiger Wasserfleck ausgebreitet. Plitsch-platsch, das Schlafzimmer glich einer Tropfsteinhöhle.
Fra war hundemüde, betrunken, und sie hatte kein Sofa in der neuen Wohnung. Nur ihr nasses Bett – wo bitte sollte sie schlafen? Mal wieder zu Mario? Auf keinen Fall. Fra überlegte nicht lange. Das Wasser kam von oben.
Laura kauerte noch immer hinter der Haustür. Ausgerechnet dieses unsägliche Paar hatte das Schleusentor aufgerissen. Erinnerungen an Fabio umzingelten sie, seitdem der Typ seiner schrillen Freundin am Boden galant seine Hand gereicht hatte, und dazu noch dieses gurrende, samtweiche Italienisch zum Abschied, bevor die Haustür zufiel.
Absätze klickerten auf den Treppenstufen, blieben vor der Haustür stehen. Waren die beiden etwa zurückgekommen? Laura erhob sich vorsichtig, schaute durch den Spion – sie war’s! Allein, ohne den Kerl. Die blau-grünen Haare verstrubbelt, den samtroten Mantel mit Leopardenfellkragen eng um sich geschlungen, stand sie vor der Tür. Laura zuckte beim Klang der melodischen Glocke zusammen. Sie wollte wegrennen, doch diese Frau klingelte Sturm. Laura zog die Tür einen Spalt auf und hörte eine bemüht freundliche, aber sehr entschlossene Stimme sagen: »Ich muss bei dir übernachten.« Ein hochhackiger Schuh hatte sich bereits in den Türrahmen geschoben.
Warum sagte diese Frau nichts? Fra hatte sich an der dürren Dalmatiner-Lady vorbei in den Flur gedrängt. War doch eine klare Frage: »Wo ist dein Sofa?« Keine Antwort, nur dieser irre Blick. »Hör mal, du solltest deine Rohre kontrollieren, den Abfluss der Waschmaschine, oder hast du eine Badewanne?« Der Flur bog um eine Ecke, Fra wankte an Zimmertüren und Gemälden vorbei – war ja riesig hier! »Bei mir unten schwimmt nämlich alles.« Wohnte die tatsächlich allein in diesem Palast? »Entschuldige, aber ich muss echt schlafen, sonst sehe ich morgen unmöglich aus, von meiner Stimme gar nicht zu reden. Willst du das? Nein, sicher nicht.«
Fra palaverte und palaverte, das würde die Signora von Dummheiten abhalten, zum Beispiel die Polizei anzurufen. »Habe mittags ein Interview, netter kleiner Journalist, hat mich heute Abend singen gehört, will was schreiben über mich, den Club und so weiter.« Wo war das Wohnzimmer? Fra blieb stehen, drehte sich um und hörte plötzlich eine dünne Stimme: »Was wollen Sie …?«
»Schlafen, Schätzchen«, Fra mühte sich um Geduld und ein Lächeln, »aber mein Schlafzimmer steht unter Wasser, und das Wasser kommt von oben. Hier, bei dir, ist also die Quelle, sozusagen.« Diesen Gedankengang mit der Quelle fand Fra überzeugend und irgendwie auch witzig. »Also bitte, wo ist dein Sofa?« Sie blickte in ein ausdrucksloses Gesicht. »Mach doch mal bitte Licht an.« Fra zeigte ins Dunkel vor sich. Sie konnte sich kaum noch auf den Stöckelschuhen halten, wollte bitte endlich schlafen. Eine Deckenlampe erleuchtete plötzlich den Flur. Du liebe Güte, diese Frau sah wirklich erbärmlich aus. »Du solltest auch besser mal schlafen gehen«, sagte Fra.
Sie standen an der Schwelle zum Wohnzimmer. Bücherwände, gediegene Sessel und – jaaaah! – ein wahrhaftiger Diwan, lang und breit und in einer gewagten Schlangenlinie zog Fra darauf zu, warf Mantel und Schuhe von sich und versank mit einem wohligen Seufzer in den dicken Polstern. Die Dalmatiner-Lady schaute stumm und schockgefroren – wollte Fra tatsächlich bei einer Verrückten schlafen? Die Augen fielen ihr zu, doch dann hörte sie noch ein »Hier …«, sie schaute auf – die Verrückte hielt ihr tatsächlich eine Wolldecke hin.
Eins war sicher: Guendalina tanzte da oben nicht allein. Wer also war der andere, wenn ihr Verlobter doch vermisst war? Niemand in der Nachbarschaft sprach darüber und schon gar nicht meine Mutter.
Also setzte ich mich nachts ans Fenster meiner dunklen Kammer und wartete. Ich überblickte die Gasse und eine Ecke von der Piazza, und wenn ich nur wach bliebe, konnte ich sie nicht verpassen.
Nacht für Nacht verging, ich wartete umsonst. Entweder kamen sie nicht, ich war auf dem Stuhl eingenickt oder schon enttäuscht in mein Bett gekrochen, um dann doch vom Tappen und Klopfen und den Tönen der Musik über meinem Kopf zu erwachen.
Es waren die letzten Schultage vor den langen Sommerferien. Morgens rüttelte mich meine Mutter wach, schon wieder zu spät, dabei sollte ich dankbar sein, dass die Nonnen in der Klosterschule mich unterrichteten, mir sogar ein Mittagessen gäben, also »Los! Los! Los!«, schimpfte sie und scheuchte mich aus dem Haus. Ich stolperte verschlafen über das Pflaster, während die Kirchturmuhr acht silbrige Schläge hören ließ.
Am Morgen nach einer der getanzten Nächte verließ ich unsere Wohnung wie üblich zu spät und noch im Halbschlaf, trotzdem sah ich das rosé schimmernde Seidentuch. Es lag auf dem Treppenabsatz zum zweiten Stock. Ich hob es auf, ließ den kühlen Stoff über meine Finger gleiten. Es musste Guendalina gehören. Ich schlich mich ins Obergeschoss. Blieb reglos vor der herrschaftlichen Wohnungstür stehen. Kein Ton drang nach außen. Stille. Nur mein Herz wummerte, als wollte es aus der Brust springen. Gerade legte ich das Tuch über den Knauf, als sich die Wohnungstür öffnete. Guenda. Wir erschraken alle beide. »Oh!«, kiekste ich, hielt ihr das Tuch hin und stammelte, »auf der Treppe, wollte nur fragen …« Ich versuchte irgendwie zu lächeln.
Sie nahm das Tuch. »Grazie« sagte sie leise und zog die Tür hinter sich zu, bevor ich irgendetwas hinter ihr in der Wohnung hätte entdecken können. Ich drehte mich um und stolperte die Treppe hinunter. Draußen hörte ich nicht einmal mehr die Kirchturmuhr, das würde Ärger geben.
Aber eines Nachts schließlich sah ich ihn. Und sah ihn doch nicht. Im dunklen Hauseingang gegenüber, etwas bewegte sich, in einem Streifen Licht der Straßenlaterne baumelte ein Fuß neben dem Treppenabsatz. Lautlos und unsichtbar war er gekommen und drückte sich in den Schatten.
Ich hörte eilige Schritte, Absätze klackerten auf dem Pflaster, ein Sommerkleid wehte durch die Nacht, gewellte braune Haare hüpften auf den Schultern – Guenda blieb unter der Straßenlaterne stehen, schaute. Ein leiser Pfiff aus dem Hauseingang, dann trat er heraus, ein amerikanischer Soldat.
Sie umarmten sich einen ungeduldigen Atemzug lang, Guenda fingerte nach dem Schlüssel in ihrer Handtasche, sie verschwanden im Palazzo. Kurz darauf hörte ich oben Musik.
Sie hatte tatsächlich eine Affäre. Mit einem amerikanischen Soldaten. Nein, mit einem schwarzen amerikanischen Soldaten – unfassbar. Meine Fantasie ließ mich schwindeln. Nein, nein, ich traute mich nicht, mir mehr vorzustellen.
2
Sie war immer noch da. Laura hörte ihre leise schnorchelnden Atemzüge, der Berg unter der karierten Wolldecke hob und senkte sich, die grün-blauen Haare glänzten auf dem dunkelroten Samtkissen. Laura trat zögernd näher, betrachtete den nackten Arm auf der Decke und las das Tattoo wie eine Postkarte, die nicht an sie adressiert war. Um eine knapp bekleidete Tänzerin rankte sich die Schrift und schlängelte sich hinunter auf den Handrücken: »Wild women don’t have the Blues«.
Wer um Himmels willen war diese Frau, die wie eine Dampfwalze in ihre Wohnung eingedrungen war? Wie alt mochte sie sein? Ende dreißig, Anfang vierzig? Egal, sie sollte verschwinden. Einfach weg sein.
Laura wollte sie wachrütteln, aber ihre Hände weigerten sich, hingen schlaff an ihren Armen. Wäre diese Trulla wach, müsste Laura reden, erklären oder würde wieder in dem Sturzbach ihres Gequatsches ertrinken. Zitternd drehte Laura sich weg, ging zurück in ihr Schlafzimmer und schloss die Tür hinter sich.
Was sollte sie tun? Sie begann hin- und herzulaufen, zwischen Bett und Tür, hin und her, Tür und Bett – wehrte sich gegen die innere Erstarrung, die sich in ihr festkrallte, hin und her. Sie öffnete das Fenster und die Lamellen zur Gasse. Sonnenlicht stach ihr in die Augen. Auf der Dachterrasse gegenüber hängte Signora Luisa Bettlaken auf. Sie war es gewesen, die Laura damals schreien gehört, Fabio auf der Terrasse gesehen und die Ambulanz gerufen hatte. Laura schloss das Fenster wieder, bloß keine Fragen beantworten.
Laura ließ sich auf das Bett fallen, schaute an die Decke, die Stuckrosette, den gläsernen Leuchter, die Spinnweben zwischen den Birnen. Sie könnte einen Spaziergang machen. Weggehen, wiederkommen, Erscheinung verschwunden, alles gut. Auch ihre Ärztin hatte neulich Bewegung empfohlen, frische Luft, Licht – das würde ihr guttun. Vielleicht könnte ein kleiner Hund sie aufmuntern? Spaziergänge hätten noch niemandem geschadet, ob mit oder ohne Hund, und könnten nebenbei auch manche Tablette ersetzen. Laura hatte nicht reagiert. Die Gute-Laune-Pillen nahm sie sowieso nicht. Von den Rezepten löste sie nur die Schlaftabletten ein.
Laura sammelte Hose, Pullover, Socken vom Boden ein. Verließ das Schlafzimmer durch die zweite Tür, die sich auf den Flur neben der Haustür öffnete. Griff Wintermantel, Tasche, Strickmütze, Schal und flüchtete aus der Wohnung.
Leichtes Brummen im Kopf – Fra öffnete vorsichtig die Augen. Fremdes Sofa in fremder Wohnung – wo verdammt war sie schon wieder gelandet? Hohe Decke, Bücher, überall Bücher an den Wänden, auf kleinen Tischen. Ein Kamin, behäbige Sessel, schwere Vorhänge, durch die sich ein Sonnenstrahl zwängte. Gediegenes Ambiente, das Sofa war bequem, die Wolldecke kratzte. Sie befühlte den Zustand ihrer Bekleidung – Bluse, Bleistiftrock, Netzstrümpfe, Wäsche –, alles verrutscht, aber vollständig. Sie war angezogen, dann konnte es so schlimm nicht gewesen sein. Fra schloss noch einmal die Augen. Aus dem Nebel tauchten die Bilder der Nacht auf, sie sortierte die Teile, und als sie das Puzzle zusammengesetzt hatte, war klar: Fra hatte ein Problem.
Sie langte nach ihrem Mantel auf dem Teppich, dem Telefon in der Tasche. Mario anrufen. Mario würde helfen. Trotz allem. Mario antwortete nicht. Welcher Tag? Wie viel Uhr? Montag, kurz nach elf, sagte das Handy. Okay, keine Chance, er saß an seinem Postschalter. Fra hinterließ ihm eine Sprachnachricht. Ihre Stimme klang erbärmlich. Aber Mario würde sich melden, sobald er am Nachmittag das Postamt abschloss. Sicher würde er das tun. Seine Hoffnung war unsterblich.
Trotz der ungezählten Nächte, die Fra auf Marios Sofa – und nicht in seinem Bett – geschlafen hatte. Trotz der ungezählten allerletzten Nächte. Mario blieb der ewig beste Freund aus Schultagen. Ein Sanitäter mit dem untrüglichen Gespür, auch ohne Notruf im richtigen Moment in Fras Leben zu landen. Nach Jahren ohne Kontakt war er wie aus dem Himmel in die Schlange an der Supermarktkasse gefallen – Ciao, bella, so eine Überraschung! Wie geht’s? Damals ging es gerade gar nicht gut, aber Mario tanzte neuerdings Swing. Er war zwar kein Tiger auf der Tanzfläche, aber munterte das Leben seiner Schulfreundin auf. Damals war ihre Haut noch fast frei von Tattoos gewesen, ihre Haare lang und braun. Allerdings, an ihrem Knöchel leuchtete schon der kleine blaue Schmetterling. Der hätte Mario eine Warnung sein können, für das, was noch kommen sollte.
Sie versuchten eine Liebesbeziehung, aber Fra brach dieses Experiment nach zwei Monaten ab, verschwand eine Weile, kam zurück und pflegte fortan ihre Dankbarkeit für Marios Liebe und Güte und seine unendliche Geduld, ihr zuzuhören, ausschließlich auf seinem Sofa und nicht mehr in seinem Bett.
Mario hatte das ertragen und noch viel mehr. Ihre Verwandlung von der freundlichen, gut erzogenen jungen Frau in ein Gesamtkunstwerk. Die bunten Haare, die aufreizenden Klamotten, das laute Make-up und all die Tattoos – Rosen, verbogene Gitarristen und Ballerinen, geschwungene Schriften und düstere Symbole, die nach und nach ihren Körper bevölkerten. Bei jeder Rückkehr auf Marios Sofa war ein weiteres Stückchen ihrer blassen Haut verschwunden. Hin und wieder schüttelte er den Kopf und seufzte wie Eltern, die den pubertierenden Kindern hinterherschauen und wissen, dass sie nur noch das Schlimmste verhindern können, vielleicht.
Er war der perfekte Postangestellte. Der jahrelange Dienst am Schalter hatte ihn gelehrt, stoisch eins nach dem anderen zu erledigen und zeternde, ungeduldige oder gar unverschämte Kunden kühl wie ein Pokerspieler hinzunehmen. Sogar Fras Liebhaber.
Er hatte die anderen Männer nie gesehen, aber Fra wusste, dass Mario sie roch. Ein einziges Mal hatte er mit zusammengebissenen Zähnen »Du stinkst« gezischt, als sie am frühen Morgen in seiner kleinen Wohnung aufgekreuzt war. Er hatte gezittert und plötzlich mit erstaunlicher Wucht ein Loch in die Wohnzimmertür getreten. Es war Marios einziger Ausfall gewesen. Kurz darauf hatte Fra das kleine Pin-up-Girl unter ihr Schlüsselbein gesetzt, das sie seitdem morgens im Spiegel anblinzelte. Es war das Ende der braven Buchhalterin.
Fra mietete eine Mansarde. Sechster Stock ohne Aufzug, ein Zimmer mit Kochnische, schräger Decke und klappriger Dachluke. Sie wollte die Reste ihres biederen Lebens loswerden, inklusive Mario, damals, nach dem Loch in der Tür. Doch im Sommer war die Mansarde ein Backofen, im Winter zischelte der Wind feuchtkalt durch die Luke. Also schlich sich Fra in schlimmen Nächten wie eine streunende Katze wieder auf Marios Sofa. Mario hoffte weiter, dass Fra doch noch zur Besinnung kommen und eines Nachts unter sein Laken rutschen würde.
Wenn Fra sich in lichten Momenten selbst betrachtete, gestand sie sich ein, dass die schwindelerregenden Schlenker aus ihrem bürgerlichen in ein bluesiges Künstlerleben auch für abgebrühtere Typen kaum verständlich gewesen wären. Hätte, könnte, sollte, wollte – auch an diesem Morgen blieb Fra sich selbst treu, rief weder Klempner noch Vermieter an, sondern Mario. Wirklich schade, dass sie in Mario nicht verknallt war. Sie brauchte ihn, aber sie begehrte ihn nicht. So banal. Fra war Mario für all seine Einsätze dankbar, aber mit Mario war es wie mit dem Swing: Der guten Laune des Tanzes fehlte die Leidenschaft.
Die Rettung erschien ihr auf dem Heimweg in einer schmuddeligen Winternacht. Sie schlenderte über die versteckte kleine Piazza in Trastevere, die sich anfühlte wie ein offenes Wohnzimmer. Einige Bäume hatten überlebt, in ihrem Schatten saßen tagsüber alte Männer auf klapprigen Stühlen der Bar und spielten Karten, Mütter schaukelten Kinderwagen. In den Palazzi drum herum gab es ein paar alteingesessene Läden, die Bar Sport, eine Pizzeria. Die wenigen Touristen, die sich auf die Piazza verirrten, bemühten sich, möglichst nicht aufzufallen, oder verschwanden aus dem öffentlichen Wohnzimmer wieder in die üblichen pittoresken Gassen.
In dieser Nacht fiel der Lichtkegel einer Straßenlampe auf einen Zettel, der an eine von Efeu umrankte Haustür gepinnt war: »Zweizimmerwohnung zu vermieten«. Fra betrachtete den ehrwürdigen Palazzo. Die Loggia im Obergeschoss, das breite Eingangstor – das war keiner der einfachen Palazzi gewesen, in denen Arbeiter gewohnt hatten. Trotzdem fasste sie einen Entschluss, riss den Zettel ab und steckte ihn in die Tasche.
Am Morgen rief sie die Telefonnummer auf dem Zettel an. Immobilien-Agent, Fra ignorierte die schnöselige Stimme und präsentierte sich so seriös wie in alten Tagen: alleinstehend, Buchhalterin, keine Kinder, keinen Hund, sie suche eine Wohnung in der Nähe ihrer Arbeitsstelle – wobei sie die Arbeitsstelle nicht näher präzisierte – und fragte vorsichtshalber nicht nach der Höhe der Miete. Die würde sie vermutlich in ein finanzielles Desaster katapultieren. Sie bekam einen Besichtigungstermin.
Der Agent musterte Signora Francesca. Die Haare waren damals noch pink, aber sie hatte einen Hut aufgesetzt und den weiten Wintermantel mit dem breiten Kragen angezogen, um das Wildeste zu kaschieren. Zwei Zimmer und eine bessere Abstellkammer mit Fenster, kleine Küche, Bad mit Duschkabine, freundlich, aber verwohnt. Die Miete? Unerschwinglich. Fra hätte sofort gehen müssen.
Aber die Wohnung war trocken, größer als die feuchtkalte Mansarde, und sie lag an dieser hübschen Piazza. Sofort gehen, warnte die Buchhalterin in ihr. Nur noch einen Blick vom Balkon, widersprach Fra und trat hinaus, schaute in den begrünten Innenhof und hinauf zur oberen Wohnung. Geschlossene, aber frisch gestrichene Fensterläden reihten sich um den Innenhof. Fra hob den Arm, zeigte hinauf und fragte: »Wird diese Wohnung hier unten noch renoviert wie die dort oben?«
Der Agent stand hinter ihr, antwortete nicht. Sie spürte seinen Blick und ahnte schon, was los war. Ihr weiter Mantelärmel war hochgerutscht, hatte ihr neuestes Tattoo freigelegt: die frech grinsende Frau mit wüsten Haaren und der lang gezogenen Sprechblase, »Wild women don’t have the Blues«, die auf ihrem Handrücken endete. Fra senkte den Arm, das Tattoo verschwand im Ärmel, und sah in das spitze Agenten-Gesicht: »Renovierungsarbeiten sind nicht geplant, aber ich habe weitere Bewerber, also …«
»Zeigen Sie doch mal …« Eine schmächtige Signora mit schlohweißen, zerzausten Haaren tauchte hinter dem Rücken des Agenten auf. Hatte der Wind sie hereingeweht?
»Oh, Signora Mattarella, buon giorno!« Der Agent deutete eine Verneigung an, wandte sich Francesca zu, »die Besitzerin dieser Wohnung.« Er nahm die runzlige Hand der alten Dame. »Ich wusste nicht, dass Sie hier sind.«
»Die Gewohnheit, mein Lieber, die Gewohnheit. Mein Sohn hat mich zwar in diese sogenannte Seniorenresidenz verfrachtet, aber ich pflege weiterhin meine Zeitung bei Virgilio auf der Piazza zu kaufen«, sie hustete mit einem Rasseln und fügte trotzig hinzu, »und auch meine Zigarillos. Außerdem kann man in meinem Alter sowieso nicht mehr schlafen. Ich bemühe mich, jede Minute, die mir auf diesem abgenutzten Planeten noch bleibt, angemessen zu nutzen.«
Sie fasste Fra an der Hand und schob deren Mantelärmel wieder hoch: »Zeigen Sie doch mal …« Signora Mattarella zog den Arm dicht vor ihre dicken Brillengläser und entzifferte leise die geschwungene Schrift. Um ihre faltigen, rot gemalten Lippen schmolz ein Lächeln.
»Sie mögen Blues, ja?«
Fra nickte erstaunt.
»Habe ich Sie nicht schon mal gesehen …?« Die alte Dame betrachtete sie mit einem schelmischen Lächeln. Fra zuckte mit den Schultern, der Agent hüstelte. »Signora Mattarella, seien Sie unbesorgt, Ihr Herr Sohn und ich werden solide Mieter finden.«
»Mein Herr Sohn, mein Herr Sohn …«, grummelte Signora Mattarella unwirsch und wandte sich Fra zu, »wollen Sie hier einziehen?«
»Wollen schon, allerdings, die Miete …«
»Gehen Sie 100 oder 200 Euro runter«, raunzte die Signora den Makler an.
»Ich weiß nicht, ob das im Sinn Ihres Sohnes …« Die Signora wischte nur mit der Hand durch die Luft.
Die Miete wäre nun nicht mehr astronomisch, nur noch unbezahlbar. ›Sofort zurück in die Mansarde‹, befahl die innere Buchhalterin. Aber die hatte in Fras Leben nichts mehr zu melden. Eins der beiden Zimmer könnte sie an Touristen vermieten, überlegte Fra, gab ja genug Rom-Besucher, die in Trastevere das echte italienische Lebensgefühl witterten und die letzte Abstellkammer noch pittoresk fanden. Ein paar Eimer Farbe konnte sie sich noch leisten und – ›Geh!‹, befahl die innere Stimme.
»Machen Sie einen Vertrag mit der Künstlerin«, sagte die alte Dame, »ich erkläre das meinem Sohn, diesem Geizkragen. Solange ich auf dieser Erde herumkrabbele, ist es immer noch meine Wohnung.«
So war Fra in diesen Palazzo gestolpert. Mario hatte die Kaution bezahlt, das abgewetzte Parkett akribisch geschliffen und neu versiegelt, Putz an den Wänden erneuert, bevor Fra sie in Weiß und Gelb getüncht hatte. Mario liebte die Handwerkelei, als Nebenjob nach Feierabend, und erst recht, wenn er Fra damit glücklich machen konnte. Sie machte Fotos für das Internetportal, in dem sie ein »Zimmer im Rom deiner Träume« annoncierte, zumindest fotografierte sie Küche, Bad und ihr eigenes, shabby chic eingerichtetes Schlafzimmer. Ein zweites Bett für das andere kleine Zimmer würde sich finden, und notfalls, natürlich nur im absoluten Notfall, gab es ja immer noch Marios Sofa.
Fra räkelte sich auf dem Diwan der Dalmatiner-Lady, eine deutlich andere Preisklasse als Marios Gestell, wuchtete sich aus den Tiefen der wolkigen Polster und stand auf ihren Füßen. Zog sich den Rock zurecht. Ließ ihren Blick durch das stumme Wohnzimmer ziehen – behagliche Polstermöbel, kleine Tische, ein Kamin, ein paar bunte Gemälde – alles sehr gediegen. Hier atmete Wohlstand, Familientradition. Und all diese Bücher, unglaublich, wer las das alles? Wie passte dieses Ambiente zu dem schlampigen Pyjama? Wo war die überhaupt?
»Buongiorno!«, krächzte Fra, Madonna, sie hörte sich an wie ein Mülleimer. »Bist du da?« Stille.
Francesca schaute sich um, vier Türen, hohe Fenster an den Stirnseiten: zum Innenhof und gegenüber auf die Piazza. Fra öffnete eine breite Schiebetür und betrat die herrschaftliche Küche, groß genug zum Tanzen, in der Mitte ein Holztisch für eine Großfamilie, entlang halbhoher Wandkacheln rankten sich zarte Blumen, durch die nebligen Fenster der Balkontüren drang die Wintersonne. In der Spüle stapelten sich ein paar Teller und Tassen, auf dem Tisch eine Obstschale mit zwei dunklen Bananen und einem schrumpeligen Apfel.
Fra schlenderte weiter, durch zwei Arbeitszimmer, die miteinander verbunden waren, das hintere mit zwei enormen Schränken und noch mehr Bücherregalen bis unter die hohe Decke. Staub bedeckte die aufgeschlagenen Bücher, die den alten Schreibtisch überschwemmten, eine Espressotasse mit angetrockneten Kaffeeflecken, einige Zettel, einen Füller. Hier hatte jemand schon vor längerer Zeit seine Arbeit unterbrochen. Fra schloss betreten die Tür.
Nichts regte sich. Sie warf einen Blick in ein unordentliches Schlafzimmer, stieg eine schmale Treppe hinauf und fand eine verwilderte Dachterrasse. Zumindest hatte die Dalmatiner-Lady keinen übertriebenen Putz- und Ordnungsfimmel. Wohnte die in dieser riesigen, verstaubten Traumwohnung etwa allein?
Das große Badezimmer hatte Dusche und Badewanne, direkt daneben eine Waschküche mit Waschmaschine und Trockner, und wenn Fra nicht schwer die Orientierung zwischen all den Zimmern verloren hatte, lagen sie direkt über Fras Schlafzimmer. Viel Wasser für ein morsches Rohr. Zumindest hatte es gereicht, ihre frisch renovierte Wohnung hinzurichten, verdammter Mist.
Fra warf sich eine Handvoll Wasser ins Gesicht, wischte die Reste der Wimperntusche unter den Augen weg, blickte in den Spiegel. Diese Wohnung war wundervoll. So viel Platz. So viele Zimmer. Fra war allein. Warum diesen Palast nicht noch ein Stündchen genießen?
3
Laura war die Kälte nicht mehr gewohnt. Sie verkroch sich in ihrem Wintermantel, auch der war ihr in den letzten Monaten zu weit geworden. Schritt für Schritt ging sie auf dem knubbeligen Pflaster aus dunklen, quadratischen Steinchen, sah Stiefel und Hosenbeine, die an ihr vorbeieilten. Es war kurz nach neun Uhr morgens, keine Zeit, zu der Laura normalerweise die Wohnung verließ oder überhaupt aufstand. Zumindest nicht mehr seit ihrem Filmriss.
Sie erreichte die breite Viale Trastevere. Die Straßenbahn summte heran, Laura wartete, bis alle eingestiegen waren, dann schob sie sich als Letzte hinein und blieb nahe der Tür. Die Bahn glitt über den Tiber. Braungrün zog sich der Fluss zwischen den haushohen Betonmauern und teilte sich an der Tiberinsel mit dem Kloster, der Kirche – dem Krankenhaus, Gott, das Krankenhaus! Es war doch so nah an ihrer Wohnung.
Ruhig bleiben. Weiter atmen. Laura hielt sich an der Stange über ihrem Kopf fest. Einfach. Weiter. Atmen. Dann verschluckte eine Häuserschlucht die Straßenbahn und die Aussicht auf den Fluss, die Insel und die Erinnerung.
An der nächsten Haltestelle wurde ein Sitzplatz frei, Laura drückte sich auf den Fensterplatz und ließ sich durch das Zentrum von Rom fahren. Schaufenster, Menschen, die aus den Bars und in ihre Büros und Läden eilten. Laura hatte sich einen unscharfen Blick angewöhnt. Sie ließ das Leben vorbeiziehen, als schaue sie durch eine zu starke Brille, ohne Details oder Gesichter zu fixieren. Wie oft war es ihr passiert, dass sie Fabios graugrüne Augen im Gesicht eines wildfremden Mannes entdeckt hatte? Ein kurzer Stromschlag, das Herz machte einen Satz, Kribbeln am ganzen Körper – dann kamen die Tränen.
Angefangen hatte alles am Abend nach Lauras freundschaftlicher Scheidung von Rolf. Sie saß mit ihrer Freundin Billy in der neu eröffneten Weinbar in Buxtehude, um auf Lauras neues Leben anzustoßen. Billy hatte darauf bestanden. Laura wäre auch, wie jeden zweiten Mittwoch, mit Billy ins Kino gegangen. Beim zweiten Glas Rotwein meinte Billy, Laura könnte wenigstens jetzt, nach der Scheidung, mal ein kleines bisschen unvernünftig sein. Irgendwas tun, das mit Rolf undenkbar gewesen wäre, sich einen kleinen Traum erfüllen. »Irgendwas Verrücktes, das dich auf ewig an diesen Neubeginn erinnert.«
»Aber so neu ist das doch alles nicht«, hatte Laura entgegnet, »wir waren vor der Scheidung gute Freunde und sind auch nach der Scheidung gute Freunde. Ich brauche keinen symbolischen Befreiungsschlag.«
Alles war so vernünftig abgelaufen, wie man es von vernünftigen Menschen erwarten konnte. Zwischen Laura und Rolf hatte sich das Leben vor allem um die beiden Söhne und die Organisation des Alltags gedreht. Als die Jungs zum Studium ausgezogen waren, war ihren Eltern leider der Gesprächsstoff ausgegangen. Den müden Schlussakkord ihrer Ehe hatte erstaunlicherweise Rolf gesetzt, als er eines Abends kleinlaut gestand, ihm wäre da was Dummes passiert, auf der letzten Tagung seiner Abteilung, die neue Kollegin … Laura beschloss kurzerhand, dass aus den ohnehin schon getrennten Schlafzimmern nun auch getrennte Wohnungen werden konnten. Kein Problem. Die verschwitzten Laufhemden und -hosen morgens und die beiden Bierflaschen vom Couchtisch abends konnte gerne die neue Kollegin wegräumen und sich im Sommer an den Wanderurlauben erfreuen, die Lauras Knie ruiniert hatten.
Laura war Deutschlehrerin, lebte für die Schönheit der Literatur, machte seit einiger Zeit Yoga und ging regelmäßig mit einer Freundin ins Theater und mit Billy ins Kino. Alles gut. Ihre Söhne fanden so ein Leben vermutlich voll öde, Leute wie Billy sicher auch, aber Laura hatte genug abenteuerliche Kapriolen und Abgründe mit ihren Eltern und Geschwistern überstanden, die reichten für zwei Leben. Sie pflegte ihre klaren Strukturen wie andere ihre manikürten Fingernägel, und ohne Rolf würde alles noch ein wenig übersichtlicher werden.
»Komm schon, irgendeinen Wunsch wirst du haben«, hatte Billy beharrt, »einen Ring von Tiffany, einen Segelflugschein, einen Besuch bei den Orang-Utans auf Borneo …«, Laura musste lachen, »komm schon, wenigstens eine Reise ins Land deiner Kinderträume.«
Ach, du liebe Güte, bloß nicht zurück ins Land ihrer Kinderträume, Laura winkte ab, aber Billy blieb dran: »Also gut, etwas bescheidener. Italien, warst du schon mal in Italien? Alle lieben Italien – Venedig, Toskana, Rom … klingelt da was?«
Es klingelte. »Rom!«, sagte Laura und musste lächeln. Billy hatte den richtigen Knopf gedrückt. Unangenehm, denn spontan und ungefiltert verband Laura Rom mit Film-Postkarten wie dem Spaghetti futternden »Amerikaner in Rom«, der klatschnassen und wohlgeformten Anita Ekberg im Trevi-Brunnen oder Audrey Hepburn mit wehendem Rock und Gregory Peck auf dem Motorroller am Kolosseum – du liebe Güte! Ganz großer Kitsch, sie hatte diese Filme geliebt! Aber Rolf, dem Wandersmann, hätte sie niemals in seinen kostbaren Urlaubstagen mit einer Städtereise nach Rom kommen können.
»Ich komme mit!«, jubelte Billy. Die Reise zur Scheidung, in die Ewige Stadt, wie passend.
Laura schob die Postkarten ihrer Mädchenträume zur Seite und bereitete sich gewissenhaft vor. Las Reiseführer, tüftelte an Tagesplänen, was wann wo zu besichtigen sei, und so flogen sie bestens präpariert tatsächlich nach Rom.
Dann kam alles anders. Billy legte sich am ersten Tag mit Fieber und Kopfschmerzen ins Hotelbett und bestand darauf, dass Laura alles allein besichtigen solle. Mit festen Schuhen, Wasserflasche und Reiseführern im Rucksack zog sie los, als ginge sie mit Rolf wandern. Bestens ausgerüstet mit ihren Tagesplänen.
Wie lächerlich! Als ob sie es in Schwimmweste mit einem Tsunami aufnehmen könnte. Rom überrollte sie einfach. Alles war riesig, mächtig und beeindruckend. Allein der Anblick des Kolosseums nahm Laura den Atem, die 2000 Jahre alten Mauern der Kampfarena schienen zu vibrieren. Nebenan stapelten sich im Forum Romanum vollkommen selbstverständlich die Jahrtausende übereinander, und Laura hätte allein dort Tage verbringen wollen. Nur dort – und all die anderen Monumente, Museen, Plätze, Kirchen, Paläste, die hinter jeder Ecke lauerten? Dazwischen wuselten überall irrsinnig viele Menschen herum, Autos und Mopeds dröhnten – Rom war ein gigantischer, uralter Ameisenhaufen, in dem Laura ihre Orientierung verlor.
Dann traf sie Fabio.
Laura hatte sich vorgestellt, in der Sixtinischen Kapelle einen Ort der Stille zu finden – ausgerechnet. In einem zähen Besucherstrom schob sie sich durch die unendlichen Säle der Vatikanischen Museen, die noch vor dem Eingang der Kapelle lagen. Mühte sich, zwischen Schultern und Köpfen hindurch Raffaels begnadete »Schule von Athen« zu entziffern, wenigstens dieses eine Gemälde, sie hatte sich zu Hause so gut vorbereitet, aber wo bitte war denn nun Platon, für den angeblich Leonardo da Vinci Modell gestanden hatte? Und welcher Gelehrte auf den Treppenstufen hatte das Gesicht Michelangelos? Laura resignierte, das Gedrängel war unerträglich. Zu Hause könnte sie alles noch einmal nachlesen, sie trottete weiter, nur noch die Ausstellung moderner Kunstwerke, die den letzten Päpsten geschenkt worden waren, dann erreichte sie vollkommen erledigt den Eingang der Sixtinischen Kapelle. Sie hörte die mahnenden Worte einer Touristenführerin, diesem heiligen Ort respektvoll und in aller Stille zu begegnen. Ein letztes »Silenzio!«, dann öffnete sich die Tür zur berühmtesten Kapelle der Welt.
Rauschendes Stimmengewirr schwappte Laura entgegen. Dicht an dicht drückten sich die Besucher unter dem zwanzig Meter hohen Deckengewölbe, fotografierten mit Smartphones und Tablets die wahrhaftig begnadeten Freskenmalereien, an denen Michelangelo bis zum Wahnsinn gearbeitet hatte, und quatschten. »Silenzio!« Die Stimme eines Wärters hallte durch ein Megafon und ließ das internationale Geplapper kurz abschwellen. Laura drängelte sich in die Mitte der Kapelle, verfluchte innerlich diese Horden, warum konnten Menschen im Angesicht dieser Schönheit nicht einfach mal die Klappe halten? Unerträglich. Laura versuchte die Stimmen auszublenden und Details zu erkennen, um sich in diesem heiligen Wimmelbild zurechtzufinden, den göttlichen Finger im Zentrum zu finden, der … ein Russe brabbelte über ihren Kopf hinweg mit seinem Freund, es reichte! »Schhhht!«, zischte Laura. Der Russe verstummte, schaute irritiert, Laura drehte sich weg – und traf diese dunkelbraunen Augen.
Ein schmaler Italiener mit kräftigen, sichelförmigen Augenbrauen, in Anzug und ohne Krawatte, den Trenchcoat über seinem Arm. Nicht quatschend, kein Smartphone in der Hand, hatte er sie beobachtet? Er zwinkerte kurz, wandte sich dann einem älteren Paar zu und zeigte mit der Hand nach oben. Lauras Blick folgte seiner Bewegung – da war sie, die berühmte Postkarte: der göttliche Finger, der sich gerade von Adams Finger löst, nachdem er ihm Leben eingehaucht hat. Die Stimmen verschwanden, Laura begann in den himmlischen Bildern zu lesen.
Es war schon Mittag, als sie die Sixtinische Kapelle verließ. Sie setzte sich im Museumsgarten auf eine Bank und konnte bereits den nächsten Punkt ihres Tagesprogramms sehen: die Kuppel des Petersdoms. Erst mal sitzen. Der Signore, der ihr in der Kapelle zugezwinkert hatte, eilte vorbei, versuchte im Gehen umständlich seinen Trenchcoat anzuziehen. Hinter ihm segelte ein zusammengefalteter Zettel auf den Boden. Laura hob ihn auf.