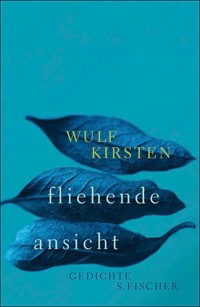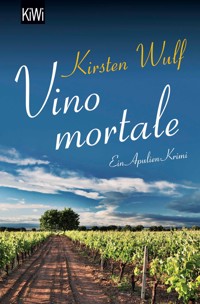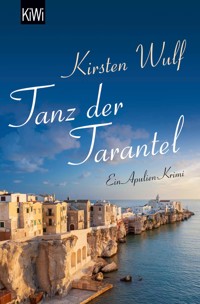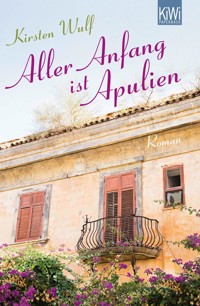
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine einzige Postkarte kann alles verändern Als sie an ihrem Geburtstag durch Zufall erfährt, dass ihr Mann sie betrügt, ist Elena erst mal weg: Sie packt ihre Koffer und ihren kleinen Sohn und fährt nach Süditalien, ins Land ihrer Kindheit. Im apulischen Lecce quartiert sie sich im Palazzo ihres Onkels Gigi ein. Dort lernt sie Michele kennen, einen jungen Maler aus Rom, der ebenfalls neu in der kleinen Stadt ist – und seiner Familiengeschichte auf der Spur. Auf einem nächtlichen Spaziergang machen die beiden eine Entdeckung, die das Leben in der kleinen Stadt auf den Kopf zu stellen droht – und die mehr mit ihnen zu tun hat, als sie ahnen. Eine brisante Affäre, ein lang gehütetes Familiengeheimnis und eine ungewöhnliche Liebesgeschichte – der Roman einer großen Entscheidung unter dem azurblauen Himmel Süditaliens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Kirsten Wulf
Aller Anfang ist Apulien
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Kirsten Wulf
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Kirsten Wulf
Kirsten Wulf, 1963 in Hamburg geboren, arbeitete als Journalistin in Mittel- und Südamerika, Portugal und Israel. Seit 2003 lebt und schreibt sie in Italien.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Als Elena an ihrem Geburtstag durch Zufall erfährt, dass ihr Mann sie betrügt, ist sie erst mal weg: Sie packt ihre Koffer und ihren kleinen Sohn und fährt nach Süditalien, ins Land ihrer Kindheit. Im apulischen Lecce quartiert sie sich im Palazzo ihres Onkels Gigi ein. Dort lernt sie Michele kennen, einen jungen Maler aus Rom, der ebenfalls neu in der kleinen Stadt ist – und seiner Familiengeschichte auf der Spur. Auf einem nächtlichen Spaziergang machen die beiden eine Entdeckung, die das Leben in der kleinen Stadt auf den Kopf zu stellen droht – und die mehr mit ihnen zu tun hat, als sie ahnen.
Eine brisante Affäre, ein lang gehütetes Familiengeheimnis und eine ungewöhnliche Liebesgeschichte – der Roman einer großen Entscheidung unter dem azurblauen Himmel Süditaliens.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2013, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Image Source / Getty Images
ISBN978-3-462-30698-9
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
Epilog
Grazie!
Meinen Eltern Marli & Charlie
1
Michele hatte die Postkarte in Lucias Nachttisch gefunden, vergraben in einer vollgestopften Schublade zwischen bunten Ketten, Muscheln, Bibelversen und einem Fläschchen Lavendelöl, dem beruhigenden Duft für ihre schlaflosen Nächte.
Sie steckte in einem Briefumschlag, zusammen mit einigen Fotos: Wie Michele von Nonno Salvatore vor dem Weihnachtsbaum in die Luft geworfen wird, im blauen Schulkittel und mit Zahnlücke auf einer Schaukel unter Schirmpinien schwingend, als Teenager, lang und dürr, in schlotternden Shorts am Strand, endlich groß genug, seiner Mutter den Arm um die Schultern zu legen, aufgenommen vom Eisverkäufer an einem ihrer kostbaren Montage am Meer. Am Ruhetag der Osteria durfte Michele manchmal die Schule schwänzen, dann flüchteten sie aus Rom und gönnten sich einen Urlaubstag. Nur sie beide.
Seit Tagen rätselte Michele über diese Postkarte. Sie zeigte eine Piazza mit Amphitheater, davor eine Säule, auf der ein Heiliger mit wehendem Umhang und Wanderstab vor wolkenlos blauem Himmel thronte. Auf der Rückseite stand in krakeliger Schrift:
»Teuerste Lucia! Ein Gruß und eine Erinnerung aus Lecce. Ich hoffe, es geht dir und dem kleinen Michele gut. Alles ist wie geplant gelaufen, auch dein Bruder ahnt nichts. Sei beruhigt und bleibe, wo du bist – in Sicherheit! Dies sind der Rat und die Bitte einer Freundin. Ich weiß, dass Salvatore und Daniele dich lieben werden wie ihre eigene Tochter. Ihr werdet es gut bei ihnen haben. Ich umarme dich, M.«
Michele hatte diese Zeilen immer wieder gelesen, ratlos und enttäuscht. Was hatte Lucia mit Lecce in Apulien zu tun? Seit wann hatte sie einen Bruder? Wer war M.? Michele konnte sich nichts zusammenreimen. Warum hatte seine Mutter nichts erzählt?
Alles hatten sie geteilt, es gab keine Lügen, keine Geheimnisse zwischen ihnen – hatte Michele bislang zumindest gedacht. Er wusste alles, von der kleinen Kasse mit Schwarzgeld in der Osteria bis zu Lucias meist unseligen Männergeschichten. Die hübsche Lucia, mit ihrer singenden Stimme und dem überraschenden Lachen, das so klar aus der Mitte des Herzens herauspurzelte, dass sie damit die Männer überrumpelte. Sie hatte mal kurze, mal lange Affären, und Micheles Vater war eine der sehr kurzen gewesen. Ein Tourist aus Amerika, der eines Abends vergnügt in die Osteria hereinspaziert war, Lucia zum Lachen brachte und am nächsten Morgen wieder verschwand. Zum Heiraten hatte es bei keinem ihrer Liebhaber gereicht. Sie liebte ihren Sohn, ihre Osteria, ihre Freiheit – das reichte.
Michele war vermutlich der Einzige, der auch Lucias Schatten kannte. Der von der Angst wusste, die wie eine Krake in manchen Nächten in ihren Schlaf kroch, sie umschlang und würgte, bis sie vom Wummern ihres Herzens hochschreckte. »Ich habe die Geister schon wieder weggepustet«, lächelte sie ihn müde an, wenn er sie im Morgengrauen in ihrem Korbstuhl auf der Dachterrasse fand, mit einem leeren Rotweinglas und nach Lavendel duftend.
Draußen jaulte jetzt ein Polizeiwagen durch die Nacht, rote und blaue Lichter flackerten durch das dunkle Zimmer, in dem seine Mutter vor einigen Wochen zu atmen aufgehört hatte, vom Krebs zerfressen. Sie hatte sich nicht gewehrt gegen die Krankheit, als ob sie vom Leben erschöpft gewesen sei. Mit nicht einmal 50 Jahren.
Ihre Osteria in einer Gasse bei der Piazza Navona hatte Michele verkauft, Lucia hatte darauf bestanden. Ihr Sohn wollte malen, nicht kellnern oder kochen, also bitte kein kitschiges Andenken an Mamma Lucia in der Osteria Fichi d’India.
Er stand zum letzten Mal in dem leer geräumten Schlafzimmer seiner Mutter und schaute auf die abgegriffene Postkarte, damit sie ihm endlich etwas Neues verriet. Abgeschickt in Lecce vor 28 Jahren. Michele schob die Karte in seine Jacke, schulterte die Reisetasche und zog die Tür hinter sich zu.
2
Der Weihnachtsstern über dem Amphitheater strahlte Elena entgegen. Darunter wedelte ein Signor wild mit seinem orangefarbenen Regenschirm, eingemummelt in einen anthrazitfarbenen Wollmantel, dessen Eleganz von einer bunt geringelten Pudelmütze aufgefrischt wurde. Elena erkannte ihn sofort: Gigi! Er hatte auf den Wagen mit dem deutschen Kennzeichen gewartet, der endlich auf die Piazza Sant’Oronzo rollte.
Eben noch hatte eine Sintflut das süditalienische Städtchen zu ertränken versucht, doch pünktlich zum Empfang hatte der Regen eine Atempause eingelegt. Im Auto hibbelte Ben in seinem Kindersitz, fragte zum hundertsten Mal »Mama, sind wir jetzt da?«. Elena lächelte nur, löste endlich seinen Gurt und Ben sprang befreit aus dem Auto.
»Che bel ragazzo!«, rief Gigi, hob Ben hoch, drückte dem verdutzten Jungen Küsse auf die Wangen und setzte ihn wieder ab. Dann sah Gigi seine deutsche Nichte an und umarmte sie überschwänglich, küsste sie links und rechts und nahm ihr müdes Gesicht in seine Hände: »Bella mia, ich habe immer gewusst, dass du eines Tages zurückkommen würdest. Ich habe es gewusst!«
Er küsste sie gleich noch einmal links und rechts und strahlte: »Alle, die im Licht des Salento aufgewachsen sind, kommen irgendwann zurück. Alle.«
Elena lächelte: »Ach Gigi!«
»Für dich immer noch Zio Gigi, tu mir den Gefallen, meine Kleine«, sagte er mit gespieltem Ernst. »Ich bin doch immer noch dein Onkel.«
Gigi setzte sich auf den Beifahrersitz, zog Ben auf seinen Schoß und wechselte von Italienisch zu den holperigen Resten seiner Deutschkenntnisse. »Ich zeigen dir, wo du mit deine Mamma jetzt wohnen.«
»Darf ich denn vorne sitzen?«
»Mit Zio Gigi du dürfen«, bestimmte der Onkel und ignorierte Elenas strengen Blick. »Nur eine kleine Stücke.« Gigi hatte bei Ben gewonnen.
»Vor dem Eingang meines Palazzo ist eine Baustelle«, er plapperte auf italienisch weiter, »wir müssen einen kleinen Umweg fahren.« Der Onkel lotste Elena durch die verwinkelten Gassen, zwischen aneinandergereihten Palazzi mit hohen Portalen, grünen Fensterläden und fußtiefen Balkons. Vor dem Weinladen musste sich eine Traube von Männern an die Hauswände drücken, damit Elena weiterfahren konnte. »Wir werden dir einen Anwohnerpass organisieren«, sagte Gigi, »damit du hier parken darfst. Für Nichtanwohner kostet das 112 Euro – die Polizisten verteilen gnadenlos Strafzettel. Sollten wir also bald …«
»Wo soll ich denn nun halten?«, Elena hatte die Orientierung verloren. Links-rechts-links, der krummen Gasse folgen, an der Kirche rechts und sofort wieder rechts – und nun? Sie war erschöpft von der langen Tour, wollte endlich ankommen.
»Ah, ja. Vor dem Hoftor kannst du parken. Das ist das Lager vom Weinhändler, einem guten Freund, er hat die beste Auswahl unserer Weine hier, das würde man von außen nicht vermuten, was? Habe gerade heute noch einige Flaschen des diesjährigen Novello gekriegt, sehr vielversprechend, ich sage dir …«
»Zio! Wo soll ich parken?«
»Ja, hier natürlich! Hier! Direkt vor dem Tor. Nocco weiß, dass du kommst und wird klingeln, falls er oder sein Sohn morgen früh da reinmuss.«
»Und wo ist dein Haus?«, Elena schaute sich auf der kleinen Piazza um.
»Gleich um die Ecke. Wegen der Baustelle kann man gerade nicht direkt ranfahren.«
Dicke Regentropfen klatschten wieder auf die Windschutzscheibe. Sie stiegen schnell aus, zerrten zwei Koffer und eine Tasche aus dem Kofferraum. Gigi war nur schwer davon zu überzeugen, dass auch Elena in der Lage war, einen Koffer hinter sich herzuziehen – »No, no, lass nur, du bist müde.«
»Aber Zio, ich bitte dich, also wirklich …«
»Ah, queste donne tedesche …« Elena überließ seiner Männlichkeit also einen Koffer und die Tasche, Ben setzte den Schildkrötenrucksack mit seinen zehn schnellsten Spielzeugautos und drei stärksten Rittern auf den Rücken und durfte Gigis Regenschirm aufspannen. Dann zogen sie im Gänsemarsch los, balancierten um Pfützen herum, tauchten von der Piazza in einen kaum beleuchteten Gang ein, gerade breit genug für eine Vespa. Noch eine kleine Piazza und noch ein etwas breiterer Gang. Im schwachen Licht tauchten die Schemen von zwei, drei Männern auf, die betont zufällig vor verschlossenen Haustüren herumstanden und gelangweilt ihre Fäuste in die Taschen bohrten. Die obere Hälfte einer geteilten Tür war geöffnet, schummriges Licht drang durch die rosafarbene Gardine. Durch einen Spalt sah Elena kurz eine üppige Blondine im Bademantel, die auf einer Bettkante hockte und gelangweilt in einen Fernseher starrte. Doch diese Szenerie drang nicht wirklich in Elenas Bewusstsein, sie war viel zu sehr mit ihrem Koffer und Ben beschäftigt, der den gigantischen Regenschirm bedrohlich locker hin und her schwenkte, aber – »NEIN NEIN NEIN!« – den Schirm nicht hergeben wollte.
Endlich trafen sie auf eine aufgerissene schmale Straße mit einem tiefen, langen Loch.
»Stellt euch das mal vor«, rief Gigi triumphierend durch den Regen, »Archäologen haben eine römische Straße gefunden! Direkt vor meinem Palazzo!« Der Onkel balancierte stolz auf Brettern, die eine Brücke auf die andere Seite der Straße bildeten. Elena zerrte ihren Rollkoffer in der einen Hand, hielt mit der anderen den Regenschirm über Ben fest, versuchte, den Regen zu ignorieren, der ihr in den Mantelkragen lief und die Schuhe durchweichte. Der Rollkoffer hakte an einem Brett und drohte in die Ausgrabungsstätte zu kegeln. Herr im Himmel, schenk dieser verdammten historisch wertvollen Straße einen glatt und akkurat gepflasterten Bürgersteig!
Sie hörte Gigi mit einem Schlüsselbund klimpern. Endlich. Er stand vor einem breiten Hoftor, vermutlich einst für hochrädrige Kutschen konstruiert und heute der Eingang zu Gigis barockem Palazzo. Feierlich drückte er das Tor zu einem weiten Innenhof auf, in dem sich Zementsäcke, Sand- und Steinhaufen türmten – das sah nach Bauhof, nicht nach bezugsfertiger Wohnung aus. »Sollten wir hier nicht eigentlich einziehen?«, knirschte Elena.
»Natürlich! Dort oben«, Gigi zeigte in den ersten Stock, wo ein Gang mit Arkaden den Innenhof säumte. »Mach dir keine Sorgen wegen des Krams hier unten, das sind nur noch Kleinigkeiten.«
3
Der Onkel war hocherfreut gewesen, als Elena ihn überraschend angerufen und um Asyl in Lecce gebeten hatte. Ein Jahr, vielleicht länger.
Es war ihr 40. Geburtstag gewesen. Sie hatte gerade die SMS auf Arons Handy gelesen, aber der Tag war schon vorher verkorkst gewesen.
Wenigstens eine Rose, also bitte, war das zu viel verlangt zum Geburtstag? Stattdessen lag auf dem Frühstückstisch ein Päckchen in knitterigem hellblauen Geschenkpapier. In dieses Hellblau hatte sie den Bilderrahmen mit dem Foto von ihr und Ben eingepackt, den sie Aron zum letzten Geburtstag geschenkt hatte. Er hatte das Papier aufbewahrt, klar, das war echt praktisch und sparsam und ökologisch korrekt sowieso. Aber ließ es das Herz hüpfen?
Eine Wolke Rasierwasser mischte sich mit dem Kaffeeduft in der Küche. »Happy Birthday!«, Aron umarmte sie kurz und küsste sie flüchtig in den Nacken. Die Kaffeemaschine brodelte, er nahm zwei Becher aus dem Regal und fragte, ohne sich umzudrehen: »Du auch?« Sie nickte.
Ben kam in die Küche gerannt, kletterte auf seinen Stuhl und guckte suchend auf den Tisch. »Und mein Erdbeer-Crunchy?« Aron goss Kaffee ein, als ob er nichts gehört hätte, warf einen Blick auf seine Uhr. »Ich muss gleich los, Meeting um neun.«
Elena seufzte, holte die Müslipackung aus dem Schrank [15]und füllte die Schüssel für den Fünfjährigen. Milch dazu, dann schnitt sie noch einen Apfel klein und schob die Schnitze in die Schüssel. Ben aß einige Löffel, sortierte dabei die Apfelschnitze aus und begann vom Stuhl herunterzurutschen. »Darf ich aufstehen?«, fragte er und war schon verschwunden, bevor Elena »Moment mal!« gesagt hatte.
Ein normaler Morgen. Ach was, viel schlimmer. Beim Blick in den Badezimmerspiegel hatte sie sich an diese blendend aussehende Schauspielerin erinnert, die mit einer überwältigenden Oberweite verführerische Muttertiere in Familienserien spielte und neulich in einer dieser schwatzhaften Gute-Laune-Talkshows strahlend in die Runde geworfen hatte: »Ab 40 sind wir Frauen ja nun selbst für unser Gesicht verantwortlich.« Wie viel dummes Zeug darf man eigentlich öffentlich verkünden, hatte Elena gedacht und sich darüber geärgert, dass der Satz überhaupt hängen geblieben war und nun in ihrem Kopf herumturnte, während sie die neue Antifaltencreme, »hochwirksam gegen freie Radikale«, in ihr Geburtstagsgesicht einmassierte. Seit Kurzem benutzte sie sogar Zahnseide – der Vierzigste hatte seine kleinen und großen Schatten vorausgeworfen.
»Ich muss wirklich gleich los«, drängelte Aron und schob ihr das hellblaue Paket zu.
Sollte sie die Klebestreifen vorsichtig abziehen, sodass sie an Weihnachten Arons Geschenk auch wieder hellblau einpacken könnte? Er würde das Papier wahrscheinlich nur wieder glatt streichen und sie hätte zum 41. Geburtstag erneut die Freude in Hellblau. Also riss sie das Papier einfach auf, wie Ben es getan hätte.
Ein Badeöl mit Essenzen aus Bergkräutern, beruhigend und kräftigend. Dazu ein Gutschein: eine Woche Beautyfarm im Allgäu. Der Prospekt zeigte eine schnuckelige Landschaft voll gesunder Kühe auf saftigen Wiesen vor blauen Bergen. Sehr geschmackvoll zum 40. Geburtstag. Elena starrte hilflos auf den Gutschein. Eine Einladung ins normale Leben normal gestresster Mütter, die die Verantwortung für ihre Gesichter wieder übernehmen wollten.
War’s das jetzt mit dem Abenteuer Leben? Mehr fiel Elena dazu nicht ein.
Ihr Alltag mit Mann und Kind ratterte perfekt organisiert dahin. Mit Aron, dem jungen, neugierigen Archäologen, war sie einst querfeldein über die vertrockneten Hügel einer winzigen, griechischen Insel gestolpert. Ohne Landkarte, einfach los, dem Trampelpfad und der Sonne hinterher bis ans andere Ende der Insel, der Welt, oder wohin auch immer. Stundenlang kein Haus und keine Menschenseele in Sicht, nur ein paar Ziegen und struppige Wiesen. Aber zusammen würden sie schon irgendwo ankommen. Erst kurz vor Sonnenuntergang breitete sich das Meer vor ihnen aus, der Himmel leuchtete fliederfarben – wunderschön, aber wo bitte war das nächste Dorf? Sie traten an den Rand der Steilküste: Unter ihnen bog sich eine schmale Sandbucht und am Ende blinkten Lichter, eine Holzbude mit einigen langen Tischen und Bänken, es duftete nach gegrilltem Fisch. Später rollten sie ihre Schlafsäcke unter den Sternen aus, leise schwappte das Meer an den Strand, am nächsten Tag würde ein Fischerboot sie zurückbringen – was konnte ihnen schon passieren?
Heute war aus Aron ein Doktor der Archäologie geworden, Dozent an der Uni mit der Aussicht, Professor zu werden. Ein viel beschäftigter, aber – vermutlich – zufriedener Mann, der abends im Bett bestenfalls seinen Laptop aufklappte und sich am Wochenende über den selbst gebauten Carport vor ihrer Doppelhaushälfte freuen konnte wie Ben über eine Ritterburg.
Und sie, Elena? Die Fotoreporterin, die früher aus Afghanistan in den brasilianischen Regenwald und zurück nach Jerusalem gedüst war? Heute saß sie in der Bildredaktion der Reisezeitschrift »Weltweit« und wählte Fotos der Reportagen aus. Halbtags, versteht sich. Ansonsten war sie vor allem Mama.
»Na?«, Aron lächelte erwartungsvoll.
»Mal ehrlich – was bitte soll ich da?« Elena zeigte auf die Kuhwiesen.
»Entspannen, es dir gut gehen lassen, dich pflegen … was ihr Frauen eben so tut.«
»Da spricht ein wahrer Experte. Soll ich mit 40 also endlich auch mal tun, was Frauen so tun? Fett absaugen, Mundwinkel gerade ziehen lassen …«
»So war das nicht gemeint …«
»Wie ist es denn gemeint?«
Aron stöhnte, rückte seinen Stuhl zurück und guckte schon wieder auf die Uhr. »Marlene war da schon mal, hat ihr gutgetan. Hat sie gesagt. Und meinte, du würdest dich bestimmt auch freuen.«
»Seit wann interessiert sich deine Sekretärin für mich?«
Aron legte vorsichtig seine Hand auf ihre Schulter. »Tut mir leid, ich muss wirklich los. Lass uns heute Abend reden.«
Er nahm seine Tasche mit dem Laptop, ging zur Garderobe, sagte beiläufig: »Wann wollten wir eigentlich nach Dänemark? Ich habe im Juni eine Konferenz in Kairo.«
Ach ja, Dänemark. Das Thema kam Elena grade recht. Sommer. Dänemark. Ferienhaus. Der natürliche Lauf der Dinge. Weihnachten, Ostern, Dänemark. Lief wie eine Waschmaschine. Waschen, spülen, schleudern. Immer der gleiche Rhythmus. Waschen, spülen, schleudern. Mal fehlte eine Socke, mal gab es Kochwäsche für hartnäckige Flecken. Waschen, spülen, schleudern, und immer wartete schon der nächste volle Wäschekorb.
Aber Dänemark war pflegeleicht, Sommerurlaub im Haus hinter den Dünen. Seit Jahren die gleiche Nummer, weil es so nett wie praktisch war: nah am Meer, nah am nächsten Supermarkt, nah an anderen Familien mit kleinen Kindern und nah an Hamburg. Aron konnte immer mal einen schnellen Abstecher in die Uni machen. Wollte er Professor werden, musste er präsent sein, Initiative zeigen, Projekte organisieren und begleiten, Artikel in angesehenen Fachzeitschriften veröffentlichen. Dänemark schien der perfekte Ausgleich der Interessen. Sehr schön. Und ein bisschen langweilig. Jedes Jahr ein bisschen mehr.
Elena sagte leise und beherrscht: »Entschuldige, aber du reist ständig wichtig wichtig durch die Welt und dir fällt für mich nichts Besseres als Beautyfarm bei dicken Kühen und dänisches Ferienhaus ein? Für wen hältst du mich eigentlich?«
»Ich muss los«, seufzte Aron und warf sich eilig seinen Mantel über, klemmte sich seine Tasche unter den Arm und hastete zur Haustür: »Für deine Sinnkrise hab ich jetzt wirklich keine Zeit …«
Der Knall der Haustür hallte in ihren Ohren. Dieser Feigling. Sie kochte, war auch wütend auf sich selbst: eine zickige frustrierte Hausfrau mit Halbtagsjob und erfolgreichem, leider langweiligem Mann. Fühlte sich so das Leben zwanzig Jahre vor der Rente an? Ein Mann, ein Kind, halber Job und halbes Haus – reichte das für ein ganzes Leben?
Hatte eigentlich alles mit Benjamin angefangen? Der gewollten, aber dann ungeplanten Schwangerschaft, die viel zu früh mit einem Notfall endete, und zwei Händen voll Kind, das wochenlang zwischen Leben und Tod schwebte?
Undenkbar, den Zwerg nach seinem ersten Geburtstag wie geplant in eine Kinderkrippe zu bringen. Elena kümmerte sich um Ben und um nichts anderes. Keine Tagesmutter, keine Krabbelgruppe, nur Oma Gloria, der nonna, vertraute sie Benny manchmal an. Staunend entdeckte Elena Qualitäten einer Glucke an sich – sollten die italienischen Gene ihrer Mutter durchschlagen? Derweil machte Aron Karriere. Von seiner Elternzeit war plötzlich, als das Kind nicht mehr nur eine Idee war, sondern mit vollen Windeln und eigenwilligen Schlafrhythmen ihre Welt auf den Kopf stellte, nicht mehr die Rede. So einfach. So normal.
Ben überlebte, wurde robuster – und manchmal dachte Elena, dieser Zwerg habe auch ihr eigenes Leben gerettet. Ständig Vollgas als Fotoreporterin – der kleine Ben hatte sie ausgebremst und sich im Zentrum ihres Lebens ausgebreitet. Nach drei Jahren bekam Ben einen Platz im Kindergarten und sie den Halbtagsjob bei »Weltweit« in der Fotoredaktion. Was sich zunächst wie wiedergewonnene Freiheit anfühlte, wurde bald schnöder Alltag.
Mit der Kamera die Welt entdecken, Menschen mit Bildern bewegen, etwas anstoßen, verändern … all diese großen, schönen Gedanken hatten sich scheinbar im Muttersein aufgelöst.
Arons Handy piepte auf dem Esstisch und blinkte blau wie eine Polizeisirene. Das hatte der Gatte in seiner Panik glatt vergessen. Elena schaute auf das Display: Nachricht von Marlene. Sie überlegte nicht, sie drückte auf ›Zeigen‹: »Kann ich unser Zimmer in Sharm el Sheikh bestätigen? Erwarte dich zum Mittagessen. Kuss, M.«
Marlene. Seine Sekretärin. Elena wiederholte leise die Wahrheit, die ihr wie eine Zitrone den Mund zusammenzog. Mit sei-ner Se-kre-tär-in, mit Mar-le-ne! Elena ballerte das Handy gegen die Wand. Das konnte nicht wahr sein, sie schnappte nach Luft, riss die Terrassentür auf, sog die kühle Herbstluft ein. Schloss die Augen. Halber Job, halbes Haus und ach, wie passend, ein – bestenfalls – halber Gatte. Irgendetwas war hier gründlich schiefgelaufen.
Höchste Zeit, sich auf die vollständigen Dinge im Leben zu besinnen. Elena griff zum Telefon und wählte 0039, Vorwahl Italien.
4
»Buona sera, könnte ich freundlicherweise Signor Rizzo sprechen?« Michele stand mit dem Handy am Ohr vor der hohen Balkontür, lehnte seine Stirn an das kühle Glas und schaute hinunter auf den Corso Emanuele. Gegenüber schimmerten die Lichter aus den Schaufenstern des Schuhladens und der antiken Apotheke durch den Regenschleier, hin und wieder tauchte ein roter oder blauer Regenschirm unter Micheles schmalem Balkon auf.
Die Pension Borgo Antico war eine herrschaftliche Wohnung, riesig und unübersichtlich, im zweiten Stock eines der ehrwürdigen Palazzi, die die Lecceser Flaniermeile zwischen Dom und Piazza Sant’Oronzo säumten. Michele fröstelte. Der kleine Heizkörper hatte in diesem hohen Raum keine Chance gegen die feuchte Kälte. Regentropfen sprenkelten das dünne Glas und liefen in Fäden hinunter.
Mit nichts anderem als einem Allerweltsnamen war Michele nach Lecce gekommen. Genauer: seinem Allerweltsnamen. Rizzo, so hießen er und Lucia, so müsste also auch Lucias Bruder heißen – sein Onkel, ja verflucht, das war sein Onkel! Sofern der überhaupt noch lebte, in Lecce wohnte und seine Telefonnummer im Telefonbuch hatte eintragen lassen. Dort hatte Michele rund 200 Einträge unter dem Namen Rizzo gefunden, in Lecce und den umliegenden Dörfern.
Die Pause am Telefon dauerte eine kleine Ewigkeit, im Hintergrund hörte Michele ein Kind und einen Fernseher plärren, ein Mann rief: »Wer ist am Telefon?«
»Keine Ahnung, will dich sprechen, wegen Lucia!«
»Lucia?«, Michele hörte dumpfe Schritte, dann eine gereizte Stimme. »Pronto?«
»Signor Rizzo?«
»Am Apparat. Sprechen Sie.«
»Ich suche den Bruder einer Lucia Rizzo, sie ist vor vielen Jahren …« Michele wurde schroff unterbrochen.
»Lucia soll dieser Kanaille einen Arschritt verpassen und nach Hause kommen. Mehr habe ich ihr nicht zu sagen. Sie bringt ihre Eltern noch ins Grab, am Sonntag ist sie nicht einmal zum Essen erschienen.« Signor Rizzo erhöhte seine Lautstärke: »Meine Cousine hat sie gesehen, auf einem Motorrad, ohne Helm, lebensgefährlich …«
»Signor Rizzo!«, versuchte Michele den Wutanfall am anderen Ende der Leitung zu bremsen, »vermutlich meine ich eine andere Lucia …«
»Ja, eine andere Lucia, das war meine Schwester einmal. Wie eine Hure zieht sie jetzt mit diesem Mistkerl durch die Bars! Meint, sie wäre etwas Besonderes, weil der Kerl jemanden beim Fernsehen kennt. Sind Sie das etwa? Ich warne Sie, lassen Sie die Finger …«
Michele beendete das Gespräch kommentarlos per Knopfdruck. Diese Tirade war wenigstens nicht die Standardantwort gewesen: »Lucia? Welche Lucia? Lucia gibt es hier nicht, buona sera.« Eine andere Signora Rizzo hatte vermutet, er rufe aus einem Callcenter an und wolle ihr irgendetwas verkaufen. Noch bevor er sich erklären konnte, brüllte sie: »No! Capito? NO! Wir sind NICHT interessiert! Sagen Sie das auch Ihren Kollegen, wir wollen kein Videotelefon, kein Ferienhaus und keine 25 neuen Sportsender im Fernsehen abonnieren!«
Er ließ sich zu dem Telefonbuch auf das flaumweiche, breite Bett fallen. Eine Madonna, umrankt von Plastikblumen, lächelte von der kalkweißen Wand herab. Die ersten 33 Rizzos hatte er durch, von A. bis Francesco Rizzo. Bei den ersten Anrufen war er noch aufgeregt gewesen, inzwischen spulte er mechanisch seinen Suchtext ab, ohne echte Hoffnung, den Bruder seiner Mutter zu finden.
Falls Michele seinen Onkel leibhaftig auftreiben sollte, könnte der ihm Lucias Geschichte erzählen. Wenn, wenn, wenn … und wenn nicht? Sollte Michele mit einem Schild um den Bauch durch Lecce wandern? »Suche Signor Rizzo, Bruder von Lucia Rizzo – vor vielen Jahren verschwunden! Finderlohn!«
In Micheles Kopf summte es wie in einem Bienenstock. Seine Mutter hatte ihm ihr Leben lang etwas verheimlicht. Ausgerechnet Lucia, die sofort erkannt hatte, wenn sich ihr Sohn mal um die ganze Wahrheit herummogeln wollte und ihm wieder und wieder einbläute: »Sei ehrlich, selbst wenn es wehtut.«
Und sie selbst, die stolze Römerin? Angeblich waren ihre Eltern verunglückt und sie war mit fünfzehn Jahren zu ihren Pateneltern gezogen, dem Arzt Salvatore und der französischen Malerin Danielle, die später für Michele zu Großeltern wurden. In Rom, alles in Rom. Nie ein Wort von Lecce, einem Kaff in Südsüditalien.
Aber hier hatte sie einen Bruder und außerdem eine Freundin, mit der sie ein Geheimnis geteilt hatte. Ein Geheimnis, das ihr nicht erlaubt hatte, zurückzukehren.
Seine Ersatzgroßeltern konnte er nicht mehr fragen: Salvatore war vor einigen Jahren eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Danielle, die Malerin mit Alzheimer, lebte seitdem in einem Pflegeheim in der Provence, wo sie ihr Leben einfach vergaß. Sie erinnerte sich schon lange an keine Namen mehr, aber sie hatte Michele angestrahlt, als er sie vor einigen Monaten in dem blühenden Garten des Heimes besucht hatte. Er setzte sich neben sie auf die Bank, hielt ihre Hände und erzählte von Lucias Tod, während sie ihn weiterhin anlächelte und vergnügt vor sich hinsummte. Wer auch immer Danielle wirklich war, sie war ihm eine wunderbare Großmutter gewesen.
Michele lag reglos auf dem Bett und starrte an die Decke. Die Postkarte war vor fast 30 Jahren geschrieben worden, damals war er ein Baby gewesen.
Diese krakeligen Zeilen ließen ihn nicht in Ruhe. Sie hatten ihn wie in einem Strudel nach Lecce gezogen. »… Alles ist wie geplant gelaufen … auch dein Bruder ahnt nichts. … Ich bitte dich: Bleib, wo du bist – in Sicherheit! …«
Zunächst hatte er den Text nur merkwürdig gefunden, dann beunruhigend. Er rührte an Gewissheiten, wackelte an Fundamenten seines Lebens, am Vertrauen zu seiner Mutter. Beharrlich hatten sich die Zeilen tiefer in seine Gedanken gebohrt. Bis er eines Nachmittags vor den Skizzen für ein neues Kinderbuch saß und spürte, wie er dem Sog nicht länger widerstehen konnte. Er packte Skizzenbücher, Ölkreiden, Buntstifte und Aquarellfarben in eine Tasche, legte etwas Unterwäsche, Hosen und Pullover dazu und machte sich auf den Weg. Er musste diese Postkarte, dieses andere Leben seiner Mutter entziffern. Musste wissen, was in seinem Leben wahr gewesen war, musste seine Erinnerung retten.
Die Karte duftete nach Lavendel.
Michele setzte sich auf, das Bett knarzte, er rieb sich das Gesicht, schaute in die Dunkelheit hinter den Fenstern. Frische Luft würde dieses finstere Chaos in seinem Kopf durchpusten.
Wenigstens regnete es nicht mehr. Die stolzen Palazzi wirkten wie vollgesogene Schwämme im matten Licht der Straßenlampen. Ein kalter Wind fegte über die Piazza Sant’Oronzo. Auf dem feuchten Pflaster spiegelten sich die Lichterketten, die über dem Platz aufgehängt waren und ihn mit goldenem Glanz überzogen.
Der Heilige Oronzo, der die Stadt einst vor der Pest rettete, wachte hoch über der Piazza auf einer Säule. Hinter ihm begrenzte eine hüfthohe Brüstung das 2000 Jahre alte Amphitheater. Nur eine halbe Ellipse der Arena war freigelegt worden, der Rest lag verborgen unter der Kirche Santa Maria delle Grazie und den angrenzenden Bürgerhäusern. Ein gigantischer Weihnachtsstern baumelte über dem Amphitheater und tauchte die ehemalige Arena in festliches Licht.
Michele lehnte sich über die Brüstung und schaute hinunter in die Ausgrabungsstätte. Dort unten, wo einst 20000 Zuschauer auf den rundgesessenen Steinstufen gejubelt, Gladiatoren und wilde Tiere angefeuert hatten, war ein beschauliches Krippenspiel aufgebaut worden. Das Amphitheater war in eine friedliche süditalienische Landschaft verwandelt worden, mit kleinen Gemüsefeldern, Ställen und Bauernhütten zwischen Palmen, Olivenbäumen und Kakteen. Ein Schäfer hütete Ziegen, auf einem künstlichen See saß ein Fischer mit Angel im Ruderboot, Bäuerinnen mit Körben voller Tomaten oder Orangen standen vor den Hütten aus Sandstein, Esel und Rind grasten vor dem Stall mit der noch leeren Jesuskrippe, Josef und Maria. Die Figuren waren aus Pappmaschee, kunstvoll geformt. Die einzigen lebenden Tiere, die im Amphitheater noch auftraten, waren einige wilde Katzen, denen die Nachbarn Essensreste auf Plastiktellern servierten.
Ziemlich speziell, diese Szenerie, fand Michele. Irgendwie rührend. Und kitschig. Gestern hatte er an der Brüstung zwischen dick eingemummelten Kindern und ihren Eltern gestanden, während unten der Bischof im violetten Talar durch die Felder spaziert war. Gewissenhaft Weihrauch schwenkend, um Krippe und Hütten und Tiere zu segnen, bevor feierlich – »Aaahh!« – der Weihnachtsstern zum ersten Mal aufleuchtete.
Michele dachte an Rom – an die pompösen Häuser, die weiten Straßen, die allgegenwärtige Wucht der Geschichte, all die Größe, das Chaos und Getümmel der Weltstadt, in der er groß geworden war – und registrierte erstaunt: Ihm fehlte das alles gar nicht. Er genoss das centro storico von Lecce, in dem kaum Autos fuhren und wo er wie durch eine Opernkulisse zwischen barocken Fassaden aus hellem Sandstein schlenderte. Nur ein Kumpel für eine Pizza und ein Bier, gut, der fehlte ihm. Micheles Magen rumorte, er hatte Hunger.
Er bog in die nächste Gasse ein, folgte dem krummen Verlauf, bis sie sich zu einer kleinen Piazza weitete. In einer Nische hing eine Madonna, flackernd beleuchtet von einer elektrischen Kerze. Daneben schaukelte leise quietschend das Schild einer Osteria im Wind. Michele blieb abrupt stehen: Osteria Fichi d’India, benannt nach den roten Früchten der Kakteen, das war auch der Name von Lucias Osteria in Rom gewesen.
Michele schaute über die weißen Spitzengardinen, die halbhoch die Fenster bedeckten, in einen gemütlichen Raum, der eher einem Wohnzimmer als einer Gaststube glich: ein paar Tische mit rot-weiß karierten Tischdecken, schlicht getöpferten Tellern und Bechern, beige lasiert mit blauen Punkten. Gerahmte Schwarz-Weiß-Fotos und Büschel rot leuchtender Peperoncini hingen an den rohen Wänden aus hellem Stein. Es war erst acht Uhr, noch waren keine Gäste zu sehen. Michele zog zögernd die Eingangstür auf. Ein kleiner runder Herr mit grauem Haarkranz und Schürze um den Bauch trat aus der Küche.
»Buona sera, Signor. Kommen Sie, wir haben schon geöffnet.« Ein Lächeln breitete sich in dem Gesicht aus und Michele stockte. Bekam kein einziges Wort mehr heraus. Dieses Lächeln kannte er, es war ihm so vertraut wie sein eigenes Gesicht im Spiegel. Micheles Knie waren nur noch Gummi, er sackte auf den nächsten Stuhl und fühlte, dass er angekommen war.
5
Alles war gut. Elena räkelte sich mit einem Glas Rotwein in einem Sessel mit dunkelgrünem Samtbezug, im Kamin tanzte ein Feuer. In einer Nische daneben hatte Ben sich auf einem kleinen Sofa in eine Daunendecke gekuschelt und war zufrieden eingeschlafen. Bis einige Kleinigkeiten nebenan in Elenas zukünftiger Wohnung erledigt waren, würden Ben und Elena am Kamin campieren.
Gigi hatte vor Jahren diesen damals halb verfallenen Palazzo im Herzen der Altstadt gekauft und ihn mit maßloser Geduld Stein für Stein restauriert – ein Lebenswerk. Inzwischen war der Palazzo zumindest in einem Zustand, dass Gigi im Sommer hatte einziehen können.
»Ich bitte dich, Elena, wo willst du denn sonst wohnen?«, hatte sich der Onkel am Telefon empört. »Vielleicht nebenan bei meiner Schwester Benedetta im Kloster? Nein, nein, also wirklich, du mietest gar nichts, was hast du nur für Ideen …« Der hintere Teil seiner herrschaftlichen Wohnung habe einen Eingang für Dienstboten und werde ohnehin gerade in ein Gästeappartement umgebaut. Die Renovierungsarbeiten seien sozusagen fast schon beendet. Bis auf einige Kleinigkeiten. Aber »mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich um alles.« Ein Satz, von dem Elena lernen sollte, dass er mit höchster Vorsicht zu genießen war.
Der Lichtschein huschte die weiß getünchten Wände hinauf, darüber wölbte sich die hohe Decke. Küche und Wohnraum waren durch einen hohen Bogen verbunden, ein »open space-eeh«, wie der Onkel englisch italianisierte. In dieser Wohnhalle verloren sich wenige antike Möbelstücke aus Gigis Antiquitätenladen. Ein hohes Bücherregal, das fast eine ganze Wandseite ausfüllte, eine Vitrine mit feinen Gläsern und Likörflaschen und mitten im Raum eine traumhafte Chaiselongue mit dunkelrotem Bezug und Beistelltischchen. Es gab einen großen Esstisch mit geschwungenen Beinen und passenden Stühlen, einen gigantischen Geschirrschrank und – als einzige Modernität – eine große Kücheninsel zum Kochen, die Gigi aus gut abgelagertem Holz hatte anfertigen lassen. Dahinter präsentierte sich das Prunkstück: ein alter Kachelofen. Gigi hatte monatelang nach einigen fehlenden Kacheln mit zarten Blumenranken gesucht, bis er sie schließlich wie ein Spürhund in einem verlassenen Palazzo in der Nachbarschaft auftreiben konnte.
Elena lehnte den Kopf an die Sessellehne und schloss die Augen. Wann war sie zum letzten Mal so köstlich bekocht worden? Im Handumdrehen hatte Gigi ein aromatisches Risotto mit weißen Bohnen, Speck und Rosmarin gezaubert, der Lammrücken schmorte derweil in einer feinen Marsalasoße und zum caffè hatte Gigi einige hübsche petit fours aus der besten Lecceser pasticceria serviert – wundervoll. Jetzt schrubbte er die letzten Töpfe, seine Nichte hatte er freundlich und erstaunlich bestimmt in den Sessel am Kamin geschickt: »… meine Liebe, ich bitte dich, du willst nicht im Ernst in meiner Küche putzen?«
Da saß sie nun im Samt, spürte die wohlige Wärme des Rotweins und glitt in tiefe Entspannung. Lichte Bilder stiegen aus der Erinnerung auf. Sommerferien. Das weite, flache Land mit uralten Olivenbäumen, Tausende waren es, die silbrig grün schimmerten und runde Schatten auf die aufgerissene rote Erde warfen. Das ohrenbetäubende Sirren der Zikaden in der Mittagshitze, einer Hitze, die jedes Leben im staubigen Dorf ihrer Großeltern erdrückte. Dann rührte sich nichts mehr auf der buckligen Straße vor dem Haus, alles verkroch sich hinter den meterdicken Mauern, wo es dunkel und kühl war und nach getrockneten Tomaten duftete.
Manchmal holte Zio Gigi seine kleine deutsche Nichte ab und sie knatterten auf der Vespa zu seiner geduckten Bauernkate inmitten einer gelb verbrannten Wiese, mit einem Garten voller Feigen-, Orangen- und Zitronenbäume, eingerahmt von einer hohen Mauer und Hecken aus dicken, runden Kakteen, die im Spätsommer glutrot leuchtende Früchte trugen, die süßen Fichi d’India. Hier lebte der gut aussehende Onkel, der meist als Model durch die Welt reiste. Mit Gigi baumelte Elena in der bunten Hängematte, bis es kühler wurde und sie zum Meer trödelten, zu dem langen Sandstrand mit den Kletterfelsen – wie lange war das her? 30 Jahre? Nein, länger, mindestens …
Die Heimat ihrer Mutter Gloria. Lecce, der Salento, »lu salentu«, wie die Leute im Dialekt nuschelten, das sonnige Land auf dem italienischen Stiefelabsatz. Gloria war, abgesehen vom Ehefiasko, entzückt gewesen, als Elena von ihren spontanen Fluchtplänen berichtete. Wenigstens ihre Tochter würde zurückkehren.
Die bildhübsche Gloria war als Gastarbeiterkind mit ihren Eltern nach Hamburg gekommen und dort gestrandet. Sie verliebte sich in Hendrik von Eschenburg, den Sohn einer grundsoliden Hamburger Reederfamilie. Eine Bauerntochter aus Apulien und ein Sohn derer von Eschenburg – ein Skandal in beiden Familien. Die jungen Liebenden ließen sich nicht beeindrucken, und als Glorias Eltern zurück in die sonnige Heimat wollten, schufen die Liebenden Fakten all’italiana: Sie flüchteten für ein paar Wochen und nach ihrer Rückkehr wurde die Hochzeit schleunigst arrangiert. Wenige Monate später kam Elena auf die Welt, das Kind einer eigenwilligen Liebe, mit dem Dickkopf ihres Vaters und den wirren Locken ihrer Mutter. In Deutschland lernte sie vernünftig zu sein und sich anständig zu benehmen, in den Ferien in Apulien Italienisch zu sprechen und ebenso zu fühlen. Ein halbes Emigrantenkind, das sich immer etwas fehl am Platz und irgendwie anders als die anderen fühlte.
Ihr Vater Hendrik von Eschenburg hatte die Augenbrauen bedrohlich hochgezogen, als Elena sich im Elternhaus verabschiedete. Wie gewöhnlich, wenn rote Flecken an Hendriks Hals einen Stimmungswechsel ankündigten, hatte ihm Gloria beruhigend die Hand auf den Arm gelegt: »Amore, denk an dein Herz.«
Dem Reeder passte es gar nicht, dass seine Tochter wieder in ihr unstetes Leben zurückkehrte. Dieses ewige Fernweh, immer wieder weg oder zumindest woanders sein müssen – das hatte sie garantiert von seinem Vater, dem alten Kapitän. Der hatte sich bestenfalls beiläufig für die Reederei interessiert, höchstens so lange, bis die Leinen des nächsten Frachters nach Amerika losgemacht wurden. Die Reederei hatte Hendrik deshalb schon als junger Mann direkt von seinem Großvater übernommen. Ein Familienunternehmen seit vier Generationen, wo gab es das noch? Aber was tat Elena, sein einziges Kind? Trieb sich fotografierend in der Welt herum. Mit keinem Pfennig hatte er seine Tochter unterstützt, solche Spielereien sollten sich Kinder selbst finanzieren. Das hatte Elena dann auch getan.
Mit dem gleichen Dickkopf wollte sie jetzt wieder weg, so schnell wie möglich. Weg von Aron, raus aus diesem angeblich halben Leben und dem Hamburger Himmelgrau.
Sie hatte ihren Mann mit der SMS konfrontiert, er hatte nichts geleugnet. Ja, mit Marlene habe er was laufen, aber das habe doch nichts mit ihr und Ben zu tun. Warum denn gleich ausziehen? Also bitte. »Doch nicht wegen Marlene! Das meinst du nicht ernst!«
Natürlich fand die Tochter eines von Eschenburg das alles unerträglich und billig und meinte es im Übrigen sehr ernst – das hätte Hendrik seinem Schwiegersohn gleich sagen können. Sie bat ihren verdutzten Gatten, bis auf Weiteres das Haus zu verlassen. In spätestens einer Woche sei sie mit Ben weg. Ein Jahr Abstand, das Leben sortieren. Aron war einverstanden. Vielleicht sogar erleichtert?
Elena hatte ihren Job noch am gleichen Tag gekündigt, sämtlichen Resturlaub genommen und begonnen, die Koffer zu packen. Die Flucht war zügig organisiert: im Auto mit Ben 2000 Kilometer nach Süden, über die Alpen, durch die Po-Ebene und dann an der Adria runter, bis die Autobahn zur Schnellstraße wird und schließlich in Lecce endet, kurz bevor das Land ins Meer stürzt.
Was konnte Hendrik von Eschenburg seiner eigenwilligen, vierzigjährigen Tochter noch sagen, während sie nur mit Mühe noch auf dem Sofa sitzen blieb, anstatt sofort ins Auto zu springen? Seine aufkeimende Wut wandelte sich in ein unwirsches Grummeln, als er Gloria anschaute. Die lächelte freundlich. Sie selbst wäre auch manchmal gerne zurückgegangen auf den sonnigen Stiefelabsatz. Hendrik wusste das und war dankbar dafür, dass sie bei ihm geblieben war, ihn und das Hamburger Wetter ausgehalten hatte.
»Cin cin!«, rief Zio Gigi und streckte sich im Sessel neben Elena aus. Das »Klong« der dickbauchigen Weingläser holte sie zurück an den Kamin.
»Du bist wirklich ein famoser Koch, Zio«, lobte Elena. Er lächelte geschmeichelt. Seit dem Ende seiner Karriere hatte sich Gigi mit wachsender Freude seinen Leidenschaften hingegeben: Neben dem Sammeln und Verkauf von Trödel und Antiquitäten widmete er sich der italienischen Küche im Allgemeinen und der regionalen Bauernkost seiner süditalienischen Heimat im Besonderen, inklusive der Weine, die zu unbekannten Stars heranreiften. Eitel war er noch immer, trotzdem hatte er sich über die Jahre ein kleines Bäuchlein angefuttert.
»Aber wen stört das schon? Auch Ettore hat inzwischen gemerkt, dass sich der Körper ab 40 verändert.«
»Dein Liebster?«, fragte Elena.
»Schon seit Jahren, vielen Jahren. Ein Opernsänger«, Gigi grinste. »Hier unten könnte er vielleicht noch bella figura machen, aber oben im Norden? Ts«, Gigi schnalzte und schüttelte den Kopf, »selbst in seinem geliebten Genua gehört er bestenfalls zur zweiten Liga. Von Mailand wollen wir mal gar nicht reden.«
Er leerte sein Glas gedankenverloren. »Eigentlich sollte er ja in die Wohnung nebenan einziehen.«
»Wo Ben und ich jetzt …? Kein Problem, Zio, wirklich, wir finden etwas anderes.«
»Nicht schon wieder, Elena! Ihr bleibt hier«, Gigi wurde für einen Moment richtig streng. »Ettore wird hier nicht einziehen. Der hält es keine zehn Tage in Lecce aus.«
Gigi stand schwer atmend auf, ging zum Weinregal in der Küche und wählte eine weitere Flasche aus. Schaute sich nach dem Korkenzieher um, während er erzählte, wie er diese Etage ursprünglich für das gemeinsame Leben mit seinem Geliebten geplant hatte. Zwei Wohnungen mit zwei Eingängen, verbunden oder getrennt durch eine Schiebetür, je nach Tagesform und zwischenmenschlichen Krisenherden. Gigi entdeckte den Korkenzieher direkt vor sich auf der Kochinsel. »Ettore hätte in Ruhe seine Stimmübungen machen können, ohne dass ich mir Watte in die Ohren hätte stopfen müssen«, der Onkel fummelte umständlich an der Banderole am Flaschenhals herum, »aber schließlich habe sogar ich kapiert, dass wir auf Distanz vermutlich entspannter miteinander leben.«
»Plopp!«, die Weinflasche war endlich geöffnet, Gigi setzte sich wieder. Die enttäuschende Erkenntnis war nach einem ganz normalen Krach gekommen, dem üblichen Ritual: Ettore fand das Leben in diesem Süden, am äußersten Ende von Italien nach einer Woche sturzlangweilig. Lecce, diese Provinzhauptstadt, war für den Genueser nicht nur Provinz, nein! Provinzprovinz! Also jenseits des denkbaren Status an Zivilisation. Plattes Land voller Olivenbäume und ignoranter kulturloser Bauern – Gigi vielleicht großzügig ausgenommen. Der wiederum nannte Ettore einen arroganten drittklassigen Tenor oder so etwas in der Art, jedenfalls explodierte der Wortwechsel über ihren persönlichen Nord-Süd-Konflikt und endete in der üblichen großen Oper: Ettore stürzte theatralisch zum Bahnhof und rauschte mit dem nächsten Zug gen Norden.
Zwölf Stunden Zugfahrt quer durch Italien reichten normalerweise aus, damit sich die Gemüter der beiden abgekühlt hatten und sie wieder miteinander telefonieren konnten: »Tesoro, ich bitte dich, bello mio, sei doch nicht nachtragend, tut mir leid, tut mir so leid! … Ich dich auch. Bis bald, ich denk an dich, ciao, ciao amore, ciao. Ciao, ciaociaociao.«
Aber dieses Mal hatten die zwölf Stunden Gigi zu sehr ernüchtert. Die Worte waren zu harsch gewesen. Gigis Traum von der Doppelwohnung im Palazzo, seinem Lebenswerk – »du sprichst von dieser barocken Ruine, verstehe ich dich richtig …?«, hatte Ettore in diesem breiten Gänuääser Akzent fies gefragt –, dieser Traum war endgültig geplatzt.
Der Tag der bitteren Erkenntnis war Elenas 40. Geburtstag gewesen. Bevor Gigi lange trauern konnte, hatte das Telefon geklingelt. Elena. Traurig, verletzt und fürchterlich wütend. Als sie schließlich auflegten, hatte Zio Gigi neue Bewohner für die kleine Wohnung.
Die Entdeckung der römischen Straße war nur das grande finale