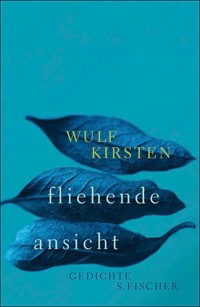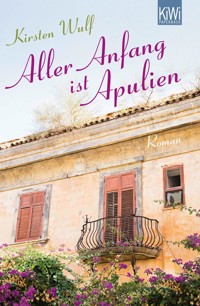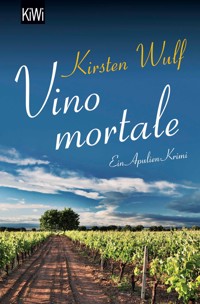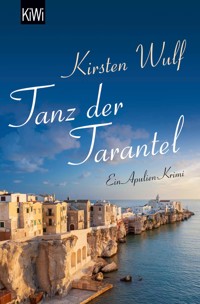9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Die Schlacht bei Kesselsdorf« dauerte nicht länger als zwei Stunden. Nach mehr als zwei Jahrhunderten sprechen Einheimische immer noch von den Schmerzensschreien der am 15. Dezember 1745 sterbenden Männer und Pferde. So kam die Erinnerung an jenes blutige Nachspiel des zweiten Schlesischen Krieges auf Wulf Kirsten, der das Schlachtfeld abschreitet und vom Verlauf des sinnlosen Gemetzels berichtet. »Kleewunsch«zeichnet halb ironisch, halb liebevoll das Bild eines sächsischen Provinzstädtchens in der Zeit der Restauration und Revolution, Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Für beide Texte wertete Kirsten zahlreiche historische Quellen aus. »Die Kirsten-Sprache ist eine Sprache, in der man sich verproviantieren kann gegen Geschwindigkeit, Anpassung, Verlust.« Martin Walser
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Dr. Wulf Kirsten
Die Schlacht bei Kesselsdorf. Ein Bericht Kleewunsch. Ein Kleinstadtbild
Über dieses Buch
Die Schlacht bei Kesselsdorf. Ein Bericht
Wulf Kirsten schließt mit »Die Schlacht bei Kesselsdorf« eine historische Lücke und berichtet von der Schlacht, die den Schlesischen Krieg beendete. Noch Jahrhunderte später sprechen die Einwohner von den Schmerzensschreien der am 15. Dezember 1745 sterbenden Männer und Pferde. Kirsten zeigt in seinem Bericht die verhängnisvollen Entscheidungen der Kriegsführer und enttarnt wie nebenbei die folgenschweren Militarismuslegenden. Exakt recherchiert und direkt erzählt er vom elenden Kämpfen und Sterben auf dem Schlachtfeld, in Kesselsdorf, von dem Ort, der zum Inbegriff sinnlosen Mordens wurde.
Kleewunsch. Ein Kleinstadtbild
Kleewunsch: verwunschen, winzig, komisch-tragisch und ein sächsisches Städtchen, durch das Wulf Kirsten wie ein Heimatforscher wandelt, auf dem schmalen Grat zwischen vertracktem Humor und freundlichem Ernst. Bevölkert von Charakter- und Querköpfen steht das fiktive Kleewunsch doch für einen vertrauten Typus der hintergründigen Kleinstadtidyllen des 19. Jahrhunderts. Lustig, sprachmächtig und liebevoll zeichnet Kirsten ein allgemeingültiges Porträt des Provinziellen, eine Welt, die in dieser Form heute verschwunden ist.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Erstausgabe erschien 1984 bei Aufbau Verlag Berlin und Weimar
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: kreuzerdesign Agentur für Konzeption und Gestaltung, München Rosemarie Kreuzer
Coverabbildung: Arno Fischer © Oliver Fischer, Hoppegarten
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490640-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Die Schlacht bei Kesselsdorf
Kleewunsch
I
II
Die Schlacht bei Kesselsdorf
Ein Bericht
In vier Marschsäulen wälzt sich der unübersehbare Strom der preußischen Armee, vom Fürsten von Anhalt befehligt, zu Fuß und zu Pferde über die vereisten und verharschten Wege auf den Elbhöhen, die sich von Dorf zu Dorf winden, eines abgelegener als das andere. Tiefes Hinterland im Winterschlaf. Von den elendesten Knochen- und Achsenbrechern geädert. Die Radgeleise tief ausgefahren, die Gefälle ausgewaschen. Viele der Brücken und Brückchen so heruntergekommen, daß jedem ein Stoßseufzer der Erleichterung entfährt, der sie heil passiert hat. Hätte nicht der Frost für einen festen Grund gesorgt, wäre überhaupt kein Durchkommen. Es bleibt auch so noch anstrengend genug, auf den Unebenheiten des gefrorenen Schlammes zügig auszuschreiten. Knirschend splittert unter den Hufen das Eis, das die mit Lehmbrühe gefüllten Schlaglöcher bedeckt. Der Winter hat der Landschaft eine dünne Schneedecke übergeworfen.
Den endlosen Marschkolonnen fahren alle verfügbaren Zimmerleute voraus. Zweihundert Arbeiter müssen ihnen zur Hand gehen. Auf zwanzig Wagen liegen Balken, Pfosten, Bohlen, Pfähle, Bretter, Bauklammern und alles, was an Handwerksgerät beim Wege- und Brückenbau vonnöten ist: Hacken, Schaufeln, Spaten, Äxte, Beile, Schrotsägen, Rammen, Vorschlaghämmer, Brechstangen, Hebebäume. Brücken sind befahrbar zu machen, Übergänge zu schaffen, Ausweichstellen einzurichten, Hohlwege freizuschaufeln. Droht eine Steigung das Tempo zu drosseln, greifen sogleich vier Hände in jeden Speichenkranz, damit der Zug nicht ins Stocken gerät und die Marschordnung nicht durcheinandergebracht wird. Die sich unausgesetzt an Forsche und Lautstärke überbietenden Zurufe der Kutscher feuern die Geschützgespanne an und halten sie in Schwung. Obendrein knallen und schmitzen die Peitschen. Nüstern, Nasen und Münder blasen den Frostrauch in die scharfe Dezemberluft, der sich über dem Heereszug zu langgestreckten Dunstwolken ballt. Aus den dampfenden Tierleibern werden die letzten Kraftreserven herausgeschunden. Gebieterischer noch als den abgeäscherten Gäulen sitzt den Musketieren und Füsilieren die Fuchtel im Nacken. Offiziere und Korporale treiben zur Eile. Kaum daß sie den Mannschaften eine kurze Verschnaufpause gönnen. Nur nicht stehenbleiben. Bewegung ist das einzige Mittel, den Frost zu ertragen. Den Soldaten, die in Kolonne marschieren, bleibt nicht mal die Zeit, ein flatterndes Huhn zu greifen und zu köpfen, wenn es durch eines der winterstarren ärmlichen Bauerndörfer geht, die beim Anblick der gefräßigen Raupe vor Angst erschrecken und sich am liebsten in eine Ackerfurche ducken würden.
Die Fouragekommandos sorgen dann schon noch dienstfertig genug dafür, daß alles seine militärische Ordnung hat. Sie räumen aus und nehmen mit, was nicht niet- und nagelfest ist. Die Armee hat einen großen Magen, der Tag für Tag aufs neue gefüllt werden muß. Kein Korn bleibt in den Dielenritzen, keine Schütte Stroh in der Scheune, kein Büschel Heu in der Raufe. Ketten, Riemenzeug, leere Säcke, volle nicht minder, Woilache, Leinwand, selbst Wagenschmiere und Pferdefluid schleppen die umsichtigen Beschaffungsexperten mit sich fort, ohne sich im mindesten von den Klagen der Bauersleute beeindrucken zu lassen, die nicht wissen, wie sie über den Winter kommen sollen. So viele Verstecke gibt es gar nicht, um in der Eile alle Vorräte beiseite zu schaffen. Zum Glück ist wenigstens das Wintergetreide bereits eingesät und kann nicht mehr requiriert werden.
In Schlachtordnung hatten die Truppen letzte Nacht mehr schlecht als recht auf freiem Felde biwakiert. Zwischen den Ortschaften Naustadt und Röhrsdorf. Weiter waren sie an dem Tage von Meißen aus nicht gekommen. Der Berg auf die Elbhöhen über Siebeneichen hatte mehr Zeit und Kräfte gekostet als vorgesehen. Ohne Stollen an den Eisen wären die Zugpferde auf der Steile überhaupt nicht vorwärts gegangen. Die Zelte boten zwar einigen Schutz vor dem eisigen Wind, der aus dem Osten blies. Dennoch fehlte es in dieser nur auf Sommerfeldzüge eingerichteten Behausung ganz entschieden an Wärme. Die hölzernen Zeltpflöcke wollten sich nicht ins gefrorene Erdreich schlagen lassen. Sie zerbrachen oder prallten zurück. Wie sonst hätte man die eisige Nacht überstanden, wenn nicht im straff gespannten, sicher stehenden Zelt. So wie jedes militärische Detail im preußischen Heer aufs genaueste und ökonomischste ausgeklügelt war, herrschte auch ein strenges Zeltbaureglement, in dem jeder Handgriff vorgeschrieben war. Selbst unter den extremen Bedingungen, wie sie der Winter stellte, durfte davon nicht um ein Jota abgewichen werden. Und mit eiserner Selbstverständlichkeit, an der zu zweifeln niemand beigefallen wäre, fußte auch das Zeltreglement auf den allgemein üblichen hierarchischen Strukturen. Die kleinen Zelte der Gemeinen aus grobem Leinen mit Lederbesatz waren nicht abgefüttert. Der spartanische Schlafraum war für sechs Mann berechnet, meist wurden jedoch sieben hineingepfercht. Die Schlafordnung schrieb vor, in zwei Reihen zu schlafen, Fuß gegen Fuß geschichtet wie die Ölsardinen. Kein Quadratzentimeter zuviel. Das Äußerste an Sparsamkeit. Auf dem Boden etwas Stroh, über den müden Marschierern die gemeinsame Zeltdecke, nicht viel größer als die Grundfläche. Die Kavalleristenzelte, in denen nur fünf Soldaten lagen, endeten in einer Apsis, dem Schopf, der als Sattelkammer diente. Die Pferde wurden vor den Zelten angepflöckt. Schon der Gedanke, unter die steifgefrorenen Planen kriechen zu müssen, machte das Blut grieseln. Die dünne Strohschicht hielt die Kälte nicht ab, die aus dem Erdboden stieg.
Die Truppen lagerten auf einer kahlen, leicht gewellten Hochfläche, die keinerlei Schutz vor der rauhen Witterung bot. Aber das Lager hatte seine eigenen Gesetze und genauen Maße. Die gesamte Armee mußte in dem Geviert überschaubar sein. Fouriere und Fourierschützen zeichneten die Grundrisse und steckten die Begrenzung ab. Jeder Griff beim Auf- und Abbau der Zelte war hundertfach exerziert worden. Die Schlafgemeinschaften waren aufeinander eingespielt. Decke falten, Pflöcke ziehen, Zelte falten, Decke in das Zelt wickeln, den Packen samt Spannstangen aufs Pferd binden – all dies erfolgte im Gleichmaß nach Kommando. Jede Handbewegung der noch schlaftrunkenen und froststarren Körper war automatisiert, anders wäre es nicht möglich gewesen, in fünfzehn Minuten abmarschbereit zu stehen. Nicht eine Sekunde durfte einer nachhinken in diesem perfekten Räderwerk.
Nur der Fürst hatte mit wenigen Begleitern sein Nachtquartier auf einem Bauernhofe des dem Biwak vorgelagerten Dorfes genommen. Die Öllaterne des Vorreiters bahnte eine kümmerliche Lichtschneise. Von Tag zu Tag war der König in seinen depeschierten Anweisungen unbeherrschter und ungnädiger geworden. Viel zu langsam sei er vorgerückt. Statt über Grimma, wie die Order lautete, hatte er die Truppen über Torgau marschieren lassen, in der Hoffnung, in der Festung ausreichend Proviant vorzufinden. Aber das war ganz offensichtlich ein unsinniger Umweg, auf dem nur kostbare Tage verlorengingen. Die eigenwillige und eigenmächtige Auslegung der anbefohlenen Marschroute hatte den König konsterniert und echauffiert. Die von Kurieren mündlich und schriftlich überbrachten Befehle ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Die Gereiztheit hatte sich zu einem giftigen Zorn gesteigert, der keine Grenzen mehr kannte.
Nach den Siegen von Hohenfriedberg und Soor glaubte der König den Krieg für sich entschieden zu haben. Wären die Sachsen nicht gänzlich mit Blindheit geschlagen, nähmen sie den Frieden an. Sie bekämen ihn sogar billig. Aber kaum war der König aus Schlesien, wo sein Heer sich anschickte, Winterquartier zu beziehen, zurückgekehrt, als er von einem geplanten Überraschungsangriff zu unvermuteter, weil ungewöhnlicher Jahreszeit der Österreicher und Sachsen Wind bekam.
Der Kriegsrat in Dresden unter Vorsitz des hinfälligen Herzogs von Sachsen-Weißenfels hatte einen Vorstoß auf Berlin beschlossen, der gewissermaßen im gestreckten Galopp vorgetragen werden sollte. Ein Reiterkunststück, von dem man sich großen Effekt versprach. Aber der schwedische Gesandte hatte die Schwachheit, in Berlin aus der Diplomatenschule zu plaudern. Die beiden preußischen Armeen lebten bereits in der wohlbegründeten Annahme, für dieses Jahr sei der Krieg überstanden. Ein Korps der österreichischen Rheinarmee rückte in Eilmärschen auf Berlin, während die Hauptmacht zum Marsch nach Leipzig rüstete, wo sie die preußische Armee, die der Fürst von Anhalt führte, schlagen zu können glaubte.
Der König hoffte nun, seinen Feinden, die ihn überrumpeln und niederdrücken wollten, durch einen geschickten Schachzug zuvorzukommen. Er mußte den Spieß einfach umdrehen. Eine andere Wahl blieb ihm nicht. Deshalb drang er unablässig und mit allem Nachdruck auf Prestissimo. Seine bei Leipzig stehenden Truppen mußten das sächsische Heer angreifen, ehe es sich mit den Österreichern vereinen konnte, und über das Gebirge nach Böhmen jagen. In dieser Situation, wo Sieg oder Niederlage unter Umständen von einer Kleinigkeit entschieden wurde, brachte ihn das Verhalten des alten Heerführers in Harnisch. Welch ein Ausbund an Halsstarrigkeit und Bockbeinigkeit! Wie konnte ihn sein Heerführer so gründlich mißverstehen? Als Drillmeister hatte der alte Haudegen wohl seine Meriten. Taktik hingegen war seine starke Seite nicht. Ganz zu schweigen von den Methoden moderner Aufklärung, wie er sie eingeführt hatte.
Der Fürst fühlte sich im Recht. Gallig kamen ihm die fortwährenden Zurechtweisungen hoch. Das ging entschieden gegen seine Ehre. Klang das nicht, als sollte er zum Hundsfott erklärt werden. Reinweg hassen mußte ihn dieser König. Es fehlte nicht viel, und der Fürst hätte mitten in diesem vermaledeiten Winterfeldzug seinen Abschied genommen, wie so manch anderer Befehlshaber in den letzten Jahren, den der junge König mit seiner Barschheit vor den Kopf gestoßen hatte. Die Absichten des alten Heerführers kamen denen des Königs ganz entgegen, hätte dieser ihn doch am liebsten zum Teufel gejagt in seiner Fuchtigkeit. Die Animositäten wuchsen auf beiden Seiten. Das Maß schien voll, als ihn der König ganz ohne allen Bonton wissen ließ:
»Ich bin extrem frappiret worden als ich aus Ew. Liebden Schreiben vom 7. dieses erfahren habe, wie Dieselben den Sinn meiner ordre vom 4. dieses so genommen haben, als ob sie über die Elbe diesseits gehen und auf dieser seyte zum General Lehwalden stoßen solten. Ich muß Ew. Liebden sagen, daß Ich Dero bisherige operationes nicht approbiren kann, weil solche so langsam gehen, und wo was im Stande wäre, Mich hier in Unglück zu bringen, so wäre es gewiß Ew. Liebden Saumseligkeit. Hier seyndt zehn dergleichen Schlößer mit Land Militz besetzet, welche wir alle liegen laßen, und uns nicht daran kehren. Es ist mir nicht in den Sinn gekommen, daß Ew. Liebden über die Elbe kommen solten, ich weiß auch nicht wie Ew. Liebden in die Gedanken kommen können, daß sie über die Elbe dießeits kommen wolten, wenn diesselbe dießeits vorgehen so wäre solches eben soviel als mir hier das Messer an die Kehle gesetzet. Ich begreife auch nicht, wie Ew. Liebden dießeits der Elbe Meißen nehmen wollen, da dieser Ort jenseit der Elbe liegt, noch weniger begreife Ich, wo Ew. Liebden dan diesseits der Elbe weiter hin wollen. Ich schicke daher Ew. Liebden den Capitain von Oelsnitz hin damit derselbe einmahl auf eine convenable arth und nach Meiner Intention agiren möge; ich kan nicht leugnen, das ich gar übel von Ihr Durchl. Manoeuvres zufriden bin, sie gehen So langsam, als wen Sie sich vohrgenommen häten, Mich aus Meiner avantage zu setzen, und weilln diese Sachen ernsthaft Seindt, So Rathe ihnen als ein guhter Freundt, Solche mit Mehrer wigeur zu tractiren, meine ordres ponctueler zu exsecutiren Sonsten Sehe Mihr gezwungen zu exstremiteten zu Schreiten die ich gerne evitiren wolte. ich weiß auch das ich mihr alle Mahl So deutlich exsplicire das sein tage kein officir von meiner armée geklaget hat, das er mihr nicht verstünde und ist mein Velt Marschal der eintzige, der Meine deutliche befehle nicht verstehen kan oder verstehen wil, ich kan es nicht begreifen und ich bin in dem großen Misvergnügen dan Sie bringen Mihr um Ehre und reputation.«
Das war starcker Toback. Als am 10. Dezember der angekündigte Kurier eintraf, seine Instruktionen übergeben und explicit dargelegt hatte, packte den Fürsten die kalte Wut. Von dieser stürmischen Gemüts- und Geblütsaufwallung wurde es ihm speiübel und schwarz vor den Augen. Das war ihm in seinen dreiundfünfzig Dienstjahren noch nicht widerfahren. Ein junger Stabsoffizier, der eigens auf die Sprachgebung seines Königs studiert zu haben schien, ihm als Gedächtnisstütze zur Seite gestellt. Pfui Teufel! Zweifelte man etwa schon an seinem Verstande, an seinem Entscheidungsvermögen. Als wüßte er nicht selbst, wie Kriege geführt werden. Gedanken, die nicht mehr aufhören wollten, ihn zu peinigen. Unerträgliche Vorstellungen. Zum Störrischwerden. In trotziger Erbitterung schloß er seine Erwiderung: »… und kann nicht anders glauben, als daß Eure Königliche Majestät einen beständigen Haß gegen mir haben und behalten werden.«
Nun sah sich der König seinerseits bemüßigt, in dieser für ihn so brenzligen Situation aus taktischen Gründen einen Pflock zurückzustecken. Eben jetzt konnte er den Fürsten unter keinen Umständen entbehren. Die geringfügigste Stockung während des Vormarschs hätte die Siegeschancen erheblich verringert. Zuviel stand auf dem Spiel für Preußen. Kaum zuvor hatte sich der Staat in einer derart miserablen Verfassung befunden. Die Kassen leer. Die Kreditwürdigkeit weit und breit nahezu erschöpft. Das massive Silbergerät aus dem Schlosse eingeschmolzen. Kronleuchter, Tischplatten, Kaminverkleidungen, der Musikantenchor bei Nacht und Nebel außer Landes gebracht und in klingende Münze geschlagen, damit der Sold ausgezahlt werden konnte. Woher nun noch Reserven nehmen? Die Talsohle war erreicht. Der Beutezug im Vorjahr nach Böhmen, der sich zunächst so verheißungsvoll angelassen hatte, brachte am Ende weder materiellen Gewinn noch sonst irgendwelche Vorteile. Alle Erfolge während des raschen Vormarsches waren am Ende in Mißerfolge umgeschlagen. Die böhmischen Bauern hatten das Korn, wie ihnen von der Kaiserin geheißen, tatsächlich vergraben und hielten sich in den Wäldern verborgen, wohlversehen mit den besten Empfehlungen der Landesmutter zur passiven Resistenz, unsichtbar für die Feinde. Ein unheimliches Land, so kam es den Besetzern vor. Dieser Art von Feindschaft war die königliche Armee nicht gewachsen. Um nicht zu verhungern, mußte sie das okkupierte Land schleunigst verlassen und nach Schlesien zurückkehren, in den sicheren Hort.
Verbissen und hartnäckig mühten sich die stolzen Habsburger, dem aufdringlichen Parvenü im Norden, der ihnen so anmaßend auf der Nase herumtanzte, diese Kornkammer wieder abzujagen. Unschicklicherweise gab Maria Theresia vor, lieber ihre Kleider, die sie auf dem Leib trug, zu missen als dieses fruchtbare Land, das seit dem Regierungsantritt des Hohenzollern zum Zankapfel geworden war, und was dergleichen kaiserliche Rodomontaden mehr waren.
Das von einer Kamarilla geleitete Sachsen war bislang lediglich als Hilfsmacht auf dem Plane gewesen. Der vertrottelte Kurfürst, ein fader, träger Fleischsack, der von seinem Vater nur die Jagdleidenschaft und Verschwendungssucht geerbt hatte, wurde bei Laune und in Ahnungslosigkeit gehalten. Brühl, der eigentliche Herrscher im Lande, verstand es, den einfältigen Landesherrn mit einer undurchdringlichen Hecke von Aufpassern zu umgeben. Wie die Schießhunde hatten diese servilen Kreaturen darüber zu wachen, daß keinerlei Informationen über die Mißwirtschaft und das Elend im Lande an seine Ohren drangen. In völliger Verkennung der Realitäten liebäugelte man am sächsischen Hofe mit weitläuftigen Ländereien, die eine Brücke nach Polen schlagen sollten. Brühl und seine wendigen Afterkriecher glaubten den Ausgang des Krieges durch einen überraschend geführten Winterfeldzug zu ihren Gunsten wenden zu können. Und da sie sich an ihren waghalsigen Plänen berauschten, schlugen sie das Friedensangebot des Preußenkönigs hochnäsig in den Wind und ließen es lieber auf ein blutiges Nachspiel ankommen. Gar zu gern hätten auch sie es gleich den Österreichern gesehen, wenn der dreiste preußische Emporkömmling wieder zum kleinen brandenburgischen Markgrafen heruntergedrückt würde und seine Einflußsphäre auf den kargen märkischen Sand beschränkt bliebe.
Auf den Brief des Feldherrn schrieb der König bereits tags darauf wesentlich kühleren Blutes und klareren Kopfes: »In den gantz besonderen Umbständen vorinnen Ich jetzo bin, und da es Mir auf die Ehre Meines Hauses und auf die Wohlfahrt Meiner Lande und Leuthe ankommt, wird es Ew. Liebden ohnmöglich befremden können, daß ich in Sachen so das Wohlseyn und die Wohlfahrt Meine Lande und Armée angehen, allen Ernst gebrauche und keinen schone. Ich kann Ew. Liebden auf Meine Ehre versichern, daß ich gegen Dero Persohn keinen personellen Haß habe, worauf dieselben sich gewiß und fest verlaßen können; So weit aber gehet Meine Complaisance nicht, daß Jemanden es sey auch wer es auf der Welt es wolte, menagirete, wenn Ich sehe, daß Mein Interesse so genau damit verknüpft ist. Ich danke Gott! daß es diesmal mit dem Generalleutnant Lewald so gut abgelaufen ist. Morgen bin ich in Königsbrüg. Mit der Armée, der Friden Sehet weitläufiger aus als es geschinen in deßen Marschiren Sie den 14. auf jener Seite der Elbe, und ich auf dießer seiten Nach Dresden, und den 15. darauf So Mus es ein Ende werden, und erfähret man das geringste vom Pr. Carel So stoße mit diesem Corps zu Ihnen.«
An ebendiesem 15. Dezember des Jahres 1745 stehen die sächsischen Truppen seit dem frühen Morgen bibbernd und zähneklappernd unter Gewehr. Die Unbeweglichkeit läßt den schneidenden Frost ins Gebein und unter die Nägel fahren, daß es ziefert. Zwei Nächte haben sie schon auf freiem Felde kampiert, malträtiert wie gepferchtes Vieh. Selbst für das zum Leben Notwendigste war nicht gesorgt worden. Mitnichten. Vor allem fehlte es an Holz und Stroh. Im Zschoner Grund hätte man zumindest Brennmaterial schlagen lassen können. Wo sich irgend ein Stück Holz fand, sei es Brett, Pfosten, Rechen, Besenstumpen, Schaufel oder Gabel, Hacken- oder Axtstiel, Stacken, Stange, Baumpfahl samt Baum und sonst dergleichen, wurde es aus nackter Not ins Feuer geworfen. Binnen Tagesfrist verschwand auf diese Weise auch das gesamte Schanzzeug der Armee. An den meisten Zelten schlotterten und klunkerten die Fetzen. So zerschlissen, wie die Zelte aus dem Magazin kamen, mußten sie aufgebaut werden. Kein Zeltschneider, kein Sattler zu sehen. Diese hatten vollauf damit zu tun, die Offizierszelte und das Riemenzeug der Offizierspferde zu reparieren.
Der Troß ist in der Stadt geblieben. Mit dem Nachschub geht es nicht voran. Keine Organisation. Schlumperwirtschaft wie überall im Lande. Die hohen Herren sehen zu, wo sie bleiben. Eigennutz geht vor.
Zwar sind Offiziere in ausreichender Zahl vorhanden, aber es fehlt an einer Hand, die imstande gewesen wäre, die Fäden zu halten. Keiner interessiert sich für Angelegenheiten, die außerhalb seines Kompetenzbereiches liegen.
In ähnlich desolatem Zustande wie die Zelte befinden sich auch die Monturen der neunzehntausend Grenadiere. In ihrem Aufzug machen sie einen ausgesprochen jämmerlichen Eindruck. Zum Gotterbarmen!
Seit der Zusammenführung vor vier Tagen sind die Mannschaften nicht mehr richtig satt geworden. Wohl waren die Brotrationen immer und immer wieder für die nächsten Stunden versprochen worden – und mit welch ehrenhaften Beteuerungen! Wenn sie nur endlich eingetroffen wären!
Woher auch nehmen – nach einer Ernte, die nur kärglich geschüttet hatte. Das Korn ist knapp, daher entsprechend teuer. An allen Ecken und Enden herrscht Mangel. Er ist der geheime König des Landes und seiner Armee. Die Decke, die vonnöten wäre, die Blößen zu decken, ist zerschlissen und viel zu kurz. Man mochte sie zerren, wohin man wollte auf den verschneiten Flächen, über die der eisige Wind das weiße Pulver aufwirbelt und davonträgt. Überall kommt das nackte Elend zum Vorschein.
Die armen Muschkoten aus den Grenadierbataillonen, denen der Rotz läuft und der Heckermatz die Hände aufreißt: Mann für Mann von der Krätze befallen. Ein Bild des Jammers. Überall Zeichen der Not und der Verwahrlosung! Ein Zustand, der unaufhaltsam von außen nach innen dringt.
Um die Stimmung nicht unter den Nullpunkt absinken zu lassen, hat der Heerführer den Mannschaften ein Trostpflaster verabreicht: den Sold für zwei Wochen. Schäbig genug. Damit ist erst der vorletzte Monat beglichen. Der Rest steht noch immer aus. Die Herren Offiziere bis zu den Fähnrichen hinab warten bereits ein Vierteljahr und länger. Und auch diesmal gehen sie leer aus. Nicht ein Stüber ist ihnen bewilligt worden. Immer und ewig tönt ihnen ein gleichlautendes Lamento in den Ohren: »Die Kassen sind leer!« Voller hinhaltender Zuversicht ist ihnen wieder einmal wortreich bedeutet worden, sie möchten sich doch bitte bis nach dem Sieg gedulden. Diese Leier kennen sie allbereits zur Genüge. Wohl wissend, daß sich’s Brühl an nichts abgehen läßt. Mag der Brotkorb im Lande so hoch hängen, wie er will.
In steiler Karriere war Brühl vom Silberpagen zum Kammerpräsidenten und Kabinettsminister aufgestiegen, in dessen Händen alle geheimen Fäden der Staatsmaschinerie zusammenliefen. Jedes einflußreiche und einträgliche Amt Zug um Zug mit eiskalter Berechnung an sich gerissen und dessen Besoldung skrupellos eingestrichen. Was monatlich das erkleckliche Sümmchen von fünfundsechzigtausend Talern brachte. Dennoch bei weitem nicht genug, den Wanst dieses Prassers zu stopfen und die Rankünen des Schurken zu finanzieren. Jede nur erdenkliche Quelle angezapft, um sich die schmutzigen Hände darin zu waschen. Und seien es die Mündelgelder. Kein Betrag ist ihm zu schäbig. Vor keiner Missetat schreckt seine unersättliche Habgier zurück, lassen sich daraus nur Gelder und Vorteile ziehen. Jedes Mittel ist ihm recht. Strauchrittergesinnung. Ein 300-Personen-Haushalt ist zu unterhalten, mindestens standesgemäß. Sein Marstall, sein Kleidermagazin, sein Stiefeldepot, seine Porzellan- und Uhrenkollektion übertreffen die des auch nicht eben in bescheidenen Verhältnissen lebenden Kurfürsten. Für jedes Anliegen, das ihm vorgetragen wird, läßt er sich in aller Bescheidenheit ein pfundiges Präsent machen. Und wehe dem Bestecher, das Schmiergeld bleibt unter den Erwartungen des Allgewaltigen, zu dessen Lebensstil es gehört, jährlich eine Million Taler auszugeben. Was dem zügellosen Sybariten daran noch in der eigenen Tasche fehlt, wird rigoros der Staatskasse entnommen. Mißwirtschaft und Machtmißbrauch in Personalunion.
Am Ende dieser unheilvollen Ära sollten allein dem Staatshaushalt über fünf Millionen blanker Taler fehlen. Unter seiner Herrschaft blühten Ämterschacher und Günstlingswirtschaft. In der Umgebung dieses Mannes, der sich in einen dicken Filz von Betrug und Lüge verstrickt hat, können sich nur die willfährigsten Kreaturen behaupten.
Die Heuchelei dieses Christenmenschen, der 1740 ein eigenes Gebetbuch herausgab unter dem wohlklingelnden Titel »Die wahre und gründliche Gottseligkeit der Christen insgemein nebst einer Anleitung zum Gebete«, geht so weit, in Sachsen den strenggläubigen Lutheraner herauszukehren, während er sich in Polen freiweg als Katholik ausgibt.
Hier stehe ich, ich kann auch anders!
Das ganze Land hat er mit einem engmaschigen Netz von Lauschern und Zinkern überzogen, die gehalten sind, ihm gegen ein geringes Entgeld jede Kleinigkeit zuzustecken, die gegen seine Person gerichtet sein könnte. Auf den Postämtern läßt er alle verdächtigen Briefschaften erbrechen. Und was sollte einem Menschen nicht verdächtig sein, der ein schlechtes Gewissen hat!
In seiner Eitelkeit läßt er sich sogar den Rang eines Generals der Infanterie zuerkennen und zum Befehlshaber über ein Regiment Chevaulegers sowie über eines zu Fuß ernennen, ohne die geringsten militärischen Kenntnisse zu besitzen und ohne sich jemals um seine Truppen zu kümmern.
Die Beamten warten auf ihr Gehalt, die Soldaten auf ihren Sold. Als es trotz aller Sicherungsmaßnahmen doch einmal einem Obersten gelang, durch ein Schlupfloch in der lebenden Hecke bis zum König vorzudringen und ihm die Petition seiner Regimentskameraden zu überreichen, die den seit zwanzig Monaten ausstehenden Sold anmahnten, ließ Brühl den Mann schlichtweg für verrückt erklären, und bewirkte mit drakonischen Mitteln, daß er wegen zeitweiligen Irrsinns um seinen Abschied nachsuchte.
Dem preußischen König, der mit seiner Streitmacht von zwei Seiten gegen die sächsische Residenz anrückt, ist Brühl nicht gewachsen. Die Kategorien, in denen die beiden dachten, lagen weit auseinander. Fiel der Name Brühls im Beisein des preußischen Königs, pflegte dieser gewöhnlich Cicero zu zitieren: »Sie sind zu gut frisiert und duften zu anmutig, als daß ich sie zu fürchten hätte.« Im Hofgefolge des Königs hat sich auch Brühl nach Prag abgesetzt.
Für den erkrankten Herzog von Sachsen-Weißenfels, der sich vor Herzkrämpfen nicht mehr auf dem Pferd halten kann, hat der Generalfeldzeugmeister und Kavalleriegeneral August Friedrich Graf von Rutowski den Oberbefehl übernommen. Ein Sohn Augusts des Starken und der Türkin Fatime. Bereits um sechs Uhr war er aus seinem Quartier in Dresden aufgebrochen, die Schlachtordnung festzulegen. Da er von seinen Entscheidungen selbst nicht so recht überzeugt zu sein scheint, verbringt er den Rest des Vormittags damit, seine Anordnungen fortgesetzt zu korrigieren, zu verbessern natürlich, wie er meint. Einige Truppenteile müssen die Position mehrmals wechseln. Hier entscheidet ein Stratege des optischen Eindrucks. Das Rangieren und Herummarschieren von einem Fleck auf den andern, als seien die Truppen Figuren auf einem Schachbrett, erzeugen Rumor und steigern die Renitenz. Merkt doch selbst der einfältigste Fußtrapser, daß die Obrigkeit im Kriegshandwerk nicht ganz sattelfest ist.
Eine solche Atmosphäre ist nicht gerade dazu angetan, Siegeszuversicht zu entfachen. Weit problematischer jedoch ist, daß durch die Korrekturen die Stellung insgesamt nicht vorteilhafter ausgebaut wird. Der Weitblick und die Umsicht, die erforderlich gewesen wären, die zweiunddreißigtausend Soldaten – etwas mehr, als auf der Gegenseite anrücken – so günstig wie möglich zu placieren und mit Sachverstand zu dirigieren, stehen diesem Heerführer ganz einfach nicht zu Gebote. Die Liste seiner Fehlentscheidungen und Fehlbesetzungen, seiner Versäumnisse ist lang. Und da er gegenüber den eigenen Fehlern vollkommen blind ist, verzettelt und verheddert er sich mit jedem Zug. Ja, er verbaut die Vorteile regelrecht, die ihm das Terrain anbietet. Alles, was er tut, wirkt, wie von einem ambitionierten Schachspieler ausgeführt, bei dem es nur zu Halma reicht.
Sein Aufmarschplan läßt zu viele tote Winkel entstehen. Ein Umstand, der den um etliche Nasenlängen schnelleren Herren Preußen sehr wohl sogleich freudvoll ins Auge springt. Vorteile dieser Art wissen sie rasch in ihre Strategie einzubauen. So können sie sich an mehreren Stellen der Verteidigungslinie unbemerkt nähern, ohne ins Schußfeld zu geraten.
Die Gesamtlänge der Front beträgt eine ganze Meile. Das allein spricht für den Dilettantismus, mit dem die Generalität zu Werke ging. Ein nicht unerheblicher Teil des rechten Flügels, an dem vor allem die Kavallerie konzentriert ist, bleibt strategisch ohne Belang. Fast tote Zone. Wohl ist die Vorderstellung günstig gewählt.
Das Dorf auf den Höhen vor Dresden liegt wie eine natürliche Festung. Südlich des Dorfrandes fällt das Gelände jählings ab. Der Frost hat die zerklüfteten Schluchten zumindest für die Kavallerie und Artillerie unpassierbar gemacht. Von dort ist nichts zu befürchten. Die im Bereich des linken Flügels gelegenen kleineren Ortschaften bleiben unverständlicherweise unbesetzt. In der leichtfertigen Annahme, es werde dort gar nicht erst zum Kampf kommen, da eine offene Feldschlacht bevorstehe. Alles andere sei ohne Bedeutung. Weit gefehlt.
Die tausend Warasdiner Kroaten, die Steinbach besetzen sollten, sind aus unerfindlichen Gründen in Dresden auf der Neustädtischen Seite steckengeblieben. Niemand denkt daran, das zu überprüfen und die empfindliche Lücke noch rechtzeitig zu schließen. Das Loch in der Front wird viel zu spät bemerkt, nämlich erst dann, als sich die Preußen nähern und aus dem Dorf auf sie nicht ein einziger Schuß abgegeben wird. Als sich die sächsische Generalität dann auch noch zu streiten beginnt, welche drei Regimenter je hundert Mann dorthin zu entsenden haben, ist der Würfel gefallen. Die Preußen haben rasch disponiert.
Ein Nachrichtendienst auf sächsischer Seite existiert nicht. Für ein Zusammenspiel zwischen Infanterie und Kavallerie bestehen nicht einmal Ansätze. So etwas zu proben wurde nie in Erwägung gezogen. Ebenso war man viel zu erhaben, einen Rückzug für möglich zu halten und für einen solchen Fall irgendwelche Vorkehrungen zu treffen. Kuriere gibt es nicht. Fast alle Adjutantendienste verrichten die Befehlshaber selbst. Bis zu Rutowski und Diemar hinauf. So reiten denn die Generäle beständig im Gelände umher und machen schneidige Figur. Werden sie jedoch gebraucht, sind sie nicht zu erreichen. Wahnwitziger Leichtsinn, auf die Spitze des Fahnenschaftes getrieben. Unglaublichstes Bornement auf der ganzen Linie. Von wahrhaft blutigen Dilettanten der Kriegführung das gesamte aristokratische Offizierskorps durchwachsen.
Weder Rutowski noch die meisten seiner Offiziere kennen sich im Gelände richtig aus. Die Ortsnamen sind ihnen böhmische Dörfer. Von den Bezeichnungen der morastigen Gründe und bebuschten Hügelkuppen im Terrain ganz zu schweigen. Entsprechend sachkundig fallen dann die vom König verlangten Berichte über den Verlauf der Schlacht aus.
Am zweckvollsten sind noch die Infanterie und die Artillerie mit ihren zweiundvierzig schweren Geschützen postiert. Eine starke Batterie mit schweren und leichten Kanonen blockiert als vorgeschobene Befestigung von der Höhe aus den etwas tiefer gelegenen Dorfeingang von Kesselsdorf. Zweiundzwanzig der schweren Geschütze stehen weiter zurückgezogen auf dem Wüsteberg bei Pennrich, einer Anhöhe über dem Zschoner Grunde. Von hier aus ist das Gelände weit zu überblicken und einzusehen. Ein idealer Standplatz. Die Kavallerie hingegen als der schlagkräftigste Heeresteil ist völlig zersplittert worden durch Rutkowskis Arrangement. In sechsundvierzig Schwadronen geteilt, wird die Front überflüssiger- und verhängnisvollerweise unnötig in die Länge gezogen.
Während den übernächtigen Soldaten vor Hunger der Magen knurrt und vor Kälte die Zähne klappern, hat der Geheime Rat für gewisse Eventualitäten wohlweislich vorgesorgt, sosehr es auch ansonsten an militärischer Vorsorge mangelt. In aller Eile ist für den Fall einer Übergabe der Stadt ein 11-Punkte-Programm aufs Papier gesetzt worden. Nur die Unterschrift des Preußenkönigs sei noch nachzutragen, witzelt einer von den Räten zynisch am Mittagstisch. Die Frage sei nur, ob er im Falle des Sieges diese Punkte akzeptieren wird.
Das österreichische Korps der Rheinarmee konnte gerade noch rechtzeitig zurückbeordert werden und steht nun zwischen Briesnitz und Ockerwitz an den Hängen des Zschoner Grundes. In guter Deckung. Um an den rechten Flügel der Sachsen anzuschließen, hätte es etwa tausendfünfhundert Schritt vorrücken müssen. Frage einer, warum dies unterblieb, warum Rutowski ihre Hilfe nicht in Anspruch nahm! Noch am Vortage hatte der Herzog von Sachsen-Weißenfels, dessen Lebenslicht nur noch glimmte, seine militärische Laufbahn damit abgerundet, jedem österreichischen Grenadier sechsundzwanzig Patronen aus den bescheidenen Vorräten des Dresdener Magazins zuteilen zu lassen, da sich der eigene Munitionsvorrat wohl doch zu kümmerlich ausnahm. Aber am Ende blieb es gleich, ob den Soldaten vier oder dreißig Patronen in die Hand gedrückt wurden.