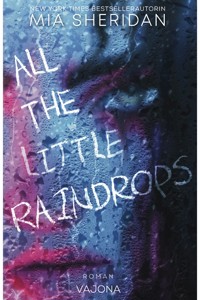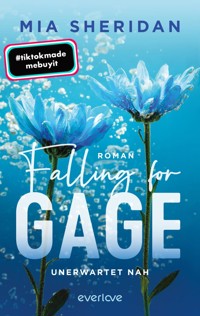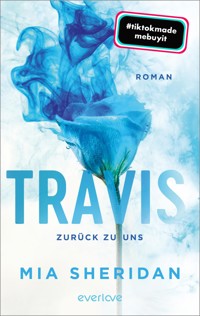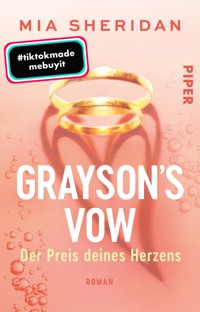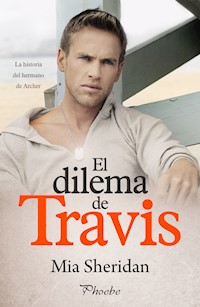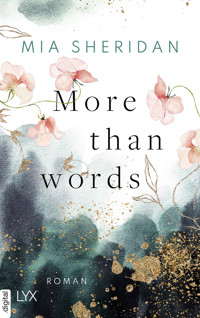
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Starkomponist. Bad Boy. Der Junge, den sie nie vergessen konnte.
Als Teenager teilten Jessie und Callen ihre Träume und Hoffnungen miteinander. Doch an dem Tag, als sie sich zum ersten Mal küssten, verschwand Callen einfach aus Jessies Leben. Jahre später erfährt sie, dass ihm der Durchbruch als Filmkomponist gelungen ist. Sie ahnt jedoch nicht, dass Callen auf dem Weg ist, sich selbst zu zerstören. Als sie sich zufällig in Frankreich treffen, ist die alte Anziehung sofort wieder da. Aber Jessie spürt, dass Callen im Innern genauso tief verletzt ist wie sie selbst. Damit ihre Liebe eine Chance hat, müssen sie sich den Dämonen ihrer Kindheit stellen, die sie damals voneinander getrennt haben ...
"Ich habe mich Hals über Kopf in dieses Buch verliebt. Ich habe schon beim Prolog Tränen vergossen. Jetzt muss ich alle anderen Bücher der Autorin lesen!" EYE HEART ROMANCE
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Prolog
Teil 1
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Teil 2
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Teil 3
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Mia Sheridan bei LYX
Leseprobe
Impressum
MIA SHERIDAN
More than Words
Roman
Ins Deutsche übertragen von Patricia Woitynek
ZU DIESEM BUCH
Als Teenager verbrachten Callen und Jessie eine kurze, aber wunderbare Zeit miteinander, fern von ihren Sorgen. In einem geheimen Zufluchtsort am Stadtrand teilten sie ihre Träume und Hoffnungen. Doch an dem Tag, an dem sie sich zum ersten Mal küssten, verschwand Callen einfach aus Jessies Leben. Jahre später erfährt sie, dass ihm der Durchbruch als Filmkomponist gelungen ist. Er gilt als Star und Bad Boy der Szene. Sie ahnt nicht, dass Callen auf dem besten Weg ist, sich selbst zu zerstören. Als sie sich zufällig in einer Bar in Paris treffen, verspürt Jessie sofort wieder die alte Anziehung, doch Callen ist betrunken und erkennt sie nicht. Verletzt und enttäuscht stürzt sich Jessie in ihre Arbeit – die Übersetzung eines mittelalterlichen Manuskriptes. Kaum in dem Schloss an der Loire angekommen, wo ihre Forschungsgruppe untergebracht ist, läuft sie als Erstes Callen über den Weg, der hofft, dort endlich die Inspiration für seine Musik wiederzufinden. Trotz des holprigen Starts in Paris verbringen sie einige magische Tage miteinander. Doch ihre Gefühle für Callen schüren in Jessie alte Ängste, und sie spürt, dass ihre Liebe nur eine Chance hat, wenn auch Callen sich endlich den Dämonen seiner Kindheit stellt …
Für Judy, die mir geholfen hat, die Federn zu sehen.
PROLOG
Jessica, elf Jahre
»Die Nacht war finster und …« Trockenes Gras raschelte unter meinen Füßen, als ich zögernd einen Schritt vorwärts machte. Stürmisch? Nee. Es wehte kein Lüftchen. Mit zusammengekniffenen Augen spähte ich zu der fahlen Mondsichel hinauf. Außerdem war es auch noch gar nicht richtig dunkel, der sommerliche Abendhimmel färbte sich gerade erst indigoblau. Irgendwo bellte ein Hund und verstummte wieder, dann waren nur noch meine Schritte zu hören. Sie schienen von überall her widerzuhallen, als wäre ich das einzige lebendige Wesen in diesen fremdartigen, tückischen Gefilden. »Trostlos«, vollendete ich den Satz schließlich im Flüsterton. Ich straffte die Schultern und nahm all meinen Mut zusammen. »Es war eine … düstere und trostlose Nacht, aber die Prinzessin setzte ihre Reise trotzdem tapfer fort. Ihr Prinz und Retter war dicht hinter ihr, daran glaubte sie von ganzem Herzen. Sie musste sich nur an dieser Hoffnung festhalten.«
Schwer atmend und mit hüpfendem Puls lief ich weiter. So weit hatte ich mich noch nie allein von zu Hause entfernt, nichts an der Umgebung schien mir vertraut. Wo bin ich nur? Während sich der Himmel stetig verdunkelte, flackerten in einiger Entfernung Lichter auf, und ich ließ mich von ihnen leiten wie von einem Wegweiser, einem Leuchtfeuer. »Am Himmel funkelten die Sterne, und die Prinzessin folgte den hellsten von ihnen. Sie vertraute fest darauf, dass sie sie an einen Ort führen würden, an dem sie Schutz fände …« Mein Magen knurrte derart laut, dass er sogar das abendliche Zirpen der Grillen übertönte. »Und Nahrung.«
Mit einer Hand umklammerte ich das Buch, das ich dabeihatte, während ich vorsichtig und mit der anderen Hand Halt suchend die Anhöhe erklomm, die wie eine Barriere zwischen mir und den hellen Lichtern – Straßenlaternen, wie ich jetzt erkannte – aufragte. »Obwohl die Prinzessin erschöpft war von ihrem Gewaltmarsch, bezwang sie mit letzter Kraft den Steilhang. Von dort oben würde sie sehen können, wo sie sich befand, und mit ein bisschen Glück sogar einen Blick auf ihren Prinzen erhaschen, der ihr auf seinem treuen Ross hinterhergaloppierte.«
Die Lichter kamen immer näher, und als ich am höchsten Punkt der Erhebung zwischen den Büschen auftauchte, fand ich mich vor einem Bahngleis wieder. Ich stieß keuchend den Atem aus und ließ meinen Blick schweifen, bis er unterhalb des Abhangs auf einem weiten Feld landete, das an einen Golfplatz angrenzte. Mir entfuhr ein erleichterter Seufzer, nun kannte ich mich wieder aus. Direkt hinter dem Golfplatz lag das Wohnviertel mit meinem Elternhaus. Wie hatte ich mich bloß so sehr in meiner Fantasiewelt verlieren können, ohne zu merken, dass ich eine derart weite Strecke zurückgelegt hatte?
Jetzt mach dich lieber mal auf den Heimweg!
Doch stattdessen blieb ich noch einen Moment dort oben stehen und schaute unverwandt in die Richtung, in der mein Zuhause lag. Im Kopf hörte ich immer noch das Schluchzen meiner Mutter, die ärgerliche Stimme meines Vaters, den Knall, mit dem mein jüngerer Bruder die Tür zuschlug, als er sich nach nebenan zu seinem Freund Kyle flüchtete. Ich will nicht dorthin zurück. Ohnehin würden sie mein Verschwinden erst in ein paar Stunden bemerken. Wenn überhaupt.
Also stapfte ich zurück zu den Gleisen. Unweit davon entfernt stand unbeachtet und vergessen ein ausgemusterter Güterwaggon. Ich spürte ein seltsames Kribbeln in der Magengegend, während ich ihn neugierig beäugte und dabei nervös von einem Fuß auf den anderen trat. »Die Prinzessin stieß unversehens auf eine Höhle und wurde auf geradezu magische Weise von ihr angezogen.« Karma.
Meine Schritte knirschten auf dem Schotter, als ich über die Schienen hinwegstieg und mich langsam dem Güterwagen näherte. Das abendliche Ständchen der Zikaden auf dem Feld unterhalb des Hügels drang nur noch gedämpft an mein Ohr, die ganze nächtliche Umgebung schien auf einmal von einer solchen Stille beseelt, als hielte die Welt den Atem an. Mein Herz schlug erwartungsvoll höher … aber in Erwartung wessen? Ich strich mit der Hand an der Außenwand des Waggons entlang, spürte kühles, glattes Metall unter meinen Fingerspitzen, als ich schließlich dem schwarzen Schlund der offenen Schiebetür immer näher kam. »Die Höhle war stockfinster, doch die Prinzessin ließ sich nicht davon entmutigen«, flüsterte ich fast lautlos. »Sie würde hier Rast machen, bis ihr Prinz sie eingeholt hätte. Er war jetzt schon ganz nahe, sie konnte es fühlen.«
Der Anblick, der sich mir bot, als ich vorsichtig den Kopf durch die Türöffnung steckte, ließ mir den Atem stocken und meine Augen riesengroß werden. An die gegenüberliegende Wand gelehnt, saß ein Junge, die langen Beine ausgestreckt, die Knöchel gekreuzt. Er schien zu schlafen. Mein Herz schlug wie wild in meiner Brust. Wer ist das? Eine der Straßenlaternen erhellte den dämmrigen Raum gerade so weit, um mich erkennen zu lassen, dass der Junge an der Lippe blutete und eines seiner Lider geschwollen war. Das dunkle Haar hing ihm in die Stirn, als könne er nicht die Kraft aufbringen, es zurückzustreichen. Sein Gesicht schien von Tränenspuren durchzogen und wies mehrere blaue Flecken auf. Was nichts daran änderte, dass er der hübscheste Junge war, den ich je gesehen hatte. Er war ein Prinz. Ein … gebrochener Prinz. Mir schwirrte der Kopf. Die Prinzessin hatte geglaubt, sie müsse auf ihren Prinzen warten … doch in Wahrheit verhielt sich die Sache genau umgekehrt: Der Prinz hatte die Schlacht überlebt und hielt sich nun in dieser pechschwarzen Höhle verborgen, bis er von ihr gerettet würde.
Er schlug die Augen auf, sie glänzten feucht. Sein Blick erfasste mich, und er starrte mich an, dabei ballten sich seine Hände zu Fäusten. Gleich darauf entkrampften sie sich wieder, als er sich gerade aufsetzte und mit gerunzelter Stirn die Tränen fortwischte.
Ich kletterte in den Waggon und stellte mich vor ihn hin, derart überrascht von meiner Entdeckung, dass mir die Knie zitterten. »Ich bin hier, um dich zu retten!«, brach es aus mir heraus.
Die Röte schoss mir in die Wangen, als ich begriff, dass ich die Worte laut ausgesprochen hatte. Er konnte ja gar nichts wissen von meinem Spiel; bestimmt hielt er mich für komplett durchgeknallt. Ich war viel zu tief in meine imaginäre Welt abgetaucht … andererseits brauchte er ganz eindeutig Hilfe. Vielleicht nicht unbedingt von einer vermeintlichen Prinzessin, aber doch von irgendwem.
Seine dunklen Brauen hoben sich, während er mich von oben bis unten musterte, bevor er mir geradewegs ins Gesicht sah. Er stieß ein leises Lachen aus, gefolgt von einem Seufzer. »Was du nicht sagst. Dann bin ich echt verratzt«, brummelte er.
Also so etwas. Das Mitleid, das ich eben noch für ihn empfunden hatte, verwandelte sich in Ärger. Es mochte ja sein, dass ich komplett durchgeknallt war, trotzdem verdiente ich es nicht, von ihm verspottet zu werden. »Ich bin stärker, als ich aussehe«, teilte ich ihm mit und richtete mich kerzengerade auf. In Sachen Körpergröße belegte ich unter meinen Klassenkameradinnen den fünften Platz.
Der Junge strich sich mit einem herablassenden Lächeln die Haare aus der Stirn. »Na klar. Was hast du eigentlich hier verloren? Hat dir niemand gesagt, dass kleine Mädchen sich nicht spätabends allein in der Nähe von Bahngleisen herumtreiben sollten?«
Ich trat tiefer in den Raum, ließ den Blick über die mit Graffiti besprühten Wände wandern. An einer von ihnen standen irgendwelche Sprüche, und ich beugte mich vor, um sie zu entziffern. »Lies die lieber nicht«, empfahl er mir. Ich wandte ihm den Kopf zu und schaute ihn fragend an. »Sind vermutlich nicht jugendfrei.« Vermutlich? Haha. Als wüsste er nicht, was sie besagten.
Ich räusperte mich und beschloss, seinen Rat dennoch zu befolgen. Jedenfalls vorerst. Allem Anschein nach handelte es sich um schmutzige Wörter. Ich würde irgendwann noch einmal herkommen und sie lesen, wenn ich allein wäre. Vielleicht würde ich sie mir sogar einprägen, einfach nur so zum Spaß. »Du siehst nicht aus, als wärst du viel älter als ich«, behauptete ich, obwohl ich ihn in Wahrheit nur schwer einschätzen konnte. Wenn ich raten müsste, würde ich auf einen Achtklässler tippen … andererseits war da dieser Ausdruck in seinen Zügen – seinen Augen –, der ihn deutlich älter wirken ließ.
»Der Unterschied ist der, dass ich ein Junge bin und darum auf mich selbst aufpassen kann.«
Nur wies sein ramponiertes Gesicht eher darauf hin, dass es mindestens einen Menschen in seinem Leben geben musste, vor dem er sich nicht zu schützen vermochte. »Hmm. Sag schon, wie alt bist du?«
Er zog die Stirn kraus und schwieg, bis ich schon dachte, er würde nicht antworten. »Zwölf.«
Ich lächelte. »Und ich bin elfeinhalb. Ich heiße übrigens Jessica Creswell.« Ich ging in die Hocke und stützte die Hände auf den Oberschenkeln auf.
Er betrachtete mich einen langen Moment, so als wüsste er nicht recht, was er von mir halten solle. Plötzlich unsicher geworden, blickte ich zur Seite und zupfte mit den Zähnen an meiner Unterlippe. Mir war bewusst, dass ich nicht zu den allerhübschesten Mädchen zählte. Meine Haare wiesen die gleiche fade hellbraune Farbe auf wie meine Augen, meine Nase und Wangen waren mit Sommersprossen übersät – meinem Versuch, sie mit Zitronensaft wegzuzaubern, hatten sie eisern widerstanden –, außerdem war ich furchtbar dünn. Die Mädchen an meiner elitären französischen Schule ließen keine Gelegenheit aus, mich an die knochige Beschaffenheit meiner Knie oder den ärgerlich widerspenstigen Wirbel an meinem Haaransatz zu erinnern. Wenn ich versuchte, ihn mit dem Haargel meiner Mutter zu bändigen, stand er gleich darauf wieder zipfelig vom Kopf ab. Ein hoffnungsloser Fall.
»Jetzt raus mit der Sprache, Jessica Creswell. Was machst du hier?«
Ich nahm eine bequemere Stellung ein, indem ich mich auf meinen Hintern zurücksinken ließ, mich an die Wand gegenüber der des Jungen lehnte und die Knie vor die Brust zog. »Hab mich irgendwie verlaufen. Aber jetzt kenne ich mich wieder aus und weiß, wie ich zurückfinde.«
»Dann ab nach Hause mit dir.«
Ich kniff die Lippen zusammen, schon bei dem Gedanken wurde mir ganz mulmig.
Winzige Fältchen erschienen in seinen Augenwinkeln, während er mich aufmerksam beobachtete und mich damit nur noch nervöser machte. »Magst du dein Zuhause nicht, Jessie?«
Jessie. So hatte mich noch nie jemand genannt. Mir flatterte das Herz, weil ausgerechnet dieser gut aussehende Junge mir einen Kosenamen gab, noch dazu einen, der mir gut gefiel. »Ich … nein, eigentlich nicht besonders. Meine Eltern streiten viel.« Ich wusste selbst nicht recht, warum ich ihm das anvertraute, zumal er ein Fremder für mich war. Es musste an der traumartigen Atmosphäre in dem halbdunklen Güterwagen liegen, an dieser Begegnung, die so surreal anmutete, als würde meine Fantasie in gewisser Weise wahr werden. Als würde das, was hier gesprochen wurde, diese Wände niemals verlassen.
Er seufzte wieder und sah zur Seite, an mir vorbei. »Ich verstehe«, sagte er und klang dabei so, als täte er das wirklich. Ich wollte ihn gerade fragen, ob seine Eltern sich auch oft zankten, als er mit dem Kinn auf das Buch wies, das ich neben mich gelegt hatte.
»Wovon handelt es?«
»Von König Artus und den Rittern der Tafelrunde.«
Er legte den Kopf schräg. »Du magst Märchen, oder, Jessie?«
Ich nickte, dabei musste ich unwillkürlich an meine Eltern denken, daran, wie meine Mutter meinen Bruder und mich zu den unmöglichsten Zeiten in Hotels und Restaurants und in Dads Büro schleifte, um ihn dort mit seinen wechselnden Freundinnen zu ertappen. Daran, wie die Augen des kleinen Johnny anfangs immer aufleuchteten und er überglücklich »Hallo, Daddy!« rief, wenn wir unseren Vater schließlich aufgespürt hatten. Woraufhin Dad eine verlegene Grimasse schnitt, während seine jeweilige Affäre entweder schockiert dreinschaute oder den Eindruck erweckte, am liebsten im Erdboden versinken zu wollen. Ich wäre jedes Mal innerlich fast vor Scham gestorben. Der Zorn meiner Mutter entlud sich in heftigen Weinkrämpfen, trotzdem kam Dad nur in den seltensten Fällen mit uns nach Hause. Meistens schlug er uns einfach die Tür vor der Nase zu oder fuhr davon und ließ uns sprichwörtlich im Regen stehen.
Mein Bruder war inzwischen neun und schämte sich genau wie ich halb zu Tode, wann immer wir unseren Vater mit einer seiner Freundinnen erwischten.
Während Mom schluchzte und zeterte und Johnny und ich uns unsichtbar zu machen versuchten, gab Dad Versprechen ab, die niemand für bare Münze nahm. Nicht einmal er selbst.
Märchen halfen mir, weil sie mich in dem Glauben bestärkten, dass nicht jeder Mann so war wie mein Vater. Durch sie fand ich Zugang zu Welten, die von ehrenhaften Prinzen und tapferen Prinzessinnen bevölkert waren.
»Ja, ich mag solche abenteuerlichen Geschichten. Eines Tages werde ich mich in das größte Abenteuer überhaupt stürzen. Ich habe nämlich vor, nach Paris zu ziehen, mich in einen Franzosen zu verlieben, der mir die allerwundervollsten Liebesbriefe schreibt, und den ganzen Tag lang französische Schokolade zu naschen.«
»Dann wirst du bestimmt bald ein ziemlicher Moppel sein.«
Ich zuckte die Achseln. »Ist mir egal. Wen stört das schon.«
Der Junge lachte in sich hinein, und in meinem Bauch stieg ein Schwarm Schmetterlinge auf. Sein Lächeln machte ihn sogar noch hübscher. Als ich ihn mir jetzt genauer ansah, fiel mir zum ersten Mal auf, dass seine Kleidung abgetragen, sein Sweatshirt eine Nummer zu klein war und sich an einem seiner Schuhe die Sohle löste. Er stammte ohne Zweifel aus ärmlichen Verhältnissen, ein Gedanke, der ein Gefühl von Zärtlichkeit in mir aufkommen ließ.
»Du hast mir deinen Namen noch nicht verraten«, erinnerte ich ihn freundlich und rückte ein Stückchen näher an ihn heran.
Er starrte mich sekundenlang an, bevor er gleichmütig mit den Schultern zuckte und sagte: »Callen.«
»Calvin?«
»Nein, Callen.«
Der Name gefiel mir, ich mochte seinen Klang. »Callen«, echote ich und verstummte für einen Moment. »Bist du in eine Prügelei geraten?« Mein Blick glitt von seiner aufgeplatzten Lippe zu seinem rot unterlaufenen, geschwollenen Auge.
»Kann man so sagen.«
»Wer war dein Gegner?«
Er schaute kurz weg und gleich darauf wieder zu mir hin. »Irgend so ein Schlägertyp.«
Ich nickte verständnisvoll. »Ach so. Na hoffentlich kannst du ihm in Zukunft aus dem Weg gehen.«
Er quittierte das mit einem heiseren Lachen. »Nein, Jessie, das wird leider nicht möglich sein, aber es ist schon okay. Die Verletzungen machen mir nichts aus.«
Ich runzelte die Stirn, mir wollte einfach nicht einleuchten, wie ein Mensch es okay finden konnte, ins Gesicht geschlagen zu werden. Ich öffnete den Mund, um etwas sagen, als Callen den Arm ausstreckte, das Buch aufhob und das Bild auf dem Umschlag betrachtete. Er drehte es herum und las die Zusammenfassung auf der Rückseite. »Du kannst Französisch?«, fragte ich perplex.
Sein Blick flog zu mir, und der Ausdruck seines Gesichtes war nicht recht zu deuten. »Nein, das nicht. Ich war nur neugierig, in welcher Sprache es geschrieben ist.«
Ich rutschte noch näher zu ihm hinüber und lehnte mich mit dem Rücken an dieselbe Wand wie er. »Soll ich den Text für dich übersetzen? Ich gehe auf eine französische Schule, und dort dürfen wir nur Bücher auf Französisch lesen.«
»Wirklich?«
Ich nickte. »Jedes Fach wird auf Französisch unterrichtet. Damit wir lernen, die Sprache fließend zu beherrschen.«
»Respekt.« Er schaute mich mit schräg gelegtem Kopf an. »Dann kannst du irgendwann wirklich in Paris leben und ein Moppel werden.«
Ich musste lachen. »Stimmt genau.«
Sein Lächeln ließ die Schmetterlinge in meinem Bauch erneut aufstieben.
»Dann leg mal los und lies mir vor, Prinzessin Jessie.«
In jenem Sommer spazierte ich Tag für Tag durch unser Wohnviertel, über den Golfplatz und das Feld und dann die Anhöhe hinauf zu den Bahngleisen.
Wann immer ich Callen dort antraf, las ich ihm vor, oder wir erlebten gemeinsam Abenteuer. Er tat so, also würde er sich nur mir zuliebe auf die Rollenspiele einlassen, aber er lächelte öfter als gewöhnlich, wenn wir uns in das Reich der Täler des Todes begaben, um dort die Vulkane zu erkunden, oder in den Ewigen Gefilden magische Kräuter pflückten.
»Du solltest dich hier nicht allein aufhalten, Jessie«, brummelte er eines Nachmittags, nachdem ich ihm erzählt hatte, dass ich mich am Vortag ohne ihn an unserem Treffpunkt aufgehalten hatte. »Man kann nie wissen, wer sich in der Gegend herumtreibt.«
»Ich habe hier noch nie jemand anderen gesehen als dich.«
»Trotzdem.« Sein Blick folgte den Gleisen bis zu einer Kurve, wo sie in einem dichten Wäldchen verschwanden. »Die Typen, die bei diesen alten Waggons herumlungern, sind normalerweise da hinten, aber man kann, wie schon gesagt, nie wissen.«
Callen war einen ganzen Kopf größer als ich, und als ich jetzt zu ihm hochschaute, bemerkte ich den Bluterguss unter seinem Kinn. »Aber wie soll ich denn erraten, wann du hier sein wirst?«
Er stopfte die Hände in die Hosentaschen und wandte sich mir zu. »Eigentlich bin ich auch nicht der richtige Umgang für dich.«
Mir sank das Herz in die Hose vor lauter Angst, er könne mich satthaben, mich wegschicken. »Da irrst du dich gewaltig!«, widersprach ich energisch. »Du bist der wunderbarste Mensch, den ich kenne.«
Er sah mir in die Augen und bedachte mich mit einem süßen, sanften Lächeln, das ihn noch jünger wirken ließ, als er war. Dann seufzte er und richtete seinen Blick in die Ferne. Vielleicht wohnte er dort irgendwo, ich wusste es nicht. Jedenfalls war sein Lächeln erloschen, bis er wieder zu mir herschaute und fragte: »Wollen wir uns ab jetzt jeden Dienstag und Donnerstag um sieben hier treffen?«
Das wäre nach dem Abendessen, wenn mein Vater zu einem »unerwarteten« Geschäftsmeeting abkommandiert würde, bei dem es sich in Wahrheit um irgendeine in einem Hotelzimmer wartende Frau handelte, und meine Mutter weinend eine Flasche Wein entkorkte, weil Johnny und ich inzwischen zu alt waren, um uns widerstandslos kreuz und quer durch die Stadt hetzen zu lassen. »Abgemacht. Und außerdem samstags um drei?«
Er schwieg einen Moment, dann verzog er den Mund zu einem schiefen Grinsen, und mein Herz schlug Purzelbäume. »Und außerdem samstags um drei.«
Ein Jahr war seit unserer ersten Begegnung vergangen, als wir an einem kühlen Herbsttag dicht beieinander im Güterwagen saßen und ich Callen mit Atemwölkchen vor dem Mund den französischen Text von Robin Hood übersetzte. Er unterbrach mich, indem er die Hand nach meinem Rucksack ausstreckte und ein Blatt Papier herauszog. Sowie er es überflogen hatte, richtete er sein Augenmerk auf mich. »Was ist das?«
Ich legte das Buch beiseite, hob den Kopf und sah ihn an. »Klavierstücke.«
Er guckte wieder auf das Blatt, dann hielt er es mir vor die Nase und tippte mit dem Finger darauf. »Sind das hier Noten?«
»Ja«, bestätigte ich verdutzt. »Hast du so etwas noch nie gesehen?«
»Nicht in dieser Form, nein.« Er sprach hastig und mit einem seltsamen Unterton in der Stimme. »Wie heißt diese hier?«, fragte er und zeigte auf die erste Note.
»Ähm, das ist ein E.«
»Ein E?« Er kniff die Brauen zusammen. »So wie der Buchstabe?«
Ich überlegte. »Einerseits ja, andererseits nein. Der Unterschied ist der, dass es sich um ein Musikzeichen handelt … und damit sozusagen um eine andere Sprache.« Ich lächelte ihn an, doch er hatte sich bereits wieder mit hoch konzentrierter Miene in das Blatt vertieft. Nach einer Weile glätteten sich seine Gesichtszüge. »Diese Note ist ein E und diese und diese ebenso«, sagte er und deutete jeweils darauf.
Ich senkte zustimmend den Kopf, konnte seine Aufregung nicht ganz begreifen. Seit wir uns kannten, hatte ich bei ihm nur zwei Gemütslagen beobachtet: mürrisch oder verhalten glücklich. Sein ungewohnter Enthusiasmus ließ eine irrationale Eifersucht in mir aufsteigen. »Völlig richtig.«
Er nickte heftig, und ich sah, wie seine Halsschlagader unter der glatten, gebräunten Haut pulsierte. »Was ist das da?«
Mein Blick folgte seinem Finger. »Ein Violinschlüssel. Er legt die Tonhöhe auf den Notenlinien fest.«
Callen kräuselte die Stirn, und ich schob hastig eine nähere Erklärung hinterher. »Mit anderen Worten, wie hoch oder tief eine Note klingen soll.«
Als er wieder nickte, stand in seinen geweiteten Augen ein Leuchten, auf das ich mir keinen Reim machen konnte. Es konnte nicht allein auf seine Aufregung zurückzuführen sein, er wirkte … wie vom Schlag getroffen. Weil es ihm gelang, diese ihm fremde »Sprache« zu entziffern? Ich hatte Callen schon oft dabei ertappt, wie er unsere Rollenspiele musikalisch untermalte, indem er leise vor sich hin summte – düstere, unheilvolle Klänge, wenn wir einem Schurken auf der Spur waren, helle, fröhliche, wenn wir durch eine Wiese voll magischer, sprechender Glockenblumen liefen. Manchmal brachte mich eine bestimmte Melodie zum Lächeln, worauf er mich jedes Mal überrascht anblinzelte, als hätte er gar nicht bemerkt, dass sie nicht nur in seinem Kopf zu hören war. Jetzt schaute er hoch, und als unsere Blicke sich trafen, durchrieselte mich ein wohliger Schauder. »Hast du noch mehr davon?«
»Mehr Klavierstücke?«
»Ja.«
»Äh, na klar. Wenn du willst, kann ich nächstes Mal außerdem mein Keyboard mitbringen. Ich habe extra eine Tragetasche dafür.«
»Oh ja, mach das«, stieß er atemlos hervor. Er nahm meine Hand und drückte sie, und wieder lief mir ein Prickeln über die Haut. Plötzlich fühlte ich mich ein bisschen verlegen, gleichzeitig entzückte es mich, wie überglücklich er auf einmal wirkte. Ich würde alles dafür geben, um ein weiteres Mal dieses freudige Strahlen in seinen klaren grauen Augen zu sehen.
Und so lief ich zwei Tage später ganz hibbelig vor Aufregung mit der Keyboardtasche in der Hand über das Feld und hinauf zu den Bahngleisen. Callen lauschte mir mit ehrfurchtsvoller Miene, während ich ihm die einzelnen Tasten erklärte. Ich war alles andere als eine begnadete Klavierspielerin, aber zumindest hatte ich die Grundlagen erlernt, und diese gab ich nun an Callen weiter – zusammen mit dem Keyboard, an das ich fast nicht mehr gedacht hatte, so lange lag es schon unbenutzt in meinem Schrank herum.
Überraschenderweise entpuppte er sich als musikalisches Naturtalent, und so war er nach wenigen Monaten bereits besser, als ich es jemals sein würde, dabei übte ich jede Woche meinem Gefühl nach Stunden – in Wirklichkeit waren es maximal dreißig Minuten – auf meinem Schimmel-Piano.
Eines Tages, es war noch immer dasselbe Jahr, tauchte er wieder einmal mit lädiertem Gesicht auf. Sichtlich wütend ließ er sich auf den Boden fallen und den Kopf schwer gegen die Wand sinken. »Könntest du mir heute etwas vorlesen, Jessie?«
Ich nickte und holte das Buch, das ich gerade las, aus meinem Rucksack. »Klar«, sagte ich und schlug Die drei Musketiere auf. Nach ein paar Absätzen hielt ich inne und sah Callen an. Er hatte die Augen geschlossen, und der Zorn in seiner Miene war tiefer Niedergeschlagenheit gewichen. Ich nahm all meinen Mut zusammen. »Wirst du von deinem Vater misshandelt?«, fragte ich ihn sanft.
Er schlug die Lider auf, blickte mich jedoch nicht an. Zuerst sah es so aus, als wollte er nicht antworten, und mir schlug das Herz bis zum Hals vor Sorge, er könnte mir die Frage übel nehmen und verschwinden. »Ja«, bestätigte er schließlich.
Mein Herz krampfte sich zusammen, und ich stieß laut den Atem aus.
Er sah mich an, ließ den Blick auf meinem Gesicht ruhen. »Die Schläge kann ich wegstecken … es sind die Erniedrigungen, die … Ach, egal.«
Verzweifelt wünschte ich mir, er möge weitersprechen, nur wusste ich nicht, wie ich ihn dazu bringen sollte. Ich räusperte mich. »Mein Dad ist ebenfalls keiner von der guten Sorte.« Meine Stimme war nur ein Flüstern, als befürchtete ich, von jemandem belauscht zu werden, den ich davor bewahren wollte, dieses Eingeständnis zu hören. Vielleicht sogar mich selbst. Ich kannte die Wahrheit schon, solang ich denken konnte, aber sie laut auszusprechen, machte sie zu einer unumstößlichen Tatsache. Von nun an würde ich mir nie wieder etwas vormachen können. Mein Vater war ein schwacher, selbstsüchtiger Mensch, der uns nicht genügend liebte, falls er es überhaupt tat.
Callen ergriff meine Hand, und mein Blick huschte zu unseren verschränkten Fingern, meine zart und blass, seine rau und sonnengebräunt und viel länger als meine. Ich schluckte und fuhr fort, während meine Augen auf unseren Händen verweilten. »Das Schlimmste ist, dass meine Mutter nicht aufhören kann, ihn zu lieben. Ganz gleich, wie oft er sie zum Weinen bringt, sie kommt einfach nicht von ihm los. Ich begreife nicht, wie jemand so viele Tränen in sich tragen kann.«
Ich hob den Kopf und fing seinen Blick auf. Obwohl auch Callen mir ein Geheimnis anvertraut hatte, fühlte ich mich auf einmal befangen. Ich biss mir auf die Lippe und schaute weg. »Ist das der Grund, warum du Märchen so sehr magst, Jessie?« Er fragte das ganz sanft, mit einem fast zärtlichen Unterton in der Stimme, dennoch wurde mir nur noch unbehaglicher zumute. Sacht drückte er meine Hand. Ich war hin- und hergerissen zwischen dem Bedürfnis, sie ihm zu entziehen, und dem Wunsch nach noch mehr Nähe. Diese widerstreitenden Gefühle waren neu und verwirrend für mich, aufregend und furchteinflößend zugleich.
»Wir haben unsere Rollenspiele schon seit einer ganzen Weile nicht mehr gespielt«, entgegnete ich kopfschüttelnd. Anstatt in Abenteuerwelten einzutauchen, las ich Callen vor oder erledigte meine Hausaufgaben, während er, die Stirn vor Konzentration gefurcht, fragmentarische Melodien auf dem Keyboard erschuf, die so schön waren, dass mir das Herz aufging. Oft verloren sie sich im Nichts, so als würden sie ihm entgleiten oder als wüsste er nicht, wie er sie vollenden sollte.
Seine vollen Lippen formten sich zu einem Lächeln. »Manchmal fehlen sie mir.«
Ich lächelte. »Im Ernst?«
»Jepp. Ich habe mich dann immer wie ein Held gefühlt.«
»Weil du einer bist«, versicherte ich ihm leise. »Jedenfalls für mich.«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, Jessie. Ich bin kein Held. Gott, ich tauge ja nicht einmal …«
»Zu was? Wozu taugst du laut deinem Dad nicht?« Ich verspürte den übermächtigen Drang, Callen zu beschützen, denn für mich stand außer Frage, dass niemand anders als sein Vater an dem kummervollen Ausdruck in seinen Augen Schuld hatte.
Seine Reaktion bestand in einem humorlosen Lachen. »Er ist einfach nur ehrlich.«
»Unsinn! Am liebsten würde ich ihm einen Besuch abstatten und ihm gründlich die Meinung –«
»Wage es ja nicht!« Seine Stimme war so kalt und schneidend, dass rote Flecken auf meinen Wangen erblühten und mir die Tränen in die Augen schossen, während ich ihn fassungslos anstarrte. Noch nie zuvor hatte er mich derart barsch in die Schranken gewiesen.
»Ich … ich würde bestimmt nichts tun, das –«
Er beugte sich so abrupt vor, dass ich aufkeuchte, dann lagen seine warmen, weichen Lippen auf meinen und sandten eine flimmernde Hitze durch meinen Leib. Ich war verwirrt, wusste nicht, was ich tun sollte, weil ich zum einen noch nie geküsst worden war und zum anderen eine wenig kusstaugliche Zahnspange trug.
Callen verschränkte die Finger fester mit meinen, während er mit der anderen Hand meinen Nacken umfasste und mich noch näher zu sich heranzog, um zärtlich mit seinem Mund über meinen zu streichen. Mir entschlüpfte ein leises Seufzen, als seine Zunge sich schüchtern zwischen meine Lippen schob und ich sie instinktiv einließ.
Er zuckte zusammen, als habe er damit nicht gerechnet. Ich schlug die Augen auf und stellte fest, dass auch seine geöffnet waren. Unsere Blicke hielten einander sekundenlang fest, bevor unsere Lider wieder zugingen und ich mir vage bewusst wurde, wie laut und stürmisch mein Herz pochte. Er näherte sich mir wieder und drang ganz leicht mit der Zungenspitze in meinen Mund vor, wo ich sie mit meiner eigenen willkommen hieß, indem ich sie neckend antippte und mich wieder zurückzog. Ein Tumult der Gefühle brach in mir los: Aufregung, Nervosität, Entzücken, Furcht. Er knabberte sacht an meinen Lippen, und ich staunte über diese sinnliche Empfindung, die mir ein Stöhnen entlockte, bekam nicht genug vom Geschmack seines Mundes, Callens Duft, den ich jetzt, da er mir so nah war, als eine Mischung aus Zimt, Salz und Seife identifizierte. Er roch nach Teenager. Nach meinem Prinzen.
Als er sich schließlich zurückzog, fühlte ich mich benommen und wie in Trance, losgelöst von Zeit und Raum. Blinzelnd kehrte ich in die Gegenwart zurück und bedachte ihn mit einem scheuen Lächeln, das er mit einem schiefen Grinsen beantwortete. »Bei niemandem fühle ich mich so gut wie bei dir, Prinzessin Jessie. Und daran wird sich auch nie etwas ändern.«
Es sollte unser letzter Kuss gewesen sein.
Nach jenem Tag tauchte Callen nie mehr bei den Bahngleisen auf. Ich wartete dort jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag auf ihn, hoffte verzweifelt darauf, ihn wiederzusehen. Ich hatte keine Ahnung, wo ich anfangen könnte, nach ihm zu suchen. Santa Lucinda, die nordkalifornische Stadt, in der wir lebten, war dafür viel zu groß, und ich kannte nicht einmal Callens Nachnamen.
Mein einziges Andenken an ihn war eine Reihe von Musiknoten, festgehalten auf einem Fetzen Papier, den ich in einer Ecke des Güterwagens gefunden hatte. Während Woche um Woche verstrich, zermarterte ich mir das Hirn, welchen Grund es dafür geben könnte, dass er sich nicht mehr blicken ließ. Hatte ich irgendetwas falsch gemacht? Hatte er es furchtbar gefunden, mich zu küssen? Oder sich hinterher geschämt? Hatte sein Vater ihm etwas Schreckliches angetan? Ich brauchte so dringend Antworten auf meine Fragen und würde sie doch nicht bekommen.
Nachdem ich ein ganzes Jahr lang auf seine Rückkehr gehofft hatte, saß ich an einem spätsommerlichen Dienstagabend in der offenen Tür unseres Waggons und sagte meinem verschollenen Helden – meinem gebrochenen Prinzen – still und leise Lebewohl. Danach wischte ich mir die Tränen von den Wangen und kam nie wieder zurück.
TEIL 1
Uns ist nur dieses eine Leben gegeben, und wir leben es, weil wir daran glauben. Doch zu opfern, was uns ausmacht, und ohne Glauben zu leben, ist ein Schicksal, grausamer als der Tod.
Jeanne d’Arc
1. KAPITEL
Callen
Zehn Jahre später
Ich leerte mein Schnapsglas in einem Zug und verzog das Gesicht, als der Tequila mir wie flüssiges Feuer die Kehle hinabrann. Ich stand nicht auf das Zeug, aber die Runde ging auf Larry, meinen Agenten, und da konnte ich schlecht ablehnen. Was gelogen war. Weil ich verdammt noch mal tun und lassen konnte, was ich wollte. Aber wozu diesen Edelstoff vergeuden?
Ich biss in den dazugehörigen Zitronenschnitz und saugte ihn aus, die Säure half gegen das nachklingende Brennen in meinem Hals. Für einen kurzen Moment verschwamm mein Blickfeld, dann wurde der Raum um mich herum wieder scharf. Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück, hatte schon jetzt zu viel getrunken, aber ich mochte dieses warme, taube, vertraute Gefühl. Zu vertraut, ermahnte mich eine innere Stimme, die ich sofort ausblendete.
Ich achtete nicht auf die Gespräche an meinem Tisch, sie waren reine Geräuschkulisse; stattdessen scannte ich die Bar, bis mein Blick auf einer brünetten Kellnerin landete, die ganz in der Nähe mit einem Tablett an einem Tisch stand und einem älteren Herrn ein Glas Wein servierte. Sie bemerkte, dass ich sie anstarrte, riss die Augen auf und schaute hastig weg. Mein Herz machte einen Satz, und ich hatte das Gefühl, als würde eine elektrische Schockwelle durch meine Wirbelsäule schießen. Ich runzelte die Stirn, wunderte mich selbst über meine Reaktion. Das Mädchen richtete sich kerzengerade auf und sagte etwas zu dem Paar an dem Tisch, erhielt ein Lächeln. Dann wandte sie sich ab und ging davon, ohne mich noch eines Blickes zu würdigen. Gebannt beobachtete ich, wie sie den Tresen ansteuerte, dabei fragte ich mich, was mich an ihr so sehr faszinierte. Sie war hübsch, aber eigentlich nicht ganz mein Typ. Ich stand mehr auf große, gertenschlanke Blondinen … oder etwa nicht? Ein verwirrender Gedanke. Plötzlich schien ich meine eigenen Vorlieben nicht mehr zu kennen, mich nicht daran erinnern zu können, welche Vorzüge eine Frau haben sollte, außer dass sie verfügbar war.
Ich massierte meine Schläfen, um die heraufziehenden Kopfschmerzen zu verjagen, konnte die Augen aber noch immer nicht von dem Mädchen losreißen. Sie war definitiv nicht gertenschlank. Und auch nicht blond. Sie war weder groß noch klein, sondern von durchschnittlichem Körperwuchs, trug ihr Haar zu einem unordentlichen Pferdeschwanz gebunden, kein Make-up, soweit ich das erkennen konnte, und eine unvorteilhafte Kellnerinnenuniform. Und trotzdem konnte ich einfach nicht aufhören, sie anzustarren.
»Wo bist du gerade?«, schnurrte Charlène, meine letzte große, blonde, gertenschlanke Eroberung, in mein Ohr und fuhr mit der Hand an der Innenseite meines Schenkels entlang. Sie sprach mit einem starken französischen Akzent und roch nach einem nicht minder starken süßlichen Parfum.
Ich schenkte ihr ein träges Lächeln. »Hier, Baby. Wo denn sonst?«
»Aber nicht gedanklich.« Ihre Hand wanderte höher, bis knapp unterhalb meines Schritts, und mein Glied zuckte in der Hose. Mein Körper war ganz bei Charlène, auch wenn meine Gedanken es nicht waren.
Ich riss den Blick von dem Mädchen los, das sich gerade über den Tresen beugte, um mit dem Barkeeper zu sprechen, und richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf meine Begleiterin. Der Kontrast zwischen Charlènes mondäner Schönheit und den frischen, unaufdringlich hübschen Gesichtszügen der Kellnerin hätte größer nicht sein können, umso verwunderlicher war mein Drang, dieses Mädchen erneut mit den Augen zu verschlingen. Anstatt der Versuchung nachzugeben, sah ich zu, wie Charlène aufreizend die Beine übereinanderschlug, sodass der Schlitz ihres schwarzen Abendkleids aufklaffte und ihre seidig glatten, leicht gebräunten Schenkel enthüllte.
Ich schaute lächelnd hoch und konzentrierte mich wieder auf unseren Small Talk, versuchte mir wenigstens ein bisschen Mühe zu geben, sonst würde sie mich später bestimmt nicht ranlassen.
»Hier, guck mal!« Charlène reichte mir ihr Handy. Sie hatte eine Klatsch-Website hochgeladen, auf der ein Foto von uns beiden zu sehen war. Es stammte von der Preisverleihung, auf der wir uns vorhin zum ersten Mal begegnet waren. »Was sagst du zu deinem neuen Titel?«, fragte sie leise lachend und zeigte auf die Bildunterschrift.
Ich warf einen flüchtigen Blick darauf, bevor ich ihr das Handy mit einem ironischen Lächeln zurückgab. »Man hat mich schon Schlimmeres genannt.«
»Und ich dachte, du würdest dich freuen.«
Dukennstmichüberhauptnicht.WoherzurHöllewillstduwissen,wasmichfreutundwasnicht? Ich schaute mich in der Bar um, fühlte mich plötzlich wie eingesperrt. Vollidiot. Schwachkopf. Armleuchter. »Klar, freu ich mich«, murmelte ich.
Charlène seufzte und strich sich mit der Hand durchs Haar. »Du bist wirklich sonderbar, Callen Hayes. Welcher Mann würde es nicht genießen, als das Sexsymbol der Musikbranche zu gelten?«
Unerwartet brachte unser Kellner eine weitere Runde an den Tisch und stellte vor jeden von uns ein Schnapsglas mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit. Ich war dankbar für die Unterbrechung. »Lieber Himmel, noch mehr von dem Zeug?«, stöhnte Larry, der dann allerdings nicht zögerte, sich sein Glas zu schnappen und genüsslich daran zu schnuppern. An einem seiner Nasenlöcher haftete noch etwas weißer Puder von seinem letzten Ausflug auf die Toilette. Ich überlegte kurz, ihn dezent darauf aufmerksam zu machen, unterließ es dann aber. Hier juckte das keinen.
»Es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass ein klassischer Komponist den Poirier Award gewinnt«, bemerkte Larrys Frau Annette mit einem schmalen, säuerlichen Lächeln in meine Richtung. Anschließend bedachte sie Charlène mit einem frostigen Blick und prostete mir zu. »Auf Callen, der in allem, was er anpackt, ausnahmslos très bon ist!« Anzüglich grinsend bog sie ihren langen, eleganten Hals zurück und kippte ihren Drink. Verstohlen warf ich einen Blick zu Larry. Er hatte von dem Ganzen nichts mitbekommen, war abgelenkt von irgendeiner witzigen Bemerkung seines Tischnachbarn.
Ich nickte Annette mit hochgezogenen Brauen zu, dann leerte ich mein eigenes Glas und lockerte meine Fliege, in der Hoffnung, zum ersten Mal seit Stunden wieder richtig Luft zu bekommen. Das Dinner war ermüdend gewesen, die Preisverleihung stinklangweilig, und den Abend mit diesen selbstverliebten, oberflächlichen Menschen ausklingen zu lassen gab mir endgültig den Rest. Der Witz an der Sache? Ich war genau wie sie, nicht einen Deut besser. Verdammt, ich wünschte, ich könnte sie einfach sitzen lassen und mich allein in mein Hotelzimmer zurückziehen. Aber so verlockend der Gedanke auch war, erfüllte er mich gleichzeitig mit absolutem Grauen. Ich musste unbedingt diesen Soundtrack komponieren, den man bei mir in Auftrag gegeben hatte. Bislang hatte ich nämlich nicht eine einzige Note niedergeschrieben.
Der Alkohol half mir, meine Panik halbwegs zu unterdrücken. Später würde der Sex ein Übriges tun, sodass ich die Worte – seine Worte – zumindest vorübergehend ausblenden konnte. Wenigstens lange genug, um irgendetwas zu Papier zu bringen. Bitte, lieber Gott. Aber Gott hatte mich noch nie erhört, und bestimmt würde er jetzt nicht damit anfangen. Nein, ich musste selbst einen Weg finden, um die Dämonen verstummen zu lassen. So wie ich es immer getan hatte.
Vor drei Jahren hatte ich eine meiner Kompositionen an eine kleine französische Indie-Film-Produktionsfirma verkauft, die daraus den Titelsong für einen ihrer Filme machte. Das Stück war derart eingeschlagen, dass mich kurz darauf ein großes Filmstudio in Hollywood beauftragte, mehrere Songs für einen Kinofilm zu schreiben, der sich am Ende als Blockbuster erweisen sollte. Angespornt von diesem Erfolg hatte ich anschließend ein Album herausgebracht, das begeisterte Kritiken erntete. Bei meinem zweiten waren die Rezensionen bestenfalls verhalten, nichtsdestoweniger war ich plötzlich gewissermaßen eine Berühmtheit. Die Leute machten in Restaurants und auf der Straße Fotos von mir, namhafte Medien luden mich zu Interviews ein. Mein Leben war praktisch ohne Vorwarnung komplett durcheinandergewirbelt worden, und ich hatte zugegebenermaßen nicht immer gut auf die permanente Verletzung meiner Privatsphäre reagiert.
Erstaunlicherweise hatte mich das nur umso begehrter gemacht und mir seitens der Presse den Ruf eingetragen, der böse Junge unter den Komponisten zu sein. Man stempelte mich als eine Art düsteren, kreativen Wüstling ab, der allein in seiner Wohnung saß und sich die Haare raufte, während er wie ein Irrer Noten auf ein Blatt Papier kritzelte, bevor er sich mit drei Topmodels, die simultan seinen abartigen sexuellen Appetit stillten, im Bett vergnügte. Was tatsächlich gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt war. Jedenfalls, was den Sex betraf – wohingegen auf meine musikalische Schaffenskraft neuerdings kein Verlass mehr zu sein schien.
Früher hatte Sex in Kombination mit Alkohol mich in diesen Zustand geistiger Abwesenheit versetzt, dessen es bedurfte, um den Noten klangvolles Leben einzuhauchen. Ich verzog mich in meine vier Wände und komponierte tage-, manchmal sogar wochenlang an einem Stück. Heute konnte ich von Glück reden, wenn mir hin und wieder mal ein paar kreative Stunden vergönnt waren. Was mich in eine äußerst missliche Lage versetzte, nachdem mich das größte Studio in Hollywood engagiert hatte, damit ich den Soundtrack zu einem Film schrieb, der nächstes Jahr in die Kinos kommen sollte. Man erwartete ein Meisterwerk von mir, und das musste ich auch unbedingt abliefern; andernfalls würden die Kritiker behaupten, dass mein Talent verbraucht und mein anfänglicher Erfolg nichts weiter als eine Sternschnuppe gewesen sei. Natürlich machte ich mir selbst am meisten Druck, nur änderte das nichts an den Fakten.
»Also, Callen, was steht jetzt als Nächstes an, nachdem Sie ja eine Weltsensation sind?«, fragte mich der Kerl, der sich noch gerade eben mit Larry unterhalten hatte.
Ich starrte ihn an. Eine Weltsensation? Herr im Himmel! Wer redete denn so? Jawohl, ich hatte einen verdammten Preis gewonnen, und darauf war ich stolz. Aber warum mussten sich alle immer so anhören, als würden sie mich für irgendeinen Zeitungsartikel interviewen?
»Darf ich vorstellen, Grégoire von Le Célébrité.« Larry wies mit dem Kopf auf den Mann, der unterdessen sein Handy herausgezogen hatte und damit auf Charlènes Hand zielte, die immer noch auf meinem Schenkel lag. Sie lächelte den Reporter mit verführerisch gespitzten Lippen an, weil sie haargenau wusste, dass er das Foto in seinem französischen Boulevardblatt veröffentlichen würde.
Ich stand auf, dabei rempelte ich Charlène an, die ein verärgertes Quieken von sich gab. »Muss aufs Klo.«
»Hier in Frankreich sagt man Toilette«, ließ Annette sich vernehmen.
Ich ignorierte sie und nahm den Reporter ins Visier, der sich in unsere Gruppe eingeschlichen hatte. Was ihm nicht schwergefallen sein dürfte. Die meiste Zeit hatte ich keine Ahnung, wer die Leute in meinem Dunstkreis waren. »Wollen Sie mitkommen? Vielleicht gelingt Ihnen ein Schnappschuss von meinem Schwanz, während ich pisse.«
Grégoire schien das einen Augenblick in Betracht zu ziehen, schüttelte dann aber den Kopf. Ich stieß ein angewidertes Grunzen aus und steuerte leicht schwankend den dunklen Flur im hinteren Bereich der Bar an.
Großer Gott. Ich bin betrunken. Völlig dicht.
Mein Handy vibrierte, aber ich bekam es nicht aus der Hosentasche, weil es sich im Futter verfangen hatte. Als ich es endlich herausgefischt hatte, erhaschte ich gerade noch einen Blick auf Nicks lächelndes Gesicht, bevor die Mailbox ansprang. Wahrscheinlich wollte er mir zu meinem Preis gratulieren. Ich blieb im Flur stehen und wartete, bis mein Handy den Eingang einer Sprachnachricht anzeigte. Ich hörte sie ab.
»Hey, mein Freund«, ertönte Nicks vertraute Stimme. »Hab gerade aus dem Internet erfahren, dass du den Preis gewonnen hast. Verdammt reife Leistung! Ich bin stolz auf dich, Mann!« Kurze Pause. »Pass auf dich auf, Cal, okay? Und melde dich bei Gelegenheit mal.«
Ich gelobte mir, ihn später anzurufen, und steckte das Handy wieder ein. Er wäre mit Sicherheit enttäuscht von mir, könnte er sehen, wie ich stockbetrunken durch einen dunklen Gang wankte, um dem geistlosen Volk zu entkommen, das mich umgab. Menschen ohne Tiefgang, denen ich mehr Platz in meinem Leben einräumte als Nick, der mein engster Freund und außerdem der einzige Mensch war, dem ich blind vertrauen konnte.
Das bist nicht du, Cal, würde er zu mir sagen. Nur leider irrte er sich in dem Punkt.
Hinter der ersten Tür, die ich öffnete, befand sich eine mit Regalen voller Putzmittel und Papiererzeugnissen ausgestattete Besenkammer. Ich machte die Tür wieder zu und hielt Ausschau nach irgendeinem Hinweis, wo das verdammte Klo sein könnte, fand jedoch keinen. Ich bog um die Ecke und entdeckte am Ende des Flurs eine weitere Tür, die auf eine menschenleere Dachterrasse führte. Da sie heute Abend – womöglich sogar für den Rest der Saison – geschlossen zu sein schien, wollte ich mich gerade wieder zurückziehen, als ich mich eines Besseren besann. Ich würde mir eine kurze Auszeit genehmigen, das aufgesetzte Lachen und dümmliche Geschwätz an meinem Tisch vergessen und einfach nur tief durchatmen.
Pass auf dich auf, Cal, okay?
Warum war das in letzter Zeit ein Ding der Unmöglichkeit? Ich trat an die Brüstung, stützte die Ellbogen darauf, beugte mich leicht nach vorn und fuhr mir mit den Händen durch das Haar, während ich die kühle Luft einsog. Sofort fühlte ich mich besser, etwas weniger betrunken … etwas weniger zornig und übellaunig. Wie war es überhaupt um meine emotionale Lage bestellt? Darüber hatte ich seit einer Ewigkeit nicht mehr nachgedacht. Ich wusste nur, dass ich nicht glücklich war.
Da hörte ich ein Geräusch und drehte mich um. Im Türrahmen stand die brünette Kellnerin, ihre Augen waren vor Überraschung geweitet, ihre Lippen leicht geöffnet, offenbar hatte sie nicht damit gerechnet, hier draußen jemanden anzutreffen. Sie merkte erst, dass hinter ihr die Tür zufiel, als diese ihrem Po einen Klaps versetzte. Ihr entfuhr ein kleiner Schrei.
Wir starrten uns mehrere Sekunden über die Dachterrasse hinweg an, dabei gab ich mir redlich Mühe, nicht zu schwanken.
»Ich, äh, muss mich entschuldigen. Bin wohl irgendwo falsch abgebogen.« Ich machte eine weit ausholende Armbewegung, die besagen sollte, dass ich hier eigentlich nicht hatte landen wollen. Hoffentlich verstand sie überhaupt Englisch. Mein Französisch taugte nicht viel. Ehrlich gesagt, war es miserabel.
Die Frau öffnete den Mund, klappte ihn wieder zu und schaute mich noch einen Moment durchdringend an, bevor sie schließlich murmelte: »Ich bin hier, um dich zu retten.«
Ich runzelte die Stirn und lehnte mich mit dem Rücken gegen die Brüstung, irgendetwas rumorte in meinem Hinterkopf, aber ich bekam es nicht zu fassen, es entzog sich mir. Sie biss sich auf die Lippe, trat von einem Fuß auf den anderen, und da dämmerte mir, dass sie vermutlich gescherzt hatte. Sie war eindeutig ein schüchterner Mensch, und ich flößte ihr Unbehagen ein. Ich lächelte sie an, dann lachte ich leise und zog eine Braue hoch. »Das weiß ich zu schätzen, aber ich fürchte, für mich kommt jede Rettung zu spät, Süße.«
Sie stieß den Atem aus, doch anstatt erleichtert zu wirken, weil der peinliche Moment überstanden war, wirkte sie geradezu … enttäuscht. »Hast du das ›Geschlossen‹-Schild nicht gesehen?« Sie nickte in Richtung Tür.
Doch, hatte ich. »Ich kann kein Französisch.«
Die Andeutung eines Lächelns auf ihren Lippen. »Es steht auch auf Englisch drauf.«
»Ist mir wohl nicht aufgefallen.« Sie runzelte kaum merklich die Brauen, und ich ging langsam auf sie zu, etwas an ihr zog mich auf rätselhafte Weise unwiderstehlich an.
Sie rührte sich nicht vom Fleck, zuckte nicht zusammen, schien nicht einmal überrascht, als ich direkt vor ihr stehen blieb. Sie hob den Kopf und schaute mich an, der enttäuschte Ausdruck war verschwunden, sie sah jetzt ganz weich aus und irgendwie atemlos. Erwartungsvoll.
»Du bist Amerikanerin«, sagte ich, als mir plötzlich klar wurde, dass ihr Englisch vollkommen akzentfrei war. Sie nickte nur.
Ich betrachtete ihr Gesicht, und aus der Nähe erkannte ich nun, wie hübsch sie tatsächlich war, mit ihrem makellosen Porzellanteint und den winzigen Sommersprossen auf der Nase. Ich wollte jede einzelne küssen, sie mit der Zunge berühren und feststellen, ob sie nach Unschuld schmeckten. Ich musste über mich selbst lachen. Unschuld? Wann hatte ich diese Vorstellung jemals reizvoll gefunden?
Dunkle, anmutig geschwungene Wimpern umrahmten die großen haselnussbraunen Augen. Dadurch, dass ihre Oberlippe etwas voller als die Unterlippe und leicht vorgewölbt war, besaß sie einen natürlichen Schmollmund. Erst jetzt registrierte ich, wie sinnlich und verführerisch dieser Mund war, von meinem Sitzplatz aus hatte ich das nicht sehen können. Auf einmal ersehnte ich nichts mehr, als diese rosaroten, leicht geöffneten Lippen auf meinen zu spüren, sie auf meiner Haut zu fühlen.
Ich beugte mich vor, innerlich darauf gefasst, dass sie mich abweisen würde, doch das tat sie nicht. Unsere Lippen trafen sich, und ihr entschlüpfte ein leises Seufzen, das mir direkt in den Unterleib schoss und mir eine Erektion bescherte. Ich fuhr mit der Zunge zwischen ihre Lippen, und sie kam mir scheu und zaghaft mit ihrer eigenen entgegen. Obwohl dieses Mädchen offensichtlich nicht viel Erfahrung hatte, brachte der Kuss mein Blut zum Kochen, wie ich es seit langer Zeit nicht mehr erlebt hatte. Falls überhaupt jemals. Gott, wie süß und unverdorben und rein sie schmeckte.
Mein geschwollenes Glied drängte gegen den Reißverschluss meiner Hose, und ich umfing stöhnend ihren Hinterkopf, um sie noch näher zu mir heranzuziehen, mich an ihr zu reiben. Ihre Haare fielen über meine Hand, als ihr Pferdeschwanz sich löste, dabei stieg mir der zarte, frische Duft ihres Shampoos in die Nase.
Zart und frisch.
Ich begehrte sie. So sehr, dass ich vor Verlangen zitterte.
Was ist bloß los mit mir? Ich war nahe daran, sie hochzuheben und zu einem der leeren Tische zu tragen, um sie dort vornüberzubeugen und dem qualvollen Pochen zwischen meinen Beinen Erleichterung zu verschaffen. Im hintersten Winkel meines benommenen, benebelten Kopfes schien es sogar möglich, dass dieses Mädchen die Fähigkeit besaß, den Schmerz in den dunklen Tiefen meiner Seele zu lindern, die für mich unerreichbar waren.
Nur diese eine verfluchte Nacht lang wollte ich mich verlieren dürfen, mich dieser süßen Frau hingeben, deren Reinheit und Unschuld ihr in den klaren Augen stand.
Doch für all das gab es in meinem Leben keinen Platz, besonders nicht für Unschuld.
Trotzdem wünschte ich es mir mehr als alles andere. Wie sehr, das gestand ich mir an diesem kühlen Abend auf einer sternenbeschienenen Terrasse in Paris zum ersten Mal selbst ein. Der Gedanke war verführerisch wie eine schläfrige Geliebte. Wie eine Muse, die versprach, länger zu bleiben als nur für ein paar Augenblicke. Ich verdiente es zwar nicht, aber das war mir egal.
Ich unterbrach den Kuss und strich mit den Lippen über ihre mit Sommersprossen getüpfelte Haut. »Komm mit zu mir nach Hause«, raunte ich, ohne das Verlangen in meiner Stimme verhehlen zu können.
»Du hast einen Schwips«, flüsterte sie zurück. »Ich habe gesehen, dass du den ganzen Abend getrunken hast.«
»Das bestreite ich nicht. Aber das wird meiner Leistungsfähigkeit keinen Abbruch tun. Tut es nie.«
Sie wurde reglos in meinen Armen, und ich begriff, wie krass meine Worte geklungen hatten, wie gewöhnlich sie sich jetzt fühlen musste. Aber war sie das denn nicht? War unterm Strich gewöhnlich nicht genau das, wonach ich suchte? Könnte ich wirklich so tun, als wäre sie anders als der Rest? Die unzähligen Frauen, die ich nach einem One-Night-Stand nie wiedersah? Ich hatte diesem Mädchen nichts zu bieten. Aber warum hatte ich dann das Gefühl, als wäre irgendetwas in meinem Inneren, das eben noch geblüht hatte, schlagartig verwelkt? Ich wusste nicht, was es war … Sondern nur, dass ich irgendetwas gefühlt hatte.
»Du hast dich verändert«, stellte sie mit einem kummervollen Unterton in der Stimme fest. Es war lange her, seit sich zuletzt jemand die Mühe gemacht hatte, meinetwegen Kummer zu verspüren. Und was meinte sie überhaupt mit verändert? Ah, bestimmt wusste sie, wer ich war, und hatte mich wiedererkannt. Vielleicht hatte sie sich dem Irrglauben hingegeben, Callen Hayes sei gar nicht so, wie er in der Presse dargestellt wurde. Dass man ihn verkannte. Während ich in ihre seelenvollen Augen blickte, wünschte ich mir einen verrückten Moment lang, es wäre so. Doch ich wusste, dass das nicht zutraf.
Ich wollte gerade zu einer Erwiderung ansetzen, mich womöglich entschuldigen oder versuchen, meinen Fehler wiedergutzumachen, als die Tür zur Dachterrasse aufgerissen wurde. Ich ließ das Mädchen los, und wir gerieten beide kurz ins Taumeln, als wir uns gleichzeitig umwandten.
In der Tür stand mit hochgezogenen Brauen Charlène, die Arme unter ihren kleinen, runden Brüsten verschränkt, die leuchtend roten Lippen zu einem mokanten Lächeln verzogen. »Falls du damit fertig bist, die Kellnerin zu befummeln, könnten wir dann gehen? Du hattest mich gebeten, mit zu dir nach Hause zu kommen, erinnerst du dich daran?«
Ich krümmte mich innerlich zusammen, während besagte Kellnerin die Schultern hängen ließ. Allmächtiger. Exakt dieselben Worte hatte ich ihr gegenüber gebraucht. Sie sah mich an, die hübschen Lippen vom Küssen geschwollen, die Haare offen auf ihre Schultern fallend. Mir entging nicht die tiefe Enttäuschung in ihrem Gesicht, und zum ersten Mal seit sehr langer Zeit betrachtete ich mich durch die Augen eines anderen Menschen. Ich verabscheute, was ich sah. Sie straffte die Schultern, ließ mich stehen und marschierte an Charlène vorbei durch die Tür.
Einen Wimpernschlag später war sie verschwunden.
2. KAPITEL
Jessica
»Und, wie lief’s?«, erkundigte sich meine Mitbewohnerin Francesca, als ich zur Tür hereinkam.
Ich warf meine Tasche in die Ecke, holte eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank und hob sie an meinen Mund. »Großartig, vorausgesetzt, man kann dem Status ›offiziell arbeitslos‹ etwas Positives abgewinnen«, sagte ich mit einem kläglichen Lächeln, nachdem ich ausgiebig meine Kehle befeuchtet hatte. Es war dermaßen stickig in unserer Wohnung, dass mir Schweißperlen über den Rücken rannen.
»Ich ziehe mich nur kurz um, bin gleich wieder da.« Ich verschwand in meinem winzigen Zimmer, schälte mich aus Rock und Bluse und hängte beides sorgsam in meinen Kleiderschrank. Da ich mich wohl oder übel nach einem neuen Job umsehen musste, war es ratsam, die wenige Berufsbekleidung, die ich besaß, schonend zu behandeln.
Ich schlüpfte in ein Paar Baumwollshorts und ein bequemes Tanktop und band als weitere kühlende Maßnahme meine Haare am Hinterkopf zu einem Pferdeschwanz zusammen, bevor ich ins Wohnzimmer zurückkehrte.
Ein ploppendes Geräusch ließ mich zusammenfahren, dann sah ich, dass Frankie eine Flasche Sekt geöffnet hatte, und musste lachen.
»Santé, mon amie«, trällerte sie, während sie zwei Gläser einschenkte und mir eins davon reichte. Grinsend nippte ich an der billigen Prickelbrause. »Du betrittst jetzt die erste Sprosse einer steilen Karriereleiter.«
»Merci.« Ich ließ mich auf das Sofa plumpsen, zog die Beine unter mich und stellte mein Glas auf den Couchtisch. Frankie setzte sich neben mich, trank einen Schluck aus ihrem und schnitt eine Grimasse.
»Etwas Besseres war finanziell leider nicht drin.«
»Sobald ich einen Job gefunden habe, geht der Sekt auf mich. Dann kann ich uns hoffentlich einen edleren Tropfen spendieren.«
Sie lächelte mir zu. »Natürlich. Ich bin stolz, dass du dieses Wagnis eingehst.«
»Du hast leicht reden. Falls ich im Armenhaus lande, mache ich dich dafür verantwortlich.«
»Nur zu. Allerdings glaube ich nicht, dass es heutzutage noch Armenhäuser gibt. Auf dich wartet dann die kalte, einsame Straße, mein Kohlköpfchen.«
»Na toll.« Ich musste lächeln, der liebevolle Spitzname war ein Running Gag zwischen uns. Frankie hatte mal irgendwo den Begriff ma choupette aufgeschnappt und mich nach der Bedeutung gefragt. Ich hatte ihn wörtlich übersetzt, und seither war er ihr bevorzugtes Kosewort. Ungeachtet ihres italienischen Vornamens beherrschte sie nicht eine einzige romanische Sprache fließend. Als wir uns kurz nach meiner Ankunft in Paris in einem Internet-Café begegnet waren, hatte sie nur wenige Worte Französisch gekonnt und radebrechend versucht, sich einen Kaffee und ein Croissant zu bestellen. Ich war ihr beigesprungen, wir waren miteinander ins Gespräch gekommen und uns auf Anhieb sympathisch gewesen. Es schien eine Fügung des Schicksals zu sein, dass wir beide zufällig nach einer Mitbewohnerin suchten. Zum Glück hatten sich ihre Sprachkenntnisse erheblich verbessert, seit sie in Frankreich lebte und arbeitete. Frankie war für das Modehaus einer angesagten neuen Designerin namens Clémence Maillard tätig. Sie liebte ihren Job, auch wenn sie kaum mehr verdiente als ich.
Wobei in Wirklichkeit faktisch jeder mehr verdiente als ich. Weil ich inzwischen nämlich überhaupt kein Einkommen mehr hatte.
»Wie hat Vincenzo deine Kündigung aufgenommen?«
Ich seufzte. »Ganz gut. Er wird problemlos einen Ersatz für mich finden.« Vermutlich hatte er die Stelle bereits neu besetzt. Das Lounge La Vue zählte zu den beliebtesten, nobelsten Hotelbars in Paris, und die Gäste gaben in der Regel ordentlich Trinkgeld. Aber ich wollte mein Leben nicht länger als Teilzeitkellnerin vertrödeln.
Nachdem ich letztes Jahr an der Cornell University meinen Abschluss in Französisch als Hauptstudiengang und französischer Mittelaltergeschichte als Ergänzungsfach gemacht hatte, war ich nach Paris umgesiedelt und hatte mich auf Jobsuche begeben. Das einzige Stellenangebot kam von einer kleinen Zeitung, wo ich nicht einmal genügend verdient hätte, um mir täglich drei Mahlzeiten leisten zu können. Also hatte ich notgedrungen als Bedienung im Lounge La Vue angefangen und nebenbei mein Gehirn mit kurzen (unbezahlten) Praktika in diversen Museen gefüttert. Das letzte war gerade zu Ende gegangen, und indem ich in der Bar kündigte, nötigte ich mich sozusagen selbst dazu, mich anzustrengen und einen lukrativen Job in meinem Fachgebiet zu finden. Frankie hatte recht – es war an der Zeit, dass ich im Vertrauen auf mich selbst ein Wagnis einging.
Durch mein Studium war meine besondere Begabung – und meine Leidenschaft – für das Übersetzen altfranzösischer Texte zum Vorschein gekommen. Wenn es mir gelänge, eine Anstellung in diesem Tätigkeitsbereich zu finden, würde sich für mich ein Traum erfüllen.
Ich hätte meinen Vater um Hilfe bitten können, um meine Karriere schneller in Gang zu bringen, aber ich war fest entschlossen, genau das nicht zu tun. Er war derjenige gewesen, der entschieden hatte, dass die französische Schule in meiner Heimatstadt die beste Ausbildung für mich bereithalten würde. Erst dort war meine Begeisterung für das Erlernen von Fremdsprachen und meine Liebe zu allem, was mit Frankreich zusammenhing, geweckt worden. Dafür war ich ihm dankbar, für viel mehr aber auch nicht.
Mit zwanzig hatte ich meine Mutter verloren. Als der Krebs diagnostiziert wurde, hatte er bereits das vierte Stadium erreicht, und sie war praktisch von einem Tag auf den anderen gestorben. Vier Jahre später trauerte ich immer noch um sie, gleichzeitig deprimierte es mich maßlos, mit welcher Art von Leben sie sich abgefunden hatte. Sie war nur achtundvierzig geworden und hatte mehr als die Hälfte dieser Jahre an der Seite eines Mannes verbracht, der ihr mit eisiger Gleichgültigkeit begegnete. Ich wollte mehr als das, ein solches Dasein würde ich niemals akzeptieren. Mein Vater hatte umgehend wieder geheiratet, und zwar ein Mädchen, das gerade einmal ein Jahr älter war als ich. Bestimmt betrog er auch sie bereits. Nicht dass ich ihn danach fragen würde. Oder es mich kümmerte. Wir hatten uns nie nahegestanden, und mittlerweile hatten wir kaum noch Kontakt.
Dem Himmel sei Dank für Frankie. Ich hatte mir in Paris einen kleinen Freundeskreis aufgebaut – hauptsächlich junge Frauen, die ich aus dem Lounge La Vue kannte –, aber Frankie war für mich wie die Schwester, die ich nie hatte. Hier in Frankreich schuf ich mir meine eigene Ersatzfamilie.
Ich ließ den Kopf gegen die Rücklehne der Couch fallen. Da ich seit dem Frühstück nichts gegessen hatte, reichte schon das eine Glas Sekt, damit ich mich matt und schläfrig fühlte.
»Er ist nie wieder in der Bar aufgetaucht, oder?«, fragte Frankie und sah mich neugierig an. Ich war versucht, so zu tun, als wüsste ich nicht, von wem sie sprach, aber sie hätte mir an der Nasenspitze abgelesen, dass ich mich aus Enttäuschung absichtlich dumm stellte.