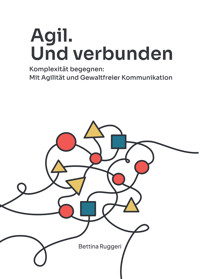15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie gelingt Lernen in Organisationen – jenseits von Trainings und Tools? Wie lässt sich Entwicklung verankern, statt sie nur zu starten? Das Movement ist ein strukturiertes Lernformat für nachhaltigen Kompetenzaufbau – durch Coaching, Mentoring und kollektive Praxis im Arbeitsalltag. Es funktioniert überall dort, wo Menschen gemeinsam lernen und Verantwortung übernehmen wollen – unabhängig vom Thema oder der Rolle. Das Prinzip ist übertragbar – das Programm strukturiert. Es verbindet individuelle Entwicklung mit gemeinschaftlichem Lernen und schafft Räume, in denen Haltung, Kompetenz und Kultur zusammenwirken. Am Beispiel der Scrum Foundations enthält dieses Buch ein vollständig einsetzbares Movement-Programm – mit klaren Lernzielen, Rollen, Workbooks, Feedbackformaten und Erfahrungswissen aus über sechs Jahren Praxis. Leser:innen können es direkt nutzen, um das Movement im eigenen Unternehmenskontext auszuprobieren – und die Struktur auf vielfältige Themen übertragen. Für alle, die Lernkultur in Organisationen neu gestalten möchten: wiederholbar, praxisnah, gemeinschaftlich getragen. Ein Buch über Lernen, das bleibt – weil es bewegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Impressum
Widmung
Autorenportrait
Einleitung
Kapitel Eins - Warum wir neues Lernen brauchen
Kapitel Zwei - Das Movement-Framework
Kapitel Drei - Das Scrum-Movement
Kapitel Vier - Movements selbst gestalten
Kapitel Fünf - Formate und Tools im Movement
Kapitel Sechs - KI & Bildung
Kapitel Sieben - Hintergründe & Modelle
Impressum
Titel: Movement - New Learning mit Coaching & MentoringAutorin: Bettina RuggeriGestaltung, Satz & Cover: Bettina RuggeriLektorat & Korrektorat: Manuel Fernandes
Veröffentlichung im SelbstverlagBettina RuggeriTherese-Giehse-Allee 11081739 Mü[email protected]
Herstellung & Distribution: tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
ISBN: 978-3-982-72595-6© 2025 - Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Zur Verwendung – auch auszugsweise – sowie Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe bedarf es der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Autorin.
Trotz sorgfältiger Prüfung kann keine Haftung für die Inhalte übernommen werden. Für Hinweise auf Fehler oder Anregungen freut sich die Autorin über Kontaktaufnahme unter: [email protected]
Widmung
Für alle, die mich gelehrt, inspiriert und begleitet haben.Und für Detlef
Buchbeschreibung
Wie gelingt Lernen in Organisationen – jenseits von Trainings und Tools? Wie lässt sich Entwicklung verankern, statt sie nur zu starten?
Das Movement ist ein strukturiertes Lernformat für nachhaltigen Kompetenzaufbau – durch Coaching, Mentoring und kollektive Praxis im Arbeitsalltag.
Es funktioniert überall dort, wo Menschen gemeinsam lernen und Verantwortung übernehmen wollen – unabhängig vom Thema oder der Rolle.
Das Prinzip ist übertragbar – das Programm strukturiert. Es verbindet individuelle Entwicklung mit gemeinschaftlichem Lernen und schafft Räume, in denen Haltung, Kompetenz und Kultur zusammenwirken.
Am Beispiel der Scrum Foundations enthält dieses Buch ein vollständig einsetzbares Movement-Programm – mit klaren Lernzielen, Rollen, Workbooks, Feedbackformaten und Erfahrungswissen aus über sechs Jahren Praxis. Leser:innen können es direkt nutzen, um das Movement im eigenen Unternehmenskontext auszuprobieren – und die Struktur auf vielfältige Themen übertragen.
Für alle, die Lernkultur in Organisationen neu gestalten möchten: wiederholbar, praxisnah, gemeinschaftlich getragen.
Ein Buch über Lernen, das bleibt – weil es bewegt.Und weil es weiterdenkt: mit Mova, der digitalen Mentorin für gemeinsames Lernen und neue Lernkultur.
Autorenportrait
Bettina Ruggeri begleitet seit über 20 Jahren Menschen und Organisationen an den Schnittstellen von Führung, Entwicklung und Lernkultur.Als Agile Coach (CEC, CTC, Accreditation Coach), systemische und hypnosystemische Coachin, GFK-Trainerin und Organisationsberaterin verbindet sie Struktur mit Tiefe, Klarheit mit Beziehung – und Veränderungsimpulse mit innerer Ausrichtung.
Mit den von ihr mitentwickelten Movement-Programmen gestaltet sie neue Lernräume für Organisationen, die Coaching, Mentoring und Selbstorganisation miteinander verbinden. Die Programme sind erprobt, anschlussfähig – und eine Einladung, Lernen als gemeinsamen Erfahrungsraum zu begreifen.
Ihre Arbeit basiert auf agiler Praxis, hypnosystemischen Grundlagen, Gewaltfreier Kommunikation und einem geistigen Kompass: Ein Kurs in Wundern, der seit einigen Jahren ihr Denken und Handeln begleitet.
Was sie antreibt, ist die Überzeugung, dass echte Entwicklung neben Wissensvermittlung, auch durch Beziehungsarbeit, Resonanz und gemeinsames Forschen im Arbeitsalltag braucht.
Das Movement ist ihr Beitrag zu einer Lernkultur, die gemeinsam getragen wird.
Einleitung
Wir leben im Dauerwandel. Digitalisierung, KI, Agilität, soziale Unsicherheit: Unsere Zeit ist geprägt von ständiger Veränderung – mit offenem Ausgang. Organisationen suchen Halt. Sie investieren in Tools, Frameworks, Trainings und müssen immer wieder feststellen: Das reicht nicht. Die Maßnahmen kratzen oft nur an der Oberfläche, verpuffen im Alltag oder führen zu Frust statt zu Fortschritt.
Was heute gebraucht wird, ist etwas anderes: Lernfähigkeit als Schlüsselressource – sowohl im Individuum als auch im Kollektiv –, als Kompetenz, verankert in Struktur und Beziehungen. Es braucht eine neue Form von Lernentwicklung, die auf Ermöglichung setzt statt auf Vorgabe. Lernen muss zur persönlichen und kollektiven Entwicklung führen.
In den letzten Jahren wurde das Lernen selbst einem Wandel unterzogen: KI-gestützte Systeme verändern, wie wir lernen, kommunizieren und arbeiten. Sie übernehmen technische Aufgaben und prägen zunehmend auch unsere Bildungsrealität – oft schneller, als es bestehende Konzepte abbilden können. Die Herausforderung liegt weniger im Zugang zur Technologie als vielmehr in den Vorannahmen, mit der wir ihr begegnen. KI kann strukturieren, analysieren und unterstützen – sie bleibt dabei jedoch auf Distanz. Emotionale Wahrnehmung, vertrauensvolle Verbindung und die Fähigkeit, situativ und beziehungsorientiert auf Lernende einzugehen, bleiben Aufgaben des Menschen.
Dieses Buch soll informieren und dazu anregen, die kollektive Kraft gemeinsamen Lernens lebendig werden zu lassen: für nachhaltigen Kompetenzaufbau im Arbeitsalltag, durch Coaching, Mentoring und gemeinsames Lernen in der Praxis. Die direkte Ansprache ist Methode – sie spiegelt die Haltung, mit der im Movement gearbeitet wird, wider: offen, kollegial und auf Entwicklung ausgerichtet.Es geht ums Lernen – nicht in der Form, wie wir sie aus Trainings, Workshops oder E-Learnings kennen. Es geht um ein anderes Verständnis davon, wie Lernen heute wirksam wird – in einer Welt, die sich nicht mehr an klare Pläne oder feste Rollen hält.
Movement
An dieser Stelle entfaltet das Movement seine Stärke. Es bietet einen Rahmen für neue Lernkultur – auch im Umgang mit KI. Die Haltung im Movement ist begleitend und integrativ. Die Strukturen schaffen Orientierung und Spielraum. Bildung bleibt menschlich, weil sie die zwischenmenschliche Dimension betont: das Schaffen einer Atmosphäre, in der nachhaltiges Lernen möglich wird.
Darum geht es in diesem Buch. Es beschreibt eine Lernform, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und individuelle wie kollektive Entwicklung an klaren Lernzielen ausrichtet. Eine Lernform, die auf nachhaltige Veränderung zielt. Sie verbindet Coaching, Mentoring und Peer-Learning – mit klarer Struktur, getragen von Beziehung und Verantwortung.
Das Movement ist eine Brücke – zwischen Menschen, zwischen Veränderung und Wirkung, zwischen dem Wunsch nach Orientierung und dem Mut, sich auf etwas Neues einzulassen. Es ist eine Einladung zum Verstehen, zum Gestalten, zum Mitmachen.
Dieses Buch nimmt dich mit auf eine Lesereise in fünf Teilen:
Kapitel 1 beschreibt die Denk- und Lernlandschaft, in der wir uns heute bewegen – und warum klassische Weiterbildungslogiken dort oft nicht mehr greifen.
Kapitel 2 stellt das Movement-Konzept vor: die Prinzipien und Rollen, Beispiele und Impulse für die Umsetzung.
Kapitel 3 beschreibt die Ein- und Durchführung eines Scrum-Movements im Unternehmen.
Kapitel 4 unterstützt bei der Gestaltung eigener Movements – ob als Facilitator:in, als Führungskraft oder als Impulsgeber:in in deiner Organisation.
Kapitel 5 sammelt Methoden, die das Movement begleiten und vertiefen: Werkzeuge für Reflexion, Selbstorganisation, Gesprächsführung und Entscheidung. Sie können direkt eingesetzt oder an den jeweiligen Kontext angepasst werden. Sie sind sowohl strukturierte Bausteine als auch flexible Werkzeuge für das gemeinsame Lernen in Gruppen.
Kapitel 6 gibt einen Ausblick auf die Rolle von KI im Bildungskontext – und eine Einladung, auch dort bewusst zu gestalten.
Kapitel 7 bietet ein nähere Beschreibung der Hintergründe und Modelle – als theoretische Fundierung, als Inspiration, als Einladung zur Vertiefung. Bei Unklarheiten lohnt sich ein Blick in dieses Kapitel.
So kannst du dir das nehmen, was du brauchst, und dich einlassen auf das, was möglich wird: eine Lernentwicklung im Spannungsfeld von Alltag und Zeitdruck, zwischen Menschen ebenso wie zwischen Wissen, Erfahrung und konkreter Anwendung.
Warum ich dieses Buch geschrieben habe
Es zerreißt mich innerlich, wenn ich sehe, wie Trainings wirkungslos bleiben. Wie viel investiert wird in Programme und Methoden – und wie wenig davon im Alltag ankommt. Wie Lernen zum Pflichttermin wird und wertvolle Chancen verloren gehen.
Was fehlt, sind Räume, in denen sich Menschen nachhaltig entwickeln können: verlässlich, begleitet, mitten im Arbeitskontext – sowohl eingebettet in die tägliche Arbeit als auch ausgestattet mit der nötigen Tiefe für nachhaltige Entwicklung.
Das Movement-Framework ist genau dafür gemacht: Es schafft die Bedingungen für Lernentwicklung – strukturiert, verbunden, praxisnah. Und es wird überall dort zur Realität, wo Menschen eingeladen sind, sich einzubringen und gemeinsam zu wachsen: in Organisationen, Teams, Communitys. Ob es um psychologische Sicherheit geht, um Gewaltfreie Kommunikation, um Softwarearchitektur oder um Führung – das Prinzip bleibt dasselbe: Lernen geschieht selbstorganisiert – in Gemeinschaft und eingebettet in den Alltag.
Die Wurzeln des Movements liegen in meiner Herkunft als Agilistin. Ich habe die ersten Movement-Programme im agilen Umfeld entwickelt – mit Scrum-Teams, Product Ownern und Führungskräften. Dort war der Bedarf am eklatantesten und die Wirkung besonders sichtbar. Manche sagen heute: „Agilität ist tot.” Und wenn man sieht, wie oft sie auf Tools, Rollen oder Frameworks reduziert wird, mag das sogar stimmen. In vielen Organisationen ist das Vokabular agil – die Kultur jedoch nicht. Es fehlt an tieferem Verständnis der zugrundeliegenden Prinzipien. Es fehlt die Verbindung zwischen Menschen, Werten und ihrem gelebten Ausdruck. Und es mangelt an der Fähigkeit, gemeinsam zu reflektieren und zu lernen.
Ich will Agilität nicht aufgeben. Im Gegenteil, ich will ihr Tiefe verleihen. Und ich habe erlebt, wie das gelingt: durch kollektives Lernen, durch Resonanz, durch Entwicklung. Genau das ermöglicht das Movement-Framework – weit über agile Rollen und Methoden hinaus.
Ich wünsche mir, dass Lernen nachhaltig im Alltag wirkt – sowohl individuell als auch kollektiv. Ich wünsche mir, dass Wissen in Organisationen entsteht, das bleibt, weil es geteilt, angewendet und gemeinsam weiterentwickelt wird. Dieses Buch ist entstanden, weil ich mir wünsche, dass Menschen wachsen können, ohne auszubrennen. Dass Entwicklung möglich wird – mit Tiefe, mit menschlicher Verbindung, mit gemeinsam getragener Verantwortung und mit klarer Struktur.
Das ist meine Sehnsucht: Wir verstehen Lernen als gemeinsame Aufgabe, in der Schulung und Begleitung ihren Platz haben. Lernen wird strukturiert gestaltet und zugleich als gemeinsamer Weg erfahrbar. Kollektive Weiterentwicklung baut auf Vertrauen und Beteiligung auf – mit Raum für Verantwortung, Unterschiedlichkeit und Mitgestaltung.
Was ist ein Movement?
Ein Movement ist ein Lernprogramm mit konkreten Lernzielen (Learning Objectives) und einer verbindlichen Struktur mit einer Laufzeit von mehreren Monaten. Die Teilnehmenden setzen sich parallel zu ihrer Arbeit mit Themen auseinander, die für ihre Rolle oder Organisation relevant sind – selbstorganisiert, in Gruppen, mit individueller Begleitung durch Mentor:innen.
Lernen erfolgt dabei durch:
Inhalte und strukturierte Aufgaben entlang der Bloom’schen Taxonomie [Bloom’s Taxonomie, Blooms Taxonomie 2025],selbstorganisierte Zusammenarbeit in kleinen Gruppen,Mentoring, Feedback, Reflexion und Anwendung im Arbeitskontext.Wissen wird sowohl geteilt als auch weiterentwickelt – über Bereichsgrenzen hinweg. Viele Teilnehmende entwickeln sich weiter und übernehmen im Fall einer weiteren Runde eine Mentoring-Rolle. Das baut sowohl Silos ab als auch systemische Verbindung auf.
Ein Movement funktioniert nach dem Prinzip Inspect and Adapt. Es lebt von Beteiligung, konkretem Handeln und wiederholter Anpassung. Die Lernreise ist verbindlich, praxisnah und übertragbar – und deshalb wirksam.
Was wir unter Movement verstehen
Movement bezeichnet bei uns sowohl das übergeordnete Framework als auch die Programme, die daraus entstehen. Der Begriff ist bewusst gewählt: Inspiriert von Derek Sivers [Sivers 2010] steht ein Movement für eine Bewegung, die Menschen freiwillig und aus innerer Überzeugung mittragen. Es geht sowohl um gemeinsame Initiativen als auch um Veränderung, die aus kleinen, sichtbaren Schritten entsteht – getragen von Beteiligung, eigener Motivation und dem Wunsch, gemeinsam etwas zu bewegen.
Im Deutschen schwingt zudem der Begriff Bewegung mit – im Sinne von Entwicklung, lebendiger Veränderung und gemeinsamer Ausrichtung auf Werte und Ziele. Ein Movement schafft Räume, in denen Menschen Verantwortung übernehmen, voneinander lernen und neue Wege der Zusammenarbeit gestalten. Persönliche Entwicklung und gemeinsames Wachstum entstehen dabei aus der Energie vieler – nicht aus der Anordnung weniger.
Zukunftsfähigkeit braucht Gemeinschaft
Zukunftsfähigkeit entsteht dort, wo verschiedene Perspektiven zusammenkommen. In einer Welt, in der niemand alles wissen kann, wird gemeinsames Lernen zur Grundlage für Entwicklung.
Zukunftsfähigkeit wächst, wenn Menschen sich auf Zusammenarbeit einlassen, einander unterstützen, herausfordern und begleiten. Wenn sie bereit sind, sich selbst weiterzuentwickeln und Verantwortung zu übernehmen für das, was sie gemeinsam gestalten.
Das ist auch die Idee hinter dem Movement. Es beschreibt sowohl die individuelle Bewegung – die Entwicklung einzelner Menschen – als auch die kollektive Bewegung innerhalb von Teams und Organisationen. Und es steht für das konkrete Programm, das in diesem Buch vorgestellt wird: ein strukturierter Lernrahmen, der persönliche Entwicklung fördert und gemeinsames Lernen unterstützt.
Das Movement ist Lernformat und kollektiver Prozess zugleich. Es schafft Räume, in denen Lernen miteinander ermöglicht wird – eingebettet in reale Arbeitskontexte. Erfahrungen werden geteilt, Irritationen aufgegriffen, Erkenntnisse weiterentwickelt. Fachliche Orientierung ist Teil des Prozesses – gemeinsam mit dem Austausch von Perspektiven, dem Reflektieren von Erfahrungen und dem Arbeiten an konkreten Themen.
Viele der Erfahrungen in diesem Buch stammen aus solchen Ansätzen: aus Initiativen, die in Teams, Communitys oder Organisationen gestartet wurden – getragen von Engagement, Verantwortung und verlässlichen Beziehungen. In diesen Gruppen entstehen Orientierung, Entwicklung und Zusammenarbeit im Alltag.
Deshalb richtet sich dieses Buch an Einzelne, Gruppen, Teams und Organisationen. Es lässt sich allein lesen oder gemeinsam nutzen: als Impuls, als Arbeitsgrundlage, als Einladung zur Weiterentwicklung. Lernen wird dabei sowohl individuell als auch gemeinsam erfahrbar.
Was wirkt – und was bleibt?
Die Anforderungen an Organisationen steigen: Neue Technologien wie KI, der anhaltende Fachkräftemangel, ständige Reorganisation und gesellschaftliche Unsicherheit erfordern sowohl Anpassung als auch Lernfähigkeit. Es reicht nicht mehr, Wissen bereitzustellen. Es muss verankert, geteilt und gelebt werden.
Forschungsergebnisse sind eindeutig: Nachhaltiges Lernen braucht Beziehung, Praxisnähe und Reflexion. Coaching und Mentoring steigern sowohl Leistung als auch Wohlbefinden und Veränderungsfähigkeit signifikant [Theeboom 2014, Hüther 2011, Schmidt 2017]. Peer-Learning schafft emotionale Sicherheit und stärkt die Integration neuer Perspektiven [Siegel 2012].
Das Movement verbindet wirksame Elemente – strukturiert, alltagstauglich, menschenbezogen. Es schafft Räume, in denen Lernen Teil des täglichen Arbeitens ist. Statt punktueller Maßnahmen wird Lernen in Abläufe, Gespräche und Entscheidungen eingebunden.
Was erwartet dich – und was bringst du mit?
Dieses Buch richtet sich an Menschen, die Verantwortung übernehmen – in ihrer Rolle, im Alltag oder in der Begleitung anderer. An Lernbegleiter:innen, HR-Verantwortliche, Führungskräfte und an alle, die sich mit der Frage beschäftigen, wie Entwicklung im Arbeitskontext möglich wird.
Du brauchst kein Vorwissen in Didaktik oder Organisationsentwicklung – Offenheit und Interesse am Thema Lernen reichen aus. Du findest in diesem Buch Impulse, Fragen und Perspektiven – und an manchen Stellen auch konkrete Ansätze, die sich in der Praxis bewährt haben. So kannst du Entwicklungen anstoßen, begleiten und reflektieren – für dich selbst und gemeinsam mit anderen.
Du kannst dieses Buch allein lesen oder, noch besser, gemeinsam mit Kolleg:innen nutzen. Einige Kapitel enthalten Reflexionsfragen, Praxisimpulse und Einladungstexte, die sich direkt in deinem Team oder deiner Organisation einsetzen lassen.
Das Buch entfaltet seine Wirkung dort, wo du es in deinen Arbeitskontext überträgst: beim Nachdenken, im Gespräch oder im gemeinsamen Ausprobieren.
Kapitel Eins
Warum wir neues Lernen brauchen
Lernen – was es war, was es sein kann
Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist Information.
(nach Albert Einstein)
Die Anforderungen in der Arbeitswelt verändern sich stetig – mal schrittweise, mal in schnellen, dynamischen Bewegungen. Mit jeder Veränderung steigen die Erwartungen: Organisationen sollen anpassungsfähiger werden, Verantwortung dezentralisieren und Selbststeuerung fördern. Gleichzeitig stehen die Menschen in dieser Arbeitswelt vor der Aufgabe, sich weiterzuentwickeln, neue Kompetenzen aufzubauen und mit Unsicherheit umzugehen. Begriffe wie Agilität, New Work oder Transformation beschreiben diese gewachsenen Herausforderungen im Alltag.
Parallel dazu bleibt eine zentrale Frage bestehen: Wie gelingt Lernen unter diesen Bedingungen – im Arbeitskontext, unter Druck, inmitten ständiger Veränderung?
Trainings und klassische Weiterbildungen bieten Struktur und Orientierung. Gleichzeitig zeigen Forschung und persönliche Erfahrung, dass Lerninhalte im Alltag wirksamer werden, wenn sie mit Praxisbezug, gemeinsamer Reflexion und kontinuierlicher Weiterentwicklung verbunden sind. Lernen braucht Raum, Wiederholung und die Möglichkeit, neue Erfahrungen in den eigenen Kontext zu integrieren.
So wird Lernen zur strategischen Aufgabe – getragen sowohl von individueller Initiative als auch von organisationaler Verantwortung.
Lernen unter industriellen Bedingungen
Lange Zeit wurde Lernen als ein geordneter linearer Prozess verstanden: vorbereitet, vermittelt, geprüft, abgeschlossen. Ein Anfang, ein Curriculum, ein Zertifikat – und damit ein scheinbares Stück Sicherheit. Dieses Verständnis folgt der Logik der industriellen Moderne. Dort gilt: Wer Wissen besitzt, kann planen. Wer plant, kann kontrollieren. Und was kontrolliert werden kann, lässt sich standardisieren. Lernen wird zu einem messbaren Produkt.
In dieser Denkweise findet Lernen überwiegend getrennt von der Arbeit statt: im Seminarraum, im Intranet, in der Fortbildungsreihe. Theorie und Praxis folgen aufeinander: erst der Input, dann die Anwendung. Arbeit und Lernen erscheinen als aufeinander folgende Schritte mit klarer Trennung.
Jeremy Rifkin beschreibt die industrielle Revolution sowohl als technologischen Umbruch als auch als einen Wandel im Selbstverständnis des Menschen [Rifkin 2010]. Die Logik der Fabrik reduzierte den Menschen zur planbaren Einheit und Lernen zu einem Vorgang, der auf Normierung und Effizienz ausgerichtet war. Wissen wurde in kleine Einheiten zerlegt, in standardisierten Abläufen vermittelt und in Prüfungen zertifiziert. Dieses Denken prägt viele Weiterbildungsformate bis heute: mit klaren Zielen, messbaren Ergebnissen und zeitlich begrenzten Lernphasen.
Doch die Anforderungen haben sich in jüngerer Vergangenheit geändert. Klassisch strukturierte Lernangebote bieten nach wie vor Orientierung und methodische Grundlagen, aber sie greifen oft zu kurz, wenn Situationen komplexer, dynamischer oder schlechter planbar sind. Probleme entstehen sowohl durch fehlendes Fachwissen als auch durch Ambiguität, Systemzusammenhänge und das Zusammenspiel von Menschen und Erwartungen. Deshalb braucht es ein erweitertes Verständnis von Lernen, das praxisnah ist, Reflexion ermöglicht und im Arbeitsumfeld verankert wird.
Lernen als lebendiger Prozess
Organisationen sind keine Maschinen und Menschen keine Schnittstellen, die man mit Updates versorgt. Lernen funktioniert nicht wie ein Software-Download oder ein einmal installiertes Format. Es ist lebendig: beweglich, sozial, irritierbar – und manchmal auch widersprüchlich.
Wir lernen dann, wenn wir eine Notwendigkeit zur Weiterentwicklung erkennen und uns betroffen fühlen. Lernen geschieht auch dann, wenn das Alte nicht mehr trägt und das Neue noch nicht greifbar ist. Es entfaltet sich an konkreten Herausforderungen, im Zusammenspiel mit anderen, im Alltag sowie in Momenten von Reibung und Zweifel.
Oft geschieht der Lernprozess dort, wo er nicht geplant ist: Wenn etwas anders verläuft als erwartet. In Momenten der Unsicherheit. Im Gespräch. Im Stolpern. Dann, wenn Irritation zum Innehalten führt. Wenn Menschen sich fragen: „Was passiert hier? Was hat das mit mir zu tun? Und wie möchte ich damit umgehen?“
Der Organisationsentwickler Peter M. Senge beschrieb bereits in den 1990er-Jahren, dass Unternehmen nur dann zukunftsfähig bleiben, wenn sie zu lernenden Organisationen werden [Senge 1990]. Das umfasst mehr als die Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten. Gemeint ist damit eine Kultur, in der Lernen selbstverständlich ist und in die tägliche Arbeit eingebettet bleibt. Eine Kultur, in der Fragen Entwicklungsprozesse auslösen, Fehler als Lernquelle genutzt werden und Reflexion kontinuierlich stattfindet.
In einer solchen Kultur ist Lernen eine gemeinsame Praxis. Einzelne entwickeln sich weiter, während zugleich die Organisation als Ganzes beweglicher wird. Teams lernen, wie sie miteinander sprechen, wie sie Entscheidungen treffen, wie sie mit Spannungen umgehen. Führung schafft Voraussetzungen für Entwicklung. Zusammenarbeit wird zum Lernfeld.
Lernen ist in diesem Sinn keine Zusatzleistung. Es ist eine strategische Voraussetzung für jede Organisation, die in einer Welt bestehen will, die sich nicht an vorgegebene Abläufe oder Pläne hält.
Lernen als Teil des Systems
Auch Gregory Bateson wies schon 1972 darauf hin, dass Lernen mehrdimensional verläuft. Er sprach von Lernen 1, Lernen 2 und Lernen 3 [Bateson 1972].Lernen 1 meint das Einüben von Verhalten: Wir lernen, wie etwas funktioniert – eine Methode anzuwenden, ein Gespräch zu führen, ein Tool zu bedienen.Lernen 2 bedeutet, gewohnte Muster zu erkennen und infrage zu stellen – zum Beispiel zu bemerken, dass wir auf bestimmte Situationen immer gleich reagieren.Lernen 3 schließlich beschreibt jene tiefgreifenden Momente, in denen sich unser gesamtes Bezugssystem verschiebt – unsere Sicht auf uns selbst, auf andere, auf die Welt.
In dynamischen Kontexten – überall dort, wo Sicherheit fehlt, Komplexität hoch ist und Erwartungen sich schnell ändern – wird dieses Lernen auf höherer Ebene bedeutsam. Es lässt sich nicht gezielt erzeugen oder zeitlich einplanen. Es entsteht in Kontexten, die Vertrauen ermöglichen, Ambivalenz aushalten und Selbstbegegnung im Denken fördern – über das Erlernen neuer Werkzeuge hinaus.
Was Bateson theoretisch beschreibt, zeigt sich im Arbeitsalltag in Situationen, in denen Menschen neue Tools einsetzen und zugleich ihre Perspektive auf Führung, Zusammenarbeit oder Verantwortung hinterfragen. Lernen geschieht dabei sowohl auf individueller Ebene als auch im gemeinsamen Denk- und Handlungsrahmen innerhalb von Organisationen.
Lernen als kulturelle Weiterentwicklung
Jeremy Rifkin, anerkannter US-amerikanischer Ökonom, Sozialtheoretiker und Zukunftsforscher, spricht in seinem Buch Die empathische Zivilisation davon, dass jede große Transformation in der Geschichte auch eine Veränderung des Bewusstseins mit sich brachte [Rifkin 2010]. Für ihn steht fest: Technologische Umbrüche brauchen ein neues Verhältnis des Menschen zu sich selbst und zur Gemeinschaft. Lernen ist dabei keine Reaktion auf den Wandel – es ist dessen Voraussetzung.
Diese Sichtweise verschiebt den Fokus: Lernen ist nicht die Reparaturstelle für Kompetenzlücken. Es ist nicht die Nachbesserung, wenn Menschen den Anforderungen nicht gewachsen scheinen. Stattdessen ist es ein kultureller, kollektiver, manchmal auch unbequemer Prozess, in dem sich neue Haltungen, Denkweisen und Beziehungsformen herausbilden.
Für Organisationen heißt das: Lernen darf nicht am Rand stattfinden. Es gehört ins Zentrum – genauso wie das operative Geschäft.
Die Herausforderungen des Neuen
Lernen – wie es heute gebraucht wird – stellt Menschen und Organisationen vor Anforderungen, die mit den alten Spielregeln brechen. Es ist nicht mehr linear, planbar, lehrbar im klassischen Sinne. Es ist beweglich, kontextabhängig, oft widersprüchlich. Und das macht es herausfordernd.
Für Einzelne bedeutet das: Sie müssen sich auf das Unbekannte einlassen, ohne Sicherheitsnetz, ohne bewährten Rückhalt. Sie sollen neue Wege gehen, obwohl niemand garantieren kann, dass sie erfolgreich sein werden. Sie werden dazu aufgefordert, eigenverantwortlich zu lernen, sich selbst zu reflektieren, sich zu verändern – und das alles unter Zeitdruck, im Spannungsfeld von Erwartungen, Zielen und Alltag. Es reicht nicht mehr, „richtig“ zu lernen. Es braucht die Bereitschaft, sich auf Unklarheiten einzulassen, sich irritieren zu lassen – und dennoch handlungsfähig zu bleiben.
Lernen bedeutet heute oft, Orientierung zu suchen, wo keine ist, Standpunkte zu finden inmitten widersprüchlicher Anforderungen und Entscheidungen zu treffen, obwohl das Ergebnis ungewiss ist. Wer sich darauf einlässt, braucht neben Motivation auch innere Beweglichkeit, psychologische Sicherheit und die Erfahrung, mit diesen Spannungen nicht allein zu sein.
Auch für Organisationen verändern sich die Bedingungen. Lernräume zu organisieren, bleibt wichtig. Zugleich braucht es ein erweitertes Verständnis davon, was Lernen ermöglicht. Denn Lernen bedeutet Entwicklung – und oft auch Irritation. Menschen, die lernen, stellen Sachverhalte infrage. Sie brauchen ehrliches Feedback. Sie brauchen Strukturen, die sowohl Orientierung bieten als auch Raum zur eigenen Auseinandersetzung lassen. Und sie brauchen Führung, die Klarheit schafft und gleichzeitig mit Offenheit und Ungewissheit umgehen kann.
Organisationen, die Lernen ermöglichen wollen, müssen demnach ebenso lernen, mit Ambivalenz umzugehen, Fehler als Entwicklungssignale zu sehen und Entscheidungen gemeinsam zu tragen. Sie brauchen Geduld, denn das Lernen, wie es heute gebraucht wird, ist nicht schnell. Aber es reicht tief. Und wenn es gelingt, verändert es nicht nur Verhalten – es verändert Kultur.
Entfaltung: das Movement-Lernen
Das Movement-Lernen versteht Lernen als kontinuierlichen Prozess – über Zeit, im Miteinander und im Arbeitskontext. Es ist kein Kurs, keine Plattform, kein Etikett auf bekannten Formaten. Es bietet einen strukturierten Rahmen, in dem Menschen lernen, reflektieren und Verantwortung übernehmen – abgestimmt auf den Alltag und mit Bezug ihm.
Im Zentrum steht das gemeinsame Ringen um wirksame Selbstorganisation, lebendigen Wissenstransfer und nachhaltige Weiterentwicklung – individuell und im Team. Lernen entfaltet sich durch bewusste Beteiligung: Menschen entscheiden sich dazu, ihre Zeit gezielt einzusetzen und ein gemeinsames Ziel im vereinbarten Rahmen zu verfolgen.
Dabei entstehen Räume, in denen Nachfragen und Hinterfragen gefördert werden, Erfahrungen geteilt und der Status quo hinterfragt wird – mit dem Ziel, Bewährtes zu würdigen und Neues zu erproben. In kleinen, stabilen Gruppen entsteht ein Setting, das Sicherheit gibt und gleichzeitig fordert. Es bietet Struktur ohne Vorgabe, Orientierung ohne Belehrung.
Menschen arbeiten über einen definierten Zeitraum an klaren Lernzielen. Sie reflektieren, probieren aus und wenden das Gelernte direkt in ihrem Arbeitsalltag an – begleitet von Peers, Mentor:innen und einem verbindlichen Commitment. Movement-Lernen verbindet die Tiefe des Coachings mit der Kontinuität des Mentorings und richtet sich konsequent an der Praxis aus. Es fördert die Anwendung des Gelernten und schafft gemeinsame Entwicklungserfahrungen.
So entsteht eine Lernkultur, in der Wissen wirksam wird und Lernen verbindlich, alltagsnah und praxisrelevant bleibt. Veränderung wird darin nicht nur ausgehalten, sondern aktiv mitgestaltet – aus eigener Motivation und im Handeln.
≡ Was bleibt?
Lernen ist kein Zusatzangebot. Es ist kein Reparaturbetrieb für Defizite. Und auch kein Ort zur Aufbewahrung von Methoden. In einer Welt, die sich kontinuierlich verändert, ist Lernen das, was Anpassungsfähigkeit und Weiterentwicklung ermöglicht – für Einzelne, Teams und ganze Organisationen.
Doch dieses Lernen folgt heute anderen Regeln als früher. Es lässt sich nicht vollständig planen, standardisieren oder nebenbei erledigen. Es braucht neue Rahmenbedingungen: weniger Anleitung, mehr Verantwortung. Weniger Prüfen, mehr Erforschen. Weniger Kontrolle, mehr Vertrauen.
Was Organisationen heute brauchen, ist mehr als ein gutes Trainingsportfolio. Sie brauchen ein erweitertes Verständnis davon, was Lernen leisten kann – als kontinuierlicher Prozess, verankert im Arbeitsalltag. Lernen wird Teil der Kultur. Es wird gemeinsam getragen, nicht einzelnen Personen überlassen.
☼ Denkanstoß
In vielen Organisationen ist Lernen als Maßnahme organisiert – mit klaren Zielen, festen Zeitfenstern und überprüfbaren Ergebnissen. Diese Strukturen können hilfreich sein, um Orientierung zu geben und Entwicklung zu unterstützen. Gleichzeitig zeigt sich in der Praxis, dass Lernen dann besonders wirksam ist, wenn Menschen aktiv mitdenken, mitgestalten und Verantwortung übernehmen.
Es lohnt sich, die Bedingungen in den Blick zu nehmen, unter denen Lernen gelingt: Wann fühlen wir uns sicher genug, um Fragen zu stellen? Wann sind wir bereit, Routinen zu hinterfragen? Und was braucht ein Team, um sich gemeinsam so zu entwickeln, dass es seine Ziele auch in unsicheren Zeiten erreichen kann?
Lernen zeigt sich im Verhalten: in Entscheidungen, Kommunikation und Zusammenarbeit. Es entwickelt sich im Arbeitskontext selbst – eingebettet in den Alltag, geprägt von konkreten Anforderungen, getragen vom Miteinander im Team.
▷ Und es geht weiter
Lernen neu zu denken: Das klingt gut – und notwendig.
Doch was bedeutet das für den Alltag in Organisationen? Für Menschen, die unter Druck stehen, für Teams, die Ergebnisse liefern müssen, für Führungskräfte, die Erwartungen erfüllen sollen?
Viele Unternehmen setzen nach wie vor auf Trainings, Seminare und Programme in der Hoffnung, dass neues Wissen zu besseren Ergebnissen führt. Das ist nachvollziehbar. Es existieren Strukturen, Budgets, Routinen. Und es gibt den Wunsch, Menschen gezielt zu befähigen, mit wachsender Komplexität umzugehen.
Doch die Frage stellt sich immer drängender: Funktioniert das noch? Bringt das, was als Lernmaßnahme geplant ist, tatsächlich die gewünschten Ergebnisse hervor? Oder schaffen wir Formate, die zwar gut gemeint sind, aber in der Praxis kaum etwas verändern?
Im nächsten Kapitel tauchen wir tiefer ein und fragen:Was verhindert, dass Lernen dort ankommt, wo es gebraucht wird?Warum bleiben viele Trainings wirkungslos, obwohl so viele Ressourcen hineinfließen?Worauf kommt es an, wenn Lernen nachhaltig in den Teams und der Organisation verankert sein soll?
Warum Trainings nicht (mehr) funktionieren
„Wissen ist ein Schatz. Aber Übung ist der Schlüssel dazu.“
(Thomas Fuller)
Trainings gelten in vielen Organisationen als universelle Antwort auf Veränderung. Wenn Mitarbeitende besser kommunizieren sollen, wird ein Kommunikationstraining organisiert. Wenn Führungskräfte mehr Verantwortung übernehmen oder empathischer führen sollen, gibt es ein Seminar zu Leadership. Wenn ein Unternehmen agiler werden will, startet es gleich mehrere Schulungsreihen zur neuen Arbeitswelt – von Scrum über Design Thinking bis hin zu New-Work-Basics.
Dieser Reflex ist verständlich. Ein Bedürfnis nach Wissen wird sichtbar, das gestillt werden soll. Die Idee dahinter ist so einfach wie plausibel – und im Grunde auch sympathisch: Wer etwas lernen soll, dem wird das passende Format serviert. Wer etwas besser machen soll, muss dazu die richtigen Methoden kennen. Und natürlich ist es richtig, Kompetenzen gezielt zu entwickeln. Doch was in der Theorie gut klingt, stößt in der Praxis oft schnell an seine Grenzen.
Denn obwohl viele Trainings mit Sorgfalt geplant, methodisch professionell gestaltet und mit hohen Erwartungen belegt sind, bleibt am Ende oft eine leise Enttäuschung zurück. Es wurde viel gesagt – aber wenig verändert. Es wurde intensiv gearbeitet – aber der Arbeitsalltag läuft weiter wie zuvor. Es gab klare Impulse – doch kaum etwas davon hat den Weg in die tägliche Praxis gefunden.