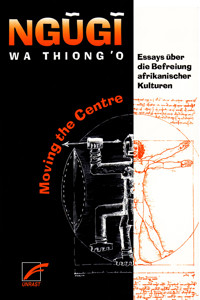
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Auswahl von Vorträgen und Artikeln des kenianischen Literaturwissenschaftlers und Schriftstellers Ngugi wa Thiong’o, in denen er seine postkoloniale Kritik formuliert und eine Reihe kulturwissenschaftlicher Thesen aufstellt. So müssten beispielsweise, um die Kulturen der Welt – insbesondere die Afrikas – von nationalistischen, rassistischen und neokolonialen Fesseln befreien zu können, die Zentren der Macht ›verrückt‹ werden: sowohl innerhalb der Nationen als auch zwischen ihnen. »In den Betrachtungen und Schlussfolgerungen werden die politischen und gesellschaftlichen Realitäten einer schonungslosen Kritik unterworfen […] Spannende und zum Teil auch provokante Lektüre.« – Asien-Afrika-Lateinamerika, No. 2
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ngugi wa Thiong’o wurde 1938 in Limuru, Kenia geboren. Bereits während seines Studiums an der Makerere University of Kampala veröffentlichtete er seine ersten Schriften. Sein radikaler Einsatz für demokratische Verhältnisse in Kenia führte zu mehreren Verhaftungen, bei denen Ngugi immer wieder Folterungen ausgesetzt war. 1982 mußte Ngugi ins Exil nach London gehen. Zur Zeit lebt er in den USA und lehrt dort Literaturwissenschaften an den Universitäten von New York und Yale.
Ngugi wa Thiong’o
Moving the Centre
Essays über die Befreiung afrikanischer Kulturen
herausgegeben vom Arbeitskreis Afrika, Münster (AKAFRIK)
aus dem kenianischen Englisch von Jörg W. Rademacher
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
Ngugi wa Thiong’o:
Moving the Centre
2. Auflage, Oktober 2017
(vom Übersetzer im Frühjahr 2023 vollständig durchgesehene
und korrigierte Fassung des Erstdrucks von 1995)
eBook UNRAST Verlag, Oktober 2024
ISBN 978-3-95405-092-5
© UNRAST Verlag, Münster
www.unrast-verlag.de | [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: UNRAST Verlag, Münster
Satz: UNRAST Verlag, Münster
Inhalt
Vorwort der Herausgeber
Vorwort des Autors zur englischen Ausgabe
I. Die Befreiung der Kulturen vom Eurozentrismus
1 Das Zentrum verlagernAuf dem Weg zu einem kulturellen Pluralismus
2 Raum schaffen, damit hundert Blumen blühen könnenDer Reichtum einer allgemeinen globalen Kultur
3 Die Universalität regionalen Wissens
4 Imperialismus der SpracheEnglisch, eine Welt-Sprache?
5 Kultureller Dialog für eine neue Welt
6 Der kulturelle Faktor im neokolonialen Zeitalter
II. Die Befreiung der Kulturen von kolonialen Hinterlassenschaften
7 Der Schriftsteller in einem neokolonialen Staat
8 Der Widerstand gegen das VerdammungsurteilDie Rolle der Kopfarbeiter
9 Die Rolle des Wissenschaftlers bei der Entwicklung der Literaturen Afrikas
10 Postkoloniale Politik und Kultur
11 In Mois Kenia ist Geschichte subversiv
12 Aus den Korridoren des SchweigensDer Exilierte schreibt zurück
13 Imperialismus und RevolutionBewegungen für sozialen Wandel
III. Die Befreiung der Kulturen vom Rassismus
14 Die Ideologie des RassismusKrieg gegen Frieden innerhalb von und zwischen den Nationen
15 Rassismus in der Literatur
16 Ihr Koch, ihr HundKaren Blixens Afrika
17 Biggles, Mau Mau und ich
18 Black Power in Großbritannien
19 Der lange Marsch zur FreiheitWillkommen daheim, Mandela!
IV. Matigari, Träume & Alpträume
20 Das Leben, die Literatur und eine Sehnsucht nach der Heimat
21 Matigari und die Träume von einem geeinten Ostafrika
Glossar(Mit * markierte Wörter sind hier erklärt.)
Danksagungen
Personenverzeichnis
Anmerkungen
Vorwort der Herausgeber
Ngugi wa Thiong’o, kenianischer Schriftsteller und Autor, ist bekannt für seine Novellen, Erzählungen und Theaterstücke, die er in den letzten Jahren immer öfter auch in seiner Muttersprache Gikuyu erstveröffentlichte, damit die große Masse der Kenianer, die kein Englisch spricht, in die Lage versetzt wurde, seine Stücke überhaupt verstehen zu können. In den hier zum ersten Mal im deutschen Sprachraum veröffentlichten Essays stellt er eine andere Seite seines Schaffens vor, die des politischen Essayisten und Schriftstellers, der eingreift, wenn es ihm notwendig erscheint, der einem recht fest umrissenen Weltbild folgt, dessen Zentrum die Beschäftigung mit der Landbevölkerung Afrikas und ihrer elenden Lage ist. Bei der kenianischen Regierung ist er berüchtigt für seinen kompromißlosen Einsatz für eine wahre, von allen Bürgerinnen und Bürgern bestimmte Demokratie von unten in diesem von Präsident Moi autokratisch geführten Land. Das brachte ihm Verhaftungen und Jahre des Exils ein – zu Zeiten, als im Westen von »Demokratie für Afrika« noch keine Rede war, sondern jede Regierung in Ost und West die kleinen und großen Diktatoren des Kontinents politisch, militärisch und wirtschaftlich stützte.
Ngugi begreift sich als politischer Lehrer: er lehrt Literatur und verwandte Wissenschaften an den Universitäten von Yale, Smith, Amherst und New York. So sind einige der hier veröffentlichten Essays, die aus Vorlesungen an den Universitäten entstanden, Teil seiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung über Literatur, besonders über die Gleichberechtigung und Eigenständigkeit von Literatur und Sprachen aus Ländern der ›Dritten Welt‹. Für die Literaturen des afrikanischen Kontinents fordert er literaturwissenschaftliche Institute, die nicht mehr Anhängsel der eurozentrischen Anglistik sind.
Der Leser, die Leserin kann und wird sich nach dem Sinn fragen, den eine Übersetzung von Artikeln, Vorträgen und Vorlesungen ins Deutsche macht, die z.T. vor mehr als 10 Jahren geschrieben wurden, oft aus einem sehr aktuellen Anlass heraus, die vor allem auch nicht mehr die große »Änderung der Weltlage« reflektieren, die durch den Zerfall des sowjetischen Imperiums Ende der achtziger Jahre eingetreten ist. Ngugi hat, ohne sich mit den politischen Zuständen in diesem sowjetischen Imperium zu identifizieren, doch immer die Bedeutung dieses Blocks als Gegengewicht zu den alten und neuen kolonialistischen Mächten des Westens betont. Diese Polarität und die daraus folgende weltweite Konkurrenz zwischen dem Osten und dem Westen bewirkten einerseits den Aufbau gigantischer Waffenlager in fast allen Ländern der sog. ›Dritten Welt‹ – nicht nur in Afrika – und daraus die Entwicklung selbst kleinster, regionaler Konflikte zu mörderischen Kriegen, Hungersnöten und Flüchtlingskatastrophen. Andererseits gaben sie einigen Ländern auch die Möglichkeit, eine selbstbestimmte Entwicklung zumindest zu probieren. Diese Möglichkeit verteidigt Ngugi in allen Schriften immer wieder vehement. Tief beeinflußt ist er dabei von den verschiedenen Spielarten des »Afrikanischen Sozialismus«, besonders denen aus der Anfangsphase der nationalen Selbständigkeit zu Beginn der sechziger Jahre. Hier ist er besonders von der Notwendigkeit regionaler Staatenzusammenschlüsse, ja Verschmelzungen, als einer Voraussetzung zu einem kontinentalen Panafrikanismus überzeugt, wie sie damals leider für nur kurze Zeit zwischen den ostafrikanischen Staaten, Kenia, Uganda und Tansania, bestand.
Ngugis Essays sind auch nicht in dem Sinne aktuell, daß sie sich auf das modische Schlagwort von der »Demokratisierung Afrikas« beziehen – ein Schlagwort, das ebenfalls Anfang der 90er Jahre aus dem Niedergang des sowjetischen Systems entsprang. Die Behinderung der demokratischen Entwicklung Afrikas durch Diktatur, Bürokratie und Ineffizienz schien mit der Aufhebung der Polarität aus dem Weg geräumt, die westlichen Länder präsentierten sich als Vorbilder, ja sogar als Garanten einer demokratischeren Entwicklung Afrikas. Das ging soweit, diese Entwicklung sogar militärisch, wie im Falle Somalias, erzwingen zu wollen. Ngugi macht immer wieder darauf aufmerksam, daß die tieferliegenden Ursachen der afrikanischen Fehlentwicklung beachtet werden müssen – als da sind eine ungeheure Verschuldung gegenüber westlichen Kreditgebern, Verschwendung und Korruption einer vom Westen erzogenen Elite und die damit einhergehende tiefe Verachtung und Vernachlässigung der kulturellen und sozialen Interessen der afrikanischen Landbevölkerung. Das Debakel in Somalia ist nur der augenscheinlichste Ausdruck dieser grandiosen Fehleinschätzung Afrikas, für deren theoretische Unterfütterung sich auch ›Linke‹ und sich fortschrittlich nennende Intellektuelle hergegeben haben.
Ngugi beleuchtet auch nicht den Übergang von einem ›rassischen‹ Kolonialismus zu den Anfängen einer demokratischen Mehrheitsherrschaft in Südafrika, der mit den ersten freien Parlamentswahlen und der Ernennung von Nelson Mandela zum Präsidenten 1994 begonnen hat. Aber er hat diesen Übergang als wesentliche Bedingung für eine wirklich freie Entwicklung des gesamten Kontinents bezeichnet und mit allen seinen Mitteln der schreibenden Kunst daran mitgewirkt. Insoweit wird er sich, trotz all der vielen Enttäuschungen, die auch in den wenigen Jahren des neunziger Dezenniums schon wieder das Bild Afrikas verdunkeln, über diese Entwicklung sehr freuen. Immer wieder verweist er in den folgenden Essays auf die Notwendigkeit, sich der historischen Bedingungen der sozialen und kulturellen Entwicklung Afrikas aus einer langen geschichtlichen Phase des Kolonialismus und Imperialismus bewußt zu sein.
Als Schriftsteller legt Ngugi besonderen Wert auf eine selbstbestimmte kulturelle und soziale Entwicklung der Menschen. Mehr und mehr sind in den letzten vier Jahrhunderten die Kulturen der Welt von einer Handvoll westlicher Nationen mit ihren kulturellen Zentren dominiert worden. Der Westen sieht sich selbst als Zentrum des Universums. Kulturelle Macht und kultureller Einfluß, genau wie politische und ökonomische Macht, wurden und werden von diesem Zentrum aus kontrolliert. In den vorliegenden Essays drückt Ngugi seine Überzeugung aus, daß dieses Zentrum in zweifacher Weise verrückt, verschoben werden muß: zwischen den Nationen und innerhalb der Nationen. Nur dann können sich die Kulturen der Welt von ihren Fesseln aus Nationalismus, rassistischen Vorurteilen, Klassen- und Geschlechtsschranken befreien.
Zwischen den Nationen, das heißt, daß das Zentrum aus seiner angemaßten Position im Westen in die Vielfalt der Sphären aller Weltkulturen aufgelöst werden muß. Innerhalb der Nationen bedeutet, daß Kultur nur kreativ werden und wirken kann, wenn der Prozeß der kulturellen Produktion aus den kleinen Zirkeln des Establishments in die Mitte der Gesellschaft verschoben wird, befreit von ›rassischen‹, religiösen und geschlechtlichen Fesseln.
Ngugi betont, daß diese Prozesse wichtige Schritte im Kampf für wahre kulturelle Freiheiten überall auf der Welt sind, um die Unausgewogenheiten einer vielhundertjährigen eurozentristischen Sichtweise zu korrigieren. Sein ›multikultureller Ansatz‹, der die Menschen mit ihren lokalen und regionalen Sichtweisen, Verständnissen und Überzeugungen in den Mittelpunkt seiner Überlegungen stellt, geht sicherlich weiter als das, was in den letzten Jahren in der Bundesrepublik als ›Multi-Kulti‹-Kultur zum Schlagwort geworden ist und oftmals über das oberflächliche Nachahmen fremder Einflüsse nicht hinausgeht. Insoweit können wir aktuell von Ngugi viel lernen.
Arbeitskreis Afrika (AKAFRIK), April 1995
Vorwort des Autors zur englischen Ausgabe
Den Titel dieser Essay-Sammlung habe ich von der ersten Arthur-Ravenscroft-Vorlesung übernommen, die ich am 4.12.1990 an der Universität Leeds gehalten habe. Die Reden und Aufsätze sind jedoch zu diversen Anlässen zu unterschiedlichen Zeiten und an verschiedenen Orten entstanden.
Der früheste Vortrag, Ihr Koch, ihr Hund. Karen Blixens Afrika wurde 1981 in Kopenhagen gehalten. Er rief in Dänemark einen Aufschrei der Empörung hervor, wo Karen Blixen alias Isak Dinesen zu dieser Zeit als Heilige galt. Eine rassistische Heilige? Obwohl ich direkt aus ihren Büchern Out of Africa und Shadows on the Grass zitierte, wurde ich der Übertreibung bezichtigt. Bei dem letzten Text, Postkoloniale Politik und Kultur, handelt es sich um die Niederschrift eines Vortrags, den ich während einer einmonatigen Australienreise im September 1990 an der Universität von Adelaide gehalten habe. Er beschreibt die Fortexistenz von Karen Blixens Afrika in Kenia über das Ende der Kolonialherrschaft hinaus. Ansonsten entstand der größte Teil der vorliegenden Texte zwischen 1985 und 1990. Somit fallen die Texte mit Ausnahme des Kopenhagener Vortrags in die Zeit, als ich außerhalb Kenias im Exil lebte.
Zwei Texte bereiten mir besondere Freude, Englisch, eine Welt-Sprache? und Der lange Marsch zur Freiheit: Willkommen daheim, Mandela!, weil es sich um Übersetzungen der Gikuyu-Originale handelt. Der erste war Teil eines BBC-Seminars über Englisch als mögliche Weltsprache, das am 27. Oktober 1988 abgehalten wurde. Die Übersetzung wurde später durch den BBC World Service gesendet. Die englische Version mit dem Titel English: A Language for the World und die Originalversion in Gikuyu, Kiingeretha, Ruthiomi rwa Thi Yoothe? Kaba Githwairi! wurden zum ersten Mal in der Ausgabe des Yale Journal of Criticism vom Herbst 1990 publiziert. Der zweite Text, der den historischen Moment der Freilassung Nelson Mandelas behandelt, wurde von dem in New York ansässigen afrikanisch-amerikanischen Nachrichtenmagazin EMERGE in Auftrag gegeben und erschien als Leitartikel in der Ausgabe vom März 1990. Zwar ist die Gikuyu-Originalversion des Textes über Sprache in Yale Journal of Criticism herausgegeben worden, aber der Gikuyu-Originaltext über Mandela liegt, neben einer beträchtlichen Zahl anderer Texte, noch in meiner Schublade. Trotz ihrer unterschiedlichen Zweckbestimmung illustrieren die beiden Texte die Schwierigkeiten derjenigen, die theoretische, philosophische, politische und journalistische Prosa in einer afrikanischen Sprache verfassen, insbesondere wenn sie im Exil geschrieben wird. Beispielsweise ist die Gikuyu-Sprachgemeinschaft hauptsächlich in Kenia ansässig. Weder innerhalb Kenias noch außerhalb existieren Zeitschriften oder Zeitungen in dieser Sprache. Das gleiche gilt für alle anderen afrikanischen Sprachen in Kenia, bis auf die im ganzen Land verbreitete Sprache Kiswahili. Dies bedeutet, daß es den Autoren, die in afrikanischen Sprachen schreiben, an Sprachrohren für ihre Publikationen mangelt und damit auch an Plattformen für eine kritische Auseinandersetzung derer, die diese Sprachen benutzen. Sie können ihre Werke lediglich in Übersetzungen veröffentlichen oder sich ansonsten einen Platz in europäischsprachigen Zeitschriften ausborgen, beides sicherlich keine Ideallösungen. Diese Situation ist nicht sehr günstig für die Entwicklung eines adäquaten Begriffsapparates für die moderne Technologie, Wissenschaft und Kunst in diesen Sprachen. Der Zuwachs an Schrifttum in afrikanischen Sprachen wird eine Gemeinschaft von Wissenschaftlern und Lesern ebendieser Sprachen brauchen, die die Fülle an Literatur über moderne Technologie, Kunst und Wissenschaft in sie hineintragen. Dafür brauchen sie entsprechende Plattformen. Es ist ein Teufelskreis. Daher spiegeln die beiden Texte wider, wie ich mich in den Kampf darum einmische, das Zentrum unseres literarischen Engagements von europäischen Sprachen weg und hin zu einer Vielzahl von Standorten in unseren Sprachen zu verlagern. Gleichzeitig illustrieren sie auch die Enttäuschungen auf dem Weg zu einer sofortigen und erfolgreichen Verwirklichung dieses Ziels unter den gegenwärtigen Bedingungen auf unserem Kontinent, der nicht an sich selbst glaubt. Schwierigkeiten in der Natur und im Leben sind jedoch dazu da, überwunden zu werden. Ohne Kampf gibt es keinen Fortschritt, hat Hegel gesagt. Der Kampf um die Entkolonisierung der Vorstellungskraft dauert an, und die beiden Texte treten zu meinen anderen Schritten – im Roman, im Drama und in Kindergeschichten – auf einer sicherlich langen Reise hinzu.
Obwohl diese Vorträge und Aufsätze zu diversen Anlässen zu unterschiedlichen Zeiten und an verschiedenen Orten geschrieben wurden, wurde mir klar, daß bestimmte vorherrschende Annahmen und wiederkehrende Themen und Anliegen sie miteinander verbinden.
Zunächst einmal ist da die Annahme, daß man, will man die Dynamik, die Dimensionen und Funktionsmechanismen einer Gesellschaft – einer jeden Gesellschaft – gänzlich verstehen, kulturelle Aspekte nicht völlig von wirtschaftlichen und politischen trennen kann. Quantität und Qualität des Reichtums in einer Gesellschaft, die Art seiner Organisation von der Produktion bis hin zur Verteilung, wirken auf die Art und Weise ein, wie Macht organisiert ist, und werden selbst wiederum davon beeinflußt. Dies alles wirkt seinerseits auf die Werte dieser Gesellschaft ein und wird von ihnen beeinflußt, so wie sie sich in der Kultur der Gesellschaft verkörpern und ausdrücken. Reichtum, Macht und Selbstbild einer Gesellschaft sind nicht voneinander zu trennen.
Die andere Annahme bezieht sich darauf, daß sich jede Gesellschaft wandelt. Nichts, nicht einmal die Kultur in einer Gesellschaft, kann für sich in Anspruch nehmen, bereits in der besten aller möglichen Welten angekommen zu sein. Da aber Kultur gleichzeitig ein Produkt der gesellschaftlichen Entwicklung und ein Aufbewahrungsort für alle Werte ist, die die verschiedenen sozialen Schichten in dieser Gesellschaft mit der Zeit hervorgebracht haben, ist sie hinsichtlich des Zusammenhalts einer bestimmten Gesellschaft konservativer als die sich vergleichsweise schneller verändernden Bereiche Wirtschaft und Politik. Kultur verleiht der Gesellschaft ihr Selbstbild, indem sie sich von den wirtschaftlichen und politischen Bereichen fernhält. Daher neigt sie dazu, sowohl neutral (als Ausdrucksmittel für alle und zugänglich für alle) als auch unveränderlich zu erscheinen, als ein sicherer Hort für alle Glieder der Gesellschaft. Daher spricht man in verschiedenen Gesellschaften von ›unseren Werten‹. Jedoch können als Ergebnis der Bewältigung der internen Widersprüche dieser Gesellschaft im Rahmen einer empfindlichen oder gar stürmischen Beziehung zur externen Umgebung Veränderungen eintreten, seien sie nun evolutionärer oder revolutionärer Art. In diesem Sinne ist die Gesellschaft wie ein menschlicher Körper, der sich als Ergebnis interner Zell- und anderer biologischer Prozesse entwickelt – Absterben, neues Wachstum und all ihre verschiedenen Kombinationen – und auch in externen Beziehungen mit der Luft und anderen Faktoren seiner Umgebung steht. Luft und Nahrung, die der Körper im Kontakt mit der Umwelt aufnimmt, werden verdaut und damit zum integralen Bestandteil des Körpers. Das ist normal und gesund. Es kann jedoch passieren, daß die Kraft des von außen einwirkenden Faktors zu groß ist. Er wird nicht organisch verarbeitet, und der Körper kann sogar absterben. Überschwemmungen, Erdbeben, der Wind, zuviel oder zu wenig Luft, vergiftetes oder gesundes Essen, Völlerei und Trunksucht sind alles äußere Faktoren oder Aktivitäten, die etwas mit der Aufnahme der Außenwelt zu tun haben, und sie können den Körper negativ beeinflussen. Dasselbe gilt für die Gesellschaft. Alle Gesellschaften entwickeln sich im externen Kontakt mit anderen Gesellschaften, und zwar auf wirtschaftlicher, politischer und kultureller Ebene. Unter ›normalen‹ Umständen ist eine bestimmte Gesellschaft in der Lage, fremde Einflüsse aufzunehmen, zu verarbeiten und sich zu eigen zu machen. Aber im Falle externer Vorherrschaft, z.B. durch Eroberung, sind Veränderungen nicht das Ergebnis der Verarbeitung interner Konflikte und Spannungen und entstehen somit nicht aufgrund einer organischen Entwicklung der Gesellschaft, sondern werden ihr von außen aufgezwungen.
Das kann zu einer gesellschaftlichen Deformation führen, zu einem totalen Kurswechsel oder sogar zum Aussterben der Gesellschaft. Ein Zustand externer Vorherrschaft und Kontrolle schafft genausowenig das notwendige Klima für das kulturelle Wohlbefinden einer Gesellschaft wie ein Zustand interner Vorherrschaft und Unterdrückung.
So können völlig isolierte Kulturen innerlich verdorren, austrocknen oder verschwinden. Kulturen, die von anderen vollkommen beherrscht werden, können verkrüppelt, deformiert werden oder aussterben. Kulturen jedoch, die sich verändern und die konstante Dynamik interner Beziehungsgeflechte widerspiegeln und die ein ausgewogenes Geben und Nehmen mit den externen Beziehungsgeflechten aufrechterhalten, sind gesund. Daher betone ich in diesen Aufsätzen immer wieder den erstickenden und letztlich zerstörerischen Charakter kolonialer und neokolonialer Strukturen. Eine neue Weltordnung, die nichts anderes ist als die weltweite Vorherrschaft neokolonialer Verhältnisse, die durch eine Handvoll westlicher Nationen kontrolliert werden – ob durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder nicht –, ist eine Katastrophe für die Völker der Welt und ihre Kulturen. In der Tat müssen sich Kulturen einander annähern und sich gegenseitig beeinflussen; aber dies muß auf der Grundlage von Gleichheit und wechselseitigem Respekt geschehen. Dem Ruf nach einer westlich orientierten neuen Weltordnung sollte man mit einem unablässigen Ruf nach einer neuen, gerechteren internationalen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Ordnung innerhalb der und zwischen den Nationen entgegentreten, einer Weltordnung, die die Vielfalt der Völker und Kulturen widerspiegelt: daher auch der Kampf für die Befreiung der Kulturen.
Aus all diesem erwächst das Thema der ›Verlagerung des Zentrums‹ das diesem Sammelband zugrunde liegt und damit auch seinem Titel. Es ist mir ein Anliegen, das Zentrum in mindestens zweierlei Hinsicht zu verlagern. Zum einen besteht die Notwendigkeit, das Zentrum von seiner für selbstverständlich erachteten Position im Westen auf eine Vielzahl von Sphären in allen Kulturen der Welt zu verlagern. Eurozentrismus ist der Begriff dafür, den Westen für das naturgemäße Zentrum des Universums zu halten. Diese Vorstellung entwickelte sich mit der Beherrschung der Welt durch eine Handvoll westlicher Nationen:
Eurozentrismus [sagt Samir Amin in seinem gleichnamigen Buch] ist ein kulturelles Phänomen in dem Sinne, daß er die Existenz absolut verschiedener kultureller Konstanten voraussetzt, die den Lauf der Geschichte bei den unterschiedlichen Völkern bestimmen. Eurozentrismus ist deswegen antiuniversell, weil er nicht darauf abzielt, mögliche Gesetzmäßigkeiten zu finden, die der menschlichen Evolution zugrunde liegen. Er stellt sich jedoch als universell dar, weil er vorgibt, daß eine Nachahmung des westlichen Modells durch alle Völker die einzige Lösung für die Herausforderungen unserer Zeit sei.
Die eurozentrische Weltanschauung manifestiert sich, obwohl sie in allen Bereichen anzutreffen ist – in der Wirtschaft, in der Politik usw. –, besonders auf dem Gebiet der Sprachen, der Literatur, der Kulturwissenschaften und in der allgemeinen Organisation der Fachbereiche für Literatur an den Universitäten in vielen Teilen der Welt. Die Ironie liegt darin, daß sogar das wirklich Universelle im Westen vom Eurozentrismus gefangengenommen wird. Die westliche Zivilisation selbst wird zur Gefangenen, deren Gefängniswärter ihre eurozentrischen Interpreten sind. Am gefährlichsten jedoch ist der Eurozentrismus für das Selbstvertrauen der Völker der ›Dritten Welt‹, wenn er zum integralen Bestandteil ihrer intellektuellen Vorstellung vom Universum wird.
Mein zweites Anliegen ist noch bedeutsamer, wenngleich darauf in diesen Aufsätzen nicht so ausführlich eingegangen wird. In fast allen Nationen liegt heutzutage die Macht bei der herrschenden Gesellschaftsschicht, einer männlichen, bürgerlichen Minderheit. Da aber viele dieser Minderheiten in der Welt immer noch durch den Westen beherrscht werden, sprechen wir von der Vorherrschaft einer eurozentrischen, bürgerlichen, männlichen und ›rassischen‹ Minderheit in der Welt, auch im Westen. Daraus ergibt sich auch die Notwendigkeit, das Zentrum von jedem Establishment einer Minderheitenklasse innerhalb der Nationen in Richtung auf die wirklich kreativen Zentren in der arbeitenden Bevölkerung auf der Basis der Gleichheit der Geschlechter, Rassen und Religionen zu verlagern.
Die Verlagerung des Zentrums in beiderlei Hinsicht – im Verhältnis zwischen den Nationen und innerhalb der Nationen – wird dazu beitragen, die Kulturen der Welt von den restriktiven Mauern des Nationalismus, der Klassen- und Rassenzugehörigkeit sowie der Geschlechterdifferenz zu befreien. In diesem Sinne bin ich ein unverbesserlicher Universalist. Denn ich glaube, daß wahrer Humanismus – so sehr er auch in den Geschichten und Kulturen der verschiedenen Völker der Erde verwurzelt ist – mit seiner weltumspannenden Kraft unter den Völkern der Erde blühen kann, ohne seine Wurzeln in regionaler und nationaler Individualität zu verlieren. Dann wird, um mit Marx zu sprechen, der menschliche Fortschritt aufhören, der heidnischen Gottheit zu ähneln, die Nektar ausschließlich aus den Schädeln der Erschlagenen zu trinken pflegt.
Es ist meine Hoffnung, daß dieser Sammelband etwas zu der Diskussion darüber beisteuert, wie man den Kampf für die Befreiung der Kulturen in der Welt am besten führen und gewinnen kann. Das Machtzentrum zu verlagern, ist für mich ein wesentlicher Schritt, um das Ungleichgewicht der letzten vierhundert Jahre auszubalancieren.
Ngugi wa Thiong’o, Yale, New Haven 1994
IDie Befreiung der Kulturen vom Eurozentrismus
1 Das Zentrum verlagern
Auf dem Weg zu einem kulturellen Pluralismus
Irgendwann im Jahre 1965 reichte ich Professor Arthur Ravenscroft im Rahmen einer sprachpraktischen Übung als Hausaufgabe ein Stück Prosaliteratur ein. Es handelte sich um die Beschreibung eines Kunsttischlers bei der Arbeit mit Holz. Später wurde dieses Stück Teil einer längeren Reminiszenz an das dörfliche Leben in Kenia unter der Kolonialherrschaft zwischen dem Ende des 2. Weltkriegs und dem Beginn des bewaffneten Mau-Mau-Aufstandes gegen die britische Kolonialherrschaft im Jahre 1952. Als ich 1966 an der ersten Konferenz skandinavischer und afrikanischer Schriftsteller in Stockholm teilnahm, stellte ich den Text unter dem Titel Memories of a Childhood vor. Zu dem Zeitpunkt war der Text schon in ein noch größeres Unternehmen integriert worden, in einen Roman mit dem Titel A Grain of Wheat (Preis der Wahrheit), den ich während meiner Zeit in Leeds verfaßte. Er erschien im Jahre 1967. Es hat mich gefreut, daß ich in dem Exemplar, welches ich für Arthur Ravenscroft signierte, seine Aufmerksamkeit auf das Kapitel lenken konnte, das den Übungstext enthielt.
Ich erwähne den Roman, weil A Grain of Wheat für mich in so vielerlei Hinsicht das Leeds symbolisiert, das ich mit Arthur Ravenscrofts Zeit verbinde, die auch einen bedeutsamen Augenblick in der Entwicklung der afrikanischen Literatur darstellt. Das waren die 60er Jahre, als der Mittelpunkt des Universums sich von Europa weg bewegte oder, um es anders auszudrücken, als viele Länder besonders in Asien und Afrika ihr Recht einklagten und geltend machten, sich selbst und ihre Beziehung zum Universum von ihren eigenen Zentren in Afrika und Asien her zu definieren. Frantz Fanon wurde zum Propheten des Kampfes um die Verlagerung des Zentrums, und sein Buch Die Verdammten dieser Erde wurde zu einer Art Bibel unter den afrikanischen Studenten aus West- und Ostafrika, die damals in Leeds studierten. In der Politik war diese Verlagerung des Zentrums eine klare Angelegenheit. Zwischen 1960 und 1964, dem Jahr, in dem ich nach Leeds kam, hatten viele afrikanische Länder, z.B. Tansania, Uganda, Zaire und Nigeria, um nur einige zu nennen, ihre eigenen Nationalflaggen gehißt und sangen neue Nationalhymnen anstelle derer ihrer europäischen Eroberer, wie dies in der Kolonialzeit der Fall gewesen war. Kenia hatte sich noch nicht einmal richtig an seine neue Nationalhymne gewöhnt, die zum ersten Mal um Mitternacht am 12. Dezember 1963 gesungen wurde. A Grain of Wheat feierte den mehr als sechzig Jahre dauernden Kampf der kenianischen Völker um den Anspruch auf ihren eigenen Lebensraum. Die politischen Anstrengungen, das Zentrum zu verlagern, der ungeheure Entkolonisierungsprozeß, der die politische Landkarte der Nachkriegswelt veränderte, hatte auch im Westen einen radikalisierenden Effekt, insbesondere unter den jungen Menschen. Dies wurde am ehesten durch die Unterstützung des Kampfes der Vietnamesen durch die Jugend der 60er Jahre symbolisiert. Diese radikale Tradition hatte ihrerseits einen starken Einfluß auf die afrikanischen Studenten in Leeds, die daraufhin den Inhalt des Dekolonisierungsprozesses noch kritischer als die Form betrachteten. Anstoß war Fanons Kritik in dem zu Recht gefeierten Kapitel ›Die Fallstricke des Nationalbewußtseins‹ aus dem Buch Die Verdammten dieser Erde. Bei A Grain of Wheat handelte es sich gleichermaßen um einen Lobpreis auf die Unabhängigkeit wie um eine Warnung vor den damit verbundenen Fallstricken.
Auf dem Gebiet der Kultur spiegelt sich der Kampf um eine Verlagerung des Zentrums in der trikontinentalen Literatur Asiens, Afrikas und Südamerikas wider. Dramatischer verlief er im Falle Afrikas und der Länder der Karibik, wo die Nachkriegswelt den Aufstieg einer neuen Literatur in Englisch und Französisch erlebte, die sich zu einer Tradition konsolidierte. Diese Literatur feierte das Recht, die Welt zu benennen, und A Grain of Wheat gehörte zu dieser Tradition des Kampfes um das Recht, die Welt für uns zu benennen. Die neue Tradition forderte die vorherrschende heraus, in der Asien, Afrika und Südamerika immer von den Hauptstädten Europas aus durch Europäer definiert wurden, die die Welt oft durch eine gefärbte Brille sahen. Der gute und der schlechte Afrikaner der rassistischen europäischen Tradition, die tölpelhaften Messrs. Johnson* der liberalen europäischen Tradition oder sogar das Fehlen eines Bewußtseins über die kolonialisierte Welt in der Hauptströmung der europäischen literarischen Vorstellungskraft, sie alle wurden von der Energie der Okonkwos der neuen Literatur herausgefordert, die eher im Widerstand sterben als auf Knien in einer Welt leben wollten, die sie nicht mehr zu ihren Bedingungen für sich selbst bestimmen konnten, Charaktere also, die mit jeder ihrer Gesten in Wechselwirkung mit der Natur und mit ihrem sozialen Umfeld ein lebendiges Bild der Tatsache darstellten, daß Afrika nicht das Land der ewigen Kindheit blieb, über das die Geschichte hinwegging, so wie sie von Osten nach Westen weitergereicht wurde, um ihren vollendeten Ausdruck in den westlichen Imperien des 20. Jahrhunderts zu finden. Das Hegelsche Afrika war ein europäischer Mythos. Die Literatur forderte die eurozentrische Grundlage der Vorstellung von anderen Welten heraus, sogar bei Schriftstellern, die sich nicht notwendigerweise in Übereinstimmung mit dem befanden, was Europa dem Rest der Welt antat. Die Frage lautete nicht, wie man ein Zentrum durch ein anderes ersetzen könnte. Das Problem entstand nur, wenn Menschen versuchten, die Vision irgendeines beliebigen Zentrums zu benutzen und diese als universelle Realität zu verallgemeinern.
Die moderne Welt ist sowohl ein Produkt des europäischen Imperialismus als auch des Widerstandes, der diesem von den afrikanischen, asiatischen und südamerikanischen Völkern entgegengesetzt worden ist. Sollten wir etwa die Welt vermittelt durch europäische Antworten auf den Imperialismus von der Art Rudyard Kiplings, Joseph Conrads oder Joyce Carys sehen, deren Werk in Themen, Orten und Einstellungen die Erfahrung des Imperialismus voraussetzte? Natürlich reagierten sie auf den Imperialismus auf der Grundlage einer Vielzahl ideologischer Voraussetzungen und Einstellungen. Aber sie hätten niemals das Zentrum ihrer Weltsicht verschieben können, weil sie selbst durch das europäische Zentrum ihrer Erziehung und Erfahrung gebunden waren. Selbst wenn sie sich der verheerenden Auswirkungen des Imperialismus auf die unterworfenen Völker bewußt waren, so wie das in Conrads Beschreibung der sterbenden Opfer kolonialer Abenteuerlust in Heart of Darkness der Fall ist, konnten sie sich von der eurozentrischen Basis ihrer Weltsicht nicht freimachen.
In der Tat stieß ich am Makerere University College, aber außerhalb der offiziellen Struktur, zum ersten Mal auf die neuen Literaturen aus Afrika und der Karibik. Ich erinnere mich noch immer an die Aufregung, mit der ich die Welt von einem nichteuropäischen Zentrum her las. Die große Tradition der europäischen Literatur hatte die Weltsicht der Calibans, der Freitags und der zivilisierten Afrikaner ihrer Phantasie erfunden und sogar definiert. Nun erzählten die Calibans und die Freitags der neuen Literatur ihre eigene Geschichte, die auch die meine war. Sogar die Titel, wie Peter Abrahams Tell Freedom, schienen von einer Welt zu sprechen, die ich kannte, und von einer Hoffnung, die ich teilte. Als Trumper, eine der Hauptfiguren aus George Lammings Roman In the Castle of my Skin, davon spricht, wie er plötzlich sein eigenes Volk und daher seine eigene Welt entdeckt, nachdem er Paul Robeson ›Let My People Go‹ singen gehört hatte, sprach er von mir und meinem Zusammentreffen mit den Stimmen, die aus den außereuropäischen Zentren kamen. Diese neuen Literaturen hatten zwei wichtige Auswirkungen auf mich.
Ich wollte schreiben, von der Freiheit erzählen, und zu dem Zeitpunkt, als ich 1965 in Arthur Ravenscrofts Kurse in Leeds kam, hatte ich schon zwei Romane geschrieben, The River Between (Der Fluß dazwischen) und Weep Not Child, einen Dreiakter, The Black Hermit (Der schwarze Eremit), zwei Einakter und neun Kurzgeschichten. Mein dritter Roman, A Grain of Wheat, sollte dann in Leeds geschrieben werden, aber sogar die ersten beiden wecken Erinnerungen an Leeds. The River Between, mein erster Roman, der aber erst als zweiter veröffentlicht wurde, kam 1965 heraus. Das Buch wurde in Leeds lanciert, wobei die schöne Präsentation des neuen Bandes im Buchladen Austicks auf der gegenüberliegenden Strassenseite dem Ego des Autors schmeichelte. Für Weep Not Child, meinen zweiten Roman, allerdings den ersten, der im Jahre 1964 bei Heinemann erschien, wurde mir von der UNESCO der erste Preis auf dem ersten Festival schwarzer und afrikanischer Schriftsteller und Künstler in Dakar verliehen. Ich hörte die Nachricht, als ich mich gerade in Leeds aufhielt. Mir wurde von überall auf der Welt gratuliert. Ein UNESCO-Preis für Literatur? Meine finanziellen Sorgen in Leeds waren vorbei, und ich äußerte meine Erwartungen vor meinen Mitstudenten, die von dem Glück, das einem aus ihren Reihen widerfuhr, nicht gerade wenig beeindruckt waren. Man kann sich vorstellen, wie enttäuscht ich war, als ich später erfuhr, daß es sich bei dem Preis um eine reine Ehrenbezeigung handelte. Ein erster Preis als reine Ehrenbezeigung. Ich habe von da an nie mehr über diesen Preis gesprochen oder ihn als eine meiner großen Errungenschaften angeführt. Glücklicherweise hörte ich die ehrbezeigende Nachricht, als ich schon mitten in der Arbeit an meinem dritten Roman steckte, A Grain of Wheat. Ich hoffte, daß diesem kein erster Preis als Ehrenbezeigung verliehen würde, jedenfalls nicht, solange ich mich als British Council Scholar in Leeds aufhielt.
Fast genauso stark wie meine Berufung zum Schreiben war der Wunsch, mich in die neue Literatur zu vertiefen. Eine Zeitlang war ich hin- und hergerissen zwischen Joseph Conrad, mit dem ich mich in aller Form während meines Studiums in Makerere in einer Prüfungsarbeit befaßt hatte, und George Lamming, der im offiziellen Lehrplan von Makerere nicht auftauchte. Joseph Conrad übte eine gewisse Anziehungskraft aus. Er war Pole, in einem Land und in eine Familie geboren, die immer nur die Freuden der Unterwerfung und des Exils gekannt hatte. Er hatte die englische Sprache erst spät erlernt und es dennoch vorgezogen, in ihr, dieser geborgten Sprache zu schreiben, obwohl er seine Muttersprache und Französisch perfekt beherrschte. Und – was noch wichtiger ist – sein Werk war ein Teil der Great Tradition* der englischen Literatur geworden. War er nicht schon ein Abbild dessen, was wir, die neuen afrikanischen Schriftsteller werden konnten, wie schon vor uns die irischen Schriftsteller wie z.B. Yeats und andere? Und es gab noch einen zusätzlichen Grund für seine Anziehungskraft. Conrads wichtigste Romane spielen hauptsächlich im Kolonialreich: in Asien, Afrika und Südamerika. Die Erfahrung des Empire war zentral für Conrads Einfühlungsvermögen in seinen wichtigsten Romanen, Lord Jim, Victory und Nostromo, ganz zu schweigen von all den anderen langen und Kurz-Geschichten, die an den verschiedenen Außenposten des Empire spielen. Man denke z.B. an die Dominanz der Bilder von Elfenbein in Heart of Darkness, von Kohle in Victory, von Silber in Nostromo. Besonders Nostromo gehörte zu den frühesten Romanen, die die Verquickung von Industrie- und Bankenkapital beschreiben, aus der schließlich das Finanzkapital entsteht, das Lenin in seinem Buch Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus einmal als eine der wesentlichen Eigenschaften des modernen Imperialismus bezeichnet hat. Die Entfremdung liegt den meisten Themen in Conrads Romanen zugrunde, so auch in Nostromo. Aber Conrad hatte sich aus freien Stücken entschieden, zum Empire zu gehören, und die moralische Ambivalenz in seiner Haltung gegenüber dem britischen Imperialismus ergibt sich aus dieser selbstgewählten Treue. Auch George Lamming wurde im Exil geboren, in dem Sinne, daß seine Vorfahren sich nicht freiwillig in die Karibik aufmachten. Die Erfahrung des Empire war auch für seine Romane zentral, von In the Castle of My Skin bis hin zu Season of Adventure. Koloniale Entfremdung lag all den Themen seines Werkes zugrunde, und er sollte die Zentralität dieses Themas für sein Werk in einem Aufsatzband mit dem Titel The Pleasures of Exile bestätigen. Lamming jedoch schrieb, anders als Conrad, ganz klar von der anderen Seite des Empire aus, von der Seite derjenigen, die aufschrien: ›Let My People Go‹. Bei Conrad fühlte ich mich wegen seiner Unfähigkeit, irgendeine aus dem Kräftepotential der Unterdrückten erwachsende Möglichkeit der Erlösung zu erkennen, immer unwohl. Er schrieb vom Zentrum des Empire her. Lamming dagegen schrieb vom Zetrum derjenigen her, die gegen das Empire kämpften. Er schien mir daher, daß George Lamming mir mehr zu bieten hatte, und ich wollte mich näher mit ihm und der karibischen Literatur insgesamt beschäftigen.
Wenngleich sich der Kampf um die Verlagerung des Blickwinkels, von dem aus man die Welt betrachtet – weg von der einseitig europäischen Sicht hin zu einer Vielzahl von Zentren – in den neuen Literaturen Asiens, Afrikas und Südamerikas widerspiegelte, spiegelte er sich nicht in gleicher Weise in der publizistischen und akademischen Kritik in den neuerdings unabhängigen Ländern, und übrigens auch nicht in Europa. Das Studium der Humanwissenschaften bedeutete wortwörtlich das der klassischen Humanität, die in die kanonisierte Tradition der europäischen kritischen und schöngeistigen Literatur eingegangen war, und dies darüber hinaus eingegrenzt innerhalb der sprachlichen Grenzen der einzelnen Kolonialmächte. Der Fachbereich für Englisch in Makerere, an dem ich studiert habe, war wahrscheinlich typisch für alle anglistischen Fachbereiche in Europa oder Afrika zu jener Zeit. Man behandelte englischsprachige Schriften der Britischen Inseln, beginnend mit der Zeit Chaucers über Spenser und Shakespeare bis hin zum 20. Jahrhundert eines T.S. Eliot, James Joyce und Wilfred Owen. Diese Enge eines Literaturstudiums, das auf einer ausschließlich nationalen Tradition basierte, wurde in den Ländern ein wenig gemildert, in denen es andere literaturwissenschaftliche Fachbereiche gab, beispielsweise für Französisch. In solchen Institutionen gab es dann konkurrierende oder dem Vergleich verpflichtete Zentren im Studium der Humanwissenschaften: Allein die Tatsache, daß man an einer Universität studierte, an der es andere literaturwissenschaftliche Fachbereiche gab, bedeutete, daß man sich anderer Kulturen bewußt wurde. Aber die meisten dieser Fachbereiche beschränkten sich größtenteils auf die europäischen Sprachen und innerhalb Europas auf die muttersprachliche Literatur in diesen Sprachen. Amerikanische literaturwissenschaftliche Fachbereiche waren z.B. für die Lyrik und Prosa der afrikanisch-amerikanischen Bevölkerungsgruppe völlig blind. In der Diskussion über den amerikanischen Roman wurden beispielsweise Richard Wright, James Baldwin und Ralph Ellison kaum einmal als Angehörige der zentralen Tradition der amerikanischen Literatur erwähnt. Es war überall möglich, ein Literaturstudium in irgendeiner der europäischen Sprachen abzuschließen, ohne je von Achebe, Lamming, Tagore, Richard Wright, Aimé Césaire und Pablo Neruda gehört zu haben, Schriftstellern aus den Erdteilen, die man mittlerweile unter dem Namen ›Dritte Welt‹ kennt. Kurzum, die meisten Universitäten neigten dazu, die ungeheure Menge an Literaturen, die, wenngleich in europäischen Sprachen, so doch außerhalb der formalen Grenzen Europas und Euroamerikas entstanden waren, zu ignorieren.
An der Universität Makerere gab es keinen Platz für diese neue Literatur (ohnehin gab es damals in Makerere keine Studiengänge für Graduierte) und, soviel ich in Erfahrung bringen konnte, auch an keiner anderen Universität zu jener Zeit. Leeds kam mir zu Hilfe. In Leeds war schon im Jahre 1964 eine Konferenz über Commonwealth-Literatur abgehalten worden. Wole Soyinka, eine der neuen Stimmen, hatte in Leeds studiert. Andere Studenten aus Makerere, Peter Nazareth, Grant Kamenju und Pio Zirimu waren auch schon dort. Die Universität Leeds schien etwas an sich zu haben, und ich fühlte, daß ich dorthin gehen müßte, um meinen Anteil davon zu bekommen.
Es stellte sich heraus, daß es in Leeds keine offiziellen Veranstaltungen zu den neuen Literaturen gab. Weder die Literatur der ›Dritten Welt‹ im allgemeinen noch die Commonwealth-Literatur, geschweige denn die afrikanische und karibische Literatur im engeren Sinne waren zu jener Zeit ein fester Bestandteil des mainstream* der literaturwissenschaftlichen Curricula. Aber es gab dort schon Gastdozenten aus verschiedenen Teilen der Welt, die Visionen aus Zentren außerhalb Europas vermittelten. Man war auch offen für die Stimmen aus anderen Zentren, was mich in die Lage versetzte, im Bereich der karibischen Literatur zu forschen, wobei ich mich auf das Thema ›Exil und Identität in der karibischen Literatur unter besonderer Berücksichtigung des Werkes von George Lamming‹ konzentrierte. Ich erinnere mich an die Universität Leeds zur Zeit Arthur Ravenscrofts als an eine Institution, die als eine der ersten erkannte und zugab, daß es außerhalb des traditionellen Standortes der europäischen Phantasie etwas Lohnendes gab, wenngleich man eine politische Determinante benutzt hatte, um ein Gebiet für die offizielle Zulassung abzugrenzen, ein Gebiet, das ›Commonwealth-Literatur‹ genannt wurde. Die Einrichtung eines Lehrstuhls für Commonwealth-Studien mit Professor Walsh als erstem Lehrstuhlinhaber und die Herausgabe des Journal of Commonwealth Literature sorgten dafür, daß die Literatur aus den neuen Zentren als würdig legitimiert wurde für eine ernsthafte akademische Betrachtung und Diskussion. Der Begriff ›Commonwealth-Literatur‹ war beklagenswert unangebracht, und die afrikanische und karibische Literatur hat sich in ihm nie gut aufgehoben gefühlt. Afrikanische und karibische Literatur, ob in Englisch oder Französisch oder Portugiesisch, hatte eine viel grundlegendere Identität gemeinsam, und ihr natürlicher literarischer Verbündeter war die gesamte Protestliteratur, die ungeachtet sprachlicher Barrieren von der ehemals kolonisierten Welt Asiens, Afrikas und Südamerikas hervorgebracht worden war. Aber sie verwies auf die Möglichkeit, das Zentrum von seinem Standort in Europa weg und hin zu einer Vielzahl von Zentren zu verlagern, die ihrerseits ebenso legitime Standorte der menschlichen Phantasie sind.
Was im Leeds unserer Zeit nur ein Versuch war, möglicherweise den mainstream* zu öffnen, um Nebenströmungen aufzunehmen, sollte später für die Diskussion über die Relevanz von Literatur in einem afrikanischen Umfeld richtungweisend sein, die an allen drei ostafrikanischen Universitäten, Nairobi, Dar es Salaam und Makerere, heftig geführt wurde, nachdem die meisten der Studenten, die damals in Leeds gewesen waren, später zurückgekehrt waren und die Praktiken der existierenden anglistischen Fachbereiche in Frage stellten. Da gab es Grant Kamenju in Dar es Salaam, Tansania, Pio und Van Zirimu in Makerere, Kampala, Uganda, und mich in Nairobi, Kenia. Als ich 1967 nach Kenia zurückkehrte, stellte ich zu meinem Entsetzen fest, daß der Fachbereich für Englisch immer noch auf der Grundlage einer eurozentrischen Weltsicht organisiert war. Europa das Zentrum unserer Phantasie? Ezekiel Mphahlele aus Südafrika, der schon vor mir dort war, hatte hart darum gekämpft, daß afrikanische Texte ins Curriculum integriert würden. Der anglistische Fachbereich übersah im übrigen immer noch weitestgehend, daß in Afrika neue Literaturen in europäischen Sprachen aufkamen, und noch mehr, daß es eine schon lange existierende Tradition afrikanisch-amerikanischer Literatur und eine der karibischen Völker gab. Die Grundsatzfrage war: Aus welchem Blickwinkel betrachteten die afrikanischen Völker die Welt? Aus einem eurozentrischen oder einem afrozentrischen? Es ging hier nicht um den gegenseitigen Ausschluß von Afrika und Europa, sondern um die Grundlage und den Ausgangspunkt für ihr Zusammenwirken. Ich erinnere mich an die Aufregung, mit der meine beiden afrikanischen Kollegen und ich an der Universität von Nairobi im Jahre 1968 die Abschaffung des Fachbereichs für Englisch, so wie er damals organisiert war, forderten. Der Fachbereich sollte durch einen anderen ersetzt werden, der die Literaturen der ›Dritten Welt‹, verfügbar entweder direkt auf Englisch oder durch Übersetzungen ins Englische, ins Zentrum des Curriculums rücken sollte, ohne dabei natürlich die europäische Tradition auszuschließen. Solch ein Curriculum würde das Literatursein der Literatur eher betonen als das Englischsein. Der Fachbereich würde dadurch der offensichtlichen Tatsache Rechnung tragen, daß die Kenntnis des eigenen Selbst und der eigenen Umgebung die korrekte Ausgangsbasis dafür ist, die Welt in sich aufzunehmen; daß es niemals nur ein Zentrum geben kann, von dem aus man die Welt betrachtet, sondern daß die verschiedenen Menschen der Welt ihre eigene Kultur und ihre eigene Umgebung als Zentrum haben. Die entscheidende Frage war daher, wie ein Zentrum mit anderen Zentren in Verbindung stand. Ein Pluralismus der Kulturen und Literaturen wurde von den Fürsprechern der Umbenennung der literaturwissenschaftlichen Fachbereiche vorausgesetzt. Wenn die Diskussion auch von den ehemaligen Studenten der Universität Leeds ausgelöst wurde, so oblag die tatsächliche Realisierung der neuen Strukturen einigen Professoren, die in den 60er Jahren an der Universität Leeds unterrichtet hatten. Professor Arnold Kettle in Dar es Salaam und Professor Andrew Gurr in Nairobi waren maßgeblich daran beteiligt, den neuen literaturwissenschaftlichen Fachbereichen in Ostafrika sichere und arbeitsfähige Strukturen zu geben.
Bemerkenswerterweise waren die Vermittlersprachen sowohl in den neuen afrikanischen Literaturen als auch in den literaturwissenschaftlichen Fachbereichen, in die diese aufgenommen wurden, europäische Sprachen. Diese Frage sollte mich lange verfolgen, bis ich 1977 begann, in Gikuyu, einer afrikanischen Sprache, zu schreiben. Wieder einmal hatte meine Entscheidung, schließlich alle meine Werke hauptsächlich in Gikuyu zu verfassen, ihre Wurzeln in meiner Zeit im Leeds Arthur Ravenscrofts. Mein Roman A Grain of Wheat erschien 1967. Viele Leute, die mein Werk kommentiert haben, haben auf die auffällige Veränderung der Form und der Stimmung [gegenüber den beiden ersten Romanen] hingewiesen. Die Veränderung der politischen Stimmung spiegelte die intensive ideologische Diskussion wider, die sowohl unter Studenten in Professor Kettles Seminar über den Roman als auch außerhalb des offiziellen Unterrichts stattfand. Es wurde mir nur zu schmerzlich bewußt, daß der Roman, in dem ich so sorgfältig ein Bild des Kampfes der kenianischen Bauernschaft gegen koloniale Unterdrückung gezeichnet hatte, von deren Angehörigen nie gelesen werden würde. In einem kurze Zeit später geführten Interview in der Studentenzeitung Union News sagte ich 1967, daß ich nicht gedächte, weiterhin in Englisch zu schreiben: Ich wüßte, über wen ich schrieb, aber nicht, für wen. Eine umfassende Diskussion über die Sprachpolitik in der afrikanischen Literatur – in einem Sinne, der genau die Frage beantwortete, die in den 60er Jahren in Leeds gestellt worden war – sollte 1987 stattfinden, als ich mein Buch Decolonising the Mind veröffentlichte. Aber das Wichtigste in diesem unmittelbaren Zusammenhang ist, daß die Frage, welches die angemessene Sprache für afrikanische Literatur sei, an der Universität Leeds in den 60er Jahren überhaupt gestellt wurde. Wieder einmal ging es darum, wie man das Zentrum verlagern könne: weg von den europäischen Sprachen hin zu all den anderen Sprachen überall in Afrika und auf der ganzen Welt; ein Schritt, wenn Sie so wollen, hin zu einem Pluralismus der Sprachen als legitimem Mittel der menschlichen Phantasie.
Ich glaube, die Frage der Annäherung an einen Pluralismus der Kulturen, Literaturen und Sprachen ist heute, da die Welt immer mehr eins wird, immer noch wichtig. Die Frage, die diese neuen Literaturen, ob in europäischen oder in afrikanischen Sprachen, aufwerfen, ist die folgende: Wie sollen wir das 20. Jahrhundert verstehen oder eigentlich die dreihundert Jahre, die zum 20. Jahrhundert führten (wobei wir voraussetzen, daß das Studium der Literatur nicht nur ein masochistischer Akt ist, bei dem man sich bei den Toten aufhält wie der Gelehrte Casaubon in George Eliots Middlemarch)? Sklaverei, Kolonialismus und das gesamte Netz neokolonialer Beziehungen, die Frantz Fanon so gut analysiert hat, waren ebenso beteiligt an der Entstehung des modernen Westens wie des modernen Afrika. Die Kulturen Afrikas, Asiens und Südamerikas sind ebenso wie die Europas ein integraler Bestandteil der modernen Welt. Es gibt keine Rasse, schrieb Aimé Césaire in seinem berühmten Gedicht ›Rückkehr in das Land meiner Geburt‹, die für alle Zeiten das Monopol der Schönheit, der Intelligenz und des Wissens innehat, und er schrieb, es gebe einen Platz für alle bei der Siegesfeier anläßlich des Sieges der Menschheit.





























