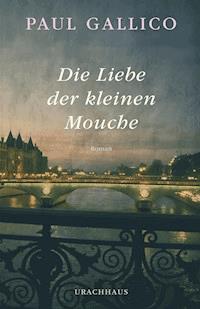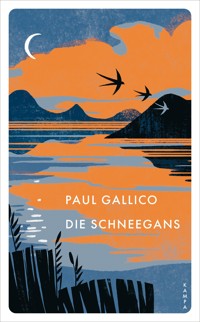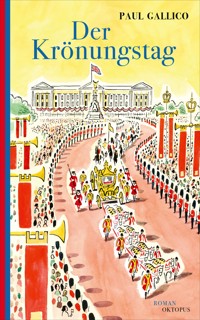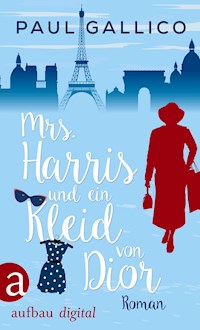8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Abenteuer von Mrs. Harris
- Sprache: Deutsch
Die Abenteuer von Ada Harris gehen weiter.
Auch mit ihren sechzig Jahren scheut die Raumpflegerin Ada Harris kein Abenteuer und so setzt sie es sich zum Ziel den verschollenen Vater des kleinen Henry zu suchen, der unglücklich bei Pflegeeltern lebt. Kurzerhand schmuggelt sie den Steppke an Bord des Kreuzfahrtschiffes und begibt sich mit ihm auf eine abenteuerliche Schiffsreise nach New York. Inmitten des Großstadttrubels suchen die beiden nach seinem Vater, der leider auf den Allerweltsnamen George Brown hört. Doch als sie ihn endlich finden, zerplatzen alle Träume wie Seifenblasen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über Paul Gallico
Paul Gallico wurde in New York als Sohn der österreichischen Violinistin Hortense Erlich und des italienischen Komponisten, Musiklehrers und Pianisten Paolo Gallico geboren, die 1895 in die Neue Welt ausgewandert waren. 1916 begann Gallico ein Studium an der Columbia University, das er 1921 mit dem akademischen Grad eines Bachelor of Science abschloss. Danach arbeitete er als Sportjournalist bei den New York Daily News, wo er ab 1923 auch eine eigene Kolumne hatte.
In den 30er Jahren wandte er sich zunehmend vom Sport ab und verfasste Kurzgeschichten, von denen viele in der Saturday Evening Post erschienen. Viele seiner Erzählungen und Romane wurden später für Kino und TV verfilmt.
Paul Gallico war viermal verheiratet und hinterließ mehrere Kinder. Er starb am 15. Juli 1976 in Antibes im Alter von 78 Jahren.
Informationen zum Buch
Die Abenteuer von Ada Harris gehen weiter!
Auch mit ihren sechzig Jahren scheut die Raumpflegerin Ada Harris kein Abenteuer und so setzt sie es sich zum Ziel den verschollenen Vater des kleinen Henry zu suchen, der unglücklich bei Pflegeeltern lebt. Kurzerhand schmuggelt sie den Steppke an Bord des Kreuzfahrtschiffes und begibt sich mit ihm auf eine abenteuerliche Schiffsreise nach New York. Inmitten des Großstadttrubels suchen die beiden nach seinem Vater, der leider auf den Allerweltsnamen George Brown hört. Doch als sie ihn endlich finden, zerplatzen alle Träume wie Seifenblasen …
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Paul Gallico
Mrs. Harris reist nach New York
Roman
Inhaltsübersicht
Über Paul Gallico
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Impressum
FÜR GINNIE
Der Marquis Hypolite de Chassagne ist natürlich nicht der französische Botschafter in den Vereinigten Staaten. Er ist nur der gute Geist aus einem modernen Märchen. Auch Mrs. Harris, Mrs. Butterfield oder Schreibers wird man unter der genannten Anschrift nicht finden, denn in dieser Geschichte ist jeder und alles erfunden. Wenn allerdings die auftretenden Figuren nicht irgend jemandem ähneln, dem der Leser irgendwo irgendwann begegnet ist, dann hat der Verfasser versäumt, dem Leben einen kleinen Spiegel vorzuhalten, und dehnt sein Bedauern auf alle und jeden aus.
P. W. G.
1
Mrs. Ada Harris und Mrs. Violet Butterfield, Willis Gardens Nr. 5 und 7, Battersea, London, tranken ihre abendliche Tasse Tee in Mrs. Harris’ sauberer, mit Blumen geschmückter kleiner Wohnung im Kellergeschoss von Nr. 5.
Mrs. Harris war eine jener tatkräftigen Londoner Reinemachefrauen, die täglich ausziehen, um die größte Stadt in der Welt aufzuräumen, und ihre alte Busenfreundin, Mrs. Butterfield, arbeitete stundenweise als Köchin und Zugehfrau. Beide hatten eine vornehme Kundschaft in Belgravia, wo sie den Tag über allerlei erlebten und hier und dort kleine Brocken Klatsches von den komischen Leuten auflasen, bei denen sie arbeiteten. Und abends tauschten sie bei einer letzten Tasse Tee diese Neuigkeiten aus.
Mrs. Harris war sechzig, klein und zierlich, mit roten Apfelbäckchen und beinahe frechen kleinen Augen. Sie war sehr tüchtig und praktisch, neigte aber dennoch zu Romantik und Optimismus und sah das Leben schwarz oder weiß. Mrs. Butterfield, ebenfalls sechzig, eine rundliche, freundliche, schüchterne Frau dagegen war ein Pessimist, wie er im Buche steht, der alle Menschen und auch sich selbst beständig am Rande eines drohenden Unglücks sieht.
Die beiden guten Damen waren schon lange Witwen. Mrs. Butterfield hatte zwei verheiratete Söhne, die sie beide nicht unterstützten, was sie auch gar nicht überraschte. Es hätte sie erstaunt, wenn sie es getan hätten. Mrs. Harris hatte eine verheiratete Tochter, die in Nottingham lebte und ihr jeden Donnerstagabend schrieb.
Die beiden Frauen führten ein nützliches, tätiges und interessantes Leben, stützten einander äußerlich und innerlich und trösteten sich gegenseitig in ihrer Einsamkeit. Mrs. Butterfield war es gewesen, die vor etwa einem Jahr für eine Zeit Mrs. Harris’ Kundschaft übernommen und ihr dadurch den aufregenden und romantischen Flug nach Paris ermöglicht hatte, den sie nur unternahm, um ein Kleid von Dior zu kaufen. Diese Trophäe hing jetzt in Mrs. Harris’ Schrank als tägliche Erinnerung daran, wie wunderbar und abenteuerlich das Leben sein kann, wenn man es mit etwas Energie, Beharrlichkeit und Phantasie dazu macht.
Die beiden Frauen saßen behaglich beim Schein der Lampe in Mrs. Harris’ blitzsauberer Wohnung, mit der heißen, duftenden Kanne Tee unter der geblümten Haube vor sich, die Mrs. Butterfield für Mrs. Harris zu Weihnachten gestrickt hatte, und plauderten über die Ereignisse des Tages.
Das Radio war angestellt, und eine Reihe schauerlicher Laute kam heraus. Es war eine Schallplatte von Kentucky Claiborne, einem echten amerikanischen Hillbilly-Sänger.
»Und so sagte ich zu der Gräfin: ›Entweder ein neuer Hoover, oder ich gehe‹«, erzählte Mrs. Harris. »›Das Ding taugt nichts mehr.‹ – ›Liebe Mrs. Harris‹, sagte sie, ›können wir das nicht auf nächstes Jahr vertagen?‹ Das könnte ihr so passen. Jedesmal, wenn ich das elende Ding anfasse, bekomme ich einen Schlag bis in die Zehen hinunter. Ich stellte ihr ein Ultimatum: ›Wenn morgen früh kein neuer Hoover hier ist, dann werfe ich die Schlüssel durch die Tür‹«, schloss Mrs. Harris. Die Wohnungsschlüssel durch den Briefkastenschlitz werfen, war die klassische Kündigungsform der Reinemachefrauen.
Mrs. Butterfield trank einen Schluck Tee. »Es wird keiner da sein«, sagte sie düster. »Ich kenne diese Sorte. Sie geben jeden Penny aus, um sich selbst zu behängen, und alles andere ist ihnen gleich.«
Aus dem Lautsprecher des kleinen Tischrundfunks grölte Kentucky Claiborne:
»Küss mich zum Abschied, alte Kajuse.
Küss mich, du altes Pferd.
Verweigere es nicht!
Schlechte Menschen haben mich angeschossen –
Ach, ich fürchte, sie haben mich getroffen!
Küss mich zum Abschied alte Kajuse.«
»Huh«, sagte Mrs. Harris, »ich kann diese Katzenmusik nicht mehr ertragen. Würdest du sie bitte abstellen?«
Mrs. Butterfield beugte sich gehorsam hinüber, stellte das Radio ab und sagte: »Es ist wirklich traurig, angeschossen zu sein und zu wünschen, dass sein Pferd ihn küsst! Nun werden wir nie erfahren ob es das getan hat.«
Dennoch sollten sie es erfahren, denn die Leute in der Nachbarwohnung waren offensichtlich begeisterte Anhänger des amerikanischen Schlagersängers, und die Ballade von Tod und Liebe im Wilden Westen sickerte durch die Wand. Noch ein anderer Laut drang in die Küche, in der die beiden Frauen saßen, ein dumpfer Schlag und dann ein Schmerzensgewimmer, woraufhin sofort der Rundfunk nebenan lauter gestellt wurde, so dass die Klänge der Gitarre und Kentucky Claibornes nasales Gegröle die Schreie übertönten.
Die beiden Frauen erstarrten, und ihre Gesichter wurden grimmig und bekümmert zugleich.
»Die Teufel«, flüsterte Mrs. Harris. »Sie prügeln den kleinen Henry schon wieder.«
»Ach, das arme Lämmchen«, sagte Mrs. Butterfield, und dann: »Ich höre ihn gar nicht mehr.«
»Sie haben den Rundfunk so laut gestellt, damit wir es nicht hören.« Mrs. Harris ging an eine Stelle der die Häuser trennenden Mauer, wo sie, weil es dort anscheinend einmal eine Durchstiegluke gegeben hatte, dünner war, und trommelte mit den Knöcheln dagegen. Fast unmittelbar darauf ertönte ein ebenso starkes Getrommel auf der anderer Seite.
Mrs. Harris hielt ihren Mund dicht an die Wand und schrie: »Hören Sie auf, das Kind zu schlagen! Wollen Sie, dass ich die Polizei rufe?«
Worauf klar und deutlich von drüben eine Männerstimme herüberschallte: »Waschen Sie sich erst einmal Ihre Ohren! Wer schlägt denn hier jemand?«
Die beiden Frauen standen beklommen lauschend dicht an der Wand, aber keine weiteren Klagelaute waren zu vernehmen, und bald wurde auch der Rundfunk wieder leiser.
»Die Teufel«, zischte Mrs. Harris noch einmal. »Das Schlimme ist, dass sie ihn nicht so heftig schlagen, dass man Striemen sieht, sonst könnten wir den ›Verein zum Schutz der Kinder vor Grausamkeit‹ anrufen. Ich werde ihnen aber morgen früh gründlich Bescheid sagen.«
Mrs. Butterfield sagte traurig: »Das wäre nicht gut, denn sie lassen’s dann nur an ihm aus. Gestern habe ich ihm ein Stück Kuchen gegeben, das ich noch vom Tee übrig hatte. Aber da stürzte sich die ganze Gusset-Brut auf ihn und riss es ihm weg, bevor er auch nur einen Bissen davon gegessen hatte.«
Zwei Tränen der Enttäuschung und Wut erschienen plötzlich in Mrs. Harris’ blauen Augen, und sie erleichterte sich selbst durch eine Reihe sehr unfeiner und nicht für den Druck geeigneter Worte, mit denen sie die Familie Gusset von nebenan beschrieb.
Mrs. Butterfield klopfte ihrer Freundin auf die Schulter und sagte: »Nun, nun, Liebe, reg dich nicht so auf. Es ist eine Schande, aber was können wir dagegen tun?«
»Wir können etwas tun«, erwiderte Mrs. Harris leidenschaftlich. Dann wiederholte sie: »Ja, wir können etwas tun. Ich kann das nicht aushalten. Er ist ein so lieber kleiner Kerl.« Ihre Augen funkelten. »Ich wette, wenn ich nach Amerika führe, würde ich seinen Vater schnell finden. Irgendwo muss er doch schließlich sein, und sein Herz verzehrt sich sicher nach seinem Kleinen.«
Mrs. Butterfield machte ein entsetztes Gesicht. Ihr Doppelkinn begann zu beben, und ihre Lippen fingen an zu zittern.
»Ada«, stammelte sie, »du denkst doch nicht daran, nach Amerika zu fahren?« Sie hatte es noch frisch im Gedächtnis, dass Mrs. Harris verkündet hatte, sie begehre nichts mehr in der Welt als ein Kleid von Dior, und dass sie dafür zwei Jahre lang geknausert und gespart hatte. Dann war sie nach Paris geflogen und triumphierend mit dem Kleid zurückgekehrt.
Zu Mrs. Butterfields großer Erleichterung waren ihrer Freundin aber Grenzen gesetzt, denn Mrs. Harris jammerte: »Wie kann ich das? Aber es bricht mir das Herz. Ich kann es nicht ertragen, zusehen zu müssen, wie ein Kind misshandelt wird. Er ist so dürr und mager, dass er nicht einmal auf einem Fleischpolster sitzen kann.«
Alle in Willis Garden kannten die Geschichte des kleinen Henry Brown und der Gussets. Eine Tragödie der Nachkriegszeit, wie es sie nur leider allzu oft gab.
Im Jahre 1950 hatte George Brown, ein auf irgendeinem amerikanischen Luftstützpunkt in England stationierter Flieger, eine Kellnerin aus der in der Nähe gelegenen Stadt geheiratet, ein Mädchen namens Pansy Cott, und sie hatten einen Sohn bekommen, den sie Henry tauften.
Als George Brown seinen Militärdienst beendet hatte und in die Vereinigten Staaten zurückkehren sollte, weigerte sich die Frau, ihn zu begleiten. Sie blieb mit dem Kind in England und verlangte von ihrem Mann, dass er sie unterhielt. Brown schickte ihr aus Amerika für das Kind wöchentlich einen Dollarbetrag in Höhe von zwei Pfund und ließ sich von seiner Frau scheiden.
Pansy und Henry zogen nach London, wo Pansy eine Stellung bekam und einen anderen Mann kennenlernte, der sie heiraten wollte. Aber er wollte von dem Kind nichts wissen, und der Preis dafür, dass er sie zu seiner Ehefrau machte, war, dass sie sich von dem Jungen trennte. Pansy gab darauf sofort den damals drei Jahre alten Henry in eine Familie namens Gusset (die in Willis Gardens lebte und in der es schon sechs Kinder gab), heiratete ihren Geliebten und zog in eine andere Stadt.
Drei Jahre lang zahlte Pansy pünktlich jede Woche das Pfund, das sie für des kleinen Henrys Unterhalt den Gussets zu zahlen versprochen hatte (wodurch ein Pfund für sie selber übrigblieb), und wenn Henry auch nicht gerade verwöhnt wurde, so hatte er es doch nicht viel schlechter als die Sprösslinge der Gussets. Aber eines Tages traf das Pfund nicht ein, und von da an kam es überhaupt nicht mehr. Pansy und ihr neuer Mann waren verschwunden und blieben unauffindbar. Die Gussets hatten eine Adresse des Vaters George Brown irgendwo in Alabama. Ein Brief, in dem sie das Geld von ihm forderten, kam mit dem Stempel »Adressat unbekannt« zurück. Den Gussets wurde klar, dass sie das Kind nun auf dem Buckel hatten, und von da an verschlechterte sich Henrys Lage.
Die Nachbarschaft merkte bald, dass die Gussets, die sich sowieso keines guten Rufes erfreuten, es das Kind entgelten ließen. Der kleine Henry war zu einem Gegenstand tiefer Sorge für die beiden Witwen geworden, die neben den Gussets wohnten, aber besonders für Mrs. Harris, deren Herz das arme Waisenkind rührte und dessen schlimme Lage ihr Tag und Nacht keine Ruhe ließ.
Wären die Gussets brutaler und grausamer zu dem kleinen Henry gewesen, dann hätte Mrs. Harris zusammen mit der Polizei drastisch dagegen einschreiten können. Aber das Ehepaar Gusset war dafür zu gerissen. Niemand wusste genau, wovon Mr. Gusset seine Familie ernährte, aber er arbeitete in Soho, manchmal die ganze Nacht hindurch, und alle waren einmütig der Ansicht, dass es eine etwas anrüchige Beschäftigung war.
Nun, was es auch sein mochte, es war bekannt, dass die Gussets ängstlich darauf bedacht waren, die Aufmerksamkeit der Polizei nicht auf sich zu lenken, und darum, soweit es den kleinen Henry betraf, sich strikt an das Gesetz hielten. Sie wussten sehr wohl, dass die Polizei nur in Fällen äußerster und sichtbarer Grausamkeit zugunsten eines Kindes eingreifen konnte. Niemand vermochte aber zu behaupten, dass der Junge Hunger litt oder gequält wurde. Mrs. Harris wusste jedoch, sein Leben war eine Hölle knapper Rationen, Püffe, Schläge, Flüche, womit die Gussets sich für das Aufhören der Zahlungen rächten.
Er war das Aschenbrödel und der Prügelknabe der schlampigen Familie, und jedes ihrer eigenen Kinder, zwei Mädchen und vier Jungen von drei bis zwölf Jahren, konnte ihn kneifen, treten und misshandeln, ohne dass jemand sie dafür bestrafte. Aber das Schlimmste von allem war, dass das Kind ohne jede Liebe oder Zärtlichkeit aufwuchs. Im Gegenteil, es wurde gehasst, und Mrs. Harris und Mrs. Butterfield fanden, das war das Allertraurigste.
Mrs. Harris hatte selber viele Schläge aushalten müssen; in ihrer Welt war das die Regel, mit der man sich abzufinden hatte. Aber sie hatte ein warmes und mitfühlendes Wesen, hatte ihr eigenes Kind erfolgreich aufgezogen, und was sie von dem kleinen Jungen nebenan und der Behandlung, die man ihm angedeihen ließ, sah, begann zu einer wahren Folter für sie zu werden, zu etwas, das sie beständig verfolgte und an das sie fast immer denken musste. Oft, wenn sie, wie es ihre Art war, froh und heiter mit nicht unterzukriegender guter Laune ihrer Arbeit nachging oder sich mit ihren Brotgebern und Freunden unterhielt, überfiel sie plötzlich der quälende Gedanke an die schlimme Lage des kleinen Henry. Dann versank sie in einen ihrer Tagträume, wie jenen, der sie vor einem Jahr veranlasst hatte, zu dem großen Abenteuer ihres Lebens nach Paris aufzubrechen.
Der neue Tagtraum nahm die Gestalt eines jener Kitschromane an, die Mrs. Harris gierig in den vielen Zeitschriften verschlang, die ihre Brotgeber ihr gaben, wenn sie selber sie ausgelesen hatten.
Nach Mrs. Harris’ Meinung – und übertragen auf den Traum – war Pansy Cott, oder wie ihr neuer Name lauten mochte, der Bösewicht der Geschichte, der verschollene Flieger Brown der Held und der kleine Henry das Opfer. Von einem war Mrs. Harris felsenfest überzeugt, dass nämlich der Vater den Unterhalt des Kindes bezahlte und dass Pansy einfach das Geld einsteckte. Es war alles Pansys Schuld – Pansy, die sich geweigert hatte, ihren Mann nach Amerika zu begleiten, wie es ihre Pflicht als Frau war; Pansy, die ihm das Kind vorenthalten hatte; Pansy, die einem Liebhaber zu Gefallen den kleinen Jungen in diese scheußliche Familie gegeben hatte; und schließlich Pansy, die mit dem Geld verduftet war und den Jungen seinem kläglichen Schicksal überließ.
George Brown dagegen war ein von Natur edler Mensch; in den dazwischenliegenden Jahren hatte er gewiss, wie es die Amerikaner taten, ein Vermögen gemacht. Vielleicht hatte er wieder geheiratet, vielleicht nicht. Aber wie dem auch sein mochte, er sehnte sich nach seinem verlorenen Henry.
Diese Einschätzung George Browns beruhte auf ihrer Erfahrung mit amerikanischen GI’s in England, die sie alle freundlich, warmherzig, großzügig und vor allem kinderlieb gefunden hatte. Sie erinnerte sich daran, wie sie während des Krieges stets ihre Süßigkeitsrationen mit den Kindern, die rings um ihre Stützpunkte wohnten, geteilt hatten. Sie waren zwar gern laut, lärmend, prahlerisch und verschwenderisch, aber wenn man sie näher kennenlernte, verbarg sich darunter die Güte selbst.
Sie waren natürlich die reichsten Leute in der Welt, und Mrs. Harris errichtete in ihrer Phantasie eine Art Palast, in dem George Brown jetzt lebte und in dem der kleine Henry sich seines Geburtsrechts erfreuen konnte, wenn sein Vater erst erfuhr, wie schlecht es ihm ging. Sie zweifelte nicht daran, dass, wenn Mr. Brown aufgefunden und von der schlimmen Lage seines Sohnes in Kenntnis gesetzt werden könnte, er in einem Düsenflugzeug angebraust käme, um sein Kind zu fordern und es aus der Tyrannei der scheußlichen Gussets zu befreien. Es bedurfte nur einer guten Fee, die an dem Knopf des Schicksals drehte und dafür sorgte, dass der Apparat sich in der richtigen Richtung bewegte. Und es dauerte nicht sehr lange, dass Mrs. Harris, der das jammervolle Los des kleinen Henry so naheging, sich selbst als die gute Fee zu sehen begann.
In ihrem Traum wurde sie auf irgendeine Weise in die großen Vereinigten Staaten von Nordamerika verpflanzt, wo sie mit Schläue und Glück fast sofort den verschollenen George Brown ausfindig machte. Als sie ihm die Geschichte des kleinen Henry erzählte, füllten sich seine Augen mit Tränen, und als sie damit fertig war, weinte er ohne jede Scham. »Meine gute Frau«, sagte er, »mit all meinen Reichtümern kann ich nie gutmachen, was Sie für mich getan haben. Kommen Sie, wir wollen sofort ein Flugzeug besteigen und hinüberfliegen, um meinen kleinen Jungen nach Hause zu holen, wohin er gehört.« Es war ein sehr befriedigender Traum.
Aber, wie schon gesagt, Mrs. Harris war kein Mensch, der sich mit Phantasiegespinsten begnügte. Sie sah die Lage des kleinen Henry und die Gussets im nüchternen Licht der Wirklichkeit, und sie wusste, dass niemand den Vater hatte ausfindig machen können, ja, es nicht einmal ernstlich versucht hatte. Trotz all ihrer Träume war sie mehr und mehr davon überzeugt, dass, wenn sich ihr nur die Gelegenheit böte, sie es fertigbringen würde, ihn zu finden. Eine Überzeugung, in der sie nicht im geringsten dadurch wankend gemacht wurde, dass sie nichts weiter von ihm wusste, als dass er George Brown hieß und bei der amerikanischen Luftwaffe gewesen war.
2
Tief in ihrem Inneren war sich Mrs. Harris wohl bewusst, dass eine Reise nach Amerika für sie so fern lag wie eine Reise zum Mond. Freilich, es war ihr gelungen, den Kanal zu überqueren, und für die Flugzeuge war der Atlantische Ozean auch nichts weiter als ein Stück Wasser, über das sie hinwegschwirrten, aber wenn sie bedachte, was eine solche Reise kostete, war sie für sie unerreichbar. Mrs. Harris hatte sich ihren Herzenswunsch, Paris zu besuchen, dadurch erfüllen können, dass sie zwei Jahre lang geknausert und gespart hatte. Doch das war eine Riesenanstrengung gewesen und hatte sie viel Kraft gekostet. Sie war jetzt älter und wusste, dass sie nicht mehr die Energie hätte, um die notwendige Anzahl von Pfunden zur Finanzierung einer solchen Expedition zusammenzubringen.
Bei der Affäre Dior war allerdings der zündende Funke der Gewinn von hundert Pfund im Fußballtoto gewesen, ohne den Mrs. Harris es vielleicht nie auf sich genommen hätte, weitere dreihundertfünfzig Pfund zu sparen. Sie spielte weiter im Toto, aber ohne den festen Glauben, der manchmal Fortunas Gesicht zum Lächeln verführt. Sie wusste ebenso genau, dass solch ein Blitz nie zweimal an der gleichen Stelle einschlug.
Aber in eben diesem Augenblick, da man den kleinen Henry in der Küche von Willis Gardens Nr. 3 verprügelte, wobei das schauerliche Gegröle von Kentucky Claiborne das Wimmern des Kindes übertönen sollte, und Henry dann wieder einmal mit hungrigem Magen ins Bett gesteckt wurde, legte das Schicksal schon den Grundstein für eine unglaubliche Veränderung nicht nur in Henrys, sondern auch in Ada Harris’ und Mrs. Butterfields Leben.
Es geschah kein Wunder; nichts Ungewöhnlicheres ereignete sich, als dass zwei Gruppen von Männern sich an dem großen Tisch in dem Konferenzzimmer eines gigantischen, sechstausend Meilen entfernten Hollywooder Film- und Fernsehstudios gegenübersaßen und einander so giftig anblickten, wie es nur Männer vermögen, die um die Macht kämpfen.
Sieben Stunden später, nachdem hundertdrei Tassen Kaffee getrunken und anschließend zweiundvierzig Havanna Perfectos geraucht worden waren, spiegelte sich in den Blicken immer noch der gleiche Hass, aber der Kampf war vorüber. Ein Kabel wurde abgeschickt, das direkt und indirekt für das Leben eines Häufleins sehr verschiedener Menschen, von denen einige noch nie etwas von der Nordamerikanischen Film- und Fernsehgesellschaft gehört hatten, Folgen haben sollte.
Zu den Kunden, bei denen Mrs. Harris nicht nur regelmäßig, sondern begeistert tätig war – denn sie hatte ihre Lieblinge –, gehörten Mr. und Mrs. Joel Schreiber, die eine Sechszimmerwohnung im obersten Stock eines der umgebauten Häuser am Eaton Square hatten. Joel und Henrietta Schreiber waren ein kinderloses amerikanisches Ehepaar mittleren Alters, das seit drei Jahren in London wohnte, wo Mr. Schreiber als europäischer Vertreter der Nordamerikanischen Film- und Fernsehgesellschaft fungierte.
Durch Henrietta Schreibers Freundlichkeit hatte Mrs. Harris damals ihre hart verdienten Pfunde gegen die notwendigen Dollars umwechseln können, die es ihr ermöglichten, ihr Diorkleid in Paris zu bezahlen. Keine von beiden ahnte, dass sie damit gegen das Gesetz verstießen. So wie Mrs. Schreiber es sah, blieben die Pfundnoten bei ihnen in England und verließen das Land nicht. Und das war doch genau das, was die Engländer wollten. Aber Mrs. Schreiber war eine jener etwas einfältigen Menschen, die nie ganz begreifen, wie die Dinge gehandhabt werden oder gehandhabt werden sollen.
Dank Mrs. Harris’ Hilfe und Rat hatte sie sich daran zu gewöhnen vermocht, ihren Haushalt in London zu führen. Sie kaufte in der Elizabeth-Street ein und kochte selber, während die nie erlahmende Mrs. Harris täglich für zwei Stunden erschien und die Wohnung tadellos in Ordnung brachte. Jede plötzliche Veränderung oder jedes unvermutet auftretende Problem versetzten Mrs. Schreiber in höchste Erregung. Da sie, ehe sie nach England kam, sich mit der in Hollywood und New York verfügbaren Art von Hauspersonal hatte herumschlagen müssen, war Henrietta eine glühende Bewunderin von Mrs. Harris’ Flinkheit, Tüchtigkeit und Geschick im Reinemachen, aber vor allem ihrer Fähigkeit, mit fast jeder Situation fertig zu werden.
Joel Schreiber trug, wie jeder Soldat Napoleons, einen Marschallstab im Tornister, eine imaginäre Ernennung zum Präsidenten in seiner Brieftasche. Er war ein tüchtiger Geschäftsmann, der sich bei der Nordamerikanischen Film- und Fernsehgesellschaft vom Botenjungen zu seiner jetzigen Stellung heraufgearbeitet hatte, aber ebenso hatte er immer von Kunst und Literatur geträumt und davon, was er tun würde, wenn er erst einmal Präsident wäre; eine Möglichkeit, die aber so fern lag, dass er nicht einmal mit seiner Henrietta darüber gesprochen hatte. Die Art von Stellung, die Mr. Schreiber hatte, führte nicht zum Präsidentensessel, zum beherrschenden Einfluss auf die Geschicke der Firma und zu Konferenzen mit den großen und fast großen Stars der Film- und Fernsehwelt.
Dennoch, als die bereits erwähnte Konferenz in Hollywood beendet und das Kabel abgeschickt war, war der Empfänger niemand anders als Joel Schreiber. Er wurde darin aufgefordert, nach New York überzusiedeln, und man bot ihm einen Fünf-Jahres-Vertrag als Präsident der Nordamerikanischen Film- und Fernsehgesellschaft an. Zwei Machtgruppen, die um die Beherrschung der Firma kämpften, aber beide nicht stark genug waren, um diesen Kampf zu gewinnen, hatten sich schließlich erschöpft auf Schreiber, einen unbekannten Außenseiter, als Kompromisskandidaten und eventuellen Präsidenten der Firma geeinigt.
Dem Kabel das Schreiber an diesem Nachmittag in seinem Büro erreichte, folgten lange Ferngespräche, Wunderkonferenzgespräche, die Ozeane und Kontinente umspannten, bei denen fünf Männer – einer in London, zwei in Kalifornien, zwei in New York – jeder an einem Telefon saßen und sich miteinander unterhielten, als befänden sie sich alle in einem Raum. Und als Mr. Schreiber, ein untersetzter, kleiner Mann mit klugen Augen, am frühen Abend nach Hause zurückkehrte, platzte er geradezu vor Erregung und Neuigkeiten.
Er konnte es nicht bei sich behalten. Schon beim Eintreten in die Wohnung sprudelte er alles mit einemmal heraus. »Henrietta, ich habe eine große Neuigkeit für dich. Eine wirkliche Neuigkeit. Ich bin Präsident der Nordamerikanischen Film- und Fernsehgesellschaft geworden. Sie verlegen ihre Büros nach New York. Wir müssen in zwei Wochen hinüberfahren. Wir werden eine große Wohnung in der Park Avenue bekommen. Die Firma hat schon eine für mich gefunden, eine prächtige, zweigeschossige. Ich bin jetzt der große Boss, Henrietta. Was sagst du dazu?«
Sie waren ein liebevolles und zärtliches Paar, und so umarmten sie sich erst einmal, und darauf tanzte Mr. Schreiber mit Henrietta eine Weile durch die Wohnung, bis sie ganz außer Atem war.
»Du hast das verdient, Joel«, sagte sie. »Sie hätten das schon längst tun müssen.« Dann trat sie, um sich zu beruhigen und ihre Gedanken zu sammeln, ans Fenster und blickte auf den stillen belaubten Eaton Square hinaus, und mit einem Stich im Herzen dachte sie, wie sehr sie sich an dieses ruhige Leben gewöhnt hatte, wie sehr sie es liebte und wie sehr ihr davor graute, wieder in den Wirbel und das Wahnsinnstempo von New York zurück zu müssen.
Mr. Schreiber ging erregt in der Wohnung auf und ab. Er brachte es nicht fertig, sich zu setzen, da Dutzende neuer Gedanken, Einfälle, Ideen, die mit seiner neuen großartigen Position zusammenhingen, ihm durch den runden Kopf schossen. Dann blieb er plötzlich stehen und sagte: »Wenn wir einen Sohn hätten, Henrietta, müsste er dann nicht in diesem Augenblick auf seinen Alten Herrn stolz sein?«
Diese Bemerkung traf Henrietta wie ein Pfeil ins Herz. Sie wusste, es sollte kein Vorwurf sein – das passte nicht zu ihrem Mann –, es war ihm über die Lippen gekommen, weil er sich schon lange danach sehnte, nicht nur Ehemann, sondern auch Vater zu sein, und jetzt, da er über Nacht »jemand« geworden, war es nur allzu verständlich, dass dieses Verlangen stärker wurde. Als sie sich von dem Fenster abwandte, hingen ihr Tränen in den Augenwinkeln, und sie konnte nur sagen: »Ach, Joel, ich bin so stolz auf dich!«
Da wurde ihm plötzlich bewusst, dass er sie verletzt hatte, und er ging auf sie zu, legte seinen Arm um ihre Schultern und sagte: »Henrietta, sei nicht traurig, ich habe es nicht so gemeint, wie es klang. Du brauchst nicht zu weinen. Wir sind ein sehr glückliches Paar, und wir spielen jetzt eine große Rolle. Denke an die wundervollen Zeiten, die wir in New York erleben werden, und an die Dinnerparties, die du für all die berühmten Leute geben wirst. Du wirst wirklich ›die Höchsten bewirten‹, wie es in dem Liede heißt.«
»Ach Joel«, rief Henrietta. »Es ist so lange her, seit wir in Amerika oder New York gelebt haben – ich fürchte mich davor.«
»Pah«, tröstete sie Mr. Schreiber. »Wovor brauchst du dich zu fürchten? Es wird herrlich für dich werden, und du wirst alles wunderbar machen. Wir sind jetzt reich, und du kannst so viele Dienstboten haben, wie du willst.«
Aber das gerade eben bekümmerte Mrs. Schreiber, und es bekümmerte sie auch noch am nächsten Morgen, lange nachdem Mr. Schreiber auf einer rosa Wolke in sein Büro entschwebt war.
Ihre verwirrte und erregte Phantasie sah die ganze riesige Schar von internationalen Schlampen, Bummlern, Faulpelzen und Nichtsnutzen vor sich, die ihre Dienste als »ausgebildetes Personal« anboten. Ein Zug von slowakischen, litauischen, bosnischen Butlern oder Dienern mit schmutzigen Fingernägeln, vom Zigarettentabak gelb gefärbten Fingern, die einmal bei ihr gearbeitet hatten, marschierten an ihr vorüber, und alle ließen die Asche ihrer ewigen Zigarette auf die Teppiche hinter sich fallen. Sie hatte mit ochsenstarken Schweden, ebenso kräftigen Finnen, dreisten Deutschen, faulen Iren, noch fauleren Italienern und undurchsichtigen Orientalen zu tun gehabt.
Nachdem ihr die Ausländer über waren, hatte sie Amerikaner engagiert, schwarze und weiße, Dienstboten, die im Hause wohnten, ihren Schnaps austranken und ihr Parfüm benutzten, oder Tagesmädchen, die morgens kamen und abends meistens mit irgendeinem Kleid, einer Bluse oder einem Wäschestück von ihr, das sie unter dem Mantel versteckten, wieder gingen. Sie wussten nicht, wie man rein macht, Staub wischt oder fegt, Gläser spült oder Silber putzt; sie ließen Fußspuren auf dem Boden zurück, wo sie, unbeweglich wie Statuen, stundenlang nichtstuend auf ihre Besen gestützt, gestanden hatten. Keiner von ihnen hatte Sinn für Häuslichkeit oder schöne Dinge. Sie zertepperten ihr gutes Geschirr, Lampen und Nippes, verdarben ihre Überzüge und Wäsche, brannten mit ihren Zigaretten Löcher in die Teppiche und zerstörten ihren Besitz und ihren Seelenfrieden. Diesem entsetzlichen Zuge schloss sich jetzt eine lange Reihe Köchinnen mit sauertöpfischen Mienen an, deren jeder sie einige der grauen Haare verdankte, die sie schon hatte. Einige hatten kochen können, andere nicht. Aber alle waren unfreundliche Weiber mit allen möglichen Schrullen und schlechten Charakteren, erbitterte Tyrannen, die für die Dauer ihres Aufenthalts in ihrem Heim das Regiment übernommen und sie terrorisiert hatten. Die meisten von ihnen waren ein bisschen blöde und einige nur einen Schritt vom Irrenhaus entfernt. Keine hatte sich je sympathisch oder nett gezeigt, und das einzige, woran sie alle dachten, waren die von ihnen zu ihrem eigenen Wohlbefinden festgelegten Vorschriften.