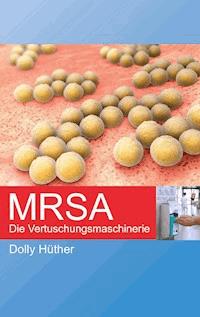
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein höchst aktuelles Buch, das die Autorin Dolly Hüther vorlegt. Sie berichtet aus erster Hand und hautnah von den Gefahren, denen sie während ihrer Aufenthalte in Krankenhäusern ausgesetzt war und denen andere, wir, ausgesetzt sind, sobald wir auch nur eine Klinik betreten. Mangelnde Hygiene, spät diagnostizierte Erkrankungen, der sogenannte Ärztepfusch und die Bedrohung durch den gemeingefährlichen „Killerkeim“ MRSA gehören fast schon zum un/heimlichen Klinikalltag. Den dramatischen Ereignissen in dieser Sache hätte die Betroffene oft gern Grenzen gesetzt – und fand sich als Kämpferin wieder, um als Patientin der Entmündigung zu entgehen, die Selbstheilungskräfte zu mobilisieren und ein Restvertrauen gegenüber dem Behandlungs- und Pflegepersonal erhalten zu können. Von diesem Weg, der mal Widerstand, mal Kooperation verlangt, spricht sie ungeschönt und direkt. Über ihre Wut und ihren Mut, ihren Humor und ihre Trauer hinaus nehmen die Lesenden wahr, welches eigenverantwortliche Engagement möglich und nötig ist, um die Versäumnisse der Gesundheitspolitik, die Vertuschungsmanöver der Institutionen und die virulenten Risiken nicht länger passiv hinzunehmen. Sie hat hier stets aus Notwendigkeit gehandelt, das macht ihre Darstellungen und Informationen so wertvoll für die Leserschaft. Dieser Band kann also ansteckend und revitalisierend zugleich sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Methicillin resistenter Staphylococcus aureus,genannt „Krankenhaus- oder Killerkeim.”
Wenn Krankenhäuser unsere Selbstheilungskräfte aufs Spiel setzen
Vorwort
Einleitung
Kunstfehler? Oder schlicht Pfusch?
Talk Show
Die Gebärmuter
Rote Haare!
So kann’s kommen! Erkrankt an gemeinen Bakterien
Der Leidensweg der Sieglinde N.
„Killerkeim“ MRSA Aus einem Klinikum in Saarbrücken
Das Theater um mich, die Orthese
Die REHA
Zuhause sind Sie sicherer! Gehen Sie zurück auf LOS
Fazit
Was leistet die Gesundheitspolitik (nicht)
VORWORT
Das Erscheinen dieses brisanten Buches einer Autorin, die in erster Person aus der Perspektive als betroffene Patientin spricht, bedarf einer editorischen Ergänzung.
Nachdem der Erstverlag die avisierten Exemplare gedruckt hatte, die dank des aktuellen Themas rasch vergriffen waren, verweigerte er den Nachdruck weiterer Bücher. Offenbar hatte ihn der anfängliche Mut verlassen.
Nun konnte endlich der Nachdruck weiterer bereits bestellter Bücher durch den zweiten Verlag erfolgen – allerdings hat die Autorin die bereits in der Originalversion unkenntlich gehaltenen Personennamen (z. B. Dr. B.) einem weiteren Verschlüsselungs-System unterzogen, um derart jedwede Identifikation der Protagonisten auszuschließen, sei sie auch noch so unwahrscheinlich. So wurden alle Namen mit XY gekennzeichnet und zusätzlich mit einem alphabetischen Anfangsbuchstaben ergänzt, z.B. Chefarzt Dr. XYA oder Dr. XYB ...
Ist der Schachzug der Autorin erst mal erkannt, hinterlässt er gewiss ein leichtes Schmunzeln bei den Leserinnen und Lesern, trotz oder gerade im Hinblick auf den Titel dieses Buches.
Der Autorin danke ich für Ihren Mut und wünsche dem Kreis ihrer Leserschaft wichtige Erkenntnisse bezüglich eines heiklen Themas des noch krankenden Gesundheitssystems, ein Thema, das uns jedoch (auch) mit einem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft entlässt.
Monika Jehl Juni 2015
EINLEITUNG
Das ist zu viel, einfach zu viel, was im letzten Jahr und auch in den Jahren zuvor in den Krankenhäusern passiert ist. Das ist nicht mehr nur den Medien wie Tageszeitungen, Fernsehen und Zeitschriften zu entnehmen. Schlimmer ist es, denn die Missstände rücken näher, sind hautnah mitzuerleben, wenn nicht gar am eigenen Leib zu erfahren, wie ich feststellen musste. Und leider häufen sich ähnliche Vorfälle auch in meinem Umfeld. Ich weiß, das Ganze ist ein sehr komplexes Thema, komplexer kann es nicht sein. Und momentan stehen die Krankenhäuser und ihr Personal, ob Ärzteschaft oder Pflegekräfte bis hin zur Verwaltungsspitze, wieder einmal im Fokus der Öffentlichkeit. Doch trotz ihrer erhöhten Medienpräsenz bleibt das ungute Gefühl zurück, im Wesentlichen ändert sich nichts.
Denn wenn es bei den Demonstrationen auf der Straße (immerhin, Ärzte und Ärztinnen streiken!) nicht um höhere Bezüge oder Vergütungen geht, um Personalnotstand und den damit einhergehenden Arbeitsstress, gilt das Medieninteresse den ExpertInnen.
Tatsächlich sind es oft nur Experten, die da vorgeführt werden! Was ich mich nach ihren Statements, Interviews und statistischen Verweisen frage, ist: Was kommt von dem Gesagten oder Geschriebenen beim Gros der ZuhörerInnen oder LeserInnen an? Diejenigen, mit denen ich über die Thematik sprach, beendeten oft genug schulterzuckend das Gespräch: Was kann man da schon machen? Allein ist doch sowieso nichts zu ändern! Manche wiegelten gar von vornherein ab: Lassen wir das. Am besten ist’s, das Ganze schnell zu vergessen! Leicht gesagt, wenn die- oder derjenige (noch) nicht zu den Geschädigten zählt. Aber viele dieser Personen haben mich humpeln sehen; einige wussten von meinen mehrfachen Operationen während der letzten Jahre, andere hatten sich erkundigt, wenn ich fünfzehn Wochen wie vom Erdboden verschwunden war, weil ich im Krankenhaus oder in der REHA weilte. Ändern? Will ich etwas ändern? Ja, ich will.
Aber nicht das war mein Ziel, als ich während meiner Krankenhausaufenthalte und -behandlungen mit meinen Aufzeichnungen begann. Ich war erschöpft – durch den zähen Verlauf einer erst spät diagnostizierten Infektionserkrankung; verzagt über den sich Wochen, Monate hinziehenden Heilungsprozess, unterbrochen durch Rezidivbildungen. Ich war empört, wenn sich ein „Verdacht auf ...“ im Laborbericht nicht bestätigte, weil die gründlichere Untersuchung aus Kostengründen nicht stattgefunden hatte ..., wütend über mangelnde Hygiene im Krankenhaus, wodurch ich mir den „Killerkeim“ MRSA zugezogen hatte ... zu perplex und unwissend um das richtige Wort an der richtigen Stelle gesagt zu haben ..., aufgebracht über das Vertuschungsmanöver, das ich jetzt nachweisen kann.
Es reichte mir! Ich hatte so manches Mal laut aufschreien müssen. Aber das half nicht lange. Also schrieb ich, fertigte Gedächtnisprotokolle an, notierte Verlaufsphasen meiner Erkrankung und ihrer vorläufigen Heilung. Das war der erste, persönlich motivierte Schritt, ein selbsttherapeutischer Versuch sozusagen. Der überarbeitet und vervollständigt jetzt in Form dieses Buches zu einer politischen Lösung an der Basis beitragen möchte. Denn es gibt Gefahren und Probleme in Krankenhäusern, die zu minimieren in der Hand eines jeden, einer jeden hier und heute liegt:
Hygieneempfehlungen einzuhalten, die in einem Krankenzimmer aushängen, um bereits bei einem Besuch im Krankenhaus sich und andere zu schützen;
Informationen einzuholen, um über PatientInnen-Rechte unterrichtet zu sein;
die Aufklärungspflicht seitens der ÄrztInnen zu verlangen, sobald ihr nicht entsprochen wird;
Erfahrungen
zu kommunizieren, um so das eigene Selbstbewusstsein und das Problembewusstsein anderer zu stärken.
Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie ich die folgenden Berichte und Erfahrungen so gestalten kann, dass sie für möglichst viele Menschen nachvollziehbar sind und ihnen im Falle eines Falles helfen, die richtige Vorsorge und die entsprechenden Entscheidungen zu treffen. Diesem Anspruch hoffe ich mit der Auswahl der folgenden neun Berichte entgegenzukommen.
KUNSTFEHLER? ODER SCHLICHT PFUSCH?
Im Radio (SR3, 25.06.2014) wird von gesundheitsschädigenden Legionellen (Bakterien) berichtet, die in einem Saarlouiser Krankenhaus aufgefunden worden waren. Ach – jetzt dort gefunden? Ich kann nur bitter lächeln. Es handelt sich um ein ziemlich altes Problem, das, wie es aussieht, wieder einmal nicht rechtzeitig gelöst worden ist.
Mein Ehemann hat über fünfundzwanzig Jahre lang bei einer Wassertechnikfirma gearbeitet. Bereits in den 80-90er Jahren wurde da in Fachvorträgen vor Installateuren auf diese Problematik aufmerksam gemacht. Alte oder marode Rohre sollten rechtzeitig ausgetauscht werden, damit in der Warm- und Kaltwassererzeugung wie in ihren Zuleitungen sich keine pathogenen Legionellen bilden. Sobald stark legionellenhaltiges Wasser eingeatmet werde (beispielsweise per Inhalationsgerät, oder beim Duschen), gefährde es den Menschen. Ich höre weiter: Großartig, dieses Krankenhaus ist jetzt frei von Legionellen. Die Nachricht wird verkündet, als ob eine Naturkatastrophe überstanden wäre.
Am Tag zuvor lautete die Überschrift der Saarbrücker Zeitung (Nr. 143, Seite A 3, Thema des Tages) in roter Schrift: „Ärztepfusch“. Und weiter: „Eine vergessene Schere im Bauch, falsche Diagnose, schlecht behandelte Knochenbrüche – die Liste ärztlicher Fehler ist lang. Viele Patienten [es sind Patientinnen, die es sehr viel öfter trifft] schalten Experten ein. [Keine Expertinnen?] Mehr als 12 000 Beschwerden gab es 2013, in 2243 Fällen war ein Behandlungsfehler nachweisbar.“ Und – wie hoch ist die Zahl derer, die infolge solcher Fehler gestorben sind? Von den vielen unnötigen Toten ist keine Rede! Auch das Verschweigen hat System, so funktioniert die Vertuschungsmaschinerie. In der Spalte HINTERGRUND sind keine konkreten Fälle beschrieben, erst recht keine Namen genannt. Aber immerhin werden die Adressen von Institutionen angegeben, die mit Rat und Tat zur Seite stehen wollen. Doch sobald ich diese sogenannten helfenden Institutionen mit meinen Interessen als MRSA-Betroffene abgleiche, muss ich feststellen, dass der unter anderem gelistete Medizinische Dienst der Krankenversicherungen mir gar nicht weiterhelfen wird, er würde mich an die Krankenkasse verweisen. Die Hauptaufgaben des MDK bestehen darin, Gutachten zu erstellen, wenn Pflegestufen festzulegen sind. Von wegen Krankenkassenadressen, von wegen Anlaufstellen der Ärztekammer. Im Verlauf meiner Aufzeichnungen wird nachvollziehbar, wie sich die Institutionen aus der Affäre ziehen statt zu helfen. Wenn die Zeitungsspalten stattdessen genutzt worden wären, einen betroffenen Patienten, eine Patientin zu Wort kommen zu lassen, könnten sich ihre diesbezüglichen Erfahrungen für LeserInnen als hilfreicher herausstellen.
Und angesichts der öffentlich bekannt gewordenen Häufigkeit von Behandlungsfehlern und Fehldiagnosen beruhigen folgende Sätze keineswegs mehr: Och, das sind Einzelfälle ... oder: Das kann dir überall passieren. Aber die Experten selbst machen es vor und betreiben Augenwischerei. Bei jeder Gelegenheit wird meines Wissens wenn nicht negiert, dann auf fahrlässige Art und Weise relativiert. Wie von Herrn Josef Mischo, Präsident der Ärztekammer des Saarlandes, in einem Interview (gleiche Zeitung, gleiches Datum): „Überall, wo Menschen arbeiten, können Fehler passieren.“ Stellen Sie sich vor, da hat uns der Herr Präsident aber auf etwas ganz Neues aufmerksam gemacht. Natürlich bin ich hellhörig und kritisch geworden nach all den gemachten Erfahrungen, insbesondere was das Verdrängen, Herunterspielen oder Vertuschen von Missständen im Krankenhaus angeht. Die betreffen einfache Vorsorgemaßnahmen, die angemessene Behandlung von PatientInnen, die Verbreitung gemeingefährlicher Keime wie auch unterlassene Nachforschungen über die Ursache ihres Auftretens, vom Pfusch einmal ganz zu schweigen.
Ich hätte nichts dagegen, als Einzel-, Sonder- oder bedauernswerter „Krankenhausunfall“ dazustehen. Leider ist dem nicht so. Aus den folgenden tatsächlich passierten Vorfällen, die sich bis auf einen in meinem Umfeld ereignet haben, wird deutlich, inwieweit das Vertrauensverhältnis zwischen ÄrztInnen und PatientInnen bereits auf dem Spiel steht; wie sehr sich die Umgangsweisen verändert haben, auch die von PatientInnen und Pflegekräften in den Krankenanstalten. Das beobachte ich schon länger. Erschreckend sind die Geschichten geworden, als sie immer näher rückten und sich häuften. Das schärfte meinen Blickwinkel.
TALK-SHOW
Kürzlich erzählte eine junge Frau während einer Sendung mit Markus Lanz, im Alter von fünfzehn Jahren sei ihr rechtes Bein operiert worden, obwohl das linke krank war. Heute fehlen ihr beide Beine. Diese Frau hat einen Prozess angestrengt – und gewonnen. Die Höhe des Schmerzensgeldes aber, das ihr zugestanden wird, reicht gerade einmal aus, um sich den unbedingt nötigen Kauf eines Autos leisten zu können. Und was für eins? Einen alten Gebrauchtwagen. Auch hier handelt es sich nicht um einen Einzelfall, wie ich beweisen werde. Um gehört zu werden, wünsche ich mir manchmal, einen Bekanntheitsgrad zu haben wie ein Günther Wallraf oder Michael Moor. Haben sie mit ihren Recherchen nicht eine Menge an unglaublichen Zuständen aufgedeckt und eine Veränderung auf den Weg gebracht?
DIE GEBÄRMUTTER
Von einem der Ereignisse, die sich in der letzten Zeit häufen, berichtete meine Freundin B.S. Erst wenige Tage zuvor war sie aus einer Klinik heimgekehrt. Sie verständigt mich telefonisch darüber, und ich möchte wissen, ob sie die notwendig gewordene Kürettage schmerzfrei überstanden hat. Da wispert sie wie ein Mäuschen in den Hörer:
Nein, die Behandlung zu diagnostischen Zwecken konnte gar nicht erst durchgeführt werden, weil die operierende junge und unerfahrene Ärztin meine Gebärmutter durchstochen hat. So konnte die Ausschabung nicht vorgenommen werden. Zuerst einmal mussten sie die von ihnen verursachte Wunde verschließen, und das muss jetzt verheilen.
B. S. erinnert mich daran, dass während der ärztlichen Vorbesprechung der Chefarzt ihr versichert hatte, bei einer Risikopatientin, wie sie eine sei, die Operation persönlich durchzuführen ...
Als der Heilungsprozess endlich abgeschlossen war, wurde Frau S. zu weiteren Voruntersuchungen ins Krankenhaus bestellt. Der operative Eingriff sollte dann am nächsten Morgen erfolgen, um die notwendige Gewebeprobe zu entnehmen. Sicherheitshalber informierte Frau S. sowohl das Pflegepersonal als auch die ÄrztInnenschaft detailliert über die unhygienischen WC-Bedingungen, die Frau S. bei ihrem Erstbesuch vorgefunden hatte. Sie wies darauf hin, nicht mehr gewillt zu sein, sich in einer derart verschmutzten Umgebung umzuziehen. Ihren Krankenhausunterlagen sei zu entnehmen, dass sie mit ihren Allergien, der Neurodermitis und dem Asthma als Risikopatientin von den Behandelnden eingestuft worden sei. Sie selbst wolle und müsse sich schützen, wenn gewisse Räumlichkeiten im Krankenhaus nicht einmal den Regeln einer Grundreinigung entsprächen.
Pünktlich erscheint Frau S. am nächsten Morgen zur Aufnahme. Trotz OP-Termin ist leider kein Bett für die Patientin frei. Trotzdem wird Frau S. gebeten, sich umzuziehen, und wieder steht sie in dem verdreckten WC-Raum. Auf der Stelle verlässt sie wütend das Krankenhaus.
Inzwischen bin ich so weit, auf den Test zu verzichten, teilt sie mir mit. Ob die Ursache der Blutungen bösartiger Natur ist oder die Blutungen harmlos sind, beunruhigt mich in meinem Alter weniger als die Bedrohung, mich dort im Krankenhaus infizieren zu können.
Wie schon gesagt, es handelt sich um einen Einzelfall, und gleichzeitig ist es kein Einzelfall. Seitdem bekannt geworden ist, dass ich über den Pfusch in den Institutionen schreibe, erzählen viele Menschen bereitwillig von ihren Erlebnissen. Würde ich das wirklich alles aufschreiben, wie manche sich wünschen, wäre dieses Buch über fünfhundert Seiten stark. Aber noch etwas anderes hindert mich daran. Diejenigen, die mir berichten, leiten ihre Schilderung oft so oder ähnlich ein: Ach, da kann ich dir von meiner Mutter ... meinem Vater ... dem Onkel ... der Freundin von ... erzählen. Manchmal mache ich Notizen, tausche Namen und Adressen aus. Doch wenn ich solch einen Fall dann ernsthaft durchspiele, macht der oder die Betroffene einen Rückzieher, sobald es um Fakten und vor allem um die Veröffentlichung des persönlichen Namens geht. Da geht die Scheu um, bekannter, zitiert, haftbar zu werden. Aber mit dieser Angst rechnen die Institutionen, sie arbeiten quasi damit. So beschränke ich mich auf die Fälle, die authentisch sind und wenn nötig auch nachweisbar.
ROTE HAARE!
Eine andere befreundete Frau muss 2014 wegen eines kleineren Eingriffs an der Harnröhre ebenfalls stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Als eine Pflegerin ihr noch im Krankenzimmer die obligatorische Tablette zur Ruhigstellung geben will, bevor sie in den OP-Vorraum gefahren wird, lehnt diese Frau die Beruhigungstablette ab. Sie erklärt keine Angst zu haben, zumal eine Vollnarkose geplant sei. Im Vorraum selbst unterhalten sich die dort arbeitenden Pflegekräfte, die ja nicht wissen, dass Frau M. die Tablette abgelehnt hatte. Sie hält die Augen geschlossen, ruht in sich, wie sie mir schildert. Bis sie folgende Sätze vernimmt: Ich bin mal gespannt, ob die da unten genau so rot ist wie da oben! Mal sehen! Da sind die Augen der Patientin noch geschlossen. Besagte Personen nehmen weiterhin an, sie schliefe. Plötzlich aber hebt sie den Kopf an und sagt schlagfertig in Richtung der Pflegekräfte: Da unten sind sie nicht rot. Nur oben. Und die sind gefärbt. Die peinlich Getroffenen entschuldigen sich nicht einmal.
Wohl dem- und derjenigen, die sich in Vollnarkose befinden. Was während einer OP so gefrotzelt wird, möchte vielleicht wirklich niemand wissen. Und da bildet auch ein Klinikum mit konfessionellem Hintergrund keine Ausnahme, wie ich weiß.
Die Überlastung des medizinischen und pflegenden Personals aufgrund von Arbeitskräftemangel, die Unterbezahlung und der Stress während eines Krankenhausalltages, all das ist nicht unbekannt und muss auch in diesem Zusammenhang Erwähnung finden. Laut engagierter Journalisten und Experten lastet ein weiterer Druck auf dem medizinischen Personal. Da ist von Verwaltungsvorgaben die Rede, was die optimale Auslastung der vorhandenen Krankenhausbettenanzahl angeht, die oft genug erreicht wird, indem Kranke willkürlich zu Kurzzeit- oder Langzeitpatienten werden. Da ist die Rede von operativen Sollvorgaben, die schon mal zu Manipulationen an der Anzahl vorgenommener OP’s führen. Wichtige Informationen zum Pfusch in Krankenhäusern lassen sich auch der Sendung HAUTNAH im WDR entnehmen. Aber wer sieht die schon um 23 Uhr? Durch einen Beitrag erfuhr ich detailliert, wie die Pharmaindustrie, diese Ersatzteilfabrik der Kassen, ihrerseits Druck ausübt, etwa durch Fallpauschalen, die sich gut rechnen, beziehungsweise günstig verrechnen lassen.
Und seitens der Pflegekräfte? Sichtbar, spürbar stehen auch sie unter starkem Belastungsdruck. Und verständlich ist, dass der Unmut ein Ventil braucht, wenn Pflegekräfte die Arbeit jener KollegInnen mitübernehmen müssen, die körperlich und seelisch eine Auszeit brauchen. Nur – frage ich mich –, wenn solch ein Alltag zu Lasten von Kranken geht, und wie sollte das nicht der Fall sein, was passiert da am Ende einer solchen Spirale? Das Ganze kann für PatientInnen tödlich enden, schlimmstenfalls. Ich spekuliere nicht, sondern spreche aus Erfahrung, wie ich noch berichten werde. Wenn aus pflegerischem Zeitmangel, aus fehlender Hygiene und unterlassener medizinischer Behandlung der Verfall eines Patienten oder einer Patientin weit fortgeschritten ist, sind wir mit einer paradoxen Situation konfrontiert: den Tod als human zu empfinden.
Was tun, um einem menschenwürdigen Krankenhausalltag Kontur zu geben und alle diesbezüglichen Anstrengungen zu unterstützen, soweit das in unseren Händen liegt? Sich solidarisch mit einer angemesseneren Bezahlung des Personals zu zeigen, ist ein Anfang. Doch allein die Gehälter zu erhöhen, das reicht vorn und hinten nicht. Oder glaubt jemand, dass dadurch Pflegekräfte nur so angeflutet kommen? Nicht nur aus China, wie es momentan der Trend ist? Ich schlage vor, vom Ist-Zustand auszugehen, von den realen Tatsachen. Welche positiven Erfahrungen haben wir alle in und mit der Arbeitswelt? Vielleicht nicht jedermann, aber fast jede Frau, die ich kenne, legt großen Wert auf ein gutes Klima, sei es in der Familie oder im Betrieb. Kollegiales Zusammenarbeiten ermöglicht oft, dass couragierte Einzelne sich nicht scheuen, offene Worte zu sagen oder, sprichwörtlich gemeint! , den Finger auf eine Wunde zu legen, ohne deswegen gemobbt oder ausgegrenzt zu werden. Dann muss verpfuschte Arbeit nicht vertuscht oder schöngeredet werden. Sie kann dazu führen, dass die Beteiligten aufmerksamer mit den Gegebenheiten im (Krankenhaus-)Betrieb umgehen. Was letztlich dem Verhältnis zwischen PatientInnen und Pflegekräften zugute kommt. Als Patientin wüsste ich solch ein Klima immer zu schätzen. Und wenn ich nicht allzu oft aufgebracht, empört oder am Ende meiner Kräfte gewesen wäre, hätte ich womöglich Wege und Mittel gefunden, die positiv erfahrenen Momente in der Pflege nicht nur den Betreffenden gegenüber deutlicher auszudrücken.
Gibt es eigentlich engagierte PolitikerInnen, die zu unterstützen sind, wenn sie gesundheitspolitisch neue Wege vorschlagen? Ich erinnere mich an eine Ministerin, die notwendige Reformen zugunsten der Kranken ankündete – sie musste die Häme der gesamten Presse ertragen, war mein Eindruck. Ich frage ernsthaft:
Helfen uns kranken Menschen tatsächlich weitere Reformen und Gesetze, die von „oben“ für „oben“ ausgehandelt werden?
Bringt uns ein effizienteres Krankenhauscontrolling oder Qualitätsmanagement dem Ziel eines menschenwürdigen Krankenhausalltages wirklich näher?
Ich bin mir nicht sicher, ob verwaltungstechnische Änderungen und eine qualitätsorientierte Planung die Missstände und den Pfusch beheben können. Im Grunde sind doch die Vorschriften und Empfehlungen der Länder über Hygienemaßnahmen und Aufklärungspflichten gegenüber PatientInnen längst vorhanden. Es scheitert an der Umsetzung in den Krankenhäusern selbst, beispielsweise an der Durchführung von dringlich notwendigen Hygienemaßnahmen. Einmal abgesehen davon, dass ich „oben“ eh nichts ausrichten kann, bin ich aber auch nicht willens, auf Veränderungen von oben zu warten wie auf einen Sankt-Nimmerleins-Tag. Deswegen wünsche ich mir eine persönliche und öffentliche Auseinandersetzung über Probleme in und mit Krankenhäusern, die wir selbst haben kennen lernen müssen und von denen wir wissen. Ein solcher Austausch müsste mit der Frage beginnen, was sich die und der Einzelne an Veränderungen herbeisehnt, welche Bedürfnisse tatsächlich vorhanden sind. Wer soll sie formulieren, wenn nicht wir selbst! Um dann miteinander darüber zu diskutieren, was zu tun ist, und zwar ohne die Schere im Kopf: Das kostet die Institutionen viel zu viel! ... Es fehlt sowieso am lieben Geld! ... Wer soll das bezahlen? Also schreibe und hoffe ich, auf diese Weise Menschen und Institutionen anzusprechen, die meine Berichte zum Anlass nehmen, etwas anzupacken.
SO KANN’S KOMMEN! ERKRANKT AN GEMEINEN BAKTERIEN
Am Freitag, dem 02.06.2010, verspürte ich wieder einmal die üblichen Symptome einer Blasenentzündung. Eine typische Infektion bei Frauen – wie die Ärztin mir einmal bestätigte –, die aber bei mir fünf bis sieben Mal im Jahr auftreten konnte. Die letzte war gerade erst überstanden, wenn auch nur durch die Einnahme eines Antibiotikums, zu dem meine Hausärztin dringend geraten hatte, da die Laborwerte der Harnprobe bewiesen, dass sich wieder einmal alles im Urin befand, was nicht hineingehörte. Erst Ende Mai hatte ich die letzte Cefuroxim 250 mg gegen die Blasenentzündung eingeworfen. Und jetzt, eine Woche später, sah mein Urin schon wieder wie Milch aus, und das Entleeren der Blase war begleitet von brennenden, stechenden Schmerzen. Bitte kein weiteres Antibiotikum, dachte ich flehentlich und griff zur Selbsthilfe. Da es auf den Freitagabend zuging, eilte ich in die Läden der Wohngegend, um Preiselbeersaft zu besorgen. Umsonst gelaufen. Ich kaufte zwei Liter schwarzen Johannisbeersaft. Den ersten trank ich rasch in kleinen Schlucken. Ich aß normal zur Nacht: dunkles Toastbrot, Butter, Wurst, Käse, eine Tomate. Gegen 20:00 Uhr trat ein Schüttelfrost auf, das Fieberthermometer zeigte 38,7° an. Diese Symptome waren doch ungewöhnlich für mich. Mir klapperten die Zähne, der Kreislauf wurde instabil, ich legte mich sofort ins Bett. Etwa um 01:00 Uhr in der Nacht erwachte ich durch quälende Darmkrämpfe. Bereits auf dem Weg zur Toilette konnte ich bei aller Anstrengung keinen Muskel mehr kontrollieren. Diese Inkontinenz erschreckte mich besonders, da der flüssige Kot schwarz wie Teer aussah. Blut im Stuhl, assoziierte ich. Als mein Kopf wieder richtig arbeitete, tippte ich auf den Johannisbeersaft als Ursache. Ich trank ein Glas Apfelsaftschorle, und als ich sie bald wieder ausschied, war die Flüssigkeit bernsteinfarben. Inzwischen war es Samstagmorgen und keine meiner Ärztinnen erreichbar. Eine Freundin besorgte mir zwei Flaschen Coca Cola und eine Tüte Salzstangen, in der Apotheke erstand sie das Medikament Loperamid akut zur Behandlung akuter Durchfallerkrankungen. Inzwischen weiß ich, dass es sich bei der Therapie aus Cola und Salzstangen um eine Mär handelt, die sich aber hartnäckig behauptet, denn viele bestätigen noch: Ja, das ist richtig, diese Kombi hilft immer. In einer kleinen Broschüre aus der Apotheke aber las ich wenig später:
Cola & Salzstangen sind zum ausgewogenen Ersatz von Flüssigkeit und Mineralstoffen ungeeignet. Lassen Sie sich bei Durchfällen keinen „Colabären“ aufbinden!
In den letzten Monaten war mein Gewicht von 71kg auf 64 geschrumpft. Schön, mit achtundsiebzig Jahren wieder eine Figur wie bei der Heirat vor fünfundfünfzig Jahren zu haben – wenn da nicht die Kraft verloren gegangen wäre! Und das Aussehen durch die vielen Falten nicht einem Plisseerock gleichen würde. Ich bat die Freundin noch darum, mir Zwieback und Fencheltee zu besorgen, was sie auch tat. Trotzdem, das Wochenende wurde durch zwölf bis zwanzig Toilettenbesuche zu einem Trauma für mich.
Montagmorgen, der 05.06. Ich rief meine Hausärztin an und schilderte ihr mein Befinden. Sie riet mir, das Medikament abzusetzen und stattdessen Imodium akut





























