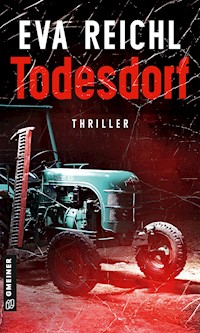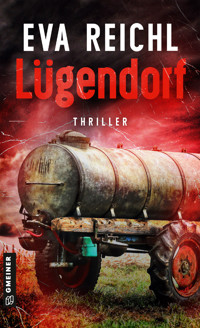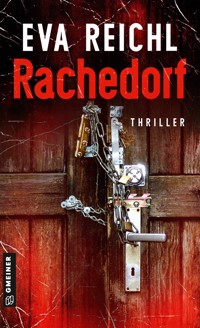Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Chefinspektor Oskar Stern
- Sprache: Deutsch
Auf der Burgruine Reichenstein wird Hochzeit gefeiert. Am nächsten Morgen hängt die Braut tot in den Bäumen unterhalb der Ruine. Schnell rücken die Familienmitglieder der Brautleute ins Visier von Chefinspektor Oskar Stern und seinem Team, da sie etwas zu verbergen scheinen. Dann taucht auch noch eine Überweisung in Höhe von 5 Millionen Euro auf. Doch wer profitiert von dem Geld? Und wer vom Tod der Braut? Die Ermittler gehen auf Täterjagd ins Mühlviertel. Dabei macht einer von ihnen einen bedeutsamen Fehler, den er teuer bezahlen muss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eva Reichl
Mühlviertler Kreuz
Kriminalroman
Zum Buch
Hochzeit mit Folgen Auf der Burgruine Reichenstein wird ausgelassen Hochzeit gefeiert. Am nächsten Morgen hängt die Braut tot in den Bäumen unterhalb der Ruine. Für die Inspektoren Oskar Stern und Mara Grünbrecht vom LKA Linz ist rasch klar, dass das Opfer über die Mauer der Hochburg gestoßen wurde. Bald rücken die Familienmitglieder der Brautleute ins Visier der Ermittler, da sie etwas zu verbergen scheinen. Als dann auch noch eine Überweisung in Höhe von 5 Millionen Euro auftaucht und bekannt wird, dass der Sänger der Hochzeitsband der Braut näher kam als üblich, ist klar, dass das keine normale Hochzeit war. Doch wer profitiert von dem Geld? Und wer vom Tod der Braut? Und wer ist der Unbekannte, der auf der Feier immer wieder mit der Braut getanzt hat und seither wie vom Erdboden verschluckt ist? Die Ermittler gehen auf Täterjagd ins Mühlviertel. Dabei macht einer von ihnen einen bedeutsamen Fehler, den er teuer bezahlen muss.
Eva Reichl wurde in Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich geboren und zog bereits als Kleinkind mit ihrer Familie ins Mühlviertel, wo sie bis heute lebt. Neben ihrer Beschäftigung als Controllerin schreibt sie überwiegend Kriminalromane und Kindergeschichten. Mit ihrer Mühlviertler-Krimiserie verwandelt sie ihre Heimat, das wunderschöne Mühlviertel, in einen Tatort getreu dem Motto: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Böse liegt so nah.
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Katja Ernst
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Lisa Reichl
ISBN 978-3-8392-6960-2
Widmung
Für Franz, meinen Ehemann
1. KAPITEL
Die Hochzeit auf der Burgruine Reichenstein im Mühlviertel war in vollem Gange. Marion Balduin tanzte ausgelassen mit Albert Freiherr, ihrem Zubräutigam. Hin und wieder erhaschte sie in dem unbeschwerten Treiben die Blicke ihres frisch angetrauten Ehemannes. Sie vermochte nicht zu sagen, ob er eifersüchtig war, bereits heute am Tag ihrer Hochzeit. Aber eigentlich interessierte sie es nicht. Sie wollte Spaß haben und ausgelassen feiern, wenn sie schon einen Mann heiraten musste, den sie aus freien Stücken niemals genommen hätte. Fabian Hallsteiner.
Er war nicht Marions Typ. Sie bevorzugte ältere, reifere Männer, die wussten, was sie wollten. Fabian hingegen war lieb und nett, ein Träumer. Und er spähte zu ihr herüber. Beobachtete sie bei allem, was sie tat, und strich sich die blonden Haare zurück, die seitlich kurz geschnitten und oben etwas länger waren. Stumm forderte er sie heraus.
Sie reckte das Kinn, zog Alberts Kopf zu sich herab und küsste ihn. Mit Zunge. Leidenschaftlich. Er machte mit, schien den Kuss zu genießen, erwiderte ihn und drückte sie an sich, bis sie seine Erregung spürte. Dann löste sie sich von ihm und drehte sich ausgelassen im Kreis. Sie wusste, dass die Aufmerksamkeit aller Hochzeitsgäste ihr galt, lachte und verlangte nach einem Glas Wein. Jemand reichte es ihr und Albert führte sie von der Tanzfläche.
Doch sie wollte nicht aufhören. Sie wollte tanzen!
Sie ließ Albert stehen und eilte zurück auf die Fläche im Burghof, wo sich die Menschen ausgelassen im Rhythmus der Musik bewegten. Jeder von ihnen war froh, endlich wieder gemeinsam feiern zu können, denn während der Hochblüte der Corona-Pandemie war eine so große Hochzeit nicht möglich gewesen.
Gleich neben dem Eingang in die Burgkapelle hatte sich auf einer Bühne die Band positioniert. Canticum Lupi war eine Mittelalterrockband, passend zum Ambiente der Burg, von deren Gemäuer nur noch Teile erhalten waren. Dennoch konnte man sich gut in das Leben zur damaligen Zeit hineinversetzen – oder zumindest in eine moderne Vorstellung davon. Bestimmt hatten einst die tapferen Ritter mit ihren Frauen desgleichen hier gefeiert, wenn sie einen blutigen Sieg errungen hatten. Hatten Tische und Bänke aufgestellt und diese mit Speis und Trank beladen, bis sie zum Bersten voll gewesen waren. Dies war zumindest die romantische Idee davon, und so ähnlich fand es heute auch tatsächlich statt. Geld spielte keine Rolle, Marions Schwiegervater hatte keine Kosten gescheut, die Feier zu einem rauschenden Fest werden zu lassen, denn so mancher der Anwesenden hatte mit dem heutigen Tag wie die Ritter zur damaligen Zeit erreicht, was er wollte.
Die Klänge des Dudelsackes und des Schlagzeuges peitschten Marion hoch und ließen sie dieses Gefühl eines Sieges spüren. Jemand nahm ihre Hand, drehte sie im Kreis, fing sie auf, lachte. Es war ein junger Mann mit strahlenden blauen Augen.
Der Dudelsackspieler von Canticum Lupi vollführte auf der Bühne eine Glanzleistung in dieser sternenklaren Mainacht, unterstützt von der Stimme des Sängers, der ein Lied über Krieg und Frieden zum Besten gab.
Marion verschüttete ihren Wein und sah in die blauen Augen, die sie zu vergöttern schienen. Nur für diese eine Nacht wollte sie seine Königin sein. Nur dieses eine Mal war er ihr blauäugiger Ritter. Danach würde sie sich in die Rolle der Ehefrau fügen und verrotten, wie all die anderen Ehefrauen auch, wenn man den Geschichten derer, die längst verheiratet waren, Glauben schenken durfte. Den Geschichten ihrer Tanten und Cousinen. Der Geschichte ihrer Mutter.
Doch Marion hatte Pläne, Ziele, Visionen, die sie nicht zu begraben gedachte. Sie würde durch die Ehe wachsen, hoffte sie, und sich all das nehmen, was ihr durch den Kopf flatterte wie Schmetterlinge, weil es bislang unausgegorene Ideen waren. Diese Schmetterlinge würden sich zur gegebenen Zeit auf einer Blüte niederlassen. So lange musste sie warten. Dann aber würde sie ihre frisch erhaltene Fessel wieder ablegen.
Der Blauäugige packte Marion an der Taille und zog sie an sich. Sie warf das Glas in die tanzende Menge und konzentrierte sich auf den Unbekannten, auf seine Hände, auf sein Lächeln, und fragte sich, wer ihn eingeladen hatte? Zu ihrer Verwandtschaft gehörte er nicht, auch nicht zu der entferntesten, das wusste sie. Diese Augen und dieser Mund wären ihr bestimmt im Gedächtnis geblieben, hätte sie beides schon mal gesehen.
Vielleicht war er Fabians Cousin? In diesem Fall würde sie den Fremden jetzt öfter sehen, dachte sie und lachte wieder.
Die Musik wurde langsamer. Marion passte ihre Bewegungen dem Takt an. In der Menge suchte sie nach ihrem Ehemann in der Annahme, er würde sie eifersüchtig beobachten. Doch wider Erwarten tanzte er mit der Zubraut, Leona Sipacher, ebenso eng umschlugen wie sie es selbst mit ihrem blauäugigen Ritter tat.
Marion traute ihren Augen nicht!
Die Zubraut, die ihr zur Seite stehen sollte, ihr behilflich sein musste bei den vielen Dingen, die bei einer Hochzeit anfielen, machte sich an ihren Ehemann ran! Unerwartet spürte Marion Eifersucht ihre Knochen emporkriechen. Was widersinnig war, da sie Fabian Hallsteiner gar nicht liebte. Sie verabscheute ihn in diesem Augenblick sogar, kniff die Augen zusammen und streckte den Rücken durch. Dann versprühte sie ihr Gift.
»Ich finde, wir sollten uns ein kuscheliges Plätzchen suchen, wo wir ungestört sind«, flötete sie ihren blauäugigen Helden an.
»Wenn du möchtest.«
»Heißt das, du willst nicht?«, fragte sie keck ob der zurückhaltenden Antwort.
»Es ist deine Hochzeit, nicht meine«, erwiderte der Unbekannte.
»Wie heißt du? Nein! Sag es mir nicht! Ich möchte einmal in meinem Leben mit jemandem ficken, dessen Namen ich nicht kenne.« Marion zwinkerte ihm zu und entwand sich seinen Armen. Anschließend verließ sie die Tanzfläche, ihr Ritter folgte ihr.
Bei ihrem Gang über den Burghof bemerkte Marion, dass sie betrunken war. Nicht beschwipst und auch nicht angeheitert, sondern richtig betrunken. In diesem Zustand würde es nicht leicht sein, die Stufen in die Hochburg zu erklimmen. Ihr Schwiegervater hatte die komplette Burg für diesen Abend gemietet, demnach standen ihnen die Räumlichkeiten ganz oben ebenfalls zur Verfügung. Doch schon nach den ersten Stufen musste sich Marion setzen. Sie brauchte eine Pause.
»Was ist mit dir?«, fragte derjenige, den sie eben noch hatte abschleppen wollen.
»Mir ist schlecht«, antwortete Marion, den Kopf in beide Hände gestützt.
»Also wird es nichts mit …«
»Nein! Hau ab!«, schrie sie ihn an.
»Schon gut, beruhige dich …«
»Ich will mich nicht beruhigen, hau einfach ab!«
In diesem Augenblick kam ein Pärchen die Treppe herab und bemerkte Marion und ihren Ritter am Fuße derselben. Es war Marions Cousine Luise mit ihrem Ehemann Floyd. Marion hatte sich schon immer über den seltsamen Namen gewundert.
»Geht es dir gut?«, fragte Luise. Zumindest nahm Marion an, dass es ihre Cousine war. Sie sah das Gesicht der Frau nur verschwommen und wünschte sich, dass die Stufen endlich aufhörten sich zu drehen.
»Alles bestens«, stieß Marion aus.
Luise musterte den Mann an Marions Seite, der unschuldig mit den Schultern zuckte und sich lässig an die Mauer lehnte.
»Ihr ist schlecht«, sagte er und deutete auf Marion, als wüssten die Anwesenden nicht, wen er meinte.
»Wenn du Hilfe brauchst …«
»Wir schaffen das«, unterbrach er sie. »Sie braucht nur ein paar Minuten Auszeit. Danach ist sie wieder ganz die Alte.«
Luise und Floyd zogen von dannen.
»Was jetzt? Willst du hier sitzen bleiben?«, fragte er Marion, als niemand mehr in Hörweite war.
»Nein«, antwortete Marion. »Bring mich zurück zur Feier.« Sie versuchte sich aufzurichten, was kläglich misslang, und rutsche lediglich auf ihrem Hinterteil eine Stufe nach unten.
»Los, ich zieh dich hoch«, sagte er und fasste ihr unter den Arm. Mit Schwung half er Marion auf die Beine. Da sie nicht wusste, wie lange das funktionieren würde, weil ihr immer noch schwindelig war, hakte sie sich bei ihm unter.
»Warte!«, sagte ihr Ritter und hielt ihr seinen Finger hin.
»Was soll das?«, wollte sie von ihm wissen und starrte den Finger an, als wäre er eine obszöne Geste. Als würde der Blauäugige erwarten, dass sie ihn lutschte.
»Spuck darauf! Deine Wimperntusche ist verschmiert.«
Marion lachte. Der Mann war fürsorglich, genau wie Fabian. Doch während sie diese Eigenschaft bei ihrem frisch angetrauten Ehemann verabscheute, gefiel sie ihr bei ihrem Gegenüber. Sie leckte seinen Finger ab, und er wischte ihr damit die verschmierte Mascara weg. Wieder vorzeigbar schlenderten sie Arm in Arm zurück, wohl wissend, dass sie von den Gästen neugierig beobachtet wurden.
An der eigens für die Hochzeit aufgestellten Bar genehmigte sich Marion ein Glas Wasser, um klarer im Kopf zu werden. Sie bat den Barkeeper, ihr das Wasser in ein Weinglas zu füllen, damit niemand sie mit dem alkoholfreien Getränk ertappte. Schließlich wollte sie den Eindruck machen, dass sie Spaß hatte, und wie bei einer Hochzeitsfeier üblich, musste dafür reichlich Alkohol fließen. Nüchtern würde sie den heutigen Abend und die folgende Nacht auch nicht ertragen. Aber noch war die Hochzeitsfeier ja nicht vorüber. Das traditionelle Brautstehlen fehlte, und Marion wünschte sich, dass ihr blauäugiger Ritter sie ganz weit weg von hier brächte, an einen Ort, von wo sie nie mehr zu dieser Feier zurückkehren würde und ein freies Leben führen könnte, ganz so, wie sie es sich vorstellte.
»Wie geht es dir?«, fragte eine Stimme hinter ihr. Ihr Ritter war es nicht, der war auf seltsame Weise verschwunden. Es war Albert Freiherr, der Zubräutigam.
»Warum fragen mich alle, wie es mir geht?«, fuhr Marion ihn an.
»Weil es deine Hochzeit ist und du glücklich sein solltest«, antwortete Albert und nippte an seinem Rotwein.
Marion erwiderte nichts, sondern sah hinüber zu dem Tisch, an dem ihre Eltern saßen. Sie unterhielten sich angeregt mit Leuten, die Marion nicht kannte. Wahrscheinlich Geschäftspartner ihres Vaters oder Verwandte von Fabian. Vielleicht auch irgendjemand, der für sie immer unbekannt bleiben würde, weil diese Menschen nur wichtig für andere waren.
»Lass uns tanzen«, sagte sie an Albert gewandt.
»Jederzeit gerne, das weißt du.«
»Ja, das weiß ich.«
Albert zog Marion hinter sich her auf die Tanzfläche. Die Band stimmte im selben Augenblick eine Ballade an und der Sänger zwinkerte Marion zu. Sie löste sich von Albert, marschierte in Richtung Bühne und neckte den Frontman der Band mit lockendem Zeigefinger, er möge sich zu ihr herunterbeugen. Der Sänger kam der Aufforderung nach, und anstatt eine weitere Zeile Text zu singen, ließ er sich von der Braut küssen. Ein Raunen ging durch die Gäste, und Marion fing den erzürnten Blick ihres Vaters auf. Volltreffer!, dachte sie und ging beschwingt zu Albert zurück.
»Findest du das klug?«, fragte er.
»Nein«, antwortete Marion ehrlich. »Aber was bringt es mir, klug zu sein?«
»Du würdest nicht den Unmut deiner Alten auf dich ziehen, auch nicht den deiner Schwiegereltern«, resümierte Albert.
Marion sah, während sie sich von Albert über die Tanzfläche führen ließ, zu Viktor und Stefanie Hallsteiner hinüber, ihren Schwiegereltern. Anhand deren Mimik erkannte sie, dass ihnen ihre kleine Einlage nicht gefallen hatte. Sie würde sich nach der Hochzeit demnach nicht nur von ihren Eltern und ihrem Ehemann etwas anhören müssen, sondern auch von ihrer angeheirateten Familie. Sie seufzte, hatte jedoch keine Lust, zu dem bösen Spiel, das um sie herum stattfand, eine fröhliche Miene aufzusetzen.
»Es ist mir egal, was sie über mich denken«, sagte sie schließlich.
»Ist es dir nicht«, konterte Albert.
»Ist es wirklich. Schließlich ist das hier meine Abschiedsparty.«
»Abschiedsparty? Du heiratest doch bloß.«
»Ja, aber einen Mann, den ich mir nicht ausgesucht hab.«
»Was hast du vor?« Albert hielt Marion eine Armlänge von sich gestreckt und musterte sie. Dann zog er sie wieder heran und drehte sich mit ihr, wie es der Tanz verlangte.
»Keine Ahnung. Abhauen?« Marion setzte ein Lächeln auf, doch es war nur eine Maske, die sie trug, damit niemand ihre wahren Gefühle erkannte.
»Mach dich nicht lächerlich. Du kannst immer zu mir kommen, das weißt du.«
»Ja, das weiß ich.«
Die Musik verstummte und die Gäste applaudierten. Danach kündigte der Sänger eine 20-minütige Pause an. Sofort strömten alle Richtung Bar.
»Darf ich dir einen Drink spendieren?«, fragte der Frontman der Band, der plötzlich hinter Marion und Albert auftauchte. Seine rot gefärbten Haare hatte er auf einer Seite wegrasiert, dafür trug er sie auf der anderen umso länger. Die Klamotten, die er anhatte, waren aus Leinen gefertigt und der breite Gürtel aus weichem Rindsleder. Das Outfit könnte gut und gerne aus jener Zeit stammen, die er und seine Band ein Stück weit aufleben lassen wollten. Und das taten sie mit Erfolg, das musste Marion zugeben.
»Du weißt schon, dass die Getränke für die Braut gratis sind?«, erwiderte sie lachend.
»Klar weiß ich das. Das ist auch nur so eine Anmache, die du sicher kennst«, konterte der Sänger.
»Natürlich kenne ich die, genau wie dich, Goliat, aber deine Anmache ist halt nicht sonderlich originell«, erwiderte Marion. Die Melancholie von vorhin war wie weggeblasen. Sie wollte nur noch im Hier und Jetzt existieren. »Von einem wie dir hätte ich etwas anderes erwartet.«
»Ja? Was denn?«
»Keine Ahnung.« Marion zuckte mit den Schultern.
»Ich könnte dir ein Lied trällern …«
»Oh ja, genau darauf hab ich gewartet.«
Goliat stimmte einen schmalzigen Liebessong an.
»Sei still! Die anderen schauen schon«, lachte Marion.
Goliat verstummte, ebenso in bester Laune. Es war ihm anzusehen, dass er Freude daran hatte, im Mittelpunkt zu stehen. Das war er als Frontman der Band gewöhnt. »Was willst du trinken?«
»Einen Gin Tonic, bitte.«
Goliat bestellte zwei dieser Mix-Getränke und reichte ein Glas Marion. »Was war das denn vorhin?«, fragte er unschuldig und stieß mit seinem Drink gegen ihren.
»Was meinst du?« Marion stellte sich unwissend.
»Der Kuss vor all den Leuten«, erinnerte Goliat sie daran.
Marion schlürfte ihren Gin Tonic. Nach einer Weile sagte sie: »Mir war einfach danach.«
»Tust du immer, worauf du gerade Lust hast?«
»Meistens.«
»Das ist gut.« Goliat grinste.
Das Gedränge an der Bar wurde heftiger und jemand rempelte Marion von hinten an.
»Entschuldige«, sagte der blauäugige Ritter, als Marion sich umwandte. Er schob sich durch die Umstehenden an die Bar, um ebenfalls Getränke zu ordern. An seinem Gesichtsausdruck konnte sie nicht ablesen, ob er sauer auf sie war, weil aus dem Stelldichein nichts geworden war, oder ob er nur ihre Aufmerksamkeit erregen wollte. Sie machte ihm Platz und drückte sich an Goliat, der nicht zurückwich. Es kam ihr sogar vor, als würde seine Hand die Konturen ihrer Beine unter dem Brautkleid nachzeichnen. Ein schlimmer Finger, dachte sie und stellte sich vor, wie selbiger in sie eindrang und sich bewegte.
»Alles okay?«, fragte Goliat, mit dem Glas in der Hand und einem Grinsen im Gesicht, das Marion signalisierte, dass er genau wusste, was sie im Augenblick fühlte.
»Küss mich!«, forderte sie ihn auf.
»Ich werde dich bestimmt nicht ein weiteres Mal vor all den Leuten küssen. Die würden mich lynchen, und darauf hab ich echt keinen Bock.«
»Du bist ein Feigling«, provozierte Marion ihn.
»In fünf Minuten oben in der Hochburg«, raunte er ihr ins Ohr, leerte seinen Gin Tonic und verschwand in der Menge.
Marion stand an der Bar inmitten von 400 Hochzeitsgästen und mit dem Rücken zu ihrem Ritter, dennoch fühlte sie sich allein. Und unsicher. Ob sie Goliat folgen sollte?
»Marion!« Die Stimme ihres Bruders riss sie aus ihren Überlegungen. Im Schlepptau hatte er ihren Ehemann. Sie genehmigte sich einen Schluck, um sich für das Bevorstehende zu wappnen. Danach ging sie auf David und Fabian zu. Die zwei könnten Brüder sein, schoss es ihr durch den Kopf, sie glichen einander im Aussehen wie Zwillinge. Beide hatten blonde Haare, die oben länger und seitlich kurz geschnitten waren, blaugraue Augen und ein markantes Kinn. Marions Haare waren im Gegensatz dazu braun und lockig und reichten ihr bis über die Schultern – heute trug sie sie jedoch mit weißen Perlen verziert hochgesteckt –, und ihre Augen funkelten in einem angriffslustigen Grün. Kaum zu glauben, dass David und sie Geschwister waren.
»Mensch, Marion!«, wiederholte David ihren Namen, und Marion machte sich auf Vorwürfe gefasst.
»Was willst du?«, herrschte sie ihn an.
»Ich bringe dir deinen Ehemann. Du solltest auch mal mit ihm tanzen«, brachte David das Anliegen vor, das sie beide hertrieb, als hätte es Fabian die Sprache verschlagen. Als könnte er nicht für sich selbst eintreten.
»Hörst du vielleicht Musik, zu der wir tanzen könnten?«, maulte Marion.
»Ich finde, ihr solltet euch wie Mann und Frau verhalten, jetzt, wo ihr verheiratet seid«, sagte David Marions Einwand ignorierend. »Die Liebe wird schon noch kommen.«
»Wann?«, keifte Marion ihren Bruder an.
»Irgendwann«, sagte Fabian ruhig. Es waren die ersten Worte, die er seit seinem Ehegelübde an sie richtete. Sie spürte seine Traurigkeit über die Vermählung. Auch wenn sie sonst nichts gemeinsam hatten, diese Traurigkeit einte sie.
»Willst du etwas trinken?«, fragte sie ihn, weil David und Fabian nun schwiegen und die Menschen rundum zu tuscheln begannen. Dabei brachte sie sogar ein Lächeln zustande.
»Gerne. Was trinkst du?« Fabian deutete auf das Glas in ihrer Hand, in dem nur mehr Eiswürfel vor sich hin schmolzen.
»Das war ein Gin Tonic. Willst du einen?«
Fabian nickte.
»Zwei Gin Tonic bitte!«, rief sie dem Barkeeper zu, froh, etwas zu tun zu haben und nicht höfliche Konversation mit ihrem Ehemann treiben zu müssen. Umgehend standen die bestellten Drinks auf dem Tresen. Das war der Vorteil, wenn man die Braut war: Man musste nicht auf die Getränke warten, sondern wurde vorrangig bedient. Einen Drink reichte sie an Fabian weiter.
»Danke«, sagte er.
Klirrend stießen die Gläser aneinander.
»Glaubst du wirklich, dass die Liebe eines Tages kommen wird?«, fragte Marion ihn.
»Wenn es unsere Eltern zulassen, kann das durchaus der Fall sein.«
»Das bezweifle ich.«
»Weshalb?«
»Weil sich mein Vater überall einmischt.«
»Genau wie meiner.«
Wieder klirrten die Gläser.
Als sie getrunken hatten, sagte Marion: »Ich dachte immer, dass nur dort, wo es zum Überleben der Familien dient, die Mädchen zwangsverheiratet werden.«
»Dein Vater bekommt einen Haufen Geld von meinem, damit sein Unternehmen weiterläuft. Das dient doch zum Überleben deiner Familie«, antwortete Fabian.
»Und was hat deine Familie davon?«
»Das frag ich mich auch schon die ganze Zeit.«
»Was fragst du dich die ganze Zeit?«, ertönte es hinter ihnen. Viktor Hallsteiner war unbemerkt an sie herangetreten und hatte Fabians letzte Worte gehört.
»Nichts, Vater«, antwortete Fabian. Es war unschwer zu erkennen, dass zwischen ihm und seinem Erzeuger nicht das beste Verhältnis bestand. Aber ein Sohn gehorchte, wenn er nicht wollte, dass ihm das Erbe entzogen wurde. Dass ihm bis auf den Pflichtteil alles genommen wurde, was ihm von Geburt an zustand.
»Ich würde es begrüßen, wenn ihr mehr Freude ausstrahlen würdet. Es ist schließlich eure Hochzeit«, sagte Viktor Hallsteiner.
»Jawohl, Vater«, antwortete Fabian gehorsam. »Komm, Marion, lass uns tanzen.« Er hielt seiner Angetrauten den Arm hin und die hakte sich unter, nicht ohne ihrem Schwiegervater ein süffisantes Lächeln zu schenken. Es war ihr gar nicht aufgefallen, dass die Band wieder zu spielen begonnen hatte, demnach hatte sie ihr heimliches Rendezvous mit dem Sänger Goliat verpasst. Das würde sie nachholen, die Nacht war ja noch jung.
Fabian führte sie elegant über die Tanzfläche, war charmant und ganz der wohlerzogene Spross einer einstmals adeligen Familie. Wäre die Monarchie nicht schon vor über 100 Jahren abgeschafft worden, wäre Fabian ein »von Hallsteiner«. Zugegeben schmeichelte dieser Umstand Marion, und sie fühlte sich ein wenig wie eine Prinzessin, in diesem Fall – und vor allem dank des Ambientes – wie ein Burgfräulein. Als der Tanz zu Ende war, klatschte Marions Schwiegervater ab.
»Darf ich bitten?«, fragte er und wartete gar nicht erst auf eine Antwort. Er entzog seinem Sohn dessen Ehefrau und deutete dem Bandleader, er möge ein langsameres Lied anstimmen. Gleichzeitig orderte er mehrere Krüge Bier für die Band. Zum Takt einer deutschsprachigen Mittelalter-Ballade zog er Marion an sich und geleitete sie über die Tanzfläche.
»Du siehst wunderschön aus«, flüsterte er ihr ins Ohr.
»Danke«, antwortete Marion brav, wenngleich es sie störte, dass Viktor so tat, als gehörte sie ihm. Das war schon immer sein Problem gewesen.
»Hast du mein Geschenk bekommen?«, fragte er leise.
»Hab ich. Aber ich dachte, es ist ein wenig unpassend, wenn ich es heute trage, wo ich doch deinen Sohn heirate.«
»Es wäre niemandem aufgefallen, und ich hätte gewusst, dass du es zu schätzen weißt. Immerhin hat es ein Vermögen gekostet.« Viktor Hallsteiner klang eingeschnappt.
»Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt jemals tragen werde«, ließ Marion ihn abblitzen. Es war ein Stich mitten ins Herz, mit einer sehr feinen Klinge, aber der Tadel ihres Schwiegervaters weckte in ihr die Rebellin.
»Wie meinst du das?«, fragte er verwundert.
»So wie ich es sagte«, antwortete Marion erleichtert, dass das Lied zu Ende war. Sie löste sich von ihrem Schwiegervater und verließ das Tanzparkett. Auf ihrem Weg sah sie Albert, der sie anstarrte. Und ihre Zubraut Leona Sipacher, die sich an Fabian ranmachte. Leona hatte ihr immer wieder zu verstehen gegeben, dass sie es unfair fand, dass Marion den begehrtesten Junggesellen des Landes ehelichen durfte, obwohl sie ihn gar nicht liebte. Marion hatte nicht gewusst, was sie hätte dagegenhalten können. Es war in der Tat ungerecht. Mehr als ungerecht. Sie wollte lieber frei sein!
Aufgebracht achtete sie nicht auf den Boden und stolperte. Der Ritter mit den blauen Augen fing sie auf.
»Du hast wohl zu viel getrunken«, sagte er.
»Noch nicht genug, um das hier auszuhalten«, murmelte Marion und zupfte ihr Kleid zurecht.
»Wie bitte?«
»Ach nichts. Bringst du mir noch einen Gin Tonic?«
»Wenn du möchtest.«
»Ja, ich will.«
»Ich glaube, diese Worte hast du heute schon mal gesagt, aber nicht zu mir«, erwiderte der blauäugige Mann.
»Jetzt sag ich sie aber zu dir. Ich will dich, ich will ihn, ihn und ihn. Sie will ich nicht und ihn auch nicht.« Marion deutete dabei auf unterschiedliche Gäste und wollte gar nicht mehr aufhören, auf sie zu zeigen.
»Ist gut. Ich bring dir deinen Gin Tonic. Lauf nicht weg.« Marions Ritter machte sich auf den Weg zur Bar.
»Wo soll ich denn hin?«, murmelte Marion und nahm den Sänger der Band ins Visier. Goliat sah süß aus, wie er dort oben auf der Bühne stand und eine Hymne nach der anderen schmetterte. Bald würde sie den Hochzeitsbräuchen im Mühlviertel nach »gestohlen« werden, das hieß, man brachte sie an einen anderen Ort und ihr Ehemann musste sie auslösen mit vielen Gesängen, Spielen und noch mehr Schnaps. Sie war gespannt, wer ihr Entführer sein würde. Wer sich ihr für dieses Spiel anböte. Goliat würde es nicht sein, der wurde auf der Bühne gebraucht, um die restlichen Gäste zu unterhalten.
Was war mit David, ihrem Bruder?
Oder Albert?
Ihr blauäugiger Ritter?
Bis es so weit war, wollte sie noch Spaß haben. Sie betrat erneut die Tanzfläche und inhalierte die Rhythmen der mittelalterlichen Klänge. Sie schloss die Augen und ließ sich von der Musik treiben. Drehte sich im Kreis und streckte die Arme aus, als könnte sie fliegen. Sie fühlte sich wie ein Vogel. Frei und unbeschwert. Ja, in diesem Augenblick dachte sie tatsächlich, sie könnte davonfliegen in ein anderes Leben.
Jemand packte sie am Arm. Erschrocken riss sie die Augen auf. Es war ihr Bruder, der sie mit fröhlicher Miene von der Tanzfläche führte.
»David, was ist los?«
»Es ist so weit«, antwortete er geheimnisvoll und zog sie hinter sich her die Treppe der Burg hinab. Ein ganzer Schwung angetrunkener Hochzeitsgäste folgte ihnen.
Marion lachte, ohne zu ahnen, dass einer von ihnen diese Hochzeit nicht lebend verlassen würde.
2. KAPITEL
»Ich kann nicht mehr«, japste Chefinspektor Oskar Stern und schnappte nach Luft. Die paar Kilo zu viel um Bauch und Hüfte machten sich gehörig bemerkbar. Er blieb stehen und tat, als schaute er sich die Umgebung an. Derweilen brauchte er die Pause, um mal durchzuschnaufen.
Das Mühlviertel breitete sich sanft hügelig vor ihnen aus. Die saftigen Wiesen waren mit einem sonnengelben Schimmer überzogen, da unzählige Löwenzähne ihre Köpfe gen Himmel reckten. Die Wälder waren frisch und dunkelgrün, und das Summen von Millionen Insekten umrahmte die Natur wie ein Orchester. Stimmt schon, der Ausblick war berauschend, und seit sie in Pierbach losgegangen waren, hatten sie schon mehrere davon genießen dürfen.
Aber musste Weber dermaßen rennen?
Stern fühlte sich dadurch gehetzt, gedrängt, als gäbe es kein Morgen. Wenn sie weiterhin so liefen, konnte es gut sein, dass er bei dieser Schinderei einen Herzinfarkt erlitt, und zwar mitten auf dem Weg.
»Wir sind doch erst fünf Kilometer gegangen«, warf Dominik Weber ein, und Stern fragte sich, woher der Gerichtsmediziner das überhaupt wissen wollte. Sterns Beine und Fußsohlen schmerzten nämlich, als wären sie schon das Dreifache der Strecke gewandert, ganz zu schweigen von seinen kneifenden Zehen, die sich bei jedem seiner Schritte wie ausgepresste Zitronen anfühlten.
In Webers Rucksack – und an seinem Körper – war mehr technisches Equipment angebracht, als es im ganzen LKA gab, was gleichzeitig Sterns Frage beantwortete. Irgendetwas von GPS und ähnlichem Kram hatte Weber zu Beginn ihrer Wanderung gefaselt. Da hatte Stern aber nicht zugehört, sondern tatsächlich die Landschaft genossen. Dazu brauchte er kein GPS – und ebenfalls keine Kamera wie manche Leute, die vor lauter Fotoschießen die reale Welt nur noch über das Display ihres Handys oder durch den Sucher eines Fotoapparates kannten.
»Mir kommt es vor, als wären wir seit Stunden unterwegs«, sagte er.
»Sind wir auch, aber nur, weil du so dahinschneckst«, stichelte Weber und machte gleichzeitig Fotos von der Umgebung.
»Wenn ich dir zu langsam bin, brechen wir halt ab. Ich muss den Johannesweg nicht gehen«, witterte Stern seine Chance, den verlorenen Wetteinsatz vielleicht doch nicht einlösen zu müssen. Beim letzten Mordfall hatte Dominik Weber bei einer Leiche den Alkoholgehalt im Blut über zwei Promille geschätzt, ohne technische Hilfsmittel, nur durch die Ausdünstungen des Toten, und er hatte recht behalten. Stern hatte nicht weiter darüber nachgedacht und in die Wette eingewilligt, die ihm Weber vorgeschlagen hatte. Hätte er damals gewusst, dass der Johannesweg, der quer durchs hügelige Mühlviertel führte, ganze 84 Kilometer lang war, hätte er natürlich nicht derart leichtfertig zugestimmt.
»Aber geh, das passt schon. Hab ich halt ein bisschen mehr Zeit zum Fotografieren und Erholen«, machte Weber einen Strich durch Sterns Rechnung.
»Wie weit ist es denn noch?«, fragte der Chefinspektor.
»Du meinst die heutige Etappe?«
»Bis zur ersten Pause.«
»Die machen wir doch gerade.« Weber nahm einen Schluck Wasser aus seiner Trinkflasche.
»Und wie viele Kilometer müssen wir heute noch zurücklegen?«
»Ich würde sagen: neun. Mit deiner Kondition schaffen wir eh nicht mehr. Und dann sind wir in Schönau im Mühlkreis und suchen uns eine nette Bleibe.«
»Und etwas zum Essen wäre gut«, ergänzte Stern, denn das Frühstück lag bereits eine Weile zurück. Weber hatte ihn heute Morgen schon früh von zu Hause abgeholt. Der Gerichtsmediziner war voller Tatendrang gewesen und hatte nicht bis nach dem Mittagessen warten wollen. Außerdem hatte der Wetterbericht für die kommenden Tage durchgehend Sonnenschein und angenehme 22 Grad angekündigt – das perfekte Wanderwetter!
Anfang Mai blühten die Frühlingsblumen mit den Obstbäumen um die Wette, überall summte es, Bienen sammelten eifrig Nektar von den Blüten, die einen süßlichen Duft verströmten. Eine wunderbare Kulisse, um die Seele baumeln zu lassen und Abstand zu gewinnen zu einem Alltag, der manchmal ziemlich nervtötend und belastend war, das musste Stern zugeben. Er setzte sich auf eine Bank, die am Wegrand für Wanderer aufgestellt war und zum Rasten einlud, und streckte die Beine aus.
Mitten in diese Idylle hinein läutete sein Handy.
»Bitte nicht«, seufzte Weber, der Böses ahnte. »Warum hast du es nicht ausgeschaltet?«
»Weil ich erreichbar sein will, wenn etwas ist.« Stern kramte in dem Rucksack nach dem Smartphone.
»Wenn etwas ist? Es ist immer etwas, Oskar«, maulte Weber.
»Ich meine, mit Barbara oder den Kindern«, antwortete Stern, immer noch nach dem Handy suchend. Mittlerweile lag schon der halbe Rucksackinhalt auf der Bank. Unvermittelt verstummte das nervige Klingelgeräusch.
»Ah, es hat aufgehört.« Weber zeigte sich erleichtert. »Wird schon nicht so wichtig gewesen sein, und wenn doch, versucht der Anrufer es bestimmt später wieder. Komm, räum das Zeug ein und lass uns weitergehen.« Weber klopfte sich energiegeladen auf die Oberschenkel. Das Wandern bereitete ihm Freude. Er war schlank und drahtig und seine Waden waren stramm und muskulös. Seine ganze Erscheinung deutete darauf hin, dass er öfter zu Fuß unterwegs war.
Sterns Handy klingelte erneut.
»Dann ist es wohl wirklich wichtig«, brummte der Chefinspektor und holte das lärmende Gerät von weit unten aus dem Rucksack heraus. Ein Blick auf das Display verriet ihm, dass ihn der Dienststellenleiter erreichen wollte. Da musste er rangehen, ob es Weber passte oder nicht.
»Stern«, meldete er sich.
»Stern, Sie haben einen neuen Fall!«, teilte Bormann ihm ohne Umschweife mit.
»Einen neuen Fall?«, wiederholte Stern laut, damit Weber es mitbekam. Der ließ auch gleich enttäuscht die Schultern hängen.
»In Reichenstein, und zwar auf der Burgruine. Die örtlichen Kollegen haben uns verständigt, dass sie nicht sicher sind, ob es sich um einen Unfall oder einen Mord handelt, deshalb fahren Sie dorthin. Und bringen Sie Weber mit, Stern. Der ist doch bei Ihnen, oder? Ich hab gehört, dass Sie beide zusammen im Mühlviertel wandern sind.«
»Ich richte es ihm aus«, antwortete Stern diensteifrig. Etwas Besseres als ein neuer Fall konnte ihm im Augenblick nicht passieren. Denn jetzt durfte er die drückenden Wanderschuhe gegen seine weichen Kalbslederschuhe eintauschen. Seine Füße würden es ihm danken, und sein geschundener Körper erst recht.
»Ach, eine Sache noch«, sagte Bormann. »Die Kollegen von der örtlichen Polizei haben etwas von einem Kreuz, das wie ein Engel aussieht, gesagt …«
»Bitte was?« Stern war sich nicht sicher, ob er den Dienstellenleiter richtig verstanden hatte. Die Verbindung war nicht die beste und in der Leitung knackte und rauschte es.
»Die Leiche soll wie ein Kreuz im Engelsgewand aussehen, Stern. Es verbreitet sich schon in den sozialen Netzwerken. Irgend so ein Scherzkeks hat die Tote fotografiert und das Foto ins Internet gestellt.«
»Und wie bitte kommt man von einer Leiche auf ein Kreuz, das wie ein Engel aussieht? Was soll das überhaupt sein?«, fragte Stern konsterniert.
»Am besten, Sie schauen sich das an. Sie brauchen nur ›Mühlviertler Kreuz‹ oder ›Kreuz und Engel in Reichenstein‹ bei Facebook eingeben und das Foto wird Ihnen angezeigt.«
»Äh …«
»Noch viel besser allerdings ist, Sie und Weber fahren sofort hin. Dann können Sie es sich vor Ort ansehen. Die Kollegen warten bereits auf Sie!« Damit verabschiedete sich Bormann.
Stern starrte sein Handy fassungslos an.
»Was ist?«, fragte Weber.
»Wir haben einen neuen Fall, und du sollst auch gleich mitkommen. Gar nicht weit von hier, auf der Burgruine Reichenstein«, sagte Stern und deutete in jene Richtung, in der er besagte Burg vermutete.
»Die liegt gute 20 Kilometer entfernt«, wusste Weber, der deutlich mehr Ortskenntnisse hatte. Er wies in die entgegengesetzte Richtung und grinste. »Und wenn wir gemeinsam hinfahren, ist keiner von uns vor dem jeweils anderen am Tatort. Ich würde sagen, damit ist es diesmal unentschieden.« Weber spielte damit auf das unausgesprochene Ritual bei jedem neuen Mordfall an, dass sowohl Stern als auch er als Erster am Tatort sein wollten, und jeder seinen Sieg dem anderen wochenlang unter die Nase rieb.
»Bormann hat gesagt, dass bereits Fotos von der Leiche in den sozialen Medien herumschwirren«, teilte Stern dem Gerichtsmediziner auch diese Information mit und ignorierte dessen Andeutung auf den lächerlichen Wettstreit zwischen zwei erwachsenen Männern.
»Wie konnte das denn passieren? Haben die Kollegen nicht aufgepasst, dass niemand Fotos macht?« Webers Grinsen wich einem empörten Ausdruck.
»Wir können es uns anschauen, hat er gemeint, auf Facebook …«
»Na, dann lass mal sehen«, forderte Weber den Chefinspektor auf und stellte sich neben ihn.
»Äh … ich hab keine Ahnung, wie das geht.« Stern wedelte mit dem Handy herum, um zu verdeutlichen, was er meinte.
Weber zog sein eigenes Smartphone aus der Tasche, wischte darauf herum und tippte etwas ein. »Es gibt für ältere Leute Kurse, in denen man den Umgang mit sozialen Netzwerken lernen kann«, sagte er wie nebenbei.
»Ältere Leute«, äffte Stern ihn nach. Er fühlte sich noch lange nicht so alt, dass er einen Kurs belegen müsste, um ein paar Tasten zu betätigen. Das würde er schon irgendwann lernen. Notfalls konnte er seinen Enkel Tobias bitten, ihm das zu zeigen. Der Zehnjährige wischte und tippte auf diesen Gerätschaften herum, was das Zeug hielt. Aber auch Erwachsene hatte dieses Virus mitunter ereilt. Manche schrieben sich lieber Nachrichten, anstatt miteinander zu reden. Die soziale Kompetenz schien jedoch mit Zunehmen der sozialen Netzwerke und dem Gebrauch von WhatsApp und Co drastisch abzunehmen. Dennoch musste Stern zugeben, dass ihm hin und wieder ein bisschen mehr Kenntnis die moderne Technik betreffend nicht schaden würde.
»Ich finde nichts«, sagte Weber.
»Gib ›Mühlviertler Kreuz‹ oder ›Kreuz und Engel in Reichenstein‹ ein«, erwiderte Stern stolz, dass er in dieser Sache doch nicht unnütz war. Dass er diese Information von Bormann hatte, verschwieg er.
»Wow!«, stieß Weber aus, als er sah, was die neue Suchabfrage für ein Ergebnis lieferte.
3. KAPITEL
Die Burgruine Reichenstein thronte im Waldaisttal auf einem Felsen, der die daneben fließende Feldaist zwang, einen Bogen zu machen. Chefinspektor Oskar Stern stand neben der Straße, die unterhalb der Burg vorbeiführte, und starrte nach oben. Hier musste ebenso die Person gestanden haben, die das Foto von der Toten gemacht hatte, das sich im Internet mit dem Hashtag »Mühlviertler Kreuz« verbreitete. Die Tote hatte die Arme seitwärts weit von sich gestreckt wie ein Priester bei der Predigt, was die Assoziation mit einem Kreuz erweckte. Und sie trug ein Brautkleid, dessen Rock weit auseinanderfiel, was sie engelsgleich wirken ließ. Sie hing in den Ästen der Bäume, die am Fuße der Ruine neben der Straße wuchsen, als würde sie schweben. Als wäre sie von den Toten bereits auferstanden. Stern fuhr bei ihrem Anblick ein Schaudern durch die Gliedmaßen. Er konnte seine Augen nicht von ihr lösen. Ihre Erscheinung war faszinierend und verstörend zugleich, ein menschliches Kreuz im Engelsgewand.
Man hatte sie nicht sofort entdeckt, hatte man Stern mitgeteilt, die Blätter hatten das verhindert, ebenso der Umstand, dass sie über dem normalen Sichtfeld im Geäst feststeckte.
Sterns Blick wanderte weiter hinauf bis zum Rand der Ruine. Von dort musste die Tote gefallen sein, denn fliegen konnte sie zweifelsohne nicht, auch wenn sich der Vergleich mit einem Engel nicht nur durch ihr Äußeres, sondern desgleichen durch ihre Auffindungsposition aufdrängte.
»Wissen wir, wie sie heißt?«, fragte er Gruppeninspektorin Mara Grünbrecht, die neben ihm gewartet hatte, bis er mit der Begutachtung der Leiche und deren Erscheinung fertig war. Das schätzte Stern an ihr. Sie wusste immer, was er wollte, manchmal sogar bevor er selbst Kenntnis davon hatte.
»Marion Balduin«, antwortete Grünbrecht. Ihre braunen schulterlangen Locken trug sie zu einem Pferdeschwanz gebunden, und ihre haselnussbraunen Augen blickten wie die von Stern hinauf in die Baumkrone.
»Balduin, den Namen kenne ich doch irgendwoher …«, grübelte Stern nach.
»Von den Balduin Gewürzen. Gustav Balduin ist der österreichische Gewürzkönig und kauft alle Kräuter und Gewächse auf, egal ob sie oben am Berg oder unten im Tal wachsen, und macht daraus seine berühmten Gewürzmischungen. Soviel ich weiß, exportiert er sie in die ganze Welt. Das Mühlviertler Lavendelsalz ist nicht nur bei uns sehr beliebt«, erzählte ihm Grünbrecht, was sie wusste und was bei ihr daheim offenbar im Küchenregal stand.
»Ist sie mit ihm verwandt?«
»Sie war seine Tochter.«
»Und wie es aussieht, ist sie am Tag ihrer Hochzeit gestorben.« Stern hielt nach wie vor den Blick auf die Leiche gerichtet. Es war seltsam, und er konnte nicht sagen, warum, aber ihr Anblick berührte ihn auf eine Weise, die er nicht beschreiben konnte.
»Ja, sie hat gestern geheiratet. Die Hochzeit fand hier auf der Burgruine statt«, erläuterte Grünbrecht und deutete hinauf zu den alten Gemäuern.
»Warum heißt sie dann noch immer Balduin?«
»Mensch, Chef, das ist doch ein alter Hut! Seit 1995 ist es sogar bei uns in Österreich möglich, dass die Frau nach der Heirat ihren Nachnamen behalten kann und nicht den des Mannes annehmen muss«, echauffierte sich Grünbrecht über Sterns Unwissenheit.
Stern erwiderte nichts. Natürlich wusste er über die Gesetzeslage Bescheid, dennoch war es bis heute die häufigste Form, dass die Frau den Familiennamen des Mannes übernahm.
»Sind die Gäste etwa noch da?«, fragte er.
»Nein, aber ich habe mit dem Caterer gesprochen, der seine Sachen abholen wollte. Ich hab ihm gesagt, dass das nicht geht und er warten muss, bis wir den Tatort freigeben.«
Stern nickte und sah ein letztes Mal hinauf zur Leiche in dem Brautkleid. Kein schöner Tod, auf diese Weise abzutreten. In die Tiefe zu stürzen auf der eigenen Hochzeit.
Oder war sie gar freiwillig gesprungen? Was war vorgefallen, dass sie diesen Tod möglicherweise selbst gewählt hatte?
Das galt es nun herausfinden.
Er wandte sich ab und gab den Kollegen ein Zeichen, dass sie die Tote vom Baum holen konnten.
»Du, sag mal, hätte sie den Sturz nicht eigentlich überleben müssen, wenn sie in den Ästen landet?«, fragte Stern Dominik Weber, der darauf wartete, die Tote einer ersten Beschau unterziehen zu können. In seinem Wagen führte der Gerichtsmediziner immer einen Koffer mit, in dem sich die wichtigsten Utensilien für die Untersuchung einer Leiche befanden. Deshalb war er stets einsatzbereit, und die Chancen, vor Stern einen Tatort zu erreichen, stiegen dem geschuldet ebenso.
»Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass man so einen Sturz überlebt«, schätzte der Gerichtsmediziner. »Wenn du mit dem Kopf aber auf einen massiven Ast prallst, brichst du dir genauso das Genick, wie wenn du auf der Erde landest. Andererseits hab ich schon von Fällen gelesen, da haben Menschen Abstürze aus über 100 Meter überlebt, und andere sterben, wenn sie bloß von einer zweistufigen Leiter runterfallen. Bei einem Sturz spielen so viele Faktoren eine Rolle, ob man ihn überlebt oder nicht, nicht nur die Fallhöhe ist ausschlaggebend. Sobald ich mir die Tote genauer angeschaut habe, sage ich dir, was in diesem Fall Sache ist.«
Weber folgte den Kollegen, die die Bergung des Opfers mit einer Drehleiter samt Korb von der hiesigen Feuerwehr vorbereiteten. Damit ließen sich der Gerichtsmediziner und ein Polizeifotograf Minuten später bis zu jener Stelle in den Bäumen hochheben, wo die Leiche festhing. Der Fotograf machte Fotos, wo und wie das Opfer zum Liegen gekommen beziehungsweise der Fall gebremst worden war, und Weber diktierte alle Informationen in ein Aufnahmegerät, die für die Bestimmung der Todesursache später hilfreich sein könnten.
Inzwischen erklommen Oskar Stern und Mara Grünbrecht über einen schmalen Trampelpfad, der beidseitig von kleinen kunsthandwerklichen Gegenständen gesäumt wurde, den Hügel hinauf zur Burg. Diese war vor dem 13. Jahrhundert errichtet worden und wurde seit dem Jahr 1750 nicht mehr herrschaftlich bewohnt, was ursächlich für ihren Verfall war.
Oben vor dem Eingang warteten die Gruppeninspektoren Edwin Mirscher und Hermann Kolanski auf sie. Sie hatten sich währenddessen die Burgruine angesehen und mit den Personen gesprochen, die die Überreste des vortägigen Festes aufräumen wollten.
»Grüß dich, Oskar. Jetzt wird wohl nichts aus eurer Wanderung durchs schöne Mühlviertel.« Mirscher empfing seinen Chef mit einem breiten Grinsen. Er wusste, dass Stern nicht freiwillig mit Weber den Johannesweg hatte gehen wollen.
»Ja, leider«, antwortete Stern mit demselben Lächeln.
»Das lässt sich bestimmt nachholen«, meinte Kolanski. Er trug wie immer Sonnenbrille und Lederjacke und könnte ruhig mal wieder zum Friseur gehen. Seine Haare waren für einen Ermittler der Mordgruppe am Landeskriminalamt Oberösterreich viel zu lang, fand Stern, verkniff sich aber einen Hinweis darauf. Immerhin war er nicht Kolanskis Vater, sondern sein Vorgesetzter, obwohl sich das mit dem Vatersein auch ausginge, wenn er schon ganz früh ein Kind gezeugt hätte.
»Sag das ja nicht Weber!«, drohte er ihm dennoch. »Für mich ist die Sache vorbei – aus! Finito!«
Kolanski lachte und folgte wie die anderen Kollegen seinem Chef hinauf zur Burgruine. Sie durchquerten den Eingangsbereich des Burgmuseums, wo sie an Wissenswertem rund um Reichenstein aus mehreren 100 Jahren vorbeigingen, ohne es eines Blickes zu würdigen. Ihre Aufmerksamkeit galt dem Todesfall, der sich letzte Nacht zugetragen hatte, und nicht den Toten des Mittelalters. Aber ob es tatsächlich Mord war, würde sich erst noch herausstellen.
Als sie die erste Stiege hinter sich gebracht hatten, traten sie in den Burghof, wo die Bühne und die Equipments der Band und des Caterers aufgebaut waren. Hier hatte das rauschende Hochzeitsfest also stattgefunden, dachte Stern und verschaffte sich einen Überblick. Die Stühle und Tische hatte man bereits gestapelt, da zu jener Zeit noch niemand vom Tod der Braut gewusst hatte. Nun waren die Aufräumarbeiten jedoch eingestellt und die Burg menschenleer, damit keine Spuren mehr vernichtet wurden.