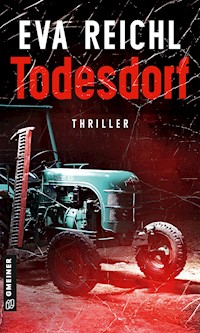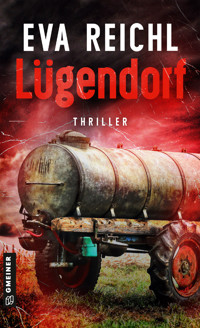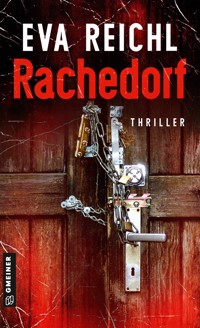Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Chefinspektor Oskar Stern
- Sprache: Deutsch
Ein Toter auf den Bahngleisen zwischen Freistadt und Summerau gibt Oskar Stern und Mara Grünbrecht vom LKA Linz Rätsel auf. Der Mann war offenbar an die Schienen gefesselt worden, der heranrasende Zug erledigte den Rest. Doch was hat das Opfer getan, dass es einen derart grausamen und theatralisch inszenierten Tod verdiente? Als seine Identität geklärt ist, haben Chefinspektor Stern und sein Team bald mehr Verdächtige, als ihnen lieb ist: Denn der Tote war Scheidungsanwalt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Eva Reichl
Mühlviertler Rache
KRIMINALROMAN
Zum Buch
Kopflos Eine kopflose Leiche wird auf den Bahngleisen der Summerauer Strecke von Linz nach Prag gefunden. Das Opfer war an Armen und Beinen an die Schienen gefesselt worden, der heranrasende Zug erledigte den Rest. Doch was hat der Tote getan, dass er so grausam sterben musste? Die Ermittler, Oskar Stern und Mara Grünbrecht vom LKA Linz, stehen vor einem Rätsel. Wenig später wird eine Reinigungskraft im Keller einer Freistädter Schule ermordet. Eine Verbindung zwischen den Fällen ist jedoch nicht zu erkennen. Chefinspektor Oskar Stern rast von einem Tatort zum nächsten, nein eigentlich schleicht er, denn sein Fahrstil entspricht dem eines Rentners mit Hut nach dem Sonntagskaffee. Damit treibt er nicht nur sein Team zur Weißglut, sondern auch seine Enkel. Denn ausgerechnet an diesem Wochenende hat er seiner Tochter versprochen, auf deren Kinder Melanie und Tobias aufzupassen. Immerhin ist inzwischen die Identität des ersten Opfers geklärt: Der kopflose Tote war ein Freistädter Scheidungsanwalt.
Eva Reichl wurde in Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich geboren und zog wenige Jahre später mit ihrer Familie ins Mühlviertel, wo sie bis heute lebt. Neben ihrer Beschäftigung als Controllerin schreibt sie überwiegend Kriminalromane und Kindergeschichten. Mit ihrer Mühlviertler Krimiserie verwandelt sie ihre Heimat, das wunderschöne Mühlviertel, in einen Tatort getreu dem Motto: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Böse liegt so nah?
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Katja Ernst
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Ernest / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-6162-0
1. Kapitel
Oskar Stern saß auf einer Parkbank im Linzer Volksgarten. Zu dieser frühen Vormittagsstunde an einem Samstag im August flanierten nur wenige Menschen die breiten Wege der Parkanlage entlang. In den letzten Wochen hatte es geregnet, und auch heute ließ sich die Sonne kaum blicken. Für August war es eindeutig zu kalt. Stern bemerkte nicht, wie sich Tobias, sein neunjähriger Enkel, die Kletterwand auf dem Spielplatz hinaufzog und über die oberste Kante kraxelte. Sein Blick war auf die Bank ihm gegenüber geheftet. Dort lümmelte ein Junge neben seiner Mutter und bohrte in der Nase, dass Stern Angst bekam, der Finger des Jungen käme bei dessen Augen wieder heraus. Stern hatte schon allerlei in seinem Leben gesehen, trotzdem ekelte es ihn vor der gefühlt meterlangen grünlichen Liane, die kurz darauf aus der kindlichen Nase gezogen wurde.
Ob er seinen Dienstausweis zücken, dem Jungen vors Gesicht halten und dann sagen sollte, dass Nasebohren und den Popel anschließend in den Mund stecken strafbar war? Der Junge würde zwar einen Schock fürs Leben bekommen, aber mit Sicherheit nie mehr in seinem Riechorgan herumgraben wie ein Totengräber, der ein Grab für die nächste Leiche ausräumte.
»Opa, wie lange willst du uns denn noch hier gefangen halten?«, raunte Melanie, Sterns zwölfjährige Enkelin, ihrem Großvater von der Seite ins Ohr. Sie saß neben ihm auf der Bank und starrte gelangweilt Löcher in die Luft. Stern hatte ihr und Tobias verboten, solange sie in dem Park verweilten, mit einem elektronischen Gerät zu spielen, damit zu telefonieren oder im Internet zu surfen. Stattdessen sollten sie auf dem Spielplatz herumtollen, sich die Knie blutig schlagen und Freundschaften schließen. Echte Freundschaften mit Kindern, die man auch anfassen konnte und die nicht durch ein Profilbild von WhatsApp, Instagram oder Facebook, welches einen oftmals erschaudern und in Stern sofort die kriminalistischen Warnglocken schellen ließ, auf sich aufmerksam machten und Nachrichten wie »asap«, »thx«, »hdl« oder »wmg« über den Kanal schickten. Stern wusste bis heute nicht, was diese Hieroglyphen bedeuteten, und wollte es, ehrlich gesagt, auch gar nicht wissen.
»Ich halte euch nicht gefangen«, knurrte er, ohne den popelziehenden Jungen aus den Augen zu lassen. »Ihr braucht hin und wieder mal frische Luft und echte Menschen um euch, das ist alles.« Im selben Augenblick zweifelte er, ob die Gesellschaft auf diesem Spielplatz wirklich die richtige für seine Enkelkinder war, immer noch den Jungen beobachtend, der jetzt Experimente mit dem Nasenrotz in seinem Mund zu machen schien.
»Hallo! Wir sind mitten in Linz!« Melanie beugte sich nach vorn und winkte mit beiden Händen vor dem Gesicht des Großvaters, um ihn auf diesen nicht zu vernachlässigenden Umstand aufmerksam zu machen. Der Volksgarten, in dem sie sich befanden, war umringt von stark befahrenen Straßen, mehreren Hochhäusern wie dem Power Tower und dem Terminal Tower, in dem die Linzer Finanz- und Zollämter untergebracht waren, dem Musiktheater und der Straßenbahn, die irgendwo dazwischen in der Erde verschwand. Inmitten von riesigen Parkbäumen war ein kleines Areal, auf dem Turngeräte für Kinder aufgestellt waren. Dort saßen sie und atmeten die Linzer Stadtluft, die von ein paar verzweifelten Parkbäumen im Kampf gegen die Auspuffgase Tausender Kraftfahrzeuge erzeugt wurde. Und dort wurden sie, laut Melanie, von ihrem Großvater gegen ihren Willen festgehalten.
»Trotzdem gibt es hier Luft«, beharrte Stern.
»Luft gibt es auch zu Hause in meinem Zimmer. Und wenn ich das Fenster aufmache, atme ich genau dieselbe Luft wie hier.« Melanie verschränkte die Arme vor der Brust. Für ihr Alter war sie weit entwickelt, dachte Stern, und genauso zickig wie manch 16-Jährige. Ihre langen blonden Haare trug sie heute mit einem Seitenscheitel, was mit sich brachte, dass sie stets den Kopf zur Seite neigte. Als Stern nichts erwiderte, legte sie nach: »Außerdem ist noch keiner gestorben, weil er sich nicht in einen Park gehockt und Babys dabei zugesehen hat, wie sie auf solch einem Dingsda herumklettern. Wenn du mir wenigstens mein Handy …«
»Nein!« Stern stand auf, zog seine Hose hoch und atmete tief durch. Er wusste, dass das, was er vorhatte, falsch war, doch er konnte nicht anders.
»Aber …«
Stern hob die Hand und Melanie verstummte augenblicklich. Ihr war klar, dass es besser war, den Mund zu halten, wenn ihr Großvater diese Miene aufsetzte. Er plante etwas, das spürte sie. Es war das erste Mal an diesem Samstagvormittag, dass es für die Zwölfjährige spannend wurde.
Stern ging auf die gegenüberliegende Parkbank zu. Auf halbem Weg griff er in die Brusttasche und zog seinen Dienstausweis hervor, der ihn als Chefinspektor der Mordgruppe des Landeskriminalamtes Oberösterreich auswies. Er steuerte geradewegs den Jungen an, dem ein Rest des Rotzes noch aus der Nase baumelte. Er holte tief Luft und wollte gerade etwas sagen, als sein Handy klingelte. Überrascht blieb er stehen, fischte das lärmende Gerät aus der Seitentasche seines Jacketts und blickte auf das Display. Bormann, der Leiter des LKA. Stern seufzte. Wenn der anrief, bedeutete das nichts Gutes. Er wischte über das Display, hielt sich das Smartphone ans Ohr, drehte sich zur Seite und sah aus den Augenwinkeln, dass Melanie ihn von der Parkbank aus giftig anglotzte. »Absolutes Handyverbot«, hatte er vorhin verkündet und sich selbst dabei eingeschlossen. Nun war ausgerechnet er es, der dieses Verbot missachtete. Das ließ ihn vor der Zwölfjährigen nicht besonders gut dastehen.
»Stern«, meldete er sich zwischen nasepopelnder und pubertierender Parkbank stehend.
»Bormann hier! Stern, wo sind Sie? Wir haben einen Toten! Auf der ÖBB-Bahnstrecke zwischen Freistadt und Summerau. Sie müssen sofort hinfahren«, drang es an Sterns Ohr.
»Es wird eine Weile dauern. Ich hab heute die Kinder meiner Tochter …«
»Sofort, Stern! Die ÖBB sitzt mir im Nacken! Die wollen die Strecke so schnell wie möglich wieder freigeben. Sie wissen ja, der Chef der ÖBB geht mit dem Landeshauptmann golfen.«
»Die Strecke wird erst freigegeben, wenn ich das sage. Teilen Sie den Leuten von der ÖBB mit, dass ich unterwegs bin, aber wie gesagt, es wird eine Weile dauern.« Stern beendete das Gespräch, steckte Handy und Dienstausweis ein und machte kehrt. »Tobias!« Mit einer Geste deutete er seinem Enkel, er möge zu ihnen auf die Parkbank kommen. Auf die pubertierende.
Tobias sprang von dem Klettergerüst und rannte auf seinen Großvater zu. Der saß mittlerweile wieder neben Melanie auf der Bank. Die neue Situation stellte ihn vor eine echte Herausforderung. Er hatte die Kinder seiner Tochter Barbara bis morgen Abend unter seiner Obhut, da diese zu ihrer Mutter nach Graz gefahren war. Seine Ex sei krank, hatte Barbara ihm mitgeteilt und auch, dass sie nach ihr sehen und ihr zwei Tage lang unter die Arme greifen wolle. Ohne Kinder natürlich. Die würden sich bei der kranken Großmutter lediglich anstecken und sich außerdem in der kleinen Zweizimmerwohnung langweilen. Stern zweifelte daran, dass seine Exfrau Franziska tatsächlich krank war. Zumindest körperlich. Erst vor Kurzem war ihre Beziehung zu jenem Mann in die Brüche gegangen, für den sie Stern vor Jahren verlassen hatte, was Stern nicht ohne eine gewisse Genugtuung registriert hatte. Denn damals hatte sie einfach alles stehen und liegen lassen und war mit ihrem neuen, viel jüngeren Lover nach Graz abgehauen. Auch wenn das bereits mehrere Jahre zurücklag und man meinen könnte, dass Stern über diesen Affront längst hinweg sei, hatte das Bekanntwerden der Trennung seiner Ex ein gewisses Glücksgefühl in ihm ausgelöst. Er würde das zwar niemals zugeben, aber ein paar Tage lang hatte er sich gefühlt, als schwebte er auf Wolken. Dass dieses Gefühl Schadenfreude gewesen war, hatte er sich natürlich nicht eingestanden.
»Was ist denn, Opa?«, fragte Tobias keuchend, als er sich völlig aus der Puste auf die Parkbank fallen ließ. Seine kurzen braunen Locken klebten ihm auf der Stirn und im Nacken und seine Rehaugen hefteten sich neugierig auf den Großvater.
»Ich muss kurz mal überlegen«, sagte Stern, und seine grauen Gehirnzellen liefen in der Tat zur Höchstform auf. Er wusste, dass seine Tochter Barbara es nicht mochte, wenn er den Kindern von seinen Fällen berichtete, die er im Landeskriminalamt als Chef der Mordgruppe bearbeitete. Wie fände sie es dann, wenn er sie zu einem Tatort mitnähme? Sie würde ihm seine geistigen Fähigkeiten absprechen, seinen Verstand infrage stellen und behaupten, sein Verantwortungsbewusstsein habe sich in Luft aufgelöst. Aber wo sollte er die Kinder so schnell unterbringen? Bis Barbara aus Graz hier wäre, vergingen locker vier Stunden, und Bormann würde ihm den Arsch aufreißen, wenn er nicht bald am Tatort erschien, wegen des Golf spielenden ÖBB-Chefs und dessen Golfpartner, dem Landeshauptmann.
»Was musst du denn überlegen?«, unterbrach Tobias Sterns Grübeleien, rutschte nach vorn auf die Kante der Bank und zog mit den Füßen einen Kreis in den gekiesten Boden.
»Wie er uns ganz schnell loswerden kann«, warf Melanie bissig ein.
»Melanie!« Stern war über die Ansicht seiner Enkelin empört.
»Stimmt doch, oder etwa nicht?« Auf Melanies Gesicht zeigte sich ein Grinsen, während ihre Augen feindselig funkelten. Es war das erste Mal, dass sie lächelte, seit sie in seiner Obhut war, auch wenn das Leid des Großvaters der Grund für ihre Heiterkeit zu sein schien, weil er nicht wusste, wohin so schnell mit den Kindern.
»Könnt ihr für ein paar Stunden zu Freunden?«, wagte Stern einen Vorstoß.
»Mama hat gesagt, dass wir auf gar keinen Fall mitspielen sollen, wenn du versuchst, uns abzuschieben«, erzählte Tobias bereitwillig, während er dem Kreis auf dem Boden ein Paar Augen, eine Nase und einen Mund verpasste.
Stern seufzte. So war das also. Die Meute hielt zusammen. Das war gut, auch wenn es ihm das Leben erschwerte.
»Also, ich könnte zu Martin fahren. Mit der Straßenbahn. Brauchst mich nicht zu bringen«, sagte Melanie wie beiläufig und versuchte, Sterns Blick auszuweichen.
Der Chefinspektor setzte sich aufrecht hin und sah seiner Enkelin ins Gesicht. »Sicher nicht, junge Dame! Dafür bist du eindeutig nicht alt genug!«
»Ich bin zwölf!«, begehrte Melanie auf.
»Ich weiß, und das ist zu jung für … so etwas!« Stern fuchtelte mit den Armen in der Luft herum, um zu verdeutlichen, was er meinte.
»So etwas nennt man Liebe«, giftete Melanie ihn an. »Aber davon hast du ja keine Ahnung. Oma hat dich schließlich verlassen. Wer weiß schon genau, warum …« Als sie den Blick des Großvaters sah, verstummte sie.
»Ihr kommt mit!«, fällte Stern eine bedeutungsvolle Entscheidung. Tobias würde sich wegen des Auftrags seiner Mutter ohnehin weigern, zu einem Freund zu gehen, und Melanie würde nur Blödsinn anstellen, für den Stern nicht die Verantwortung übernehmen wollte. Barbara brächte ihn zwar um, wenn sie erfahren würde, dass er die Kinder mit an einen Tatort genommen hatte, aber das musste er halt verhindern. Er stand auf und stellte sich breitbeinig vor seine Enkelkinder. »Wenn ihr eurer Mutter nicht verratet, wohin wir gleich fahren, dann bekommt ihr eure Handys zurück und dürft tun, was immer ihr sonst auch damit anstellt. Ist das ein Deal?«
»Das ist ein Deal!«, rief Tobias. Er sprang auf und hielt seinem Großvater die gestreckte Hand hin. »Gib mir fünf!«
Stern lächelte und schlug ein. Sein Enkel war schnell zu begeistern, vor allem für Sachen, die etwas mit der Arbeit seines Großvaters zu tun hatten. Stern wollte jedoch verhindern, dass seine Enkelkinder zu viel von dem Fall mitbekamen. Wie er das allerdings anstellen sollte, musste er erst noch überlegen, und zwar auf der Fahrt, die von Linz nach Freistadt mit zwei Kindern auf der Rücksitzbank, denen er durch den Deal buchstäblich ausgeliefert war, ohnehin lange genug dauern würde. Er wartete noch auf Melanies Reaktion. Die Zwölfjährige saß auf der Parkbank und blitzte ihren Großvater aus schmalen Schlitzen an. Er wusste, dass sie gerade ihre Fangnetze auslegte und hoffte, er würde sich darin verheddern. Trotzdem hatte er keine Wahl.
»Dann hab ich etwas gut bei dir«, sagte Melanie, ohne dieses Mal den Blick von ihm abzuwenden. Stern war über ihr Selbstbewusstsein überrascht und auch ein wenig stolz. Schließlich war sie seine Enkeltochter. Er nickte zustimmend, da sie es eilig hatten.
Melanie stand von der Parkbank auf und wollte sich an ihrem Großvater vorbeidrücken, aber der hielt sie am Arm zurück.
»Deal?«, fragte er und streckte ihr die Hand entgegen.
Melanie sah sich um, ob sie beobachtet wurden. Als sie niemanden entdeckte, den sie kannte, und auch niemanden, bei dem es wichtig war, dass sie cool wirkte, klatschte sie in die Hand des Großvaters ein.
»Deal!«
*
Nach einem anfänglichen Streit, welche Musik Sterns Audi A6 während der Fahrt ins Mühlviertel zum Beben bringen sollte, worüber der Chefinspektor sich mit seinen Enkelkindern nicht einig geworden war, blieb das Radio aus. Mit jedem gefahrenen Kilometer wurde Stern unruhiger. Es wollte ihm keine Lösung einfallen, was er mit den Kindern tun sollte, solange er den Tatort begutachtete. Und das Gezanke auf der Rücksitzbank, wer denn nun Schuld an der Musiklosigkeit trug, war auch nicht besonders hilfreich, um einen klaren Gedanken zu fassen zu können.
Sollte er Tobias und Melanie im Auto warten lassen?
Die Sonne blitzte durch die Wolken hindurch, es hatte angenehme 22 Grad Celsius. Wenn die Sonne jedoch länger auf das Autodach schien, würde es im Innenraum bald unerträglich heiß werden. Er sah schon die Headline in den OÖ. News vor seinem geistigen Auge: »Großvater lässt Enkelkinder im Wagen verrecken!« Wenn er Glück hatte, würde nur »Chefinspektor vom Landeskriminalamt OÖ lässt Enkelkinder unbeaufsichtigt im überhitzten Wagen zurück« in der Zeitung stehen. Aber das würde ihn nicht vor seiner Tochter schützen. Sie würde ausrasten, wenn sie davon erfuhr. Diese Möglichkeit kam also nicht infrage. Er musste nach einer anderen Lösung suchen, wie die Kinder nichts von dem Mordfall mitbekamen.
Dann stellte sich Stern die Frage, wieso er überhaupt zu einem Todesfall auf Bahngleisen gerufen wurde? Meistens waren solche Opfer doch Selbstmörder. Was war an diesem Fall anders? Er hatte vergessen, Bormann danach zu fragen, und jetzt wusste er nicht, worauf er sich einstellen musste. Stern fluchte und blickte schuldbewusst in den Rückspiegel, doch keines der Kinder auf der Rücksitzbank hatte seinen wüsten Ausruf gehört. Nachdem ihr Streit über das Radio verklungen war, hatten beide ihre Kopfhörer eingestöpselt und wischten seither konzentriert auf dem Display je eines Smartphones herum.
Vielleicht war ja eine Polizeibeamtin vor Ort, die er bitten konnte, ein Auge auf die beiden zu werfen, bis er mit der Untersuchung des Tatortes fertig war. Er wusste, dass die Nutzung von Staatsressourcen für private Zwecke nicht erlaubt war, aber eine andere Lösung sah er nicht.
»Sind wir bald da?«, fragte Tobias, dem die Fahrt schon zu lange dauerte. Stern war nicht gerade als Raser bekannt. Die Kollegen am Landeskriminalamt witzelten über ihn, dass eine Schnecke beim Mittagsschlaf schneller sei als er mit seinem Audi A6.
»Ja, wir sind bald da.« Stern erhöhte die Geschwindigkeit um zwei Kilometer je Stunde.
»Ich muss aufs Klo«, drang es von der Rücksitzbank.
»Ein wenig dauert es noch«, antwortete Stern und überlegte, wo er auf die Schnelle auf der S10 eine Pinkelmöglichkeit für seinen Enkel finden sollte. Er hoffte, dass es nichts Dringlicheres war, denn ein paar Büsche waren hier im Mühlviertel schneller aufgetan als eine Toilettenanlage samt Klopapier.
»Du weißt ja, wie Opa Auto fährt«, meldete sich Melanie zu Wort, was Stern erstaunte. Das Getöse aus ihren Kopfhörern war sogar bis zu ihm nach vorn gedrungen. Wie hatte sie da das Gespräch zwischen ihm und Tobias mitbekommen können? Die Zwölfjährige beherrschte doch nicht etwa die Kunst des Lippenlesens?
»Ich muss aber ganz dringend!« Tobias rutschte unruhig auf seiner Sitzerhöhung hin und her.
»Ich fahr bei der nächsten Gelegenheit rechts ran.« Stern hielt nach einem Rastplatz Ausschau.
»Und ich hab Durst«, sagte Melanie, ohne den Blick vom Display ihres Handys zu nehmen.
»Und ich hab weder eine Toilette noch etwas zu trinken«, gab Stern genervt zurück, was ihm sofort leidtat. Seine Enkelkinder konnten nichts dafür, dass er von seinem Vorgesetzten zu einem Tatort bestellt worden war und ihn ihre Bedürfnisse wertvolle Zeit kosteten. Was hatte Bormann gesagt? Dass die ÖBB die Strecke so schnell wie möglich freigeben wolle. Also musste er sich ranhalten! Schließlich gab es da dieses gemeinsame Freizeitvergnügen zwischen dem ÖBB-Chef und dem Landeshauptmann, der öfter mit Bormann zu telefonieren schien, als Stern das je mit seiner Exfrau getan hatte. Im Rückspiegel sah er, wie Tobias das Gesicht zu einer Grimasse verzog. Gleich würde er zu weinen beginnen. Schweren Herzens lenkte Stern den Audi auf den Pannenstreifen, schaltete die Warnblinkanlage ein und hoffte, dass niemand von den Vorbeifahrenden ihn erkannte. Dann half er Tobias in eine Warnweste zu schlüpfen und sah ihm zu, wie er unsicher über die Leitplanke kletterte. Dahinter blieb der Junge ratlos stehen.
»Was ist? Soll ich etwa mitkommen?«, fragte Stern gereizt und warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Seit Bormanns Anruf war gut eine Stunde vergangen. Die Kollegen würden eine Vermisstenanzeige aufgeben, wenn er nicht bald am Tatort erschien.
»Ich brauche etwas zum Abwischen«, sagte Tobias mit hängenden Schultern.
Stern seufzte, öffnete die Beifahrertür, ignorierte, so gut es ging, die grinsende Melanie auf dem Rücksitz, die plötzlich kein Interesse mehr an ihrem Handy zeigte, sondern durch das Seitenfenster auf den unglücklichen Tobias glotzte, kramte in der Mittelkonsole nach einer Packung Taschentücher und hielt sie Melanie hin.
»Hilf deinem Bruder«, sagte er.
Die Zwölfjährige lachte hysterisch auf, als hätte sie just in diesem Augenblick jemand in den Hintern gezwickt, wandte sich ab und wischte wieder auf dem Display herum, als ginge sie das Ganze nichts an.
Stern seufzte, zog seinen Oberkörper aus dem Audi, richtete sich zu seiner vollen Größe auf, atmete einmal tief durch und wollte sich gerade Tobias hinter der Leitplanke zuwenden, als er aus den Augenwinkeln sah, wie jemand ihm aus einem blauen Wagen heraus zuwinkte. Dominik Weber, der Gerichtsmediziner!
»Scheiße!« Stern musste zusehen, wie Weber mit 150 Sachen an ihm vorbeiraste. »Schnell! Los, mach jetzt!«, trieb er Tobias an und warf ihm die Packung Taschentücher zu. Tobias bekam sie nicht richtig zu fassen und ließ sie fallen. Umständlich fingerte er in dem hohen Gras herum. Das kostete wertvolle Zeit. Schon wieder! Als er die Packung endlich in Händen hielt, verschwand er damit hinter den Büschen, die gut zehn Meter von der Leitplanke entfernt wucherten. Stern ging vor der Fahrbahnabsperrung wie ein seit Jahren in einem Käfig eingesperrter Tiger auf und ab. Dabei wechselte sein ungeduldiger Blick zwischen den Verkehrsteilnehmern auf der S10 und den Büschen hin und her.
»Wie lange dauert das denn noch?«, rief er nach endlosen Minuten des Wartens.
»Bin gleich fertig!«, kam es leise zurück. Wie weit hatte der Junge sich entfernt, um sein Geschäft zu verrichten?, schoss es Stern durch den Kopf? Er versuchte zu erspähen, ob er durch die Blätter der Büsche etwas Farbiges von Tobias’ Kleidung hindurchblitzen sah. Doch da war nichts.
Nach weiteren zwei Minuten rief er erneut. »Mach schon, Tobias! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.«
»Hier hat jemand seinen ganzen Plunder abgeladen«, kam es aus den Büschen retour.
»Ich bin nicht beim Umweltschutz, Tobias. Ich bin bei der Mordgruppe des Landeskriminalamtes und muss nun endlich zum Tatort«, antwortete Stern gehetzt.
»Ich meine ja nur.« Tobias’ Schopf tauchte zwischen dem Gestrüpp auf und kam endlich näher. Stern fühlte sich bei seinem Anblick erleichtert. Einerseits, weil dem Jungen nichts passiert war – er hätte ja rückwärts eine Böschung hinunterstürzen und sich das Bein brechen können –, andererseits, weil sie nun endlich weiterfahren konnten.
»Für den Müll sind andere zuständig«, erklärte er seinem Enkel in einem ruhigeren Tonfall, während Tobias über die Leitplanke zurück auf den Pannenstreifen kletterte. Dort hielt er seinem Großvater die Packung mit den Taschentüchern hin. Eines war übrig geblieben.
»Behalte es«, sagte Stern und schob den Jungen durch die hintere Autotür hinein auf die Sitzerhöhung. Als der Sicherheitsgurt eingerastet war, eilte er um den Wagen herum und pflanzte seinen eigenen Hintern auf den Fahrersitz, schaltete die Warnblinkanlage aus und gab Gas. Nach wenigen hundert Metern bremste er wieder. Die nächste Ausfahrt musste er nehmen. Der Audi rollte von der Schnellstraße und fuhr nach dem Kreisverkehr auf der Prager Straße Richtung Freistadt. Auf der rechten Seite befand sich ein riesiges Plakat der Mühlviertler Wiesn, welche dieser Tage in Freistadt stattfand. Darauf wurde mit traditionellem Brauchtum, volkstümlicher Musik und hiesigen Schmankerln geworben. Doch der Todesfall dürfte nichts mit dem Volksfest zu tun haben, Bormann hatte schließlich die Schienen erwähnt. Irgendwo entlang der Bahnstrecke zwischen Freistadt und Summerau liege der Tote, hatte er am Telefon gesagt.
Links ließen sie das Landeskrankenhaus der Stadt hinter sich und erreichten endlich die als Kultur- und Braustadt bekannte Mühlviertler Provinzmetropole. Jetzt mussten sie noch den Tatort finden.
In Freistadt bog Stern auf die Leonfeldner Straße ein und erblickte kurz darauf auf der linken Seite den Bahnhof. Hier waren sie richtig. Er folgte der Straße und behielt die dazu parallel verlaufenden Gleise im Auge.
»Gleich verschwinden sie unter der Straße«, machte Tobias wenig später seinen Großvater aufmerksam, dass sie auf eine Brücke zusteuerten. »Vielleicht ist er ja gesprungen, der Tote … Ich meine, als er noch nicht tot gewesen ist.«
»Tobias!«, fuhr Melanie ihren Bruder an, da ihr schon allein bei der Vorstellung, was sie dort vorfänden, wenn ihr Bruder recht hatte, übel wurde.
»Das wissen wir noch nicht«, versuchte Stern, die Kinder zu beruhigen. Er verringerte die Geschwindigkeit. Auf der Brücke hielt er an, schaltete Blaulicht und Warnblinkanlage ein und stieg aus. Über das Geländer warf er einen Blick auf die Bahntrasse hinab.
»Also, gesprungen ist er schon mal nicht«, sagte Tobias, der plötzlich neben ihm auftauchte und auf ein Meer aus blau blinkenden Lichtern, etwa einen halben Kilometer entfernt auf der Bahntrasse, starrte.
»Nein, gewiss nicht. Aber du darfst deiner Mutter auf gar keinen Fall etwas davon erzählen«, verlangte Stern.
»Ist doch klar, Opa. Die macht dich sonst zur Sau.« Tobias grinste.
Und Stern seufzte. »Ab in den Wagen mit dir.«
Er startete den Motor und ließ den Audi von der Brücke rollen. Wenige Meter danach zweigte rechts ein Weg ab. Davor hatte sich allerdings ein Stau gebildet, da das blau blinkende Lichtgewitter am Ende des Weges die Aufmerksamkeit aller Autofahrer auf sich zog. Viele Köpfe wurden aus den Fenstern gereckt, um zu ergründen, was bei den Gleisen vor sich ging. Immer wieder sah Stern Handys, die aus den Autos gehalten wurden, um Fotos vom Geschehen zu machen. Ein schnelles Vorankommen war unmöglich. Ein Polizist versuchte, die Schaulustigen zum Weiterfahren zu bewegen – mit mäßigem Erfolg, wie Stern feststellte. Er drückte auf die Hupe. Dann noch einmal. Das wiederum veranlasste einen SUV-Fahrer zu einer nicht jugendfreien Geste. Im Schritttempo näherte sich Sterns Audi der Abzweigung. Als er sie endlich erreichte, nickte Stern dem Polizisten zu, dem der Schweiß auf der Stirn stand, deutete auf das Blaulicht auf seinem Wagen und drückte seinen Dienstausweis gegen die Seitenscheibe. Der Uniformierte warf einen flüchtigen Blick darauf und gab den Weg zu der Bahntrasse für ihn frei.
»Wow!«, kommentierte Melanie den Tumult nahe dem Wald und machte Fotos mit ihrem Smartphone. Mehrere Polizeiwagen, ein Rettungsauto, der Kleinbus der Spurensicherung, ein Leichenwagen, dazwischen jede Menge Menschen in Uniform und Zivilkleidung. Sie alle waren hier versammelt, um ein Verbrechen aufzuklären. Also war es doch kein Selbstmord, dachte Stern und auch, dass die Sache wohl länger dauern würde.
»Ist ja voll geil!«, rief Tobias, der sich mit seinem Oberkörper zwischen die Vordersitze schob, um besser sehen zu können.
»Dieses Wort sagt man nicht«, ermahnte Stern seinen Enkel. »Außerdem ist jemand gestorben. So etwas ist nie geil. Schreib dir das hinter die Ohren.«
»Das hab ich nicht gemeint, Opa, sondern die vielen Polizeiautos!« Tobias deutete durch die Windschutzscheibe, in der sich das blau blinkende Licht brach und zuckend ins Wageninnere fiel.
»Schon klar«, brummte Stern und parkte den Audi gleich hinter Webers Wagen.
»Was sollen wir jetzt tun?« Melanie hatte aufgehört, Fotos zu knipsen, und drückte ihre Nase am Seitenfenster platt.
»Ihr könnt euch die Beine ein wenig vertreten, dort drüben.« Stern deutete auf den Waldrand gleich neben dem Weg, der weit genug von den Einsatzkräften entfernt zu sein schien und nahe genug, um ein Auge auf die Kinder zu haben. »Ihr geht auf gar keinen Fall da runter!« Sein ausgestreckter Finger wies nun auf die Gleise, wo die Kollegen der Spurensicherung in ihren weißen Overalls geschäftig hantierten. Stern machte unter ihnen Gruppeninspektorin Mara Grünbrecht und Gruppeninspektor Hermann Kolanski aus. Wie zu erwarten, waren sie vor ihm eingetroffen. Vor ihnen kniete Dominik Weber, der Gerichtsmediziner. Der Raser von der S10. »Ihr dürft die ganze Zeit mit euren Handys spielen. Ich werde es eurer Mutter nicht verraten«, sagte Stern, führte den Zeigefinger an seinen Mund und gab vor, diesen mit einem imaginären Schlüssel zu versperren.
»Du meinst, wir verraten dich nicht bei Mama, weil du uns hierher mitgenommen hast«, stellte Tobias richtig. Er hielt seiner Schwester grinsend die Hand hin und die schlug ein.
Stern seufzte. Wie hatte er sich nur in die Gewalt von zwei Kindern begeben können? Auch wenn sie sein eigenes Fleisch und Blut waren, jetzt quetschten sie ihn aus wie eine reife Zitrone. »Ist schon recht. Hauptsache, ihr stellt keinen Unsinn an.« Stern stieg aus dem Wagen und nahm den schmalen Trampelpfad, welcher von den Einsatzkräften bereits ausgetreten worden war, durch das Gestrüpp hinab zu den Bahngleisen. Er warf noch einen Blick zurück zu seinen Enkelkindern, ob sie seinen Anweisungen Folge leisteten, denn wenn nicht, würde er sie von einer Polizistin bewachen lassen müssen, Staatsressourcen hin oder her. Doch Tobias und Melanie winkten ihm brav wie Lämmer zu.
Als Stern die Trasse erreichte, sah er den rötlichen Schimmer auf den Schienen und der Schüttung. Das Opfer musste viel Blut verloren haben, das sich auf dem kurzen Stück der Bahnstrecke verteilt hatte. Irgendwo dort lag der Leichnam.
»Grüß Gott, Chef!«, hieß Mara Grünbrecht ihren Vorgesetzten am Tatort willkommen und strich auf einer Seite ihre schulterlangen dunkelbraunen Locken hinter das Ohr. Kolanski, wie immer mit schwarzer Lederjacke und Sonnenbrille unterwegs, deutete mit der Hand einen Gruß an, sagte aber nichts, da er konzentriert Webers Tun verfolgte. Er hatte die Sonnenbrille auf den Kopf hochgeschoben, um alles genau sehen zu können.
Der Gerichtsmediziner kniete neben den menschlichen Überresten, beugte sich über sie und sagte, ohne aufzublicken: »Auch schon da?«
»Was haben wir?«, fragte Stern, ohne auf Webers Neckerei einzugehen.
»Nicht viel, nur den Torso und einen Teil der Gliedmaßen. Kopf, Hände und Füße fehlen«, antwortete Grünbrecht. Stern folgte ihrem Fingerzeig die Gleise entlang. Eine Blutspur zog sich von jener Stelle, an der die kopflose, an Armen und Beinen an den Schienen mit Seilen festgebundene Leiche lag, mehrere Meter weit den Bahndamm entlang. Dann verlor sich das Blut, wurde weniger. Wahrscheinlich hingen die übrigen Leichenteile irgendwo unten am Zug fest, der hundert Meter weiter vorn zum Stillstand gekommen war. Oder sie lagen in den Büschen, die seitwärts des Bahndammes wucherten.
»So wird es schwer, das Opfer zu identifizieren. Und einen Aufruf mit Foto können wir vergessen.« Weber blickte auf und überprüfte, ob alle mitbekommen hatten, was er mit dem Foto hatte ausdrücken wollen, gluckste und redete weiter. »Wir haben keine Fingerabdrücke. Das Opfer hatte ebenso keinen Ausweis eingesteckt. Wenn wir Glück haben, ist seine DNA in unserer Datenbank. Sonst sehe ich schwarz für unseren Kopflosen.«
»Vielleicht hat er ein anderes Merkmal, aufgrund dessen wir ihn identifizieren können«, warf Grünbrecht ein. »Ein auffälliges Muttermal zum Beispiel. Eine Tätowierung oder eine charakteristische Narbe.«
»Das wissen wir erst, wenn ich ihn auf dem Tisch hab. Hier ziehe ich ihn gewiss nicht aus. Sonst glaubt der Stern noch, in meinem Kopf ist ein IC entgleist.« Weber lachte abermals. Dann untersuchte er den Torso auf augenscheinliche andere Wunden, die nicht vom Überrollen des Zuges stammen konnten.
»Wo sind die Passagiere?«, fragte Stern knapp. Neben Webers schrägem Humor würde ihm noch fehlen, dass eine Horde hysterischer Zuggäste über den Tatort herfiel und alle Spuren niedertrampelte.
»Die ÖBB hat sie mit einem Bus abgeholt. Waren eh nicht mehr viele«, erklärte Grünbrecht ihm.
Stern begutachtete die Leiche genauer. Aufgrund des vielen Blutes wusste er auch ohne Webers Analyse, dass das Opfer durch das Überrollen des Zuges ums Leben gekommen war und nicht vorher das Zeitliche gesegnet hatte. Der Täter hatte es demnach psychisch leiden lassen wollen, es wahrscheinlich bis zum Schluss in dem Glauben gelassen, dass es möglicherweise eine Chance gab, nicht an diesem Ort zu sterben. Ob der Täter dabei zugesehen hatte, wie der Zug den Mann schlussendlich in Stücke gerissen hatte, konnte Stern nicht sagen. Die Wahrscheinlichkeit war aber hoch. Jemand, der sein Opfer so leiden ließ, wollte sehen, wie es starb.
»Was kannst du mir bisher sagen, Weber?«, wandte sich Stern an den Gerichtsmediziner.
»Dass ich vor dir am Tatort gewesen bin«, grunzte der.
»Ich meine etwas, das von Bedeutung ist«, antwortete Stern gespielt gelassen, obwohl es ihn natürlich ärgerte, dass Weber vor ihm eingetroffen war.
»Die Leiche ist männlich, wahrscheinlich so zwischen 30 und 50 Jahre alt. Der Tod ist, unmittelbar nachdem ihn der Zug überfahren hat, eingetreten. Kopf, Hände und Füße wurden abgetrennt und fehlen. Es ist unwahrscheinlich, dass sie von Tieren gefressen oder davongetragen wurden, dafür hat die Zeit nicht gereicht. Außerdem gibt es im Mühlviertel keine so großen Raubtiere.«
»Doch, mittlerweile schon«, warf Grünbrecht ein.
»Ein Rudel Wölfe streift durch die Mühlviertler Wälder oben in Liebenau«, wusste auch Weber. »Aber bis hierher sind sie noch nie gekommen. Es ist viel wahrscheinlicher, dass die Gliedmaßen irgendwo in der Nähe herumliegen. Durch die Wucht der Durchtrennung könnten sie durch die Luft geschleudert worden und im Gebüsch gelandet sein. Kein schöner Tod, wenn ihr mich fragt, auch wenn er sofort eingetreten ist«, beendetet Weber seine Kurzanalyse.
»Ja, grauenvoll, wenn man darauf wartet, dass ein Zug kommt und einen erledigt«, resümierte Stern und blickte die Gleise entlang, die nach hundert Metern in einer Kurve zwischen Sträuchern und Bäumen verschwanden. In der anderen Richtung sah er ein gutes Stück entfernt die Brücke, von der er und Tobias zuvor hinabgesehen hatten. Der Tatort war klug gewählt. Durch den Wald war man entlang des Bahndammes vor neugierigen Blicken geschützt, und die Brücke war zu weit weg, als dass man von dort etwas hätte genau erkennen können. »Wann ist er gestorben?«
»Der Todeszeitpunkt ist der Zugfahrplan«, meinte Weber und streifte seine Handschuhe ab. »Genauer kann ich es dir nicht sagen.«
»In welchen Abständen fahren hier Züge?«, wollte Stern wissen.
»Bin ich die Fahrplanauskunft?«, witzelte Weber und stand auf. Er packte seine Sachen in die Tasche, ließ sie zuschnappen und machte sich zum Gehen bereit. »Wenn du mit ihm fertig bist, schick ihn mir bitte in die Gerichtsmedizin – aber mit der Bahn!« Weber grunzte wieder.
Stern, der Webers Humor nur selten teilte, erwiderte: »Einen Fahrschein wird der ja wohl nicht mehr brauchen.« Dass der Gerichtsmediziner jedes Mal an einem Tatort so gute Laune versprühte, nervte ihn.
Doch Weber lachte aufgrund Sterns vermeintlichen Scherzes nur noch lauter und verließ pfeifend den Tatort. Stern sah ihm kopfschüttelnd hinterher. Danach wandte er sich wieder der Leiche zu. Die Kollegen der Spurensicherung durchkämmten indessen Zug und Bahndamm auf der Suche nach den fehlenden Körperteilen.
»Vielleicht hat der Täter Kopf und Hände mitgenommen, damit wir das Opfer nicht identifizieren können«, spekulierte er laut.
»Kein Kopf, keine Identifizierung durch Angehörige. Keine Hände, keine Fingerabdrücke und keine Identifizierung durch unsere Datenbank«, fasste Gruppeninspektorin Mara Grünbrecht zusammen.
»Wer packt denn einen blutigen Kopf ein?«, fragte indessen Gruppeninspektor Hermann Kolanski angewidert. »Und schleppt ihn, vielleicht sogar in einem Plastiksackerl vom Supermarkt um die Ecke, durch die Gegend?«
»Jeder könnte das tun«, brummte Stern.
»Die Züge fahren auf dieser Strecke in Abständen von etwa 30 Minuten. So lange hatte der Täter Zeit, das Opfer an den Gleisen festzubinden. Wahrscheinlich hat er es vorher betäubt oder bewusstlos geschlagen.« Grünbrecht deutete mit den Armen einen Hieb gegen den Kopf ihres Kollegen an.
»Sonst hätte sich das Opfer gewehrt, und es hätte wohl länger gedauert, es hier festzubinden«, ergänzte Kolanski Grünbrechts Ausführungen zum Tathergang.
»Als das geschafft war, hat der Täter nur noch darauf warten müssen, bis der Zug den Rest erledigt.« Grünbrecht stützte die Hände in die Hüften und betrachtete das Blutbad zu ihren Füßen.
»Zum Denken blieb dem Täter genügend Zeit. Er hat nicht im Affekt gehandelt, sondern wohlüberlegt und geplant. Schließlich hat er auch das Seil mit hierherbringen müssen«, schlussfolgerte Stern.
»Ein Täter, der einem Menschen so etwas antut, scheut nicht davor zurück, den Kopf als Trophäe mitzunehmen. Vielleicht montiert er ihn zu Hause auf eine Holzplatte, wie das die Jäger mit den Schädeln von Rehen so machen«, sagte Kolanski und erntete dafür sowohl von Grünbrecht als auch von Stern einen entsetzten Blick. »Ihr werdet schon sehen. Es gibt nichts, was es nicht gibt!«
»Welche Botschaft will der Täter uns damit vermitteln?«, überlegte Stern laut.
»Dass er gestört ist«, antwortete Gruppeninspektor Edwin Mirscher, der mit einer Plastiktüte in der Hand aus der Richtung des abgestellten Zuges kam und diese hochhielt.
»Was hast du da drinnen?«, wollte Stern wissen, obwohl er sich denken konnte, was das rötliche Fleischige in dem Beutel war.
»Zwei Füße und eine Hand«, antwortete Mirscher. Er legte den Plastiksack neben die enthauptete Leiche. »Jetzt fehlen nur noch der Kopf und die zweite Hand.«
Stern sah zu, wie die Männer der Spurensicherung das Seil durchschnitten, mit dem das Opfer an den Schienen festgebunden war und das bis jetzt den Körper an Ort und Stelle gehalten hatte. Der Leichnam entspannte sich daraufhin, als entwiche aus ihm Luft wie aus einer löchrigen Luftmatratze. Zwei Männer hievten den Toten in einen Sarg. Der Anblick erinnerte Stern an eine Puppe aus seiner Kindheit, der er den Kopf abgerissen hatte. Die Puppe hatte seiner Schwester gehört. Stern hatte den Kopf später mit einem Knödel aus Plastilin ersetzt – mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Doch Plastilin würde hier nicht helfen. Die Männer verschlossen den Sarg und brachten ihn weg.
Stern schritt hinter ihnen her wie ein Trauergast bei einem Leichenzug, fehlte nur, dass er die Hände faltete und einen Rosenkranz betete. Und natürlich gab es keine örtliche Musikkapelle, die den Trauermarsch blies, wie es im Mühlviertel üblich war. An der Stelle, wo die Einsatzkräfte ihre Fahrzeuge abgestellt hatten, verließ er den Trauerzug und bog in Richtung Rettungswagen ab. Dort maß man dem Lockführer gerade den Blutdruck und versorgte ihn mit Kaffee. Nur zu gern tränke Stern jetzt auch Kaffee. Im Gegensatz zu dem unglücklich dreinblickenden Lockführer würde ihm das schwarze Gebräu sogar schmecken. Er unterließ es jedoch, danach zu fragen, und zückte seinen Dienstausweis. Sofort versteifte sich die Haltung des Mannes, der noch immer weiß im Gesicht war, als hätte er sich für einen Clownauftritt geschminkt. Bestimmt hatte er einen Schock erlitten. Stern lehnte sich neben ihm an die Trage.
»Ich bin Chefinspektor Oskar Stern vom Landeskriminalamt Oberösterreich. Können Sie schon darüber reden, was geschehen ist?«
Der Mann nickte. »Es ist kein Unfall gewesen«, stieß er heiser aus. »Das war Mord!« Der Mann sah Stern mit geweiteten Augen an, als sähe er einen Geist.
»Ich weiß. Erzählen Sie mir, was passiert ist.«
»Ich bin in Freistadt losgefahren. Durch die lang gezogene Kurve verliert man nicht viel an Geschwindigkeit, obwohl die Strecke nur bedingt einsehbar ist. Aber das ist im Normalfall kein Problem, wissen Sie, ist ja nicht wie im Straßenverkehr. Hätte ich gewusst, dass da einer liegt, wäre ich natürlich nicht so schnell gefahren.«
»Schon gut, es macht Ihnen keiner einen Vorwurf, Herr …«
»Meier. Manuel Meier.«
»Gut, Herr Meier. Was ist dann passiert?«
»Ich komme also dort um die Kurve und sehe ihn da liegen. Sie können sich nicht vorstellen, wie der mich angestarrt hat. Ich hab sofort eine Notbremsung eingeleitet, aber mit 70 Sachen ist das nicht einfach. Sie sehen ja selber, wo der Zug stehen geblieben ist.«
»Er hat also noch gelebt, bevor …«
»Ganz sicher! Diesen Blick werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen!«, rief Manuel Meier und richtete seine Augen gen Himmel, als könnte der Allmächtige seine Erinnerungen löschen.
Stern hingegen registrierte, dass der Mann demnach nicht bewusstlos gewesen war, wie sie zuvor spekuliert hatten, damit der Mörder ihn bequem an den Schienen hatte festbinden können. Er hatte dem heranrasenden Tod regelrecht ins Auge geblickt.
»Haben Sie an der Bahntrasse, am Rand der Strecke oder im Wald jemanden gesehen?«, hakte Stern nach.
»Sie meinen, außer den Toten?«
Stern nickte.
»Nein.«
»Sind Sie sicher?«
Manuel Meier überlegte kurz, bevor er antwortete: »Ich denke schon.«
In diesem Augenblick hörte Stern seinen Enkel rufen. »Opa!«
Nicht jetzt, dachte er und blickte sich nach Melanie und Tobias um. Während die Zwölfjährige vor Sterns Audi am Boden hockte und mit eingestöpselten Kopfhörern auf ihrem Smartphone herumwischte, war von Tobias nichts zu sehen.
»Opa!«, drang es erneut an Sterns Ohr, dieses Mal lauter.
»Entschuldigen Sie mich einen Augenblick«, sagte der Chefinspektor zu Manuel Meier und stieß sich eine Spur zu heftig von der Rettungstrage ab, sodass diese ins Wanken geriet. Meier hielt sich mit einer Hand fest, damit er nicht herunterfiel, und verschüttete dabei den Kaffee, den er mit der anderen umklammerte.
»Entschuldigung«, brummte Stern, während sein Blick bereits die Umgebung nach seinem Enkel absuchte. Um das Kaffeemalheur mussten sich andere kümmern, denn von Tobias war nichts zu sehen. Weder entdeckte Stern ihn in der Nähe seiner Schwester noch am Waldrand oder in der Zufahrt zu dem kleinen Wäldchen. Wo steckte der Bengel bloß?, schoss es ihm durch den Kopf und auch, dass er für diesen Kinderkram eigentlich zu alt war. Er war der Großvater und nicht der Vater, der ganz andere Fürsorgepflichten hatte! Nur noch wenige Jahre trennten ihn von seinem wohlverdienten Ruhestand und einem Leben ohne Stress, Mord und Totschlag. Obwohl so ein Fall wie dieser seine hin und wieder aufkommenden Pensionierungsängste zu verdrängen vermochte, musste er zugeben: Auf eine ganz bestimmte Weise fühlte er sich dann wieder jung und fit. Und gebraucht.
»Opa!«
Stern folgte den Rufen seines Enkels. Sie führten ihn zur Bahntrasse hinunter. Als Stern klar wurde, was das bedeutete, beschleunigte er den Schritt.
»Tobias?«, rief er.
»Ich bin hier«, kam es zwischen Unmengen an Brennnesseln und Gestrüpp hervor. Stern blinzelte und trat noch ein paar Schritte näher. Dann entdeckte er das blaue T-Shirt seines Enkels inmitten des meterhohen Grüns.
»Tobias, was machst du da?«, fragte er erleichtert, als er den Jungen am Boden hocken sah. Gott sei Dank ein gutes Stück vom Tatort entfernt.
»Er sieht mich an«, sagte Tobias, die Augen starr nach vorn gerichtet.
»Wer sieht dich an?«, wollte Stern wissen und blickte auf seine Armbanduhr. Er musste schnell zurück und die Befragung des Lockführers fortsetzen.
»Der Waldgeist.«
»Es gibt keine Geister, Tobias. Du bist für diesen Schei… äh … für diese Märchen zu alt. Komm jetzt! Ich muss noch …«
»Warum macht er die Augen nicht zu?«, fragte Tobias weiter, ohne sich von der Stelle zu rühren.
»Dann könnte er dich ja nicht ansehen«, antwortete Stern gereizt, wandte sich ab und machte sich ohne seinen Enkel auf den Weg zurück zum Rettungswagen. Wenn Tobias Geisterjäger spielen wollte, dann sollte er das seinetwegen tun. Dort bei den Brennnesseln konnte ihm nichts passieren, außer er fiel in sie hinein. Das wäre zwar unangenehm und zöge bestimmt viele Fragen von Barbara nach sich, doch die wären schnell beantwortet. Irgendwie. Vielleicht sollte er den Sanitäter doch um einen Becher Kaffee bitten …
»Aber er ist doch tot.«
Abrupt blieb Stern stehen. »Wie? Tot?«
»Der Waldgeist. Er ist tot, oder etwa nicht?« Tobias starrte in die Brennnesseln, die hier eindeutig über all das andere Grünzeug die Oberhand gewonnen hatten und die ganze Gegend mit einem unangenehm juckenden Teppich überzogen. Stern machte kehrt und kam zu seinem Enkel zurück. Wegen der Brennnesseln blieb er mehrere Meter hinter ihm stehen und spähte von dort über dessen Schulter. Außer einem Dickicht aus Urticapflanzen sah er nichts weiter.
»Wo ist er?«, fragte er Böses ahnend.
»Dort!« Tobias wies mit dem ausgestreckten Arm in das Unterholz. Stern, der sich schon gefragt hatte, wie der Junge überhaupt dorthin gelangt war, ohne unzählige Male gebrennnesselt worden zu sein, trat vorsichtig die Urticas zur Seite und näherte sich Tobias. Als er ihn erreichte, bückte er sich zu ihm hinab, um denselben Blickwinkel zu haben wie er … Und dann sah er ihn! Er sah den Waldgeist seines Enkels! Und den Kopf des Opfers! Die Augen weit aufgerissen und den Mund zu einem Schrei geformt, der wahrscheinlich in der letzten Sekunde seiner Kehle entrissen worden war, bevor ihn der Zug überrollt hatte. Ein Schrei von allen ungehört. Außer vielleicht vom Täter.
Sofort legte Stern die Hand auf Tobias’ Augen.
»Aber Opa, ich hab ihn doch schon gesehen, bevor du gekommen bist«, rief Tobias entrüstet und befreite sich von seinem Großvater.
»Das ist nichts für dich«, brummte Stern. Er zog seinen Enkel hoch, weg von der Stelle, wo der vermeintliche Waldgeist unaufhörlich Löcher ins Gestrüpp starrte. Das würde er so lange tun, bis ihn jemand davon erlöste. Dieser Jemand sollte Gruppeninspektorin Mara Grünbrecht sein, beschloss Stern.
»Grünbrecht!«, rief er nach der Kollegin, die sofort herbeieilte und sich dorthin wandte, wohin Stern kommentarlos mit dem Finger zeigte. Dass ihr Chef seinen Enkel von der Stelle wegzerrte, war Erklärung genug.
»Hab ich dir und deinen Kollegen helfen können?«, fragte Tobias, während Stern ihn neben den Lokführer auf die Trage des Rettungswagens hob und einen Becher Tee für den Jungen und für sich selbst einen gefüllt mit Kaffee orderte. Der Sanitäter verdrehte die Augen und meinte, dass dies keine Cafeteria sei. Doch als Stern eine Erklärung folgen ließ, die beinhaltete, dass der Junge möglicherweise einen schweren Schock erlitten habe, weil er den Kopf der Leiche gefunden hatte, waren Tee und Kaffee umgehend im Anmarsch.
»Du hast uns sehr geholfen«, antwortete Stern und packte Tobias beidseitig an den Schultern. Er sah ihm tief in die Augen, um herauszufinden, wie es dem Jungen ging. Anscheinend hatte er den Anblick des abgetrennten Kopfes gut überstanden. »Jetzt können wir die Lei… äh, den Waldgeist wahrscheinlich identifizieren.«
»Toll!« Tobias strahlte übers ganze Gesicht. Das wunderte Stern. So ein Anblick müsste doch Spuren im Gemüt des Neunjährigen hinterlassen haben, ihn zum Weinen bringen, ihn sich übergeben oder zumindest sich fürchten lassen.
»Untersuchen Sie ihn!«, befahl Stern dem Sanitäter. »Herz, Kreislauf, alles, was dazugehört. Ich will, dass Sie alles an ihm checken. Sogar den kleinen Zeh!«
»Aber Opa, mir fehlt gar nichts«, widersetzte sich Tobias den Anweisungen des Großvaters und sprang von der Trage herunter.
»Das weißt du doch gar nicht«, erwiderte Stern und verfrachtete seinen Enkel zurück in den Rettungswagen. Zumindest war er dort für die nächsten Minuten sicher und es war gewährleistet, dass er nicht auch noch die fehlende abgetrennte Hand fand. »Du lässt dich jetzt von dem netten Herrn untersuchen und danach fahren wir auf ein Eis.«
»Versprochen?«, quiekte Tobias aufgeregt. Zuerst eine Leiche und dann ein Eis – das war der Jackpot für den Neunjährigen! Freudig streckte er seinem Großvater die Hand entgegen.
Der schlug ein und sagte: »Versprochen!« Danach wandte er sich ab und überließ Tobias dem Sanitäter, der sich sofort um den Jungen kümmerte.
Stern ging zurück zu Mara Grünbrecht und jener Stelle, an der Tobias den Kopf des Opfers gefunden hatte. Nun steckte er in einem Plastikbeutel und sah aus wie ein Dekorationsstück aus der Geisterbahn des Wiener Praters.
»Der gehört zweifellos unserem Mann«, sagte Grünbrecht.
»Natürlich gehört er dem Opfer. So viele Kopflose wird es hier im Mühlviertel ja wohl nicht geben«, brummte Stern, nicht ahnend, wie falsch er damit lag.
2. Kapitel
Chefinspektor Oskar Stern lenkte den Audi A6 auf der Leonfeldner Straße zurück nach Linz, auf der Rücksitzbank saßen seine beiden Enkel. Beide waren gutgelaunt, und Tobias erzählte Melanie alles, was sich vor gut einer Stunde zugetragen hatte. Die Zwölfjährige hatte aufgrund eines Handyspieles nicht viel von Tobias’ Fund mitbekommen und lauschte gespannt den aufgeregten Worten ihres Bruders.
Stern hatte Tobias ein Eis versprochen, und dieses Versprechen wollte er nun einlösen, am besten im Café Jindrak am Pöstlingberg. Anschließend ging es zum Zwergerlschnäuzen in die Grottenbahn. Das war bestimmt gut für die Kinder. Denn warum der Neunjährige derart gute Laune versprühte, war dem Chefinspektor noch immer ein Rätsel. Der Anblick des Kopfes hätte ihn eigentlich traumatisieren müssen, war sich Stern sicher. Wie es aussah, reagierte Tobias nicht wie ein normales Kind auf Derartiges. Der Junge hatte ihn sogar gefragt, ob er ein Foto von dem Schreckgespinst aller Kinder machen dürfe, was Stern natürlich abgelehnt hatte. Heutzutage posteten die Kids doch alles auf Twitter oder Instagram. Da fehlte es ihm noch, dass, bevor die Kriminalpolizei wusste, wer das Opfer war, eines seiner Körperteile die Runde in den sozialen Netzwerken machte.
Endlich erreichten sie die Landeshauptstadt. Der Audi erklomm gemächlich den Pöstlingberg, der sich über das linke Donauufer von Linz emporhob. Wie jedes Mal, wenn Stern hierherfuhr, genoss er die Aussicht über die Stadt und die Umgebung. Tobias quäkte aufgeregt am Rücksitz, dass Stern sich beeilen solle, da er endlich in der Grottenbahn eine Runde auf dem Rücken des Drachen, an den Zwergen vorbei, drehen wolle, doch der Chefinspektor ließ sich nicht drängen. Er parkte den Wagen gut hundert Meter unter der Basilika zu den Sieben Schmerzen Mariä, der barocken, römisch-katholischen Pfarr- und Wallfahrtskirche auf der Kuppe des Pöstlingbergs. Dann stieg er gemächlich aus und spazierte zu der Aussichtsplattform. Tobias hüpfte aufgeregt neben ihm her, Melanie hingegen wirkte eher gelangweilt. Weder konnte sie die Aussicht auf Linz beeindrucken, auf das Kunstmuseum Lentos, das Ars Electronica Center oder die Donaulände, welche ergeben zu ihren Füßen lagen, noch jene auf den Besuch der Grottenbahn. Für Zwerge und Märchen sei sie zu alt, hatte sie während der Fahrt mehrmals bekundetet, was an Sterns Plänen jedoch nichts geändert hatte. Die Kinder brauchten einen Gegenpol zu dem eben Erlebten, redete er sich ein, und da war die Linzer Grottenbahn genau das Richtige. Mit ihrer Märchenwelt in einem der Befestigungstürme des Maximilianischen Befestigungsrings der Stadt und dem elektrisch betriebenen Zug in Drachengestalt, der durch den äußeren Ring des Wehrturms fuhr, vermochte sie jedes Kinderherz zu begeistern.
»Komm, Opa! Lass uns endlich das Eis essen und dann in die Grottenbahn gehen!«, forderte Tobias Sterns Versprechen vehement ein.
»Das machen wir ja gleich«, sagte Stern lachend und löste seinen Blick von der wunderbaren Aussicht über die Landeshauptstadt. Er folgte seinen Enkelkindern zum Café Jindrak, zu dem sie den Weg bereits kannten. Diese Attraktion hier oben auf der Spitze des Pöstlingberges besuchten sie jedes Jahr. Bei diesen Gelegenheiten kamen sie allerdings mit der Pöstlingbergbahn her, einer der steilsten Adhäsionsbahnen der Welt, die vom Linzer Hauptplatz direkt herauffuhr.