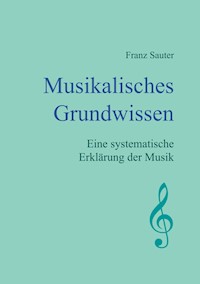
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dies ist eine kleine Musiklehre für Leute, die über ihre Lust am Musizieren hinaus auch theoretische Klarheit haben wollen über die musikalischen Erscheinungen, mit denen sie zu tun haben; die also zum Beispiel wissen wollen,- wodurch der melodische, rhythmische und harmonische Zauber in den Musikstücken zustande kommt,- worin der Unterschied im Harmonieren von Konsonanzen und Dissonanzen besteht,- warum sich das System aus zwölf Tönen durchgesetzt hat,- woran man den Wechsel einer Tonart erkennt,- wovon die Betonungen im Takt abhängen, - worauf der Effekt der Synkope beruht,- was genau der Kontrapunkt ist und welche Rolle er in der Polyphonie spielt,- woran man Anfang und Ende eines Motivs erkennt, usw.Auf Fragen solcher Art bietet dieses kleine Lehrbuch Antworten, und zwar im Rahmen einer Darstellung, die sich konsequent am inneren Aufbau der musikalischen Ästhetik orientiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 90
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
I.
Harmonik
1. Konsonanz
2. Tonalität
3. Modulation
II.
Rhythmik
4. Takt
5. Metrik
III.
Melodik
6. Tonstufen
7. Kontrapunkt
8. Motiv
Literaturverzeichnis
Verzeichnis der Notenbeispiele
I. Harmonik
1. Konsonanz
Eine systematische Erklärung der Musik beginnt am besten mit der Analyse der Konsonanz. Man erkennt dann nämlich das Prinzip, nach dem die einfachsten Bausteine der Musik geformt sind, also das Elementare und Grundlegende der Musik. Danach kann man, Schritt für Schritt, all das entwickeln und ableiten, was auf dieser Grundlage aufgebaut ist.
Elementare Klangformen sind die Dur- und Molldreiklänge, und Konsonanz ist genau die Art von Harmonie, die diesen Klängen eigentümlich ist. Das ist eigentlich jedem Musiker bekannt.1 Weniger bekannt ist, dass – und vor allem: wie – sich von diesem Ausgangspunkt her der ganze innere Zusammenhang der Harmonik, Rhythmik und Melodik erschließt. Man wird das am Ende dieses Buchs sehen, soviel sei vorweg versprochen.
Die Harmonie von Dur- und Mollklängen, die Konsonanz heißt, ist also zunächst zu erklären. Die Frage, die zu beantworten ist, lautet: Wieso, warum, wodurch und inwiefern harmonieren die Töne in einem Dur- oder Molldreiklang? Sehen wir uns zunächst einmal an, wie ein Dur- oder Molldreiklang in seiner Grundform beschaffen ist: Beiden Klängen ist gemeinsam, dass die beiden Töne, die Grundton und Quinte heißen, das Schwingungsverhältnis 2:3 ‚haben‘. Das heißt: Die Schwingungen, die einen Ton erzeugen, sind bei der Quinte eineinhalbmal so schnell wie beim Grundton. Die Terz, der Ton zwischen Grundton und Quinte, kommt beim Durdreiklang durch relativ schnellere Schwingungen zustande als beim Molldreiklang. Ein Beispiel:
Tonfrequenzen bei zwei Dreiklängen
Diese Frequenzverhältnisse sind kennzeichnend für Dur- oder Molldreiklänge, unabhängig von der Frequenz des Grundtons. Über das Harmonieren der Dur- und Mollklänge wissen wir jetzt aber nur so viel: Es findet statt, wenn die Töne die angegebenen Frequenzverhältnisse aufweisen. Wir kennen jetzt die Bedingung des Harmonierens, aber noch nicht seinen Grund. Beides miteinander zu verwechseln, würde bedeuten, dass man etwas geheimnisvoll Harmonisches in den Zahlenverhältnissen sucht, so als ob Zahlen harmonieren würden und nicht die Töne. Tatsächlich gibt es Leute, die den Zahlen mystische Eigenschaften zuschreiben und in diesem Sinne Musik im Kern für „reine Mathematik“ halten.
Das Harmonieren der Töne ist jedoch eine Form des Zusammenpassens, also eine Art von Beziehung, in der es etwas an den Tönen gibt, worin sie übereinstimmen können. Worin aber können Töne, die mit unterschiedlichen Frequenzen erklingen, übereinstimmen? Dieses Rätsel kann nur gelöst werden, wenn man sich die Töne näher ansieht, genauer gesagt: die Form der ihnen zugehörigen Schwingungen. Dazu kann man zum Beispiel die Rillen von Schallplatten, die ja neuerdings wieder beliebt werden, unter die Lupe nehmen. Noch besser geeignet sind Oszillographen, die speziell für diesen Zweck konstruiert sind. Auf einem solchen Gerät könnte ein Ton mit der Frequenz von 500 Hz zum Beispiel so angezeigt werden:
Vier Schwingungen eines Tons von 500 Hz
Die Form dieser Schwingungen beruht darauf, dass sich einige Teilschwingungen überlagert haben. Jeder Ton resultiert aus einer ganzen Menge von Teilschwingungen, deren Frequenzen immer ein ganzzahlig Vielfaches der Grundschwingung (= der ersten Teilschwingung) betragen. In diesem – vereinfachten – Beispiel sind nur vier Teilschwingungen überlagert:
Überlagerung von Teilschwingungen
Die Frequenzen dieser Teilschwingungen betragen:
1. Teilschwingung: 500 Hz
2. Teilschwingung: 1000 Hz
3. Teilschwingung: 1500 Hz
4. Teilschwingung: 2000 Hz
Die Gesamtschwingung ergibt sich als Summe der Teilschwingungen: An jedem Punkt addieren sich die Ausschläge der Teilschwingungen zum Ausschlag der Gesamtschwingung. Der Ausschlag nach unten ist ein negativer Ausschlag, wird also als negativer Betrag addiert.
Wie die Schwingungen den Ton, so erzeugen die Teilschwingungen die Teiltöne, und dieser Ausdruck soll auch im Folgenden gebraucht werden. Weniger vorteilhaft ist der Ausdruck „Obertöne“; denn mit Obertönen ist das gemeint, was durch Schwingungen „oberhalb“ der Grundschwingung erzeugt wird. Dann ist der erste Oberton dasselbe wie der zweite Teilton. Manche nummerieren die Obertöne auch so wie die Teiltöne, weil dies für die übersichtliche Darstellung der Frequenzen günstiger ist. Die unterschiedliche Nummerierung führt aber dann wieder zu Missverständnissen, die man vermeiden kann, wenn man von Teiltönen spricht. In der Physik werden die Teilschwingungen auch „Harmonische“ genannt. Das ist eine abgekürzte Fassung des Ausdrucks „harmonische Schwingungen“. Damit ist gemeint, dass die Teilschwingungen rein sinusförmige Schwingungen sind. Ihre Kennzeichnung als „harmonisch“ meint in diesem Zusammenhang so etwas wie „gleichförmig“, hat also eine etwas andere Bedeutung als das hier verwendete musikalische Attribut „harmonisch“.
Kommen wir zurück auf die Beschaffenheit der Töne: Das obige Beispiel zeigt nur das Prinzip der Überlagerung von Schwingungen. In Wirklichkeit haben die Töne noch viel mehr Teiltöne. Nicht zuletzt auch deshalb, weil seit der Durchsetzung einer auf Dur und Moll gegründeten Musik, also seit etwa 500 Jahren, die Instrumentenbauer dafür gesorgt haben, dass mit klangvollenTönen musiziert werden kann. Klangvolle Töne haben ein reichhaltiges und ausgeprägtes Spektrum an Teiltönen. Bei einer Geige, um nur ein Beispiel zu nennen, wird die Klangfülle der Töne durch ausgesuchte Hölzer und einen raffiniert geformten Resonanzkörper erreicht, der mit der gestrichenen Saite mitschwingt und dadurch den Klang anreichert. Das Klangspektrum eines Geigentons von 440 Hz kann folgendermaßen dargestellt werden:
Klangspektrum eines Geigentons von 440 Hz
Man sieht, dass der erste Teilton mit 440 Hz, also 0,44 kHz, eine Schallintensität von fast 20 db hat, der zweite Teilton mit 0,88 kHz etwas mehr als 10 db, usw. Die Frequenzen der Teiltöne sind natürlich bei jedem Ton gleich, der mit 440 Hz schwingt. Nicht aber die Schallintensität der Teiltöne. Diese beeinflusst nämlich die besondere Klangfarbe der Töne, durch die sich die Instrumente unterscheiden. Was aber die musikalischen Töne gemeinsam haben, ist ihre Klangfülle, also die Tatsache, dass sie über ein ausgeprägtes Spektrum an Teiltönen verfügen. Um zu untersuchen, wie solche Töne harmonieren können, müssen wir auf die besondere Klangfarbe der Töne keine Rücksicht nehmen. Einen Durdreiklang kann man auf einem Klavier genauso gut spielen wie auf einer Gitarre, und die Harmonie dieses Dreiklangs ist dabei dieselbe. Deshalb kann man von der Schallintensität der Teiltöne absehen und einen klangvollen Ton schematisch in folgender Weise darstellen:
Schematisches Klangspektrum eines klangvollen Tons von 500 Hz
Konsonanz-Schema eines Durdreiklangs
Konsonanz-Schema eines Molldreiklangs
In dieser Darstellung müssen keine Frequenzen angegeben werden, weil die Darstellung für alle Dreiklänge gilt, bei denen die Töne die angegebenen Schwingungsverhältnisse aufweisen. Man sieht jeweils unten die Teiltöne des Grundtons, darüber die der Terz und oben die Teiltöne der Quinte des jeweiligen Dreiklangs. Man kann jetzt erkennen, dass eine ganze Reihe von Teiltönen der unterschiedlichen Töne auf der gleichen Frequenz liegen. Soweit Teiltöne der Terz mit denen des Grundtons oder der Quinte übereinstimmen, sieht man es an der durchgezogenen Linie. Wo nur Grundton und Quinte gemeinsame Teiltöne haben, wird dies durch eine gestrichelte Linie angezeigt.
Damit ist zunächst einmal das prinzipielle Geheimnis der Konsonanz gelüftet: Die in der Konsonanz zusammenklingenden Töne haben gemeinsame Teiltöne.2 Die Schwingungen der zusammenfallenden Teiltöne überlagern sich jeweils zu einer einheitlichen Teilschwingung. Das Harmonieren der klangvollen Töne besteht in ihrem Zusammenpassen aufgrund ihrer Klangeigenschaften; es beruht ganz und gar auf dem Klang der Töne selbst und ist insofern ein unmittelbares Harmonieren der Töne.
Betrachtet man die Übereinstimmung der Klangteile in Dur- und Molldreiklängen genauer, so kann man feststellen, dass im Durdreiklang mehr Teiltöne zusammenfallen als im Mollklang. Der Durdreiklang ist daher eine stärkere Konsonanz als der Molldreiklang. Wir werden im zweiten Kapitel noch sehen, dass dieser Unterschied eine musikalische Konsequenz hat.
Wir haben bisher nur den Zusammenklang der Töne in den Grundformen der Dur- und Molldreiklänge untersucht. Konsonanz ist jedoch auch die Harmonie in anderen Formen dieser Dreiklänge. Wir sehen im Folgenden C-Dur-Dreiklänge in der Grundform, in der ersten und zweiten Umkehrung, in einer mehr auseinandergespreizten Form und in einer Form, die mehr als drei Töne enthält.
Formen des C-Dur-Dreiklangs
Beim zweiten Klang ist der Grundton oben, beim dritten in der Mitte, beim fünften kommt er zweimal vor. Die Dreiklänge unterscheiden sich in der Anordnung und Anzahl ihrer Töne. Dies erscheint in praktischer Hinsicht ganz selbstverständlich. Theoretisch gesehen ist das aber erklärungsbedürftig. Wenn es sich um verschiedene Formen derselben Sache handeln soll, dann muss es eine Gemeinsamkeit dieser Klänge geben, die ihre unverwechselbare Identität begründet. Vordergründig gesehen besteht die Gemeinsamkeit der oben gezeigten Klänge darin, dass sie alle aus den „gleichen Tönen“ bestehen. Wir müssen an dieser Stelle etwas vorsichtiger formulieren: Sie bestehen alle aus Tönen, die c, e und g heißen und die in ihrem Zusammenklang als Grundton, Terz und Quinte bezeichnet werden. Der Bezeichnung nach geht jeder davon aus, dass die obigen Klänge gleich sind und jeweils die gleichen drei Töne enthalten. Aber aus Bezeichnungen lassen sich keine objektiven Sachverhalte ableiten. Wenn wir die Identität von Harmonien klären wollen, müssen wir einen harmonischen Grund dafür finden, warum der Grundton genauso gut oben oder unten liegen kann. Diesen Grund finden wir in dem harmonischen Verhältnis zwischen den gleichnamigen Tönen. Diese Töne stehen im Abstand einer Oktave, und die Töne der Oktave haben das Schwingungsverhältnis 2:1. Die „Koinzidenz“ der Teiltöne, die das Wesen der Konsonanz ausmacht, trifft auf die Oktave in nicht zu übertreffender Weise zu.
Konsonanz-Schema der Oktave
Der Klang des oberen Tons der Oktave fällt völlig mit jedem zweiten Teilton des unteren zusammen. Der obere Ton muss daher laut genug gespielt werden, um überhaupt gehört zu werden. Wird zum Beispiel die Klaviersaite des c' bei vorsichtig niedergedrückter Taste durch das Anschlagen des um eine Oktave tieferen c zum Mitschwingen angeregt, so hört man das c' erst, wenn das c gestoppt wird. Aber das nur nebenbei.
Die extreme Harmonie der Oktave, die Stärke ihrer Konsonanz, ist zugleich ihre Schwäche beim Erzeugen harmonischer Unterschiede. Die Unterschiede, die durch verschiedene Anordnung gleichnamiger Töne erreicht werden, verblassen vor dem Unterschied, der in der Anordnung der Terzen begründet ist und über Dur oder Moll entscheidet. Der harmonische Charakter





























