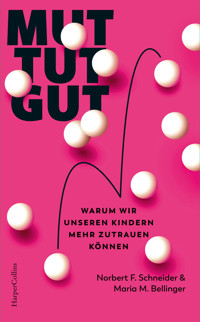
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Immer besser, immer gestresster? Die Herausforderung moderner Elternschaft
Warum stehen Eltern und Kinder heute so unter Druck, warum ist Familie so kompliziert und herausfordernd geworden?
Eltern wollen die Entwicklung ihrer Kinder möglichst optimal unterstützen und bei der Erziehung keine Fehler machen. Die gegenwärtige Tendenz, Kindern möglichst viel abzunehmen, um sie vor den Gefahren der Welt zu bewahren, führt dazu, dass Kinder nicht lernen, Verantwortung zu übernehmen, und deutlich unter ihren Möglichkeiten bleiben – die Bedürfnisse der Erwachsenen bleiben dabei oft auf der Strecke.
Kinder sind viel robuster, als wir sie heute sein lassen. Fundiert erläutern die Autoren nicht nur die vielschichtigen Gründe für unsere Kultur der Überbehütung, sondern auch, wie es uns gelingt, sich aus ihr zu lösen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch:
Warum stehen Eltern und Kinder heute so unter Druck, warum ist Familie so kompliziert und herausfordernd geworden? Eltern wollen die Entwicklung ihrer Kinder möglichst optimal unterstützen und bei der Erziehung keine Fehler machen. Die gegenwärtige Tendenz, Kindern möglichst viel abzunehmen, um sie vor den Gefahren der Welt zu bewahren, führt dazu, dass Kinder nicht lernen, Verantwortung zu übernehmen, und deutlich unter ihren Möglichkeiten bleiben – die Bedürfnisse der Erwachsenen bleiben dabei oft auf der Strecke. Kinder sind viel robuster, als wir sie heute sein lassen. Fundiert erläutern die Autoren nicht nur die vielschichtigen Gründe für unsere Kultur der Überbehütung, sondern auch, wie es uns gelingt, sich aus ihr zu lösen.
Zur Autorin:
Maria M. Bellinger ist promovierte Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Nach 20 Jahren klinischer Tätigkeit leitete sie bis 2025 die Psychosoziale Beratungsstelle eines Bundesministeriums. Sie schreibt Fachliteratur an der Schnittstelle von Gesundheit, Arbeit und Familie. Als Senior Coach (DBVC) unterstützt sie Führungskräfte, Teams und Organisationen in ihrer Entwicklung.
Zum Autor:
Norbert F. Schneider ist Professor für Soziologie und lehrte an den Universitäten Bamberg, Mainz, Wien und Frankfurt. Von 2009 bis 2021 war er Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BIB) und beriet die Bundesregierung als Mitglied mehrerer Expertenkommissionen, u. a. bei der Erstellung des Achten Familienberichts. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen zu Themen der Familiensoziologie, Demografie und Migration.
Norbert F. Schneider & Maria M. Bellinger
Mut tut gut
Warum wir unseren Kindern mehr zutrauen können
HarperCollins
Originalausgabe
© 2025 by HarperCollins in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH
Valentinskamp 24 ∙ 20354 Hamburg
Covergestaltung von zero-media.net, München
Coverabbildung von FinePic®, München
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN9783749908363
www.harpercollins.de
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten.
Die Rechte der Urheber und des Verlags bleiben davon unberührt.
Deine Kinder sind nicht deine Kinder.Sie sind Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst.Sie kommen durch dich, aber nicht von dir,und obwohl sie bei dir sind, gehören sie nicht dir.
Du kannst ihnen deine Liebe geben, nicht aber deine Gedanken,denn sie haben ihre eigenen Gedanken.Du kannst ihrem Körper ein Heim geben, nicht aber ihrer Seele,denn ihre Seele wohnt im Haus von morgen,das du nicht besuchen kannst, nicht einmal in deinen Träumen.
Du kannst versuchen, ihnen ähnlich zu sein,aber versuche nicht, sie dir ähnlich zu machen.Denn das Leben läuft nicht rückwärts und verweilt nicht beim Gestern.
Du bist der Bogen,von dem deine Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden.Lass den Bogen in der Hand des Schützen Freude bedeuten.
Khalil Gibran(1883–1931)
Einleitung
Warum stehen Eltern und Kinder heute so unter Druck, warum ist Familie so kompliziert und herausfordernd geworden?
Wenn wir aus dem Fenster schauen, sehen wir die Kinder aus der Nachbarschaft im Garten spielen. Heute sind es fünf, manchmal sind es sieben oder acht. Wir hören lautes Lachen, manchmal auch lautstarke Auseinandersetzungen, wenig später wieder fröhliches Quietschen. Manchmal sitzen einige der Eltern, die alle berufstätig sind, beiläufig daneben, unterhalten sich miteinander und mischen sich nicht weiter ein, manchmal sind sie auch gar nicht zugegen. Die Kinder haben Spaß, und ihre Eltern wirken wenig gestresst.
Ist das normal oder ein seltenes Idyll?
In den Medien lesen wir oft vom Gegenteil: »Immer mehr Eltern im Burn-out«, »Gestresste Eltern – gestresste Kinder: Der Teufelskreis der Überforderung«, »Generation Erschöpfung: Psychische Erkrankungen nehmen bei Kindern dramatisch zu« oder »Gewalt und Mobbing an Schulen eskalieren«, »Fachkräftemangel lässt Kitas kollabieren«, »Betreuungsnotstand macht Eltern zu schaffen«.
Ist das die Realität oder schon Sensationsjournalismus?
Wie passt, was wir sehen, zu dem, was wir lesen? Diese Frage hat uns beschäftigt, und wir haben uns auf die Suche nach Antworten begeben. Wir haben viel gelesen, Online- und Printmedien, Social-Media-Threads ebenso wie Fachliteratur. Was wir gelesen haben, hat unsere Neugier noch gesteigert. Wir wollten mehr wissen und haben Interviews geführt: Über fünfzig Eltern, Kinder, Experten und Expertinnen aus Kinder- und Jugendpsychiatrie und Beratung, Erzieherinnen, Lehrer und Lehrerinnen und andere, die jeden Tag mit Kindern und Jugendlichen leben und arbeiten, haben mit uns gesprochen und diskutiert. Ihre Erfahrungen und Expertise ergänzen unsere fachliche Sicht. Sichtbar wurde eine reiche Vielfalt an Erfahrungen, Perspektiven und Haltungen, die wir gerne mit Ihnen teilen.
Mit diesem Buch möchten wir Sie zur Auseinandersetzung anregen. Mit dem, was im Hinblick auf Familie, Kinder und Erziehung heutzutage als ›normal‹, ›natürlich‹, ›unerwünscht‹ oder ›krankhaft‹ gilt. Unser Angebot besteht aus einer kritischen Reflexion dessen, was wir sehen und wahrnehmen, was uns auffällt und was uns nachdenklich stimmt. Wir erkunden, was in diesem Land gut läuft und wo Veränderungsbedarf besteht.
Unser Interesse gilt vor allem der Kultur des Aufwachsens, der Situation der gesellschaftlichen Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur und den Dilemmata der elterlichen Entscheidungssituationen, den Herausforderungen des Entweder-Oder und der Unmöglichkeit des Sowohl-als-auch.
Im ersten Kapitel werfen wir einen Blick auf das Alltagsleben von Familien und ihre aktuellen Herausforderungen. Welche davon sind neu und welche haben schon immer so oder so ähnlich bestanden?
Anschließend fragen wir, ob die gegenwärtige soziale Konstruktion von Kindern und Kindheit angemessen ist oder ob sie die kindlichen Fähigkeiten nicht erheblich unterschätzt und den Kindern eine angemessene Entwicklung von Selbstverantwortung und Resilienz vorenthält? In den Fokus gerät auch die Thematik, ob Kinder unter steigenden Leistungsanforderungen und einem überbordenden Erwartungsdruck leiden, wie es die öffentliche Rhetorik nahelegt. Sind sie weniger belastbar und müssten daher die Anforderungen in der Schule weiter gesenkt werden?
Im dritten Kapitel befassen wir uns mit den Themen Elternschaft und Elternsein und ihrer Entwicklung zum ›Big Business‹, das enorme Umsätze generiert, und fragen uns, wie das zu erklären ist. Ist es das forcierte Streben nach der perfekten Elternschaft, sind es die wachsende Verunsicherung und Überforderung der Eltern angesichts des gewaltigen Erwartungsdrucks, der auf ihnen lastet, oder ist es heute tatsächlich so viel schwieriger geworden, Kinder bestmöglich in ihrer Entwicklung zu begleiten?
Ist der Erziehungsprozess gegenwärtig ein anderer als noch vor wenigen Jahrzehnten? Mit welchen Dilemmata müssen sich Erziehende aktuell auseinandersetzen? Wird zu viel von den Eltern erwartet? Oder das Falsche? Sind die elterlichen Pflichten in den Strukturen der modernen Leistungsgesellschaft noch adäquat zu erfüllen? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns im vierten Kapitel.
Ein großes Thema in zahlreichen Familien ist der Umgang mit Konsum und Knappheit. Hierzu reflektieren wir im fünften Kapitel, ob, soweit man es sich leisten kann, den Kindern alle Wünsche erfüllt werden sollten oder wie wertvoll auch Erfahrungen mit Verzicht und Knappheit im Prozess des Aufwachsens sein können. Wir stellen dar, welche Folgen Armut für die Entwicklung von Kindern hat und was Wohlstand und Überfluss bei der nachwachsenden Generation bewirken können.
Das sechste Kapitel widmen wir den Betreuungs- und Bildungsinstitutionen. Sind sie tatsächlich so überfordert und in systematische Widersprüche verstrickt, wie wir täglich hören und lesen können? Wie weit ist der Vertrauensverlust in ihre Arbeit fortgeschritten und warum? Sind die an sie gerichteten Erwartungen zu hoch? Wird die vielfach zu verspürende Erschöpfung der im Betreuungs- und Bildungssystem Tätigen zum Dauerzustand?
Im siebten Kapitel unternehmen wir einen kurzen Abstecher in die digitale Welt. Was machen Smartphone und Social Media mit den Kindern und Jugendlichen? Stellen sie eine reale Bedrohung dar oder überwiegt ihr Nutzen? Wie können Eltern und Gesellschaft angemessen mit den Herausforderungen der digitalen Technologien und Medien umgehen?
Im achten Kapitel richten wir den Blick darauf, wie die rasch gestiegene Nachfrage nach den Angeboten der Befähigungs- und Versorgungsindustrie zu erklären ist. Sind immer mehr Kinder verhaltensauffällig oder gar krank? Sind Eltern und Betreuerinnen sensibler in ihrer Wahrnehmung oder generiert womöglich das rasch gestiegene Therapieangebot seine eigene Nachfrage?
Im neunten Kapitel beschäftigt uns die Thematik, wie sich die äußeren Krisen der globalisierten Welt auf Familien auswirken. Verstärken sie die Belastungen im Inneren? Treffen sie die Familien unvorbereitet? Führt die wachsende Unüberschaubarkeit zu Resignation oder führt sie letztlich zur Stärkung der Familie?
Am Ende werfen wir die Fragen auf: Was heißt das Gesagte für die ›Kultur des Aufwachsens‹ und wie können Eltern, Kinder und Institutionen entlastet werden?
Wir stellen viele Fragen, auf die es keine einfachen, oft auch keine eindeutigen Antworten gibt. In jedem Fall erfordern sie eine differenzierte und möglichst unvoreingenommene Betrachtung. Aber nicht überall konnten wir genauer hinschauen. Daraus können sich Unschärfen ergeben, etwa im Hinblick auf die Lebenssituationen queerer Familien oder die von Kindern in Armut, mit Hochbegabung, chronischen Erkrankungen, mit Behinderungen, Flucht- oder Migrationshintergrund.
Wir konzentrieren uns im Wesentlichen auf die Zeit des Aufwachsens bis zum vierzehnten Lebensjahr und beziehen in unsere Betrachtungen auch die Umstände der Planung und Entstehung einer Schwangerschaft und die sich daraus ergebenden Folgen für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ein.
Noch ein Wort zum Gendern: Sprachwissenschaftler betonen, das generische Maskulinum kenne kein Geschlecht, deswegen sei Gendern nicht notwendig. Befürworter des Genderns sagen, hinter maskulinen Endungen wie Lehrer oder Erzieher seien andere Geschlechter nicht erkennbar und sollten deshalb explizit genannt werden. Wir verwenden in diesem Buch bei Berufsbezeichnungen stets die weibliche Form, weil die Mehrzahl der mit dem Aufwachsen von Kindern befassten Personen Frauen sind. Bei Schulkindern sprechen wir von Schülerinnen und Schülern.
1 Familie
Ein Drahtseilakt
Idyll und Konflikt. Über das Wesen von Familie
»Familie ist Liebe und immer mal wieder ein bisschen Ärger«, antwortet ein Zehnjähriger auf unsere entsprechende Frage. Knapper ist das Wesen der Familie kaum auf den Punkt zu bringen. Familie ist ein Sehnsuchtsort, kann aber auch sehr belastend sein. Familie kann freudvoll, wohltuend, aber auch schmerzvoll und sehr anstrengend sein. Das ist nicht neu, das war schon immer so.
Jede und jeder kennt es, viele haben es am eigenen Leib erfahren: Die Ambivalenz der Familienbeziehungen. Liebe, Harmonie, Zugehörigkeit, Geborgenheit und Lebenssinn sind ebenso Teil von Familie wie Ärger, Eifersucht, Konflikt, Gewalt oder gar Misshandlung. Die negativen Seiten werden in den Klischees von Familie gerne ausgeblendet.
Familien haben eine Geschichte und ein Gedächtnis. Ein Gedächtnis, weil sie Schicksalsschläge, Verletzungen, Freuden und Glücksfälle in einer Art kollektiver Familiengeschichte speichern; einer Geschichte, die auf die Familienbeziehungen einwirkt und die Eigenarten der Familienmitglieder prägt.
Familien haben Perspektiven. Familienleben findet in der Gegenwart statt, ist aber häufig auch zukunftsorientiert. Gemeinsame Vorhaben wie Hausbau, Schulabschluss der Kinder, beruflicher Aufstieg der Eltern oder Urlaubspläne machen Familien aus. Perspektiven halten Familien lebendig.
Familie. Wer gehört da eigentlich dazu? Auf diese Frage können die meisten Menschen eine, ihre, Antwort geben. »Mama, ihr neuer Freund, meine Oma, unser Hund und ich«, sagt uns ein achtjähriger Junge zum Beispiel, und eine 14-Jährige antwortet: »Mein älterer Bruder, seine Frau und ich.« Viele sagen einfach: Vater-Mutter-Kind. Familie entsteht und besteht, wo Menschen zusammenleben und wirtschaften, füreinander sorgen, sich verbunden fühlen, gemeinsam Zeit verbringen und ihren Alltag gestalten. Familie findet auch dort statt, wo Menschen täglich aneinander leiden und sich verletzen. Familie ist, was Menschen daraus machen. Familie ist aber auch, das Wort klingt altertümlich, Blutsverwandtschaft. Ihr entkommt man nicht, auch wenn man sich nicht mag, nicht zusammenlebt und sich nicht versteht. Das Familienrecht schweißt Familie zusammen, ob der Einzelne das möchte oder nicht.
Familie. Bei diesem Thema prallen romantische Vorstellungen und nüchterne Realität aufeinander. Das Idealbild eines perfekten Familienlebens trifft auf einen Alltag, der sich oftmals als stressig, belastend und konflikthaft darstellt.
»Familien sind Eltern-Kind-Gemeinschaften«, sagt die amtliche Statistik. Familien sind hier also stets Haushaltsgemeinschaften, unabhängig davon, ob die Eltern miteinander verheiratet sind, ob sie das gleiche Geschlecht haben oder nicht oder ob sie alleinerziehend sind. Wohnen Menschen, die sich als Familie verstehen, aus welchen Gründen auch immer, nicht zusammen, gelten sie statistisch nicht als Familien. Die statistische Annäherung ist daher nicht so richtig lebensnah, denn so manche Familie lebt in mehr als einem Haushalt, etwa wenn das erwachsene Kind zum Studium ausgezogen ist. Amtlich handelt es sich dann um ein kinderloses Ehepaar und einen Ein-Personen-Haushalt. Im richtigen Leben verstehen sie sich weiterhin als Familie – weil sie sich zusammengehörig fühlen, solidarisch verbunden sind und wechselseitig Verantwortung füreinander übernehmen. Aus rechtlicher Sicht können Familien durchaus in unterschiedlichen Haushalten wohnen.
»Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung«, besagt Art. 6, Abs. 1 des Grundgesetzes. Bis in die 1990er-Jahre war Ehe eine Grundvoraussetzung für Familie, nichteheliche Lebensformen mit Kindern galten nicht als Familie. Heute gilt das »Diskriminierungsverbot« der Ehe, sie darf gegenüber anderen Lebensformen nicht schlechter gestellt werden, aber andere Lebensformen können ihr (nahezu) gleichgestellt sein. Die gesetzliche Antwort auf die Frage ›Was ist Familie‹ ist von besonderer Bedeutung, weil sie regelt, welche Lebensformen als schutz- und förderungswürdig gelten und welche nicht.
Ist Familie etwas Natürliches, Biologisches, eine Art Konstante der menschlichen Zivilisation? Oder gar eine Stiftung Gottes? Die sozialhistorische Perspektive sagt hier ganz klar: Jein! Familie hat biologische Grundlagen, lässt sich darauf aber nicht reduzieren. Vielmehr können wir uns Familie als ein kulturelles Konstrukt vorstellen, gekennzeichnet durch Wandlungsfähigkeit und Formenvielfalt. Zugespitzt: Jede Kultur, jede Zeit und jede Gesellschaft bringen die Grundformen von Familie hervor, die zu ihnen passen. Die Menschen gestalten in den jeweiligen gesellschaftlichen Strukturen ihre eigene Familie so, wie sie es für richtig erachten. Oder, etwas pessimistischer, wie sie aufgrund ihrer Lebensumstände gezwungen werden, Familie zu organisieren.
Familie. Nichts ist selbstverständlich. Variationen von Familie über die Kulturen hinweg sind nahezu grenzenlos. Was aus unserer heutigen westlichen Kulturperspektive als unverbrüchlich für Familie erscheinen mag, etwa dass Ehen monogam sind, verliert schon bei einem kurzen Blick über die Grenzen seine Eindeutigkeit. Derzeit gelten weltweit in über vierzig Ländern polygame Eheverfassungen. In manchen außereuropäischen Kulturen ist es nicht ungewöhnlich, dass der Bruder oder die Schwester als Sexualpartner einspringen, wenn ein Ehepaar ungewollt kinderlos bleibt. Solche Beispiele zeigen: Fast alles ist möglich. Familie ist formbar wie ungebrannter Ton, bis sie Gestalt annimmt in den Brennöfen der Kulturen.
Als kulturelle Leitidee unterliegt Familie einem steten Wandel. Aber auch jede einzelne Familie verändert sich permanent. Familienphasen beginnen und enden, etwa wenn ein Kind geboren wird, ein Familienmitglied verstirbt, sich die Partner trennen oder ein Kind auszieht. Auch die emotionalen Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern verändern sich stetig. Familie ist daher besser als Entwicklungsverlauf zu begreifen denn als statische Einheit.
Noch vor sechzig Jahren war normativ klar, dass die Heirat einer Schwangerschaft vorauszugehen und eine gemeinsame Haushaltsgründung erst nach der Heirat zu erfolgen habe. Verstöße gegen diese Normen wurden heftig sanktioniert. Das spielt heute kaum noch keine Rolle.
Was Familie ausmacht, ist ihre Dualität. Als soziale Institution richten sich kulturelle Normen und gesellschaftliche Erwartungen auf sie, und sie ist durch Gesetze geregelt. Als individuell gestaltetes und gelebtes Beziehungsgeflecht ist sie täglich neu herzustellen. Es entsteht ein widersprüchlich anmutender Doppelcharakter von Familie: Jede Familie ist besonders, dennoch sind sich viele Familien sehr ähnlich.
Familie und Familienklischees im Wandel
Mit dem Wort Familie wird in der Regel eins von zwei Bildern assoziiert: entweder das einer Drei-Generationen-Großfamilie auf dem Land oder das einer bürgerlichen Kernfamilie in der Stadt. In der deutschen Sprache ist Familie ein vergleichsweise neuer Begriff, der sich erst im 17. Jahrhundert allmählich verbreitet und denjenigen des »Ganzen Hauses« (oikos) abgelöst hat. Das ganze Haus war eine Organisation zur Selbstversorgung und umfasste Eltern, Kinder, Verwandte, Gesinde, das Vieh, das Land, das Gebäude und das bewegliche Inventar. Es war streng patriarchal organisiert und beruhte auf der Unterordnung der Individuen unter das Kollektiv und unter die väterliche Autorität.
Oft ist von der ›traditionellen Familie‹ die Rede. Sie gilt als Symbol der guten alten Zeit, bildhaft verkörpert in der Großfamilie, in der drei Generationen harmonisch unter einem Dach zusammenleben. Die sozialhistorische Forschung hat nachgewiesen, dass es diese Familienform in größerer Verbreitung nie gegeben hat. Stattdessen existierte bereits vor der industriellen Revolution eine große Vielfalt an Familienformen. Als Schöpfer der Legende der ›traditionellen Familie‹ gilt Wilhelm Heinrich Riehl mit seinem 1855 erstmals erschienenen Buch »Die Familie«[1]. Darin beklagt er die Zerstörung der idyllischen patriarchalen Großfamilie durch die Industrialisierung und die einsetzende Verstädterung. Sein Buch, über vierzig Jahre lang neu aufgelegt, wurde zu einem der meistgelesenen Bücher in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es nahm erheblichen Einfluss auf die Formulierungen des bürgerlichen Ehe- und Familienrechts aus dem Jahre 1899, das in Teilen auch heute noch gilt.
Es ist kein Zufall, dass dieses Buch so erfolgreich war. Seine Bedeutung erklärt sich daraus, dass es in Zeiten des raschen und krisenhaften Übergangs zur Industriegesellschaft dem vermeintlichen Sittenverfall in den Städten eine Art Rest an Stabilität und »natürlicher Sittlichkeit« entgegenstellte.
Die andere Imago der traditionellen Familie ist die bürgerliche Kernfamilie. Ihre Merkmale sind die eheliche Beziehung eines Mannes und einer Frau, die zusammen mit ihren gemeinsamen Kindern unter einem Dach wohnen, sowie die strikte Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Der Mann ist für die materielle Absicherung und das Außenleben hauptverantwortlich, die Frau für Erziehung, Haushaltsführung und die Beziehungspflege im Innern. Eine besondere Ausprägung dieser Familienform entwickelte sich im Großbürgertum des 19. Jahrhunderts: Dort kamen noch Dienstpersonal und Hauslehrer hinzu. Man konnte es sich schließlich leisten. Für den Herrn im Großbürgertum war es ein Statusmerkmal, dass seine Ehefrau nicht arbeiten musste.
Auch diese Familienform war selten, diente aber Jahrzehnte später in Westdeutschland als Vorlage für das Ideal von Familienglück. Der erfolgreiche Mann in den 1950er-Jahren konnte sich (s)eine Hausfrau leisten. Tatsächlich empfanden es viele Frauen damals durchaus als Privileg, nicht erwerbstätig sein zu müssen. Schließlich bewegten sich ihre beiden Lebensfragen, so formulierte es eine Werbung von Dr. Oetker im Jahr 1954, auf einer ganz anderen Ebene: »Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?«.
Paare heiraten aus Liebe. Das ist ein weiteres Klischee im Familienkontext. Blicken wir auch hier kurz zurück ins 19. Jahrhundert. Romantische Liebe als Grundlage der ehelichen Beziehung hatte zu dieser Zeit nur eine untergeordnete Bedeutung. Rationale Zuneigung war die Grundlage. Der Partner oder die Partnerin wurden nicht um ihrer selbst willen geliebt, sondern dafür, wie sie ihre Aufgaben erfüllten, den Rollenerwartungen entsprachen und den familiären Status absicherten.
Massenhaft verbreitete sich die romantische Liebe als Grundlage der Ehe erst im 20. Jahrhundert, beschleunigt in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Stark befeuert durch Schlager, Bücher und vor allem Filmklassiker wie »Im weissen Rössl am Wolfgangsee« oder »Schwarzwaldmädel« wurde das romantische Liebesideal in die Köpfe der Menschen transportiert. Die Sehnsucht nach der heilen Familie in der damaligen Zeit war ein Produkt des Krieges und seiner Schrecken und Wirrnisse. Verstörte, entwurzelte, traumatisierte Menschen suchten Halt und Zuflucht in der harmonischen Familie. Scheidung, nichteheliche Geburten oder unverheiratetes Zusammenleben waren Ereignisse, die keinen Platz in dieser Zeit hatten. Obwohl. Bis in die Mitte der 1950er-Jahre war das Phänomen der »Onkelehe« durchaus verbreitet und irgendwie toleriert. (Kriegs-)Witwen, die ihre Rente nicht verlieren wollten, und Ehefrauen von Männern, deren Schicksal ungeklärt war, lebten unverheiratet mit neuen Partnern zusammen, bis der Ehemann für tot erklärt wurde oder nach Jahren in der Gefangenschaft wieder zurückkehrte. Verbreitet waren auch die sogenannten »Besatzungskinder«. Neuere Schätzungen gehen von einer Zahl von etwa 400000 aus. Nichteheliche Mutterschaft war tabuisiert und stigmatisiert. Von der Intensität der moralischen Verurteilung zeugen bis heute die damaligen Begriffe: Als »Russenhure«, »Britenschlampe« und »Ami-Liebchen« wurden die Mütter beschimpft, ihre Kinder galten als »Bankerte« und wuchsen oft vaterlos auf.
Als Gegenentwurf zu diesen Wirrnissen entstand die bürgerliche Kernfamilie als einzig akzeptierte Familienform in den 1950er- bis 1970er-Jahren und erlangte in dieser Zeit auch statistisch eine Art Monopolstellung. Die seitdem stattfindenden Veränderungen, etwa die wachsende Vielfalt der Familienformen und die rasche Verbreitung nichtehelicher Elternschaft, sind im längerfristigen historischen Vergleich als »Rückkehr zur Normalität der Vielfalt« der Familie zu bewerten, nicht als Neuentstehung von Diversität und schon gar nicht als krisenhafte Entwicklung.
Dennoch wird der Wandel der Familie von allgemeiner Besorgnis begleitet und ist besonders in konservativen Kreisen mit Verlustängsten assoziiert: ›Die traditionelle Familie verschwindet, die moderne schafft Probleme.‹ Der Mythos von der bedrohten ›richtigen‹ oder ›normalen‹ Familie, die es zu bewahren gilt, lebt. Das »Bekenntnis zur traditionellen Familie«, wie es sich als politische Forderung explizit bei einer rechtspopulistischen Partei findet, ist schon deshalb nicht einlösbar, weil es die traditionelle Familie niemals gab und geben wird. Genauso wenig wie die Normalfamilie. Familie als soziale Konstruktion ist fluid. Das ist eines ihrer Kernmerkmale und ein Garant für ihr Fortbestehen, gerade in wechselvollen Zeiten.
Besonders gut sichtbar sind Dynamik und Rasanz der Veränderungen der Familie am Wandel der Geschlechterbeziehungen. Dieser Wandel lässt sich gut an einigen rechtlichen Beispielen veranschaulichen. Vieles, was wir bei einem kurzen Blick in die 1950er-Jahre entdecken können, mutet aus heutiger Sicht befremdlich an. Da ist zum Beispiel der § 1354BGB, der »Gehorsamsparagraph«, der erst 1958 durch die Neufassung des Gleichberechtigungsgesetzes final reformiert wurde. Dort hieß es: »Dem Manne steht die Entscheidung in allen das gemeinsame eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu.« Da mutet die Neuregelung fast schon als Eintritt in eine neue Ära an: »Die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung« (§ 1356BGB), damit wurde das Leitbild der »Hausfrauenehe« rechtlich fixiert. Im gleichen Zuge fiel das Recht des Mannes, das vertragliche Arbeitsverhältnis seiner Gattin gegen deren Willen zu kündigen, wenn er den Eindruck hatte, dass sie ihre ehelichen Pflichten vernachlässige. Erstmals 1962 erlangten Ehefrauen das Recht, ein Bankkonto eröffnen zu dürfen. Immerhin.
Das Leitbild der »Hausfrauenehe« wurde rasch anachronistisch. Es fiel mit der Reform des Ehe- und Familienrechts 1977 und wurde durch das Leitbild der »partnerschaftlichen Ehe« abgelöst. Die Idee von »naturgegebenen wesensmäßigen Unterschieden« zwischen den Geschlechtern begann sich aufzulösen. Elisabeth Beck-Gernsheim[2] fasst diesen Prozess mit Blick auf die Frauen so zusammen: Vom »Dasein für Andere« zum Anspruch auf »ein Stück eigenen Leben«.
Wie zäh sich Reste von traditionellen Mustern halten, zeigen zwei Beispiele: Bis 1998 bestand faktisch ein rechtlicher Anspruch auf Kranzgeld. Kennen Sie nicht? Kranzgeld war ein Anspruch auf finanzielle Entschädigung einer »unbescholtenen« Frau gegenüber ihrem Verlobten, wenn dieser sie unter dem Versprechen einer späteren Heirat entjungfert hatte und dann sein Versprechen nicht einhielt und das Verlöbnis löste. Der Frau, so die damalige Logik, war durch die Defloration ein materiell auszugleichender Schaden entstanden, denn ihre Chancen auf dem Heiratsmarkt waren nun deutlich geschmälert. Die letzte dokumentierte Verurteilung zu einer Kranzgeld-Zahlung nach § 1300BGB erfolgte 1980 in Hessen.
Streng unterschieden wurde bis in die 1970er-Jahre zwischen »legitimer« und »illegitimer« Elternschaft. Nichteheliche Mutterschaft galt als Schande und als »Verantwortungslosigkeit«, der nichteheliche Vater des Kindes blieb weitgehend unbescholten. Bis 1969 war er mit seinem Kind nicht verwandt, wenn er mit der Kindsmutter nicht verheiratet war, und hatte keine Unterhaltsverpflichtung. Der nicht verheirateten Mutter stand »die elterliche Gewalt« nur zu, wenn sie ihr vom Vormundschaftsgericht übertragen worden war.
Reste der Diskriminierung nichtehelicher Elternschaft finden sich bis in die Gegenwart. Zwar erfolgte ihre vollständige rechtliche Gleichstellung durch die Reform des Kindschaftsrechts 1998, in der DDR dagegen schon 1950. Doch bis heute sind die Väter nichtehelicher Kinder nicht mit den Müttern gleichgestellt. Zwar steht nach § 1626a BGB die elterliche Sorge für ein nichtehelich geborenes Kind beiden Eltern gemeinsam zu, aber nur dann, wenn sie übereinstimmend eine entsprechende Sorgeerklärung abgeben. Wenn die Mutter nicht zustimmt, bleibt ihr das alleinige elterliche Sorgerecht. Einige nicht verheiratete Väter kämpfen energisch darum, als rechtliche Väter ihrer leiblichen Kinder anerkannt zu werden. Im April 2024 hat das Bundesverfassungsgericht dazu geurteilt, dass der Erzeuger ein Elternrecht besitzt, und damit die Position dieser Väter gestärkt.
Wenden wir uns nun der Frage zu, wie sich die Familienformen in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Welche sind häufiger geworden? Welche sind auf dem Rückzug? Der zentrale Trend ist die Verschiebung von Lebensformen mit Kindern hin zu solchen ohne Kinder im Haushalt. Die Ehe mit Kindern hat am deutlichsten abgenommen. Allein in den vergangenen zwanzig Jahren ist ihr Anteil an allen Lebensformen um zwölf Prozentpunkte zurückgegangen. 2023 gab es nach Angaben des Statistischen Bundesamts vom 2. April 2024 nur noch 5,8 Millionen Ehepaare mit mindestens einem minderjährigen Kind im Haushalt, 2005 waren es noch knapp 6,7 Millionen.
Geringfügig abgenommen hat nach Angaben des Statistischen Bundesamts seit 2005 auch die Zahl alleinerziehender Mütter (um 25000), sie beträgt rund 1,4 Millionen, während die Zahl alleinerziehender Väter um 147000 auf 301000 angestiegen ist.
Ein vergleichbarer Trend lässt sich auch für die Lebensläufe beobachten: Immer mehr Menschen leben immer länger ohne Kinder im Haushalt, daher müsste doch der ›gefühlte‹ gesellschaftliche Stress wegen der Kinder abnehmen. Warum ist das nicht der Fall? Vergleichen sich Eltern zunehmend mit Kinderlosen und meinen, sie schnitten dabei schlechter ab? In der Vergangenheit hatten fast alle Kinder, man war sich in dieser Hinsicht ähnlich. Heute erwächst eine gewisse Spaltung der Gesellschaft in Kinderlose und Eltern. Die einen, so der Diskurs, übernehmen Verantwortung, die anderen nicht. Stattdessen lassen sie es sich gutgehen, leisten sich mehr und leiden weniger unter Stress. Ist das eine Quelle der Unzufriedenheit der Eltern? Wir kommen darauf zurück.
Die Dynamik des Wandels der Familie geht so weit, dass ein zentraler Grundsatz der europäischen Leitidee von Ehe außer Kraft gesetzt wurde: »Die Ehe ist eine Verbindung von Mann und Frau.« Man darf gespannt sein, wann es im aufziehenden Zeitalter der Polyamorie die erste Klage gegen das Verbot der Vielehe geben wird, wie es in § 1306BGB niedergelegt ist. Tatsächlich stellt sich die Frage, ob der Staat seinen freien Bürgern und Bürgerinnen vorschreiben kann, wie viele Ehepartner und Ehepartnerinnen sie zu einem bestimmten Zeitpunkt haben dürfen.
Jede einzelne Familie war und ist eingebunden in Verwandtschaft. Wie der Wandel der Familie ist auch der Wandel der Verwandtschaft tiefgreifend. Verwandtschaftliche Netzwerke werden immer kleiner. Eine neue, international vergleichende Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung[3] bestätigt den Trend der Verkleinerung der Verwandtschaft eindrücklich. Eine 65-jährige Frau in Deutschland hat danach aktuell knapp sechzehn lebende Verwandte. Tendenz weiter abnehmend. Global liegt der Durchschnitt noch bei fünfundvierzig Verwandten. Die Autoren sprechen von »seismischen Verschiebungen in der Familienstruktur«.
Auch werden die Verwandten immer älter. Das hängt mit der gestiegenen Lebenserwartung und der gesunkenen Geburtenhäufigkeit zusammen. Die gestiegene Lebenserwartung hat noch einen weiteren Effekt: die sogenannte »Vertikalisierung« der Verwandtschaft. Nicht selten leben heute Angehörige von vier Generationen zur gleichen Zeit und damit mehr denn je in der Vergangenheit. Allerdings hat sich die Zahl der Personen in den jeweiligen Generationen deutlich verringert. Seitenverwandte ersten und zweiten Grades haben an Zahl abgenommen, und außerhalb der engeren Kernfamilie sind diese Beziehungen für das konkrete Alltagsleben häufig ohne größere Bedeutung.
Was heißt das für den Familienalltag? Weniger Verwandte, die sich um die Kinder kümmern könnten, Tanten und Geschwister etwa. Weniger Cousins und Cousinen, die früher oft als Spielkameraden einfach da waren und damit den Betreuungsaufwand, den die Eltern zu leisten hatten, durch ihre Spielgemeinschaften verringert haben. Verwandtschaftliches Miteinander im Alltag ist derzeit nur noch selten anzutreffen und deswegen oft emotional überfrachtet und anstrengend, und sein Schwinden ist ein wichtiger Treiber der Betreuungslücken im modernen Familienalltag.
Auch das (unbeaufsichtigte) geschwisterliche Miteinander hat deutlich an Bedeutung verloren. Bei durchschnittlich 1,35 Kindern pro Frau (2023) und einem seit Jahrzehnten konstanten Anteil von 25 Prozent Einzelkindern wachsen immer weniger Kinder mit mehr als einem Geschwister auf.
Herausforderungen für Familien heute
Ein Problem des heutigen Familienlebens besteht darin, dass es auf einem hoch ambitionierten Ideal basiert, das in der Lebensrealität kaum umsetzbar ist: eine glückliche Partnerschaft auf Augenhöhe, beruflicher Erfolg für beide Partner, glückliche und erfolgreiche Kinder, viel selbstbestimmte Zeit, gesicherte materielle Verhältnisse und eine verlässliche Einbindung in Freundschafts- und Verwandtenkreise. Das gelingt den wenigsten. Familie und Familienleben leiden unter überfrachteten und vielfach nicht einlösbaren Erwartungen und zu hoch gesteckten Zielen.
Bei vielen fehlt die Bereitschaft, sich von diesen Idealen zu verabschieden oder die Lücke zwischen Ideal und Realität anzuerkennen. Viele leiden unter den Folgen ihres steten Strebens, die Lücke zu schließen oder wenigstens zu verkleinern und damit die kognitive Dissonanz zu reduzieren.
Familie ist ein Balanceakt: Zwischen Ich und Wir, Nähe und Distanz, Liebe und Kalkül, Norm und Eigensinn, Streit und Versöhnung, Idylle und Stress. Eine grundlegende Herausforderung der modernen Familie besteht darin, diese konkurrierenden Ziele irgendwie in Einklang miteinander zu bringen, sie auf eine zufriedenstellende Weise auszubalancieren – und das unter Wahrung der Interessen aller Beteiligten. Schwer erreichbar ist für viele die Harmonisierung ihres Strebens nach erfüllender Gemeinschaft und nach individueller Autonomie, nach dem Ich im Wir oder nach dem Wir im Ich – je nachdem. Fusion oder Assoziation? Das sind die Gestaltungsalternativen der Paare. Manche verschmelzen zum Wir und gehen fortan gemeinsam durchs Leben. Andere assoziieren sich, um gemeinsame Ziele zu verfolgen. Sind diese erreicht oder erscheinen sie als unerreichbar, wird die Partnerschaft aufgelöst.
Familienleben ist komplex. Eine Herausforderung besteht darin, dass Familie der Ort ist, an dem sich Privatheit und Öffentlichkeit, Ideal und Alltag in kulturell sehr typischer Form begegnen, aber eben immer auch auf sehr individuelle Weise in Einklang zu bringen sind.
Offenkundig hat der Familienalltag seine normativ bestimmte Selbstverständlichkeit verloren. Sie existiert nur noch als loser Rahmen im Hintergrund, nicht mehr als verbindliches Regelwerk. Familienleben muss hergestellt werden. »Doing family«, nicht »being family«, das ist die tagtägliche Herausforderung. Da gibt es viel zu verhandeln. Von der banalen Frage ›Wer bringt den Müll raus?‹ bis hin zur Frage ›Wollen wir noch ein Kind?‹. Zahlreiche Konfliktfelder bestimmen den Alltag, die Aushandlungen kosten Zeit und Energie und können die Partner verschleißen.
Routinen und vorhersehbare Abläufe im Familienalltag sind zunehmend infrage gestellt. Früher saß die ganze Familie wie selbstverständlich zusammen am Abendbrottisch. Heute ist die Organisation einer gemeinsamen Mahlzeit manchmal nur noch via Doodle herzustellen. Für die einen bedeutet das einen Verlust an Lebensqualität, Harmonie und Sicherheit, für andere ein Mehr an Flexibilität und individueller Freiheit.
Hinzu kommt, dass sich Familien schwertun, »mit der ganzen Bandbreite heutiger Möglichkeiten klarzukommen«, sagt uns der Leiter einer Familienberatungsstelle, »Verbindlichkeiten lösen sich auf, die Gesellschaft wird immer fluider, und das apokalyptische Grundrauschen in den Medien verunsichert zusätzlich«.
Anspruchsvoll ist auch die gesteigerte Erwerbstätigkeit von Müttern bei gleichzeitig kaum verändertem Erwerbsverhalten von Vätern. Die Zeit in und für Familie ist knapp geworden. Vielfach auch die Energie für die Pflege der Familienbeziehungen. Alles muss reibungslos funktionieren. Schon kleine Irritationen können große Störungen auslösen. Bekommt das Kind in der Kita Bauchweh und soll abgeholt werden, entsteht oftmals ein kaum zu lösendes logistisches Problem. Erzieherinnen berichten uns, dass Eltern in solchen Fällen teilweise schlecht erreichbar seien oder man ihrem ruppigen Ton den Stress anmerke, den der Anruf auslöse. Familie erscheint als Balanceakt auf einem sehr schmalen Grat.
Familie über mehrere Generationen – Enkel werden knapp
Großeltern fungieren oftmals als Bindeglied zwischen der Familie und den öffentlichen Institutionen, wenn sie als verlässliche Unterstützung der Eltern zur Verfügung stehen. Wachsende Wohnortmobilität zwischen den Generationen, höhere Freizeitorientierung der Großelterngeneration und ihre deutlich gestiegene Erwerbsbeteiligung sind Faktoren, die diese Unterstützungsleistungen für eine wachsende Zahl von Familien erschweren und damit das Familienleben der mittleren Generation beträchtlich verkomplizieren.
Eine verlässliche Betreuung der Kinder durch die Großeltern ist für die mittlere Generation oft der einzige Weg, Elternschaft und Alltag zu bewältigen. Wer Großeltern in der Nähe hat, hat neben einer regelmäßigen Betreuung auch die Chance zur Notfallbetreuung, etwa wenn die Kita überraschend geschlossen bleibt. Wenn sie verfügbar sind, kümmern sich Großeltern zumeist gerne um ihre Enkel, wie eine neue Studie[4] veranschaulicht. Etwa ein Drittel der Kinder unter zehn Jahren wird regelmäßig von den Großeltern beaufsichtigt und betreut. Das Volumen der Betreuung ist gewaltig. In den Jahren 2020/21 betreuten Großeltern »zwischen 1,75 und 1,95 Milliarden Stunden«[5] ihre Enkelkinder. Diese Betreuungsintensität ist über die letzten zwanzig Jahre unverändert geblieben. Die Studie zeigt auch, dass die Kita zwar an Bedeutung gewonnen hat, die Großeltern aber dadurch nicht verdrängt worden sind. Vielmehr kompensieren sie die stärkere Erwerbsbeteiligung der Mütter und leisten damit auch einen messbaren Beitrag zur Erhöhung der Lebenszufriedenheit in der Familie.
Die Beziehungen zwischen Großeltern, ihren Kindern und den Enkelkindern sind insgesamt meist gut und intensiv. Wahrscheinlich waren sie noch nie so gut wie gegenwärtig. Historisch neu ist ein weiteres Kennzeichen: Oft gibt es mehr Großeltern als Enkelkinder. Das führt dazu, dass Großeltern manchmal um knappe Umgangszeiten mit ihren Enkeln konkurrieren, und nicht wenige möchten gerne mehr Zeit mit ihnen verbringen.
Die Rolle der Großeltern, auch das ist historisch neu, beschränkt sich nicht auf die Betreuung der Enkelkinder und die oft tatkräftigen Hilfeleistungen für die mittlere Generation. Immer bedeutsamer geworden ist daneben die finanzielle Unterstützung ihrer Kinder und Enkel. Mehr dazu im fünften Kapitel.
Die Familie als Hafen?
Wir leben in stürmischen Zeiten. Da lockt die traute Familie als »Resonanzhafen«, der Sehnsüchte weckt. In einer von Entfremdung, Beschleunigung und Wettbewerb geprägten Welt wird die Familie zum »Anker für Empathie, Hingabe, Zuwendung, Sinn (und) Bedeutung«[6], notiert der Soziologe Hartmut Rosa in seiner Soziologie der Weltbeziehung.
Das hier benutzte Bild vom Hafen ist insofern bemerkenswert, als es nur eines von zwei recht unterschiedlichen Framings bedient. Im ›Hafen der Ehe‹ angekommen, ist ein altes Bild, das symbolisiert, dass man nach langer Suche, nach wilden Zeiten endlich angekommen ist. Dauerhaft vor Anker geht, sich für immer in ruhigen Gewässern befindet, gefahrlos dümpelt, aber eben vielleicht auch horrende Liegegebühren zu zahlen hat. Der Hafen liegt bei dieser Idee am Ende der Reise.
Das andere Framing des Hafens ist das der Zwischenstation. Ankommen, um weiterzuziehen. Der Seemann erreicht einen Hafen zum Be- und Entladen mit der Absicht, ihn alsbald wieder zu verlassen. Das ist nicht unbedingt kompatibel mit dem romantisierten Bild von Familie als dauerhafter Wohlfühloase in den Turbulenzen des Lebens dort draußen. Aber es passt womöglich zur Idee von Familie des modernen umherstreifenden Individualisten, der gerne verweilt, aber noch lieber weiterzieht, um Neues zu entdecken und sich immer weiterzuentwickeln. Manche suchen Herausforderungen und Sensationen, andere Ruhe und Vertrautheit. Je nachdem, Familie kann beides bedienen.
2Kindheit im kulturellen Wandel
Wie robust ist das verletzliche Kind?
Kindheit – Mehr Kultur als Natur
Wenn wir Kindern begegnen, wenn wir über Kinder sprechen, haben wir meist bestimmte Bilder im Kopf. Wie Kinder so sind, wie sie sein sollten, was als normal, angemessen und altersgemäß gilt. Diese Bilder, was das ›natürliche‹ Wesen des Kindes sei, entstehen und verfestigen sich vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen, tradierter Überzeugungen und aus Büchern und digitalen Medien entnommenen ›Wahrheiten‹. Mit einer gewissen Selbstverständlichkeit wird dabei vorausgesetzt, dass dieses ›natürliche‹ Wesen des Kindes natürlich, also ursprünglich im Wortsinn, ist, unabhängig von Zeit und Raum, Kultur und Gesellschaft.
Ja, Kinder sind kleiner und schwächer, sie sind unmittelbarer in ihren Emotionen als Erwachsene, sie sind ungestümer, rennen mehr, weinen öfter, sind neugieriger und weniger angepasst, kindliche (Vor-)Freude hat eine ganz eigene Qualität. Es gibt also Verhaltensweisen, die charakteristisch für das Kindesalter sind. Jenseits dieses Empfindens und Verhaltens existieren mächtige kulturelle Zuschreibungen und Klischees des ›typisch Kindlichen‹. Diese Muster prägen das Leben der Kinder und den Umgang der Erwachsenen mit ihnen.
Doch nicht nur die soziale Figur ›Kind‹ ist kulturell beeinflusst, auch die Lebensphase Kindheit ist es. Kindheit ist keine natürliche, sondern eine zutiefst gesellschaftlich geformte und bewertete Lebensphase. Schon ein kurzer Blick in die Vergangenheit verdeutlicht die Variabilität sowie die Wirksamkeit kultureller Zuschreibungen und Deutungsmuster.
Bevor wir einen Blick auf den historischen Wandel der sozialen Konstruktionen von Kindern und Kindheit werfen, noch einige Bemerkungen zur Frage: Was bedeutet es, Kinder und Kindheit als sozial konstruiert zu betrachten? Diese Perspektive besagt, dass es sich bei Kindheit, wie bei allen anderen Lebensphasen auch, nicht nur um ein natürliches, biologisches, sondern auch um ein kulturelles Phänomen handelt. Ein Phänomen, das durch zwei Mechanismen gekennzeichnet ist: die ›Zuschreibung‹ von Eigenschaften und die ›Zuweisung‹ eines sozialen Status im gesellschaftlichen Gefüge.
Zuschreibungen erzeugen oder verstärken Eigenschaften und Verhalten. Sagt man dem Kind: »Du kannst deine Schuhe noch nicht binden, ich mache das schon«, dann wird es seine Schuhe nicht binden, und das führt wiederum zur Bestätigung der Annahme, es könne die Schuhe nicht binden, und letztlich zur kindlichen Erwartung, die Erwachsenen werden seine Schuhe schon binden. Johannes Giesinger schreibt dazu: »Kinder werden auch deshalb zu Kindern, weil ihnen im Rahmen diskursiver Praktiken bestimmte ›kindliche‹ Merkmale zugeschrieben«[1]





























