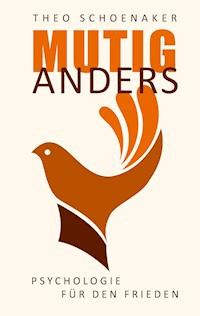
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir brauchen nicht jedermanns Freund zu sein. Was wir brauchen, ist ein gemeinsames Ziel, an das wir glauben und wofür wir uns einsetzen wollen mit der Grundeinstellung: "nicht entmutigen", "wo kann ich helfen?", "was kann ich beitragen?" Und das in dem tiefen Bewusstsein, dass wir mutig anders können, mit dem Ziel Frieden! Nur Frieden zwischen den Menschen untereinander und die Veredelung unseres eigenen Charakters, kann auf längere Sicht zu einem Zustand von Weltfrieden führen. Dabei kann die Psychologie nützliche Beiträge liefern. Es ist vielleicht nur ein kleiner Beitrag, aber eine stetig wachsende Bewegung von Menschen, die eine Psychologie für den Frieden leben, kann das Denken der Menschen verändern. Der Autor unterscheidet zwischen dem fernen Frieden, den er in weiter Ferne erkennt und dem nahen Frieden, den man auf dem Weg dahin immer wieder selbst herstellen oder beeinflussen kann. Dieses Buch ist ein faszinierender Beitrag zu einer Psychologie für den Frieden auf der Grundlage der Individualpsychologie Alfred Adlers (1870-1937), mit - wie vom Autor gewohnt - vielen praktischen Hinweisen, Beispielen und Geschichten. Es ist ein guter Begleiter für Fachleute, eine Orientierungshilfe für Ratsuchende und eine Quelle der Hoffnung für jeden, der sich Sorgen um die Zukunft der Menschheit macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Ein gewaltiges Gemeinschaftsgefühl und das völlige Ende von Gier und Macht bei dem Einzelnen und bei den Völkern“ Alfred Adler
Inhalt
Vorwort von Winfried Berner
Darum geht es
1.1 Der Anlass
1.2 Friedenspsychologie
1.3 Psychologie für den Frieden
Eine Psychologie für den Frieden
2.1 Wie es begann
2.2 Du machst den Unterschied
2.3 Es beginnt bevor du es weißt - Die Meinungsbildung
2.4 Unverwechselbar eingraviert. Typisch du!
2.5 Fortschritte machen
2.6 Welche Psychologie begünstigt Meinungsbildung für den Frieden?
2.7 Warum ist so eine Lebensart nicht Allgemeingut?
Die soziale Orientierung
3.1 Das Gefühl dazuzugehören
3.2 Das Gemeinschaftsgefühl
3.3 Die holistische Sicht – Der Mensch als Ganzheit
3.4 Die Zielorientierung
3.5 Beschränkte Wahlmöglichkeiten
3.6 Minderwertigkeitsgefühle für den Frieden
3.7 Minderwertigkeitsgefühle für den Krieg
Der Nahe Frieden
4.1 Nah und fern
4.2 Das soziale Übungsfeld
4.3 Die Üble Nachrede - Eine soziale Krankheit
4.4 Selbstgespräche
4.5 Ermutigung
Und zum Schluss
Was wirklich wichtig ist!
Epilog von Urs Bärtschi
Dank
Über den Autor
Literatur
Ausführliches Inhaltsverzeichnis
Vorwort von Winfried Berner
Darum geht es
1.1 Der Anlass
1.2 Friedenspsychologie
1.3 Psychologie für den Frieden
Eine Psychologie für den Frieden
2.1 Wie es begann
2.2 Du machst den Unterschied
2.3 Es beginnt bevor du es weißt - Die Meinungsbildung
2.4 Unverwechselbar eingraviert. Typisch du!
2.5 Fortschritte machen
2.6 Welche Psychologie begünstigt Meinungsbildung für den Frieden?
2.6.1 Sozialer Verstand
2.6.2 Gut oder schlecht?
2.6.3 Das Leben als Aufgabe
2.6.4 Zusammen oder allein?
2.6.5 Holismus oder Dualismus?
2.6.6 Es ist uns gegeben
2.6.7 Verwirklichung von Menschenrechten
2.6.8 Immer auf ein Ziel zu
2.6.9 Vom Minus zum Plus
2.6.10 Ermutigung im Gemeinschaftsleben
2.7 Warum ist so eine Lebensart nicht Allgemeingut?
Die soziale Orientierung
3.1 Das Gefühl dazuzugehören
3.1.1 Psychische Gesundheit
3.1.2 Der Missing Link
3.1.3 Untersuchungen
3.1.4 Das Gefühl ist dein Beleg
3.1.5 Warum ist das Thema so wichtig?
3.1.6 Flüchtlinge
3.1.7 Die Bedeutung für Krieg und Frieden
3.1.8 Die gute Nachricht
3.1.9 Wir können Einfluss nehmen
MUTIG ANDERS:
Klein anfangen
Hin zum Gemeinschaftsgefühl
Selbst üben
3.2 Das Gemeinschaftsgefühl
3.2.1 Mit dem Herzen des anderen
3.2.2 Der Maßstab für psychische Gesundheit
3.2.3 Warum Gemeinschaftsgefühl jetzt?
3.2.4 Wo und wie wird man Gemeinschaftsgefühl lernen?
Der Familienrat / Klassenrat
3.2.5 Gemeinschaftsgefühl in Beratung und Psychotherapie
3.2.6 Untersuchung zur heilenden Kraft von Gemeinschaftsgefühl
3.2.7 Fortschritt unvermeidlich
Beispiele zur Orientierung
Kriegszeit
Mitgefühl
Die drei Söhne
3.3 Die holistische Sicht – Der Mensch als Ganzheit
3.3.1 Verantwortung
3.3.2 Was ich tue, ist, was ich will
3.3.3 Es geht nicht
3.3.4 Es geht auch anders
Die gute Nachricht
3.3.5 Das Leben als Produkt unsererEntscheidungen
3.3.6 Hier ist eine Aufgabe
MUTIG ANDERS:
Trainieren im Kleinen
3.3.7 Holistische Systeme und Frieden
MUTIG ANDERS:
Teil des Ganzen sein
3.4 Die Zielorientierung
3.4.1 Der Sinn unseres Handelns
Beispiele
Spielen mit Zielen
3.5 Beschränkte Wahlmöglichkeiten
3.5.1 Änderungsmöglichkeiten
MUTIG ANDERS:
Etwas ändern?
3.6 Minderwertigkeitsgefühle für den Frieden
3.6.1 Das Vollkommenheitsstreben
3.6.2 Ich will besser werden als ich bin
3.7 Minderwertigkeitsgefühle für den Krieg
3.7.1 Das soziale Minderwertigkeitsgefühl
3.7.2 Ich will besser sein als du
3.7.3 Abnormale Minderwertigkeitsgefühle
3.7.4 Das Streben nach Überlegenheit und Macht
3.7.5 Der Ursprung des Machtstrebens
3.7.6 Die Kehrseite
Der Nahe Frieden
4.1 Nah und fern
4.2 Das soziale Übungsfeld
4.2.1 Mitspielen
4.2.2 Die Liebe
Der kleine Frieden
Pflanze eine Kerze
MUTIG ANDERS:
Liebe kann man sehen
Checkliste Liebe
Drei Grundregeln für Zusammenarbeit
Die innere Verbindlichkeit
Adlers Brief an seine Tochter Valerie
Denken und Fühlen in Zuneigung
MUTIG ANDERS:
Zwei Dinge
Einander kennenlernen
MUTIG ANDERS:
Das ZübaMo
Streiten
Aussicht
4.2.3 Die Arbeit
MUTIG ANDERS:
(Selbst)Ermutigung
4.2.4 Die Gemeinschaft
Der freundliche Blick
Der gute Umgang mit sich selbst
MUTIG ANDERS:
Sei es jetzt
Das Gute sehen
4.3 Die Üble Nachrede - Eine soziale Krankheit
4.3.1 Die Definition
MUTIG ANDERS:
Sprich Gutes
4.3.2 Die Wahrheit
4.3.3 Die Emotionen
4.3.4 Das Ziel
4.3.5 Die Folgen
4.3.6 Mach´s anders
MUTIG ANDERS:
Die Fragen von Sokrates
Mach´s anders
4.3.7 Üble Nachrede im größeren Zusammenhang
4.4 Selbstgespräche
4.4.1 Entdecke selbst
MUTIG ANDERS:
Sich selbst zuhören
Was sagst du, wenn du in dir selbst redest?
4.4.2 Bewusster werden
MUTIG ANDERS:
Selbstgespräche steuern
Augen auf und atmen
SmiLa
Gedanken binden
Vater und Sohn
Besser und besser...
Positive Formulierungen
Ramonas Überlastung
4.5 Ermutigung
4.5.1 Vom Minus zum Plus
4.5.2 Drei Momente
4.5.3 Die zwei Seiten
4.5.4 Mehr als schöne Worte
4.5.5 Ermutigungswachstum
Supermarkt
Chance genutzt
Ein prächtiges Kind
Das Familiendiner
Zehn Zentimeter größer
Und zum Schluss
Was wirklich wichtig ist!
Epilog von Urs Bärtschi
Dank
Über den Autor
Literatur
Vorwort
In seinem Vortrag "Wir könnten so viel glücklicher sein" (2005) interpretierte Theo Schoenaker einen Auftritt des russischen Präsidenten Vladimir Putin als einen Appell, ja geradezu als eine flehentliche Bitte um Zugehörigkeit zu der europäischen Staatengemeinschaft. Ich war damals skeptisch: Liefert solch eine psychologische Interpretation wirklich eine angemessene Erklärung für Ereignisse in der internationalen Politik? Oder ist das ein unangemessenes "Psychologisieren", das eher die Gefahr birgt, politische Entwicklungen in naiver Weise fehl zu deuten?
Heute bin ich mir da nicht mehr so sicher. Wenn man die Entwicklung von Putins Politik in den letzten zehn Jahren betrachtet, ist es zumindest nicht abwegig, in seinem ruppigen und provokativen Kurs eine Trotzreaktion auf die Verweigerung der Zugehörigkeit und eines anerkannten Platzes in der Staatengemeinschaft zu sehen: "Wenn sie mich nicht mitspielen lassen, dann sollen sie zumindest spüren, dass ich dazu in der Lage bin, ihnen ihr Spiel nachhaltig zu verderben!"
Auch die große Politik wird letztlich nicht von Halb- oder Dreiviertel-Göttern gemacht, sondern von Menschen.
Wer sich nicht zugehörig fühlt und den Eindruck hat, dass ihm ein respektierter Platz verwehrt wird, der geht nicht einfach traurig nach Hause – vielmehr wird er sich wahrscheinlich, wie es Alfred Adler und Rudolf Dreikurs genannt haben, "auf die unnütze Seite des Lebens schlagen" und denen, zu denen er nicht gehören darf, Schwierigkeiten machen. Und dann ist es eher eine Frage der persönlichen Energie, Intelligenz und der Handlungsmöglichkeiten, wie groß diese Schwierigkeiten sind.
Das altbewährte individualpsychologische Konzept des Zugehörigkeitsgefühls wird so zum Schlüssel einer "Psychologie für den Frieden" – im Großen wie im Kleinen. Wenn Jugendliche, sei es in den französischen Banlieues, in Ostdeutschland oder in Flüchtlingsheimen, die Überzeugung gewinnen, in der "Mehrheitsgesellschaft" keine Chance zu haben, dann besteht gleichfalls die Gefahr, dass sich viele von ihnen auf die unnütze Seite des Lebens schlagen. Und dann ist es eher eine Frage biographischer Zufälle, ob sie zu militanten Neonazis, zu Kleinkriminellen oder zu Islamisten werden. Wo sie Zugehörigkeit finden, da docken sie an und übernehmen das Weltbild der jeweiligen Gruppe.
Unsere sozialen Probleme sind unser soziales Echo – im Privaten ebenso wie in Politik und Gesellschaft. Wenn wir uns um die Integration von "Gastarbeitern", Arbeitsmigranten und Flüchtlingen nicht kümmern, dann ist die logische Konsequenz, dass sie Gegengesellschaften bilden. Wenn wir so wirtschaften, dass der Klimawandel im Nahen Osten, Nordafrika und anderswo für anhaltende Dürren sorgt, ist die logische Konsequenz, dass noch mehr Armuts- und Klimaflüchtlinge zu uns kommen. Wenn wir diesen Flüchtlingen keine wirkliche Chance geben, sich mit ehrlicher Arbeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen und als Gleichwertige einen respektierten Platz in unserer Gesellschaft erwerben, ist die logische Konsequenz, dass sie sich gegen und stellen und uns in die größten Schwierigkeiten bringen.
Theo Schoenakers "Psychologie für den Frieden" kommt da gerade im richtigen Moment, denn wir stehen in Europa wohl vor der größten Mutprobe seit langem. Ob wir "das schaffen" oder nicht, liegt – noch – in unserer Hand. Aber es könnte uns leicht aus der Hand gleiten. Das Einzige, was wir dazu tun müssen, ist – nichts. Und das, so könnten Zyniker sagen, wird ja wohl noch zu schaffen sein.
Klar, wir haben die Flüchtlinge nicht bestellt. Wir haben es ja kaum bemerkt, wie unser Lebensstil, der ja nicht zuletzt auf billigem Öl und einem Welthandel zu unseren Bedingungen aufbaut, in anderen Ländern eine Situation hat entstehen lassen, die dort ein akzeptables Leben kaum noch möglich macht. Wir wissen viel zu wenig darüber, in welchem Ausmaß Kriege und politische Instabilität in vielen der Länder, aus denen die Flüchtlinge kommen, die Spätfolge wiederkehrender Interventionen des Westens ist.
Aber nun ist die Situation, wie sie ist. Die Flüchtlinge sind da, und damit sind sie Teil unseres Lebens und unserer Verantwortung geworden. Nun nützt es nichts, über die Ursachen zu streiten, und es nützt noch weniger, nach Schuldigen zu suchen. Worauf es jetzt ankommt, ist, das Notwendige zu tun, damit sich die Situation nicht noch weiter verschlimmert – und damit sie nach Möglichkeit einen guten Verlauf nimmt. Oder, wie es Theo Schoenaker so wunderbar sagt, "mutig und unvollkommen unseren Beitrag zu leisten".
Einen Haken hat es dennoch mit dem psychologischen Wissen, das Schoenaker uns in diesem Buch anbietet: Wir können damit nicht einfach so weitermachen wie bisher. Wir können uns immer noch frei entscheiden, etwas zu unternehmen und unseren Beitrag zu leisten oder nichts zu tun. Aber wir können nicht mehr so tun, als würden wir die logischen Konsequenzen nicht kennen. Mehr Wissen heißt auch mehr Mitverantwortung für das, wie unsere Zukunft aussehen wird.
Dafür braucht es Mut – aber da sind wir bei Theo Schoenaker ja an der besten denkbaren Adresse. Lassen wir uns von seinem neuen Buch dazu inspirieren, mutig und unvollkommen unseren Beitrag zu leisten!
Winfried Berner
Dipl. Psychologe, Change Coach, Buchautor
1 Darum geht es
1.1 Der Anlass
Der Wunsch dieses Buch zu schreiben, entstand aus einem Schriftwechsel mit einer früheren Patientin. Sie ist Sozialarbeiterin geworden. Sie arbeitet im Bereich der Jugend und Familienhilfe. Das Buch beginnt mit meiner Reaktion auf ihre erste Kontaktaufnahme. Mal spreche ich sie als Kollegin oder Mitarbeiterin in der gemeinsamen Arbeit für den Frieden an, ein anderes Mal als Patientin, die sich mit sich selbst auseinandersetzt. Es kristallisierte sich die Frage heraus, ob es eine Psychologie für den Frieden geben könnte oder ob es diese vielleicht schon gibt.
Auszug aus dem Schriftwechsel:
Du schreibst, dass die täglichen Berichterstattungen in den Medien dir mitunter ein Gefühl von Machtlosigkeit und Einsamkeit geben und dass du dir Sorgen machst. Überall auf der Welt siehst du Machtmissbrauch, Krieg, Terrorismus, Hungersnot, hilflose Flüchtlinge in Strömen, Misshandlung, Elend, Leid. Im Großen und im Kleinen. Manchmal denkst du, dass alles was du tust, in diesem Licht gesehen, so sinnlos ist. Deswegen fragst du, was du, was wir noch tun können und insbesondere, was die Psychologie an Möglichkeiten zu bieten hat.
Auch mir sind ein Gefühl von Wut und die Fragen nach dem Sinn unserer gut gemeinten Anstrengungen nicht fremd. Ich will dann mit dir und vielen anderen am liebsten laut rufen: „Hört auf! Es ist genug!“ Dann will auch ich eine kurzfristige Lösung und ich verstehe, dass die Menschen zu Gott flehen und um Frieden beten. Jetzt! Aber es gibt sie nicht, die kurzfristigen Lösungen.
Ideologien kann man nicht auf dem Schlachtfeld vernichten. Und wenn schon ein Krieg gewonnen wird, ist der Verlierer der Feind von morgen. Wenn ein Friedensvertrag gezeichnet wird, ist die Feindschaft in den Herzen und Köpfen der Menschen die Grundlage für den nächsten Krieg.
Wir müssen an grundsätzlichen Lösungen arbeiten, mit längeren Laufzeiten, sehr langen Laufzeiten. Dabei können Politik, Wissenschaft, Religion, Kunst, Wirtschaft und die Medien in respektvoller Zusammenarbeit, mit dem gemeinsamen Ziel Weltfrieden, ihren Beitrag leisten.
Ich will gerne mit dir danach schauen, was mit Hilfe der Psychologie sein könnte, aber hauptsächlich nach dem, was wir jetzt dafür tun können. Diese zwei Sichtweisen – langfristig denken und jetzt handeln – fließen in folgender Betrachtung immer wieder ineinander. Manchmal mag es dir wie eine Utopie vorkommen und dann wieder wie eine sofort ausführbare Aufgabe – der ferne und der nahe Friede.
Die Psychologie ist die Wissenschaft, die die Beweggründe und das Verhalten des Menschen verstehen und erklären will. Sie will helfen, das Verhalten zum Guten zu ändern. Deshalb ist die Psychologie der richtige Adressat für deine Frage. Nur Frieden zwischen den Menschen untereinander und die Veredelung unseres eigenen Charakters, kann auf längere Sicht zu einem Zustand von Weltfrieden führen. Dabei kann die Psychologie nützliche Beiträge liefern. Es ist vielleicht nur ein kleiner Beitrag, aber eine stetig wachsende Bewegung von Menschen, die eine Psychologie für den Frieden leben, kann das Denken der Menschen verändern.
1.2 Friedenspsychologie
Die Psychologie ist auf diesem Gebiet nicht untätig. Die Friedenspsychologie ist beispielsweise innerhalb der Psychologie ein Fachgebiet. Sie beschäftigt sich mit Frieden, Konflikten, Gewalt und Krieg. Sie untersucht, was Frieden ist und welche Faktoren zu Frieden führen. Sie studiert psychologische Aspekte von Entstehung, Eskalation, Verringerung und Lösung von Konflikten, die psychosozialen Bedingungen, die eine positive oder negative Auswirkung auf einen dauerhaften Frieden haben, und sie beschäftigt sich mit den psychosozialen Auswirkungen von Krieg und Gewalt. Sie probiert mit ihren Untersuchungsergebnissen auch Einfluss auf die Politik und die Wirtschaft auszuüben. Das ist Friedenspsychologie, aber noch keine Psychologie für den Frieden.
Die Psychotherapie entwickelt Therapiemodelle, die helfen, die Folgen von Krieg und Gewalt zu lindern. Trauma Therapien helfen dabei, die psychischen Folgen von Gewalterfahrungen zu heilen oder zu mindern.
Es gibt auch internationale Organisationen von Psychologen1, die sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind.
Verschiedene psychologische Schulen, die in der humanistischen Psychologie ihre Wurzeln haben, liefern im Ansatz sinnvolle Beiträge, die mehr oder weniger mit ihrer therapeutischen Arbeit verbunden sind. Das gilt insbesondere für die Arbeit von Viktor Frankl (1905-1997), ein Schüler von Alfred Adler (1870-1937). Seine Logotherapie will dem Patienten auch helfen, den Sinn seines Lebens zu finden. Mit Sinngebung zielt Frankl immer auf ‚ich und der andere‘, ‚ich und die Welt‘. Frankl bietet mehr als nur Psychotherapie. Er geht darüber hinaus, wenn er von „kollektiver Psychohygiene“ und von „sozialer Psychotherapie“ spricht. Er bietet ein interkulturelles Menschenbild, in dem Freiheit und verantwortliches Handeln zentral stehen. Sinnvolles Handeln ist ethisches Handeln, das immer den anderen und die Welt mit einschließt. Meines Erachtens bietet Frankl ernst zu nehmende Lösungsansätze bei der Suche nach einer Psychologie für den Frieden.
1 Als Beispiel siehe: www.psysr.org
1.3 Psychologie für den Frieden
Mit „Psychologie für den Frieden“ meine ich eine Psychologie, die den einzelnen Menschen motiviert, den Frieden leben zu wollen und die die Mittel zur Verwirklichung dazu bereithält. Frieden ist ein Produkt des Einzelnen in seiner Beziehung zum Mitmenschen und der Gemeinschaft.
Unfrieden entwickelt und verstärkt sich in den Köpfen derjenigen, die nicht gelernt haben, mit Kritik, Ablehnung, Enttäuschung und Minderwertigkeitsgefühlen umzugehen. Die Erziehung bzw. die Eltern spielen dabei als Modell eine ausschlaggebende Rolle. Wenn die Eltern in Unfrieden leben, einander angreifen und ablehnen, dann lebt dieser Umgangsstil in der Familie und setzt sich fort in der Schule, auf der Straße, in sozialen Gruppen, in den Medien und in der Gesellschaft überhaupt. Die Psychologie kann dort, an der Wurzel des Unfriedens, nützliche Arbeit leisten.
Die Psychologischen Schulen könnten noch mehr tun um Psychologie zu den Menschen zu bringen. Sie haben sich Jahrzehnte lang bemüht, ihr Wissen in Fachjargon zu zementieren für ihre eigene elitäre Akademische Gruppe. Die Psychologie hat im Allgemeinen auch noch keinen guten Ruf. Es fehlt an Information darüber, was Psychologie ist und was sie für die Menschen – ohne dass diese psychisch krank sind – bedeuten kann. Logisch also, dass sie einen zu kleinen Platz in der Lösung des Kriegs- Friedensproblems hat.
Es wird schon viel getan und es gibt nützliche Entwicklungen, und dennoch hat Psychologie noch immer etwas Geheimnisvolles oder etwas, das mit psychisch krank sein zu tun hat.
Wenn ich erzähle, dass ich auf dem Gebiet der Psychologie arbeite, dann spüre ich mitunter eine gewisse Zurückhaltung. Manche sagen: „Oh, sind Sie jetzt dabei, mich zu analysieren?“ Oder: „Nun, dann erzählen Sie mal, was für eine Abweichung ich habe.“ Andere sagen: „Ich gehe nicht zum Psychologen; ich bin doch nicht gestört!“
Man braucht nicht krank zu sein, um besser werden zu wollen. Die Psychologie kann uns so viel mehr lehren über unser eigenes Verhalten und das der anderen Menschen. Auch können wir neue Einsichten bekommen über unseren persönlichen Wert und unsere Möglichkeiten, friedensstiftend Einfluss auszuüben auf das gesellschaftliche Leben.
Dafür brauchen wir eine psychologische Schule, die mit ihrem Konzept das Behandeln psychischer Krankheiten übersteigt, und die ein psychologisch-philosophisches Lebensmodell anbietet, das jeder verstehen und womit jeder, auch unabhängig von einem anerkannten Psychotherapeuten, ganz praktisch etwas anfangen kann. So eine Psychologie wird - ohne selbst eine Religion zu sein -, sich mit dem religiösen Grundsatz verbinden: “Was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem anderen zu“, die goldene Regel aller großen Offenbarungsreligionen, und klar machen, dass „der andere“, jedes lebende Wesen auf diesem Planeten ist, ohne Ausnahme. Das kann dann eine „Psychologie für den Frieden“ sein.
2 Eine Psychologie für den Frieden
2.1 Wie es begann
Um 1900 herum begann Alfred Adler, damals noch Mitarbeiter Sigmund Freuds (1856-1939), seine eigenen Gedanken über den Menschen und sein normales und abnormales Verhalten zu formulieren. 1911 war klar, dass er sich derart von Freuds Überzeugungen distanziert hatte, dass eine fruchtbare Zusammenarbeit nicht mehr möglich war.
Im ersten Weltkrieg diente Adler als Lazarett-Arzt an der Front. Er erlebte die schrecklichen Folgen des Krieges bei den körperlich und seelisch verwundeten Soldaten, die überdies auch noch Typhus hatten. Er erlebte als Helfer seine Hilflosigkeit. Er wurde sich zutiefst dessen bewusst, dass die Welt nie durch Waffen, sondern nur durch Gemeinschaftsgefühl gerettet werden kann.
Zusammenarbeit mit anderen und die Überwindung des Machtstrebens sagte er, ist der Preis, den wir für Wohlfahrt und Weltfrieden bezahlen müssen. Diese innere Haltung, muss in den frühen Kinderjahren erlernt und eingeübt werden, so dass dies auf Dauer, in der weiteren Entwicklung der Menschheit so selbstverständlich wird wie „das Atmen und der aufrechte Gang“. Seine Individualpsychologie sollte beitragen, dass die Menschen zu mutigen, unabhängigen Individuen werden, die sich für die ganze Menschheit verantwortlich fühlen.
2.2 Du machst den Unterschied
Die Mittel, die diese Psychologie zur Verfügung stellt, können dem Denken der Menschen eine neue Richtung geben, und sie vertraut machen mit solchen Ideen, die Krieg und menschliche Grausamkeit ausbannen und helfen, menschliches Machtstreben in Bahnen zu leiten. Dabei kommt es auf den Einzelnen in seiner Beziehung zum anderen an. Das ist die Herausforderung.
Sprechen wir von Person eins und Person zwei. Person zwei kann eine Person, eine Gruppe oder die ganze Menschheit sein.
2.3 Es beginnt bevor du es weißt - Die Meinungsbildung
„Es ist klar, dass wir nicht durch Tatsachen, sondern durch unsere Meinungen über die Tatsachen beeinflusst werden.“3
Wie kommt es dazu, dass wir uns verhalten wie wir uns verhalten und nicht anders? Unsere Meinungen regieren unser Leben! Sie machen uns zu einzigartigen Persönlichkeiten.
In den ersten Tagen seines Lebens schon, beginnt das Neugeborene mit Hilfe seiner kreativen Kraft (Adler), sich eine gefühlsmäßige Meinung über die Menschen und über seine Umgebung zu bilden.
Da ist zuerst die Mutter. Ihre Haut, ihr Geruch, ihr Atemrhythmus, die Veränderungen, wenn sie glücklich oder verärgert ist. Das Kind versteht auf einer ganz basalen Ebene, ob es willkommen ist, ob es abgewiesen wird, ob man es liebt, ob andere sich über seine Anwesenheit freuen, oder ob die anderen eher gleichgültig oder vielleicht ambivalent sind.





























