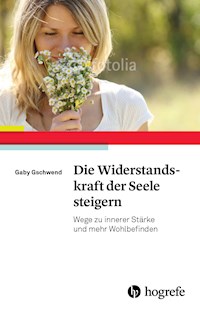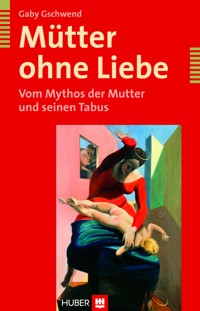
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Medien und Werbung setzen uns täglich eine heile, idyllische Mutter-Kind-Welt vor. Es gilt als ein Sakrileg, die Position der Mutter anzugreifen oder das Wesen der Mutter-Kind-Beziehung zu hinterfragen. Das vorliegende Buch strebt, jenseits der verklärenden Sicht des Muttermythos, eine sachlichere und vollständigere Wahrnehmung von Müttern und Mutter-Kind-Beziehungen an, denn es kann zu viel Verwirrung und unerkanntem Leid in der Beziehung zwischen Müttern und ihren Kindern führen, ein idealisiertes und falsches Bild der Mutter aufrechtzuerhalten. Zu den hier thematisierten 'Unaussprechlichkeiten' der Mutter-Kind-Beziehung gehören insbesondere Aspekte wie das Eigeninteresse der Mutter am Kind, die Ablehnung der Mutterschaft und das Phänomen der Abneigung, Aggression und Destruktivität gegen die eigenen Kinder, das wohl eines der letzten großen Tabuthemen unserer Gesellschaft ist. Das Buch rüttelt am Mythos der Mutter und thematisiert realitätsnah verborgene und verleugnete 'Schattenseiten', die dem gesellschaftlichen Bild der Mutter nicht entsprechen, jedoch zur alltäglichen Realität von Kindern und Müttern gehören. Dabei spricht es sowohl eine breite Öffentlichkeit als auch ein interessiertes Fachpublikum an und lädt zur Diskussion ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Gaby Gschwend
Mütter ohne Liebe
Aus dem Programm Verlag Hans Huber
Psychologie Sachbuch
Von Gaby Gschwend ist im Verlag Hans Huber weiterhin erschienen:
Nach dem Trauma101 S. (ISBN 978-3-456-84305-6)
Notfallpsychologie und Trauma-Akuttherapie101 S. (ISBN 978-3-456-84088-8)
Trauma-Psychotherapie133 S. (ISBN 978-3-456-84074-1)
Im Verlag Hans Huber sind außerdem erschienen – eine Auswahl:
J. Berryman / E. Ockleford / K. Howells / D. Hargreaves / D. WildburPsychologie – Einblicke in ein faszinierendes Fachgebiet344 S. (ISBN 978-3-456-84681-1)
G. BodenmannDepression und Partnerschaft128 S. (ISBN 978-3-456-84724-5)
M. K. Dugan / R. R. HockNeu anfangen nach einer Misshandlungsbeziehung280 S. (ISBN 978-3-456-84517-3)
M. J. V. FennellAnleitung zur Selbstachtung271 S. (ISBN 978-3-456-84145-8)
H. KennerleySchatten über der Kindheit219 S. (ISBN 978-3-456-83963-9)
Informationen über unsere Neuerscheinungen finden Sie im Internet unter: www.verlag-hanshuber.com
Gaby Gschwend
Mütter ohne Liebe
Vom Mythos der Mutter und seinen Tabus
Verlag Hans Huber
Das Umschlagbild stammt von Max Ernst:Die Jungfrau züchtigt das Jesuskind vor drei Zeugen.Der Abdruck erfolgt mit Genehmigung des Rheinischen Bildarchivs Köln.
Adresse der Autorin:Frau lic. phil. Gaby GschwendKurhausstrasse 5CH-8032 Zürich
Lektorat: Monika Eginger, Sigrid Weber (Freiburg i.Br.)Satz: Martin Janz (Freiburg i.Br.)Umschlag: Claude Borer, Basel
eBook-Herstellung und Auslieferung:Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de
Bibliografische Information der Deutschen BibliothekDie Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Anregungen und Zuschriften bitte an:Verlag Hans HuberHogrefe AGLänggass-Strasse 76CH-3000 Bern 9Tel: 0041 (0)31 300 45 00Fax: 0041 (0)31 300 45 93
© 2009 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, BernEPUB-ISBN: 978-3-456-74740-8
Inhalt
Vorwort
1 Mutterliebe
1.1 Zur Geschichte der Mutterliebe
1.1.1 Das 18. Jahrhundert: Mutterschaft ohne Sentimentalitäten
1.1.2 Das 19. Jahrhundert: Idealisierung der Mutterschaft
1.1.3 Das 20. Jahrhundert: Psychologisierung der Mutter-Kind-Beziehung
1.2 Zur Psychologie der Mutterliebe
1.2.1 Theorien zur Entstehung der Mutterliebe
1.2.2 Mütterliche Liebe
2 Vom Mythos der Mutter und von Müttern ohne Liebe
2.1 Das Ideal der Mutterliebe
2.2 Die unhinterfragten Annahmen des Muttermythos
2.2.1 Die Selbstlosigkeit der Mutter
2.2.2 Die Reinheit der Mutterliebe
2.2.3 Mütter lieben alle ihre Kinder gleich
2.2.4 Alle Mütter lieben ihre Kinder
2.2.5 Die Unentbehrlichkeit der Mutter für das Kind
2.3 Die Auswirkungen des Muttermythos
2.3.1 Verdrängung und Verleugnung der negativen Seiten der Mutterschaft
2.3.2 Verdrängung und Verleugnung ambivalenter und ablehnender Gefühle
2.3.3 Verdrängung und Verleugnung der Existenz von lieblosen Müttern
2.4 Merkmale von Müttern ohne Liebe
3 Die ablehnend-distanzierte Mutter
3.1 Merkmale und Eigenschaften
3.1.1 Interesselosigkeit
3.1.2 Körperliche Ablehnung
3.1.3 Emotionale Unberührbarkeit
3.2 Ursachen und Hintergründe
3.2.1 Die Biografie der Mutter
3.2.2 Selektive Ablehnung
3.2.3 Die Enttäuschung über das eigene Leben
3.2.4 Die solipsistische Persönlichkeit
3.3 Auswirkungen
3.3.1 Sich unwürdig fühlen
3.3.2 Körperliche Entfremdung
3.3.3 Einsamkeit und emotionaler Hunger
3.3.4 Anstrengung und Selbstverleugnung
3.4 Wege zur Selbsthilfe
3.4.1 Die Heilung des inneren Kindes
3.4.2 Botschaft für lieblose Mütter
4 Die seelisch ausbeutende Mutter
4.1 Merkmale und Eigenschaften
4.1.1 Pseudo-Nähe
4.1.2 Autonomie- und Individuationsverbot
4.1.3 Manipulation und Kontrolle
4.2 Ursachen und Hintergründe
4.2.1 Die kastrierte Mutter
4.2.2 Minderwertigkeit und Depression
4.3 Auswirkungen
4.3.1 Selbstentfremdung und Selbstverlassenheit
4.3.2 Wahrnehmungskonfusion und Gefühlsentfremdung
4.3.3 Im Kampf zwischen Abhängigkeit und Autonomie
4.4 Anregungen zur Selbsthilfe
4.4.1 Wege zur Autonomie
4.4.2 Loslassen können
5 Die aktiv Gewalt ausübende Mutter
5.1 Formen der Gewalt
5.1.1 Seelische Gewalt
5.1.2 Vernachlässigung
5.1.3 Körperliche Gewalt
5.1.4 Sexueller Missbrauch
5.2 Ursachen und Hintergründe
5.2.1 Der Kreislauf der Gewalt
5.2.2 Macht- und Dominanzstreben
5.2.3 Belastende Bedingungen
5.3 Auswirkungen
5.3.1 Angst und Misstrauen
5.3.2 Selbsthass und Selbstverachtung
5.3.3 Beziehungsstörungen
5.4 Anregungen zur Selbsthilfe
5.4.1 Selbstwert und Selbstwirksamkeit
5.4.2 Soziale und psychologische Unterstützung
6 Die Überwindung des Muttermythos
6.1 Negative Auswirkungen des Muttermythos
6.1.1 Das Leiden am Ideal
6.1.2 Das Tabu destruktiver Mutter-Kind-Beziehungen
6.1.3 Alleinzuständigkeit und Machtmonopol der Mutter
6.1.4 Die Väter im Abseits
6.2 Der Verzicht auf den Muttermythos und seine Folgen
6.2.1 Realistisches Mutterbild
6.2.2 Wahrnehmung von problematischen und destruktiven Mutter-Kind-Beziehungen
6.2.3 Erweiterte Zuständigkeit
6.2.4 Voraussetzungen, Widerstände, Hindernisse
Literatur
Vorwort
Die erste Reaktion ganz verschiedener Menschen auf den Titel dieses Buches besteht häufig in einer Art abwehrenden Entsetzens oder peinlicher Berührtheit. Sie erklären dann: «Mütter ohne Liebe – das gibt es doch gar nicht» oder: «Jede (normale) Mutter liebt ihr Kind». Auf der anderen Seite wiederum reagieren Menschen mit starker Zustimmung und drücken Erleichterung darüber aus, dass dieses Thema endlich einmal öffentlich thematisiert wird. Beide Reaktionen aber sind ein Beweis für die ungebrochene psychologische und gesellschaftliche Macht des Muttermythos und dafür, dass es auch heute noch fast ein Sakrileg ist, die Position der Mutter anzugreifen oder auch nur kritisch zu hinterfragen.
Beim Muttermythos handelt es sich um extrem überhöhte, idealisierte, romantisierte Vorstellungen von der Mutter, ihrer Bedeutung für das Kind und vom Wesen der Mutter-Kind-Beziehung. Obgleich diese Bilder nicht realistisch sind und es auch gar nicht sein können, sind wir von ihnen emotional und mental stark geprägt. Dies aber hat problematische Konsequenzen, denn es führt zu Tabus in der persönlichen Wahrnehmung und in der öffentlichen Diskussion. Ein Tabu bedeutet, dass etwas zwar möglich oder existent ist, aber aus ideologischen oder religiösen Gründen nicht wahrgenommen oder thematisiert werden darf. Es besteht ein Meide-Gebot. Dieses Meide-Gebot, das auch immer mit Scham verbunden ist, betrifft in unserem Fall die «dunklen» Aspekte der Mutterschaft. Zu den letzten Tabuthemen unserer Gesellschaft gehören dabei Aspekte wie das Eigeninteresse der Mutter in der Beziehung zum Kind ebenso wie das Thema der Abneigung, Aggression und Destruktivität gegen die eigenen Kinder.
Nur in unseren Volksmärchen wimmelt es noch von unverhohlen lieblosen Müttern, die allerdings – nach Bearbeitung der Urfassungen –, meist als Stiefmütter getarnt sind. Bei «Hänsel und Gretel» begegnen wir zum Beispiel einer (leiblichen) Mutter, die vor dem Problem steht, dass ihre Familie arm ist und die Nahrung für vier Personen nicht ausreicht.
Sie löst diesen Konflikt so, dass sie die Kinder im Wald aussetzt, um sie nicht mehr ernähren zu müssen. Auch der Einspruch ihres Mannes, des Vaters der Kinder, hindert sie nicht daran, dieses Vorhaben so konsequent wie unsentimental durchzusetzen. Hier sehen wir sie also – wie auch in vielen anderen Märchen, in der Literatur, im Film, und nicht zuletzt in der Realität –, eine wahrhafte Antiheldin, die nicht dem sentimentalen Bild entspricht, das wir von Müttern haben.
Da der Muttermythos so viel Verwirrung, Verleugnung, Verzweiflung, Unaufrichtigkeit und unerkanntes Leid mit sich bringt, ist es sinnvoll, ihn zu durchbrechen und zu durchschauen. Die Absicht dieses Buches ist es, Klischees, Mythen und Tabus der Mutterschaft aufzugreifen und vor allem unter dem Aspekt der mütterlichen Lieblosigkeit in ihren verschiedenen Facetten kritisch zu hinterfragen. Es betrachtet sozusagen «die erdabgewandte Seite der Geschichte», wie es anschaulich in einem Buchtitel heißt, die verborgenen, dunklen, unbewussten, bedrohlichen und verleugneten Seiten der Mütter, der Mutterschaft und der Mutter-Kind-Beziehungen, die dem gesellschaftlichen Bild nicht entsprechen. Dies, damit darüber freier als bisher gesprochen und bewusster damit umgegangen werden kann.
Die Spuren der Mutterliebe werden zunächst anhand der Geschichte verfolgt, wobei sich zeigen wird, dass die Idee der Mutterliebe, wie wir sie heute pflegen, eine relativ neue Vorstellung ist und nichts daran so selbstverständlich, wie es scheint. Im Kapitel über die Psychologie der Mutterliebe ist von deren psychischen Wirkfaktoren die Rede und von der Unterscheidung zwischen Mutterliebe und mütterlicher Liebe. Das Kapitel vom Mythos der Mutter und den Müttern ohne Liebe untersucht das Ideal der Mutterliebe und überprüft die zentralen Annahmen des Muttermythos auf ihren Realitätsgehalt und ihre Auswirkungen hin. Ausführlich behandelt werden dann die verschiedene Typen von «Müttern ohne Liebe» – die ablehnend-distanzierte Mutter, die seelisch ausbeutende Mutter und die aktiv gewalttätige Mutter – sowie verschiedene Formen problematischer oder destruktiver Mutter-Kind-Beziehungen. Dabei werden jeweils auch Anregungen und Wege zur Selbsthilfe für Menschen, die in entsprechenden Mutterbeziehungen aufgewachsen sind, aber auch für Mütter selber angesprochen und aufgezeigt.
Auch wenn man es unter dem Einfluss des Muttermythos leicht vergisst: Die Welt, in der Kinder groß werden und Erfahrungen im Hinblick auf Zuwendung und Lieblosigkeit machen, besteht nicht nur aus Mutter. Im Licht der gewonnenen Erkenntnisse entstehen, jenseits des Muttermythos, neue Fragen rund um die Liebe zwischen Mutter und Kind. Können und sollen wirklich die Mütter allein für die Art von fürsorglicher Liebe zuständig sein, die ein Kind braucht, um gut zu gedeihen? Was ist mit den Vätern? Anderen Personen im sozialen Umfeld? Welche Rolle spielen gesellschaftliche Systeme und Institutionen im Hinblick auch auf die Mutterliebe? Was wäre anders, wenn wir auf den Muttermythos verzichten würden? Könnte nicht sogar die Beziehung zwischen Müttern und Kindern entspannter und liebevoller sein? Wäre nicht überhaupt besser für Kinder gesorgt? Solchen Fragen widmet sich das letzte Kapitel des Buches, das die Überwindung des Muttermythos und seine Folgen thematisiert.
Zur Veranschaulichung meiner Darstellungen möchte ich auch Mütter sprechen lassen. Zitate, die nicht mit Quellenangaben versehen sind, stammen aus Begegnungen mit Frauen aus meiner eigenen psychotherapeutischen Praxis.
Gaby Gschwend, ZürichIm April 2009
1 Mutterliebe
Dieses Kapitel beschäftigt sich unter historischen und psychologischen Vorzeichen mit dem Phänomen der Mutterliebe und wird von folgenden Fragen begleitet: Handelt es sich bei der Mutterliebe um einen Instinkt, ist sie naturgesetzlicher Art? Ist sie ein Gefühl oder eine bestimmte Art von Verhalten? Ist sie immer und überall gleich oder fällt sie, interkulturell und historisch betrachtet, verschieden aus? Entsteht Mutterliebe «automatisch», wenn eine Frau Mutter wird und ist sie überhaupt auf die biologische Mutter beschränkt?
1.1 Zur Geschichte der Mutterliebe
Die meisten Menschen glauben, Mutterschaft und Mutterliebe seien zeitlose Phänomene. Wir machen uns wenig bewusst, dass unsere heutigen Vorstellungen davon eine Geschichte haben und ideologisch geprägt sind. Mutterliebe ist weder eine übergeschichtliche Konstante noch eine universelle Haltung von Müttern, die unabhängig von Zeit und Raum existiert. Zwar werden Kinder seit jeher «bemuttert» und erfahren Fürsorge und natürlich gab es zu allen Zeiten liebevolle Mütter. Vorstellungen, dass die Mutterschaft Sinn und Zweck, Beruf und die eigentliche wahre Erfüllung eines Frauenlebens sei und das Kind nur in mütterlicher Obhut gut gedeihen könne, sind jedoch kulturgeschichtlich gesehen vielleicht gerade einmal zehn Minuten alt und ein Produkt des (bürgerlichen) 19. Jahrhunderts. Vorher sah es ganz anders aus mit den Vorstellungen von Mutterliebe, der Bedeutung der Mutter und der Beziehung zwischen Mutter und Kind. Die folgenden Ausführungen zur Geschichte der Mutterliebe beziehen sich in erster Linie auf die Werke von Elisabeth Badinter und Yvonne Schütze, die zu diesem Thema über europäische und amerikanische Verhältnisse profund und aufschlussreich geforscht und geschrieben haben.
1.1.1 Das 18. Jahrhundert: Mutterschaft ohne Sentimentalitäten
Noch bis weit ins 18. Jahrhundert hinein war Mutterliebe mit keinem speziellen sozialen und moralischen Wert verbunden. Mutterschaft lag fern jeder Idealisierung und mütterliche Aufgaben erfuhren keine besondere Beachtung oder Wertschätzung. Auch um Kinder wurde nicht viel Aufhebens gemacht. Ihre Wertigkeit, ihre Rolle und ihr Ansehen ist nicht zu vergleichen mit der heutigen Stellung des Kindes in unserer Gesellschaft. Im Allgemeinen zählten Kinder, insbesondere in der Kleinkindphase, nicht viel; vor allem von Frauen, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten mussten, wurden sie nicht selten als Unglück betrachtet. Frauen aller Gesellschaftsschichten waren mehr oder weniger ständig schwanger und hatten oft sechs, acht oder mehr, natürlich nicht geplante Kinder. Und selbstverständlich arbeiteten die meisten Frauen schwer, in der Landwirtschaft oder im familiären Handwerksbetrieb, als Tagelöhnerinnen auf dem Land oder als Arbeiterinnen in der Stadt, mit Unterbrechungen nur für die Zeit des Wochenbetts. Die Säuglingssterblichkeit war hoch und das nicht nur in den ärmeren Bevölkerungsschichten. Kinder, so sie überlebten, begannen mit sechs oder sieben Jahren hart zu arbeiten oder absolvierten eine Lehrzeit,oft auswärts, fern der Familie. Schon früh hatten sie einen Beitrag zur Wirtschaft sgemeinschaft der Familie zu leisten und waren Kranken- und Alterssicherung der Eltern. In wohlhabenderen Schichten der Bevölkerung war es üblich, die Kinder schon früh in Instituten, Pensionaten und Internaten unterzubringen.
Das Verhältnis zwischen Eltern und Kind hatte nichts Sentimentales. Die meisten Kinder wuchsen auch gar nicht zu Hause auf. Im 18. Jahrhundert war die Unterbringung von Kindern bei einer Amme oder Pflegefamilie in allen Schichten der städtischen Bevölkerung verbreitet. Pariser Polizeiberichte aus dem Jahr 1780 belegen, dass von etwa 21 000 Kindern nach der Geburt nur 2000 im Haus der Eltern bleiben durften. Die anderen wurden zu Ammen verfrachtet, oft auf dem Land und so weit weg von Paris, dass sie bereits auf dem beschwerlichen Transport starben. Die meisten dieser Kinder erlebten das erste Lebensjahr nicht. Für die reiche und gebildete Bevölkerung galten Kinder als mindere, willens- und geistesschwache Erwachsene. Es wurde empfohlen, ihnen gegenüber kühle Reserviertheit und weder Zärtlichkeit noch Nachsicht zu zeigen, um ihre «natürliche Sündhaftigkeit und Bosheit» nicht zu unterstützen. Gewalt gegen Kinder war in allen Schichten der Bevölkerung alltäglich. Eine Analyse autobiografischer Aufzeichnungen von Frauen und Männern in Deutschland, die zwischen 1740 und 1820 geboren wurden, ergab im Rahmen einer Forschungsarbeit, dass es fast keinen untersuchten Text gab, in dem nicht über Gewalt gegen Kinder berichtet wurde, und fast keine Autoren, die nicht ausdrücklich sagten oder andeuteten, als Kind geschlagen worden zu sein (Deegener/Körner 2005, S. 14). Ein Gefühl für die Eigenart oder gar den Wert der Kindheit existierte in dieser Zeit nicht.
Für ein gesondertes Arbeitsfeld «Kindererziehung» bestand weder eine Notwendigkeit noch die Möglichkeit dazu. Die Erziehung von Kindern fand im Zusammenleben und Zusammenarbeiten vieler Personen statt, denn auch die Familie, wie wir sie heute als «normal» ansehen, gab es zu dieser Zeit noch nicht. Weder arbeitete der Vater getrennt von der Familie außer Haus, noch blieb die Mutter mit den Kindern allein darin zurück. Die Menschen lebten in Hausgemeinschaften, die meist zugleich auch Produktionsgemeinschaften waren. Die Bauernfamilie umfasste Eltern, Kinder, Großeltern, unverheiratete Verwandte und das Gesinde. Die Handwerkerfamilie bestand aus Eltern, Kindern, Lehrlingen und Gesellen und auch die aristokratische Hausgemeinschaft bestand neben Eltern und Kindern aus der Dienerschaft, Verwandten und Freunden. Mütter und Kinder lebten also in einer Gemeinschaft von vielen Menschen. Mutterschaft und Haushalt als privates Refugium waren nicht das zentrale Lebensumfeld von Frauen, ebenso wenig waren Mutter und Kind auf eine isolierte Beziehung festgelegt. Frauen waren vollwertige Produktivkräfte in der Wirtschaft oder verfolgten als Adlige musische oder gesellschaftliche Interessen. Die Verantwortung der Mutter für das Kind war spätestens mit dem Ende der Stillzeit beendet, wenn denn überhaupt gestillt wurde. Das Stillen war bei Frauen aller Bevölkerungsschichten unbeliebt und insbesondere in ärmeren Schichten und Gebieten völlig unverbreitet, auch wenn es eine viel größere Überlebenschance für die Kinder bedeutet hätte. Spätestens also nach der Stillphase übernahmen die Geschwister, die Alten, das Gesinde, die Dienstboten, die Ammen Aufsicht und Erziehung des Kindes.
In dieser Epoche finden sich noch viele andere Anzeichen für ein grundsätzliches Desinteresse am Kind und für die Vernachlässigung von Kindern: Eine nicht unübliche und sozial akzeptierte Praxis der Geburten kontrolle war die Kindstötung, denn zu viele Kinder bedrohten die Überlebenschancen der Großfamilie. Im 19. Jahrhundert wurde es dann gesetzlich verboten, Kleinkinder mit ins elterliche Bett zu nehmen, weil sie dort offensichtlich häufig erstickt wurden. Unerwünschte Kinder wurden auch oft ausgesetzt, verstoßen, fortgegeben oder in fremde Dienste verkauft. Natürlich sind Verzweiflung und wirtschaftliche Umstände für viele dieser Praktiken verantwortlich. Festzuhalten ist jedoch, dass sich der Überlebensinstinkt häufig dem vermeintlichen Mutterinstinkt gegenüber durchsetzte. Auch Frauen, denen es möglich gewesen wäre, ihr Kind bei sich aufzuziehen und es zu lieben, hatten über Jahrhunderte weg kein Interesse, dies zu tun. Bis ins 19. Jahrhundert haftete dem auch nicht in geringster Weise etwas Skandalöses an.
Dementsprechend löste auch der Tod eines Kindes nicht unbedingt tiefe Trauer aus. Zu dieser Zeit war es nicht üblich, dass die Familie zur Beerdigung ging, wenn das verstorbene Kind unter fünf Jahre alt war. Kinder wurden nicht, wie heute, als besonders kostbar und unersetzlich angesehen, denn sie waren zahlreich und allzu leicht «ersetzbar». Viele Kinder starben – zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert erreichte nur knapp die Hälfte der Kinder überhaupt das zehnte Lebensjahr, 20-30 % starben bereits im Verlauf des ersten Lebensjahres. Eine allzu enge Gefühlsbindung konnten sich die Eltern also gar nicht «leisten». Elisabeth Badinter kommt angesichts der horrenden Kindersterblichkeit und aufgrund ihrer ausführlichen Untersuchungen der damals herrschenden gesellschaft lichen Verhältnisse zu der Feststellung: «Nicht weil die Kinder wie die Fliegen starben, haben sich die Mütter so wenig für sie interessiert, sondern die Kinder sind deshalb in so großer Zahl gestorben, weil die Mütter sich nicht für sie interessierten.» (Badinter 1980, S. 63)
1.1.2 Das 19. Jahrhundert: Idealisierung der Mutterschaft
Mit Beginn des späten 18. Jahrhunderts wird die Stellung des Kindes in der Gesellschaft enorm aufgewertet und ebenso tiefgreifend verändert sich das Bild der Mutter, ihre Rolle und ihre Bedeutung. Neue Ansichten über Haushalt und Arbeit, Frauen und Kinder etablieren sich. Im Rahmen wirtschaftlicher Interessen und humanitärer Motive des Kinderschutzes entsteht eine historisch neue Ideologie von Familie und von der Beziehung zwischen Mutter und Kind.
Die fortschreitende industrielle Entwicklung und die neuen Produktionsverhältnisse führen zu einer Trennung von Arbeits- und Wohnort und damit werden die Arbeitswelt und die Welt des Heims und der Kinderversorgung voneinander abgekoppelt. Dies hat auch eine Veränderung der Familienstrukturen zur Folge. Das Überleben hängt in zunehmendem Maß nicht mehr von der Zugehörigkeit zu einer gemeinsam wirtschaft enden Familiengruppe ab, sondern beruht auf der Leistung des einzelnen Menschen. Arbeiterfamilien entstehen, die Männer, aber auch die Frauen und die größeren Kinder arbeiten täglich zwölf bis sechzehn Stunden außer Haus, in den Fabriken. Die Säuglinge und Kleinkinder werden in dieser Zeit zu Hause zurückgelassen, unter Obhut der Alten oder der Geschwister oder allein. In letzterem Fall werden sie häufig mit Alkohol oder Opium betäubt, um sie ruhig zu stellen.
Auch in der sich nun ausbreitenden bürgerlichen Mittelschicht sind Arbeits- und Wohnstätte für Männer nicht mehr identisch. Der Vater tritt das Exil in die Berufswelt an und wird zu Hause zu einer Randfigur. Mutter und Kind werden, abgetrennt von der öffentlichen Welt des Mannes, im Haus isoliert. Aus der Hausmutter des 18. Jahrhunderts wird die Nur-Hausfrau und «Mutter am Herd» und die Figur des außerhäusig erwerbstätigen Vaters verblasst langsam neben der immer präsenten Mutter, die an Macht und Bedeutung gewinnt. Heim und Familie, nie zuvor als abgesonderter, privater, gefühlsbetonter Lebensbereich verstanden, sollen nun unter der Obhut und Leitung der Mutter ein Ort der Menschlichkeit und der Zuflucht sein, eine «Gegenwelt» der Geborgenheit zu einer als kalt und unmenschlich empfundenen Außenwelt. Neu und reich an Konsequenzen ist auch die Verknüpfung von biologischer Mutterschaft (Kinder gebären) und sozialer Mutterschaft (Kinder pflegen und aufziehen) sowie die Zuweisung der langjährigen Alleinverantwortung für die Kinder an die leiblichen Mütter. Einen großen ideologischen Einfluss, vor allem im aufstrebenden Bildungs- und Besitzbürgertum, haben hierbei humanitäre Schriften, wie die von Rousseau, Pestalozzi und anderen, die eine bewusste Erziehung fordern, die sich der speziellen Eigenart und Entwicklung des Kindes anpassen sollte.
Die Wertigkeit und Stellung des Kindes in Gesellschaft und Familie verändern sich nun erheblich und eine neue Haltung gegenüber Kindern entwickelt sich. Ein Interesse an einem kinderreichen Volk entsteht und Kinder bekommen einen eigenen gesellschaftlichen und kommerziellen Wert. Sie werden nicht mehr in erster Linie als eine (kurzfristige) Last, sondern als von langfristigem Nutzen wahrgenommen. Nun war aber, wie bereits dargestellt, die Säuglings- und Kindersterblichkeit extrem hoch und das bis ins 19. Jahrhundert hinein unabhängig von der Schichtzugehörigkeit. Mit dem angestrebten Bevölkerungszuwachs wächst das Interesse, dass die Kinder überleben sollen. Ihrer Pflege und ihrer Entwicklung wird deshalb eine ganz neue Aufmerksamkeit geschenkt. Das gesundheitliche Wohlergehen der Kinder wird zum Hauptgegenstand elterlicher Besorgnis. Die Kinderheilkunde entsteht und die Mediziner widmen sich der Erforschung des kindlichen Körpers. Sie sind die ersten Pädagogen, die die Mütter ausbilden und erziehen, wie für das körperliche Wohl des Kindes zu sorgen ist. Kinder sollen nun auch nicht mehr «fremden» Verwandten oder professionellen Erziehern übergeben werden, sondern individuell unter Aufsicht der Mutter bleiben. Die liebende Mutter darf die Pflege und Aufsicht des Kindes nicht (mehr) delegieren.
Die neue Mutter
Die neue (bürgerliche) Mutter ist die Mutter im Heim und am Herd. Ihre Aufgaben und Pflichten liegen in Haushalt und Kinderpflege, der Mann hat die seinen in der Arbeitswelt. Erstmals wird nun auch der «Geschlechtscharakter» der Frau, dessen Hauptmerkmal die «Mütterlichkeit» sei, beschrieben und definiert. Die wahre Berufung und auch das wahre Bedürfnis der Frau sei es, so heißt es nun, für das Wohlergehen von Männern und Kindern zu sorgen. Die Mutter wird zur idealisierten Figur, die heimische Geborgenheit und «Nestwärme» in einer unpersönlichen, rücksichtslosen (Arbeits-)Welt vermittelt. Ihre Mutterliebe besteht in Selbstlosigkeit, Aufopferung und Pflichterfüllung.
Damit beginnt eine Entwicklung, in der ein Gefühl (Liebe) mit bestimmten Verhaltensnormen, einem Kodex, einem «Regelwerk» der Mutterliebe verknüpft wird. Die Pflicht der Mutter liegt in erster Linie in der körperlichen Versorgung des Kindes, zumindest der Beteiligung daran, und der Verantwortung für sein gesundheitliches Wohlergehen. Allerdings ist der mütterliche Pflichtenkatalog bei weitem noch nicht so umfassend, wie er es dann ab Mitte des 20. Jahrhunderts wird: Unter Erziehung werden zu der Zeit und noch bis in die 1950er Jahre hinein vor allem Disziplinierungsmaßnahmen und Erziehung zum Gehorsam verstanden. Zärtliche Zuwendungen, die für uns heute selbstverständlicher Teil der Mutterliebe sind, werden als Schwäche angesehen und vermieden. So heißt es im damals berühmten Kodex der Kinderbildung von Johann Michael Sailer: «[…] so soll der Kodex der Kinderbildung eigentlich nur zwei Gebote enthalten: das erste: Sei gehorsam! Das zweite, dem ersten gleich: Sei offen, aufrichtig, lüge nicht» (zit. n. Grisebach 1995, S. 33)