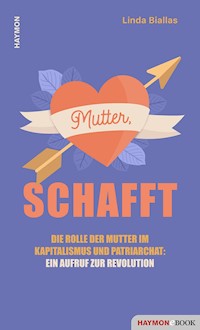
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Platz für Feminismus und Mutterschaft! Wie Mutter sein? – In einer männlichen Weltordnung, in einer Gesellschaft, die Mütter verachtet Was bedeutet Feminismus – nicht nur als Mutter, sondern als Mutter im kapitalistischen, patriarchalen System? Welche Kämpfe tragen Mütter aus? Und wer sieht hin, sieht die Kämpfe, aus denen sie nicht als Sieger*innen hervorgehen können? Zentrale Fragen, die Linda Biallas aufwirft, aber auch solche, für die es nicht immer allgemein gültige Antworten gibt. Denn: Menschen sind verschieden, und vor allem: Voraussetzungen sind unterschiedlich. Nur die Strukturen selbst scheinen so unerschütterlich wie kaum etwas anderes. Inklusive der Rolle, die einer Mutter zugeschrieben wird, und den Eigenschaften, die sie mitbringen sollte. Sicher ist: erfüllen lässt sich diese Rolle niemals. Muttersein in unserem Leistungs-orientierten System bedeutet vor allem eines: eine ernüchternde Realität, die Geschlechterrollen zementiert und Mütter als die wichtigsten Versorgungsträger*innen einer Gesellschaft im Stich lässt. Von der Feministin zur Mutter und Feministin Linda Biallas ist Mitte Zwanzig, steckt im Studium und in einem gänzlich anderen Leben, als sie ungeplant schwanger wird und sich mit Fragen konfrontiert sieht, die im Feminismus der Anfang 20-Jährigen keine Rolle gespielt haben: Was ist überhaupt eine "gute Mutter"? Warum sind die Ansprüche an Mütter und Väter so unterschiedlich? Und wie werden wir durch diese Sicht beeinflusst? Wo sind es die Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, die uns in eine bestimmte Richtung drängen? Und wo sind es erlernte Überzeugungen und Rollenbilder, die uns festsetzen, Spielräume ungenutzt lassen? Wo sind es unsere eigenen Ideologien, die uns trotz allem an ein System glauben lassen, das unsere Ausbeutung und Unterdrückung zu verantworten hat? Klar ist: Es sind vor allem Patriarchat und Kapitalismus, die dafür sorgen, dass Strukturen erhalten bleiben, die Frauen mit Kindern benachteiligen und Hindernisse reproduzieren, wo es eigentlich schon lange keine mehr geben sollte! Es reicht nicht! – neue Perspektiven für das Muttersein im 21. Jahrhundert Sexismus, Stereotype, das Ideal der kleinbürgerlichen Familie, Bevormundung und rechtliche Bestimmungen: Es sind die Umstände, die wir gemeinsam und grundlegend verändern müssen, um Müttern eine Zukunft zu geben und endlich Gleichberechtigung zu schaffen. Was nicht reicht? Schlichte Symptombekämpfung. Vielmehr müssen wir endlich analysieren und verstehen, dass es unser Gesellschaftssystem ist, das Formen von Benachteiligung hervorbringt und das Muttersein kaputtmacht. Linda Biallas erzählt in diesem Buch von Ungleichheit und Erziehungsmodellen, Care-Arbeit und Beziehungsarbeit und bohrt mit dem Finger in den Wunden unserer Gesellschaft, bis wir den Schmerz so richtig spüren!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Linda Biallas
Mutter, schafft
Die Rolle der Mutterim Kapitalismus und Patriarchat:ein Aufruf zur Revolution
Inhalt
Vorwort
1. Von der Feministin zur Mutter
Ich fand Feminismus schon immer gut und Geschlechterrollen schon immer kacke
Oh fuck, ich bin schwanger
Herzlich willkommen in der Mutterrolle, bitte geben Sie Ihre persönlichen Interessen an der Kreißsaaltür ab
2. Familie in Kapitalismus und Patriarchat
Familienformen
Ostdeutschland
Alleinerziehend bis Wechselmodell
Der Vater, obgleich im Beruf durchsetzungsstark und kompetent, schafft es einfach nicht durchzusetzen, dass er auch mal eine Windel wechseln darf
Wenn Care-Arbeit Arbeit ist, müssen wir sie bezahlen, oder?
Theoretisch modernisiertes Rollenverständnis
3. Die romantische Liebesbeziehung
Prinzessin und Fuckboy
Wer ist eigentlich frei in der freien Liebe?
Klar möchte ich später mal Kinder haben (meine Frau macht das dann)
Schwanger werden können
Männer sind wegen der Kinder sexy, Frauen trotz der Kinder
Es gibt nicht genug gute Männer für alle
4. Frau und Mutter, Vater, Kind
Eine schöne Frau, ein richtiger Mann, eine gute Mutter
Jungs sind so, und Mädchen sind schlechter
Mutterrolle, Muttermythos
Momshaming
Und die Väter?
Kleinfamilie auf Kosten der Mütter
Also bei mir ist das irgendwie ganz anders!
Einstellungen zum Geschlecht
Unterdrückung und Fortpflanzungsveranlagung
5. Reproduktionsarbeit und Körper
Schwangerschaft ist keine Krankheit
Schwangersein ist scheiße
Gebären ist Arbeit
Das schwächere Geschlecht
6. Kapitalismus und Patriarchat
Was genau ist denn überhaupt dieser Kapitalismus?
Waren und ihr Wert
Den Lebensunterhalt „verdienen“
Ausbeutung
Mittelschichtszugehörigkeit? Klasse!
Ideologien im Kapitalismus
Reproduktionsarbeit in Kapitalismus und Patriarchat
Patriarchat ist, wenn man sich umguckt und überall sind Männer
7. Feministische Mutterschaft
Freiheit vs. Care-Arbeit
Die Frage, was Feminismus denn sei, ist eine umkämpfte
Nur weil irgendwo „Choice“ draufsteht, ist noch lange nicht Feminismus drin
Was kann ich als Mutter tun, wenn ich selbstbestimmt leben will?
Die Mutterrolle abschaffen
8. Wohin gehen wir?
Es gibt keine einfache Lösung, die ich euch jetzt sage
Wir sollten mutig sein, weiter zu denken
Ich will das gute Leben
Glossar
Danksagung
Literaturverzeichnis
Zur Autorin
Vorwort
Ich bin zweifache Mutter und Sozialarbeiterin, und meine Kinder haben nicht denselben Vater. Das ist etwas, das meinen Blick auf die Bedingungen, denen lohnabhängig Beschäftigte – Arbeiterinnen und Arbeiter im Allgemeinen und Mütter im Besonderen – im Kapitalismus1, im Patriarchat, unterworfen sind, noch ein Stück weit mehr fokussiert und geschärft hat, denn ich lebe nicht in der klassischen „Kernfamilie“, der bürgerlichen Kleinfamilie. Keiner der Väter wohnt bei uns, wir leben im sogenannten Wechselmodell. Mein großes Kind geht in die Grundschule, und trotz aller Widrigkeiten zu Beginn ist es seinem Vater und mir gelungen, heute eine freundschaftliche Beziehung zu führen, in der wir uns die Elternschaft paritätisch teilen und uns gegenseitig unterstützen. Mein kleineres Kind ist im Kitaalter, auch mit dessen Papa ist die Elternbeziehung familiär, obwohl wir keine „richtige“ Familie sind und keine Liebesbeziehung mehr führen. Auch das ist etwas, dass das kapitalistische System nicht vorsieht, denn vor allem die bürgerliche Kleinfamilie – Vater-Mutter-Kind(er) – ist es, die dieses System am Laufen hält.
Ich bin Teil einer Generation, deren Eltern die Gewissheit hatten, dass alles immer besser wird. Den Menschen geht es immer besser, den Frauen geht es immer besser, die Gesundheits- und Nahrungsversorgung der ganzen Welt wird immer besser. Manches davon stimmt, zumindest statistisch gesehen. Für die früheren Generationen hat diese Annahme durchaus Evidenz, insbesondere die „Tatsache“, dass die Kinder es einmal besser haben werden. Die Verschlechterung, die unsere Generation bezüglich Mutterschaft erlebt, ist relativ neu, und die alten Gewissheiten sind für uns nicht mehr als eine Erzählung aus der guten alten Zeit. Nicht, dass nicht nachvollziehbar wäre, dass unsere Großeltern und Eltern, die Kriegsund die Nachkriegsgeneration, dieser Überzeugungen waren und sind. Aber in vielerlei Hinsicht ist die Realität eine andere. Als Frau spürt man das deutlich. Man spürt die Unterschiede. Auch wenn sie manchmal nicht greifbar sind oder einen scheinbar nicht direkt betreffen.
Als Frau und insbesondere als Mutter ist nichts besser geworden, und eigentlich war es auch vorher nicht gut. Aber was genau ist denn nicht gut? Und was hat das mit dem Patriarchat zu tun? Was mit dem Kapitalismus? Was ist das für ein Geschlechterverhältnis, in dem die Reproduktionsarbeit auf eine Art und Weise Frauen angelastet wird, die geeignet ist, persönliche Ressourcen die ganze Zeit überzustrapazieren? Was ist das für ein System, das dazu geeignet ist, die Teilhabe von Frauen und insbesondere Müttern an der öffentlichen Sphäre, an Lohnarbeit, an Politik einzuschränken, und ihre ressourcenbezogene Versorgung nicht gewährleisten kann?
Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich finde, dass wir genauer hingucken sollten. Dahin, wo es nicht gut läuft. Dieses Buch weist auf Missstände hin und kritisiert diese rücksichtslos, um in der Negation Vorschläge oder Alternativen aufzuzeigen. Wir müssen da hingucken, wo unser Wirtschaftssystem und unsere Mutterschaftsbilder das Zusammenleben in der Gesellschaft, unser Familienleben determinieren.
Ich konzentriere mich dabei auf Deutschland, auf die herrschenden Zustände in der Bundesrepublik, auf die Gesetze und Rahmenbedingungen, aber auch auf traditionell deutsche und neoliberale Ideologien. Obwohl sich rechtliche Rahmenbedingungen in Teilen unterscheiden, sind gerade aus Deutschland bekannte reaktionäre Frauen- und Mutterbilder auch in Österreich anzutreffen. Österreich ist Bestandteil, teilweise sogar Zuspitzung deutscher Ideologie. Auch andere grundlegende Mechanismen von Kapitalismus und Patriarchat sind übertragbar, sogar in globalerem Umfang, auch wenn sich der Umgang mit Mutterschaft zum Teil unterscheidet.
Ich habe dieses Buch geschrieben, um zum Ausdruck zu bringen, dass ich nicht einverstanden bin, nicht einverstanden sein kann. Weder mit dem Kapitalismus noch mit dem Patriarchat noch damit, dass Ideologien unreflektiert und somit Zustände unverändert bleiben.
Berlin, September 2022
________
1 Für die Lektüre wichtige Begriffe werden im Glossar im hinteren Teil des Buches erläutert.
1. Von der Feministin zur Mutter
Mutterschaft ist ein zentrales feministisches Thema. Leider weiß das nur fast niemand. Manchmal unterhalte ich mich mit Frauen, die jünger sind als ich, die noch keine Kinder haben, und manchmal erzählen diese dann, dass sie nicht wissen, ob und wann sie überhaupt Kinder bekommen wollen oder können, weil sie nicht wissen, wie sie „das alles“ machen sollen. Die Boyfriends sitzen dann meist daneben und sagen nichts. Frauen hingegen, die schon Mütter sind, erzählen häufig, wie erstaunt sie waren und wie erschrocken, wie viel Arbeit „das alles“ ist und wie sie sowohl gesellschaftlich als auch in der eigenen Paarbeziehung damit alleingelassen werden.
Mutterschaft ist kaum ein Thema im Feminismus der Jüngeren, im modernen, im popkulturellen Feminismus, im Choice Feminismus. Ich finde, das sollten wir ändern. Nicht nur, weil Mütter als Menschen und als zentrale Figuren in der Reproduktionsarbeit sicher versorgt und nicht unterdrückt und ausgebeutet werden sollten, sondern auch, weil am Beispiel Mutterschaft deutlich zutage tritt, wie Kapitalismus und Patriarchat ihre fatale Wirkung entfalten.
Ich fand Feminismus schon immer gut und Geschlechterrollen schon immer kacke
Als ich in der ersten Klasse war, fand ich die Kurzhaarfrisur eines Mitschülers so cool, dass ich gesagt habe: „Mama, ich will kurze Haare haben!“ Und meine Mutti hat mir die Haare abgeschnitten. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die kurzen Haare etwas daran geändert hätten, dass ich ein Mädchen bin, und mein Gerechtigkeitsempfinden sagte mir, dass es nur fair ist, wenn ich mit meinen Haaren machen kann, was ich möchte, und dass es absolut unfair ist, wenn für Mädchen in dieser Hinsicht andere Regeln gelten als für Jungen. Dass Mädchen eigentlich keine kurzen Haare tragen sollten, habe ich durchaus auch als Erstklässlerin mitbekommen, ich erinnere mich zum Beispiel an den Verkäufer an einem Stand auf dem Wochenmarkt, der mir dann jeden Samstag, wenn ich mit meiner Mutti dort war, etwas zum Probieren auf die Hand „für den jungen Mann“ gab.
In den 1990er-Jahren ein Kind gewesen zu sein, ein Mädchen gewesen zu sein, hat mich mit vielen Mixed Messages aufwachsen lassen. Einerseits erinnere ich mich an wenige Situationen, die so richtig offen sexistisch waren, ich hatte immer das Gefühl, dass so ein gewisser „Heutzutage-können-Mädchen-alles-schaffen“-Girlpower-Spirit herrschte. Gleichzeitig gab es aber trotzdem superviele klischeehafte Ideen darüber, wie Mädchen zu sein haben, die an mich herangetragen wurden. Aus Protest gegen die Idee, dass Mädchen auf jeden Fall Pferde mögen und die „Wendy“ lesen, waren Kühe lange Zeit meine Lieblingstiere.
Wenn ich sage, ich fand Feminismus schon immer gut, dann meine ich damit nicht, dass ich als Kind schon einen ausgeprägten Begriff davon hatte, was Feminismus ist. Denn den hatte ich nicht. Ich hatte vor allem ein großes Unrechtsbewusstsein und eine Abneigung dagegen, in eine bestimmte Richtung gedrängt zu werden, nur weil ich ein Mädchen bin.
Das erste Mal konkret für mich formulieren, dass ich benachteiligt werde, konnte ich, als wir die Noten im Informatikunterricht in der Mittelstufe bekamen. Mehrere Jungen aus meiner Klasse hatten bei gleicher Leistung eine 1 bekommen und ich aber eine 2. Und das, obwohl ich, im Gegensatz zu den Jungen, zusätzlich zu meiner eigenen fehlerfreien Leistung auch noch den anderen Mädchen im Kurs während des Unterrichts beim HTML-Programmieren immer wieder unterstützend zur Seite gestanden hatte. Ganz so, wie es die Geschlechterrolle Frau vorsieht. Ich hatte also eigentlich noch mehr „geleistet“ als die Jungen. Ich weiß noch genau, wie ich nach der Notenvergabe im Flur stand und überlegte, bei wem ich mich über diese Angelegenheit beschweren könnte, ob ich zum Beispiel meinem Mathematiklehrer von meinem Verdacht erzählen sollte. Er hatte mich im Unterricht immer fair behandelt und schien sich darüber zu freuen, dass ich gut in Mathe war. Letztendlich überwog aber die Angst, nicht ernst genommen zu werden, und ich habe nichts gesagt.
Viele Anekdoten über Ungleichbehandlung und Sexismus, die in meiner Kindheit und frühen Jugend passiert sind, konnte ich als Teenager besser einordnen, als ich angefangen habe, mich mit Politik, Gesellschaft und feministischer Theorie zu beschäftigen. In feministischen Büchern Begründungen dafür zu finden, wie und warum sexistische Vorfälle passieren, das hat mir das Gefühl gegeben, dass da jemand ist, der mir glaubt.
Obwohl ich aus meiner Jugend einiges über erlebten Sexismus erzählen kann, wurde mir trotzdem vermittelt, dass ich es im Leben zu etwas bringen kann. Dass ich es „trotzdem“ zu etwas bringen kann. Eine meiner Lieblingsanekdoten ist zum Beispiel die, dass mir irgendwann aufgefallen ist, dass es immer die Jungs sind, die die Joints bauen. Ich habe dann gelernt, Joints zu bauen, um dem etwas entgegenzusetzen. Oder der Moment, als ich das Gefühl zulassen konnte, dass es mich verletzt, wenn von mir erwartet wird, immer die „nicht so schlimmen“ Kleinigkeiten weglächeln zu müssen, die mich aufgrund meines Geschlechts herabwürdigen – wenn zum Beispiel vermeintlich Schwächere mit „Du Pussy!“ bedacht werden oder gesagt wird: „Bestimmt ’ne Frau“, wenn da ein schlecht eingeparktes Auto steht. Auch deutlich unangenehmere Erlebnisse, wie sie leider vielen Frauen passieren, sind Teil meiner Erfahrung. Ich denke da an die verschiedenen sexuellen Übergriffe, die ich erlebt habe.
Trotz allem bin ich mit dem Gefühl erwachsen geworden, dass ich als Frau zwar nicht gleichberechtigt bin, aber doch durch Engagement so einiges wieder wettmachen könne. Schließlich hatten trotz der vielen Benachteiligungen und Situationen, die sich scheiße anfühlten, doch zumindest alle großen Eckpunkte geklappt. Ich habe (als Erste in meiner Familie) die allgemeine Hochschulreife erreicht, ich habe einen Freiwilligendienst absolviert, ich habe, zugegebenermaßen nach einer längeren Orientierungsphase, ein Studium aufgenommen und auch abgeschlossen.
Oh fuck, ich bin schwanger
Während des Studiums bin ich dann ungeplant schwanger geworden und habe mich dazu entschieden, ein Kind zu bekommen – und von all den Wahrheiten darüber, was man als Frau in unserer Gesellschaft alles so schaffen kann, war plötzlich keine mehr wahr.
Bevor ich Kinder hatte, habe ich das Frausein in dieser Gesellschaft immer ein Stück weit als ein „Einerseits-Andererseits“ wahrgenommen: Einerseits werde ich als Frau benachteiligt und sexistisch diskriminiert, andererseits habe ich Handlungsspielraum und Möglichkeiten in dieser Gesellschaft. Durch die Schwangerschaft hat sich mein Blick auf die Notwendigkeit von Feminismus sehr fokussiert, und die Missstände, die in unserer Gesellschaft für Mütter allgegenwärtig sind, haben sich mir mit meiner ersten ungeplanten Schwangerschaft und den Erfahrungen mit dem ersten Kind schmerzlich offenbart. Alles vorher, so sehr mich manche Vorfälle doch getroffen haben, waren „nur“ Anekdoten im Vergleich zu den Erfahrungen, die ich als junge Mutter und Alleinerziehende gemacht habe.
Ich war von Anfang an alleinerziehend, bereits während der ersten Schwangerschaft. Wir waren noch nicht lange zusammen, als ich schwanger wurde. Der werdende Vater, also mein damaliger Partner, hat sich von mir getrennt, weil er keine Verantwortung für mich übernehmen könne, geschweige denn für ein Kind. Er hat die ganze Verantwortung auf mich abgewälzt, als hätte ich schwanger werden wollen. Als hätte ich in einer Situation sein wollen, in der ich mich für oder gegen ein Kind entscheiden musste. Als wäre irgendetwas fair daran, sich aus der Affäre zu ziehen mit einem: „Du hättest ja abtreiben können, deswegen ist die Schwangerschaft jetzt dein Problem.“
„Pro-Choice“ sollte nicht bedeuten, dass Männer mitreden dürfen, um Frauen von einem Schwangerschaftsabbruch zu überzeugen, weil Verantwortung für das eigene Ejakulat zu übernehmen, eine Idee ist, die ihnen noch nie gekommen ist. Warum ich mich letztendlich für die Schwangerschaft entschieden habe, trotz allem, ist an und für sich völlig egal. Werdende Mütter haben immer ein Setting verdient, in dem sie genug Ressourcen und Unterstützung haben, sich für ein Kind entscheiden zu können. Genauso wie Frauen einen nicht kriminalisierten und stigmatisierten Zugang zum Schwangerschaftsabbruch haben sollten.
Ich habe eine Weile gebraucht zu realisieren, dass meine Beziehung vorbei war und ich alleinerziehend sein würde, und ich war während der Schwangerschaft die ganze Zeit traurig. Ich glaube, ich habe ausnahmslos jeden Tag geweint. Ich trauerte um mein altes Leben. Ich hatte nie bewusst von der bürgerlichen Kleinfamilie geträumt oder mir vorgestellt, ein Haus zu bauen oder zu heiraten. Ich fand Heiraten immer komisch und blöd – ich will doch gar nicht von meinem Vater an meinen Ehemann übergeben werden, hä? Als ich dann schwanger war, wurde mir klar, dass ich dennoch bestimmte Vorstellungen davon hatte, wie ich mir das Kinderkriegen in einer Paarbeziehung wünschte: innig und einander zugewandt. So sehr hätte ich mir gewünscht, dass mein Expartner seine Hand auf meinen Bauch legen würde, um zu fühlen, wie das Baby tritt. Dass er sagen würde: „Wir schaffen das schon.“ Nichts davon ist passiert, und das tat sehr häufig sehr weh. Ich habe jede Woche allein im Internet nachgelesen, was alles Neues in der Entwicklung des Embryos passiert, und da war niemand, dem ich davon erzählen konnte. War ihm das einfach egal? Fand er die winzigen Bodys und Schühchen, die ich für das Baby kaufte, nicht niedlich? Ich freute mich so sehr auf mein Baby – warum war da denn niemand, der sich mit mir freute?
Nicht nur emotional war diese Zeit eine große Herausforderung. Bei mir ist alles gleichzeitig passiert, und das in relativ kurzer Zeit: Studium, Berufseinstieg, Mutter werden, Verantwortung übernehmen. Es war hart, so schnell erwachsen werden zu müssen, mich von einer Studentin zur alleinerziehenden Mutter zu entwickeln, die alles schafft, weil alles geschafft werden muss.
Herzlich willkommen in der Mutterrolle, bitte geben Sie Ihre persönlichen Interessen an der Kreißsaaltür ab
Zu der Herausforderung, Mutter zu werden, trug auch bei, dass es in Deutschland nicht üblich ist, gleichzeitig Mutter und finanziell unabhängig und junge Frau mit Freizeitinteressen zu sein. Mutterschaft bedeutet in Deutschland Ehe, klassische Rollenverteilung, beruflich vorher etwas erreicht haben, weil das als Frau mit Kind nicht mehr geht.
Die Idee von Mutterschaft hängt damit zusammen, einiges aufgeben zu müssen: Autonomie, eigene Interessen, Freizeit. Rückblickend denke ich, dass ich mit Mitte 20, als ich zum ersten Mal Mutter wurde, wirklich gedacht habe, dass man dann mit Mitte 30 bereit dafür sein würde, mehr Kompromisse für die Mutterschaft zu machen. Aber ich bin auch jetzt mit Mitte 30 nicht dazu bereit, so viel von meinen persönlichen Interessen zu opfern, weil es so wenig Raum dafür gibt, etwas anderes zu sein als „nur Mutter“.
Mutter zu werden, bedeutet nicht nur, ein Kind zu gebären und danach plötzlich einfach so Mutter zu sein – genauso wenig, wie bei Co-Müttern, also Müttern, die ohne Liebesbeziehung gemeinsame Elternschaft leben, oder Müttern von Pflegekindern, Müttern, die ein Kind adoptiert haben, Patchworkmüttern nur der rechtliche Status, der Verwaltungsakt der Moment ist, in dem die Mutterschaft beginnt oder der die Mutterschaft ausmacht.
Mutter zu werden, kann ein längerer Prozess sein, eine Auseinandersetzung mit sich selbst, den Erfahrungen der eigenen Kindheit, den Erfahrungen mit den eigenen Eltern. Diese Auseinandersetzung mit der Mutterrolle kann in verschiedenen Konstellationen schon vor der Geburt, vor der Adoption, vor dem offiziellen Muttersein beginnen. Ich stelle mir immer wieder vor, dass Frauen, die geplant schwanger werden, bestimmt schon vorher überlegen, wie sie leben wollen, wie sie arbeiten wollen, wie das Kinderzimmer eingerichtet werden soll. Bei mir war das nicht so. Mir war vorher auch gar nicht so richtig klar, was und vor allem wie viel ich erfüllen sollte, um als gute Mutter zu gelten. Ich hatte eine grobe Vorstellung davon, dass gute Mütter nur Wolle-Seide-Bodys kauften, natürlich voll stillten, Brei immer frisch selbst kochten, also viel mehr dünsteten, und zwar Biogemüse, na klar. Außerdem würden sie immer gerne vorlesen und nie den Fernseher anmachen, den ganzen Tag Lust haben, mit dem Kind zu spielen, und vieles mehr.
Mutter zu werden, bedeutet in jedem Fall, dass so einiges erledigt werden muss. Also habe ich Babykleidung und Möbel akquiriert, mich informiert über das Stillen und über Milchnahrung und darüber, welche Themen aus dem Bereich Kinderkriegen der Esoterik zuzuordnen sind und nicht der Wissenschaft (Blähungen durch Ernährung der Mutter, Bernsteinketten gegen Zahnschmerzen, Aromatherapie bei der Geburt). Ich habe aufgehört zu rauchen und zu trinken und versucht, irgendwie den Entwicklungsschritt von der Studentin, die sich für Politik, Partymachen und Ausschlafen interessiert, zur alleinerziehenden Mutter, die plötzlich nicht nur für sich selbst verantwortlich ist, zu bewerkstelligen.
Ich habe mich nicht nur gefragt, ob mein Kind im ersten Lebensjahr Zucker essen darf, ab welchem Zeitpunkt ich wie viel Medienkonsum gut finde, wie sich meine Perspektive auf meine eigene Kindheit durch die Mutterschaft verändern würde, sondern mir auch Fragen gestellt, die nicht nur im Persönlichen beantwortet werden können, sondern die Art und Weise betreffen, wie wir leben und wirtschaften: Warum soll ich in der Familie so viel Care-Arbeit alleine machen? Warum soll ich das gerne machen müssen? Weil ich eine Frau bin? Weil die Trennung von Lohn- und Care-Arbeit und die Festlegung von Care-Arbeit als unbezahlte Ressource, die aus Liebe absolviert wird, ein unveränderbarer Fakt ist? Mir war nicht klar, dass es diese „Vereinbarkeit“, von der immer die Rede ist, eigentlich gar nicht so richtig gibt.
Die klassische Geschlechterrolle für Mütter ist die Mutterrolle, und die funktioniert, sehr vereinfacht gesagt, so: Mutti opfert sich gerne ohne Gegenleistung für die Kinder auf, aus Mutterliebe, weil sie so selbstlos ist, so sind Frauen eben. Die Karrierenachteile (wobei die klassische Mutterrolle eigentlich noch nicht einmal eine Arbeitstätigkeit von Müttern vorsieht), die Belastung durch die Second Shift nach der Lohnarbeit in Form von die Kinder von der Kita abholen und beschäftigen, den Haushalt alleine schmeißen, dann die Altersarmut, all das nimmt sie gerne in Kauf, die Mutter, denn das Lächeln der Kinder macht alles wieder gut. Sie macht das nicht fürs Geld, das wäre kaltherzig und irgendwie materialistisch, so sind Mütter nicht. Ganz so, als würden Mütter im Unrecht sein, wenn sie sich sichere finanzielle Verhältnisse wünschten, obwohl sie natürlich durch Schwangerschaft, Wochenbett, Stillzeit weniger an der Lohnarbeit partizipieren können. Dabei ist es eigentlich andersherum: Das kapitalistische System, in dem wir leben, hat sehr viel mit der Art, wie die Mutterrolle angelegt ist, zu tun und „die Wirtschaft“ profitiert davon, dass Frauen neue Arbeiterinnen und Arbeiter gebären und sie im Prinzip nix dafür zurückgeben muss. Kinder zu bekommen, gilt praktischerweise als private Entscheidung in der Familie, in der dann die idealtypische Aufteilung vorherrschen soll: Vater – Lohnarbeit. Mutter – Care-Arbeit.
Der Zeitpunkt und die Konstellation, in der ich Kinder bekommen habe, entsprechen nicht der klassischen Vorstellung darüber, wann und wie Leute Kinder bekommen. Mutter zu werden, das war für mich höchstens ein Vielleicht, ein Irgendwann. Eigentlich hatte ich so gut wie nie drüber nachgedacht, ob ich überhaupt einmal Kinder bekommen wollte und wie das dann sein sollte. Deswegen hatte ich bis dahin auch kaum Anlass, mich in Bezug auf mich selbst damit auseinandersetzen zu müssen, was Mutterschaft für mich bedeuten könnte, und vor allem hatte ich kaum Anlass dazu, mich mit der riesigen gesellschaftlichen Erwartungshaltung an (werdende) Mütter auseinanderzusetzen. Noch nicht einmal in dieses „Kinder kriegen will ich schon irgendwann später mal“, von dem viele Freundinnen sprachen, stimmte ich mit ein, so wenig relevant war das Thema in meinem Leben.
Das erklärt ein Stück weit, weshalb meine Mutterschaft ein riesiger Entwicklungsschritt für mich war. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es auch Frauen, die die Mutterschaft geplant haben, überrascht und erschreckt, mit welcher Vehemenz die gesellschaftlichen Erwartungen an Mütter herangetragen werden, und wie eng der gesellschaftliche Rahmen für Mütter gesteckt ist. Mutter zu werden, heißt nicht nur, sich die eigenen emotionalen, die pädagogischen, die zwischenmenschlichen Fragen zu stellen. Mutter zu werden, heißt auch, sich mit der übergroßen gesellschaftlichen Erwartungshaltung an Mütter auseinandersetzen zu müssen.
Meine damalige Beschäftigung mit Feminismus und der Rolle der Frau in unserer Gesellschaft hat mich nicht darauf vorbereitet, was für einen krassen Einschnitt das Mutterwerden im Leben einer Frau darstellt und was es in unserer Gesellschaft für einen „Rückschritt“ darstellt in Bezug auf „Frauen können alles erreichen“. Das hängt auch damit zusammen, dass es wenig Kontinuitäten im Feminismus gibt. Nicht nur gibt es unterschiedliche Theorien und Schwerpunkte, sondern jede Generation Frauen entdeckt den Feminismus immer wieder ein Stück weit neu. Lange Zeit hatte Feminismus einen schlechten Ruf, es war nicht erstrebenswert, Feministin zu sein. Das ist nicht mehr so, aber der Feminismus, der heutzutage medial präsent und sexy ist, speist sich weniger aus der feministischen Theorie, dafür umso mehr aus der marktbezogenen Nutzbarmachung eines popkulturellen Feminismus. Eine verwässerte feministische Botschaft, gedruckt von ausgebeuteten Frauen auf ein „Made-in-Bangladesh“-T-Shirt.
Frauen entdecken Feminismus meist dann für sich, wenn sie ihn brauchen, und als Mutter erwächst da eine besondere Dringlichkeit. Dass man sich mit Anfang 20 noch nicht für die Lage von Müttern, insbesondere alleinerziehenden Müttern interessiert, ist logisch. Die Zeit, in der man selbst ein Teenager war und Eltern langweilig, uncool und uninformiert fand, ist noch nicht lange her. Selbst Kinder zu bekommen, erscheint verdammt fern am Horizont. Rückblickend fand auch ich wohl mit 24 den Zusammenhang zwischen der Rolle der Frau in unserer Gesellschaft und der Mutterschaft kein ergiebiges Thema, weil es keine so naheliegende Idee ist, dass Frauen, die als Mütter durchschnittlich alle älter sind als man selbst, aufgrund ihrer Lebenslage „unterdrückter“ sind, weniger Wahlfreiheit haben. Das Erwachsenwerden funktioniert doch von der Jugend bis zum Ende der Ausbildung so, dass man immer mehr Autonomie und finanziellen Spielraum dazugewinnt. Ich hatte mich mit Sexismus beschäftigt, Simone de Beauvoir gelesen, fand erschreckend, wie weitverbreitet Gewalt gegen Frauen ist, und war persönlich nicht daran interessiert, aufgrund meines Geschlechts gesellschaftlich einer untergeordneten Position zugeordnet zu werden.
Die Geschlechterrolle „Frau“ ist bereits eine Zumutung, aber die Mutterrolle stellt handfeste Grenzen auf. Wie schwierig die Lebenslage von Müttern sein kann und was das mit Patriarchat und Kapitalismus zu tun hat, das war mir nicht klar, bevor ich selbst Kinder hatte. Und ich war geschockt. Sehr geschockt, dass man als Mutter so derartig im Stich gelassen werden kann, ohne jegliche Konsequenz für den Vater, der keinen Unterhalt zahlt und so gut wie nie das Kind betreut. Weil sich ab und zu um das Kind zu kümmern zwar insofern schön ist, als dass wenigstens ein bisschen Vater-Kind-Bindung entsteht, aber es für die Mutter wegen der fehlenden Planbarkeit keine Entlastung in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf darstellt. Zudem ist es eine zusätzliche Belastung, bis zur letzten Minute nicht zu wissen, ob ein Treffen stattfindet: sich mental darauf vorzubereiten, den Expartner zu treffen, Freizeitaktivitäten spontan absagen zu müssen, weil er doch nicht kommt, all das neben den ganzen anderen Stressoren, wie Armut, Stigma oder Überlastung, die das „So-richtig“-alleinerziehend-Sein mit sich bringt.
In so eine Situation können Männer einen einfach so bringen, und es gibt kein Instrument, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Sich nicht um die eigenen Kinder zu kümmern, keine Verantwortung für die Familie zu übernehmen, passt in das Bild, das wir uns von Vätern in dieser Gesellschaft machen. Am allerschlimmsten sind die Leute, die die Empörung darüber gar nicht verstehen, die irritiert sind: Als Mutter sei es doch sowieso unsere Aufgabe. Man hätte das Kind ja nicht bekommen müssen, wenn man sich jetzt nicht darum kümmern will. 50:50-Elternzeit? Völlig übertriebene Anspruchshaltung!
Durch eine Schwangerschaft tun sich jede Menge Themen auf, sowohl die persönliche, die individuelle Entwicklung betreffende als auch Themen, die die eigene Position in der Gesellschaft und den Umgang mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen betreffen. Durch meine Schwangerschaft hat sich mein ganzes Leben verändert. Formell betrachtet ist bei mir alles gut gelaufen. Gesunde Mutter, gesundes Kind. Keine Komplikationen, keine Geburtsverletzungen. Aber jede Geburt ist ein einschneidendes Erlebnis. Ich hätte jemanden gebraucht, der in meinem Team ist, auf den ich mich in diesem vulnerablen Moment verlassen kann. Die Geburt meines Sohnes war mein erster großer „Das-war-verdammt-hart-und-ich-habe-das-allein-geschafft,-weilich-es-schaffen-musste“-Moment. Fast ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie das Leben als alleinerziehende Mutter werden würde.
Für mich war völlig klar, dass ich mein Studium abschließen wollte, dass ich es abschließen musste. Und weil ich nicht wusste, dass allgemein üblich ist, dass gute Mütter mindestens ein Jahr Elternzeit machen, in Westdeutschland besser drei, und Väter höchstens, wenn überhaupt, die zwei danach benannten Vätermonate, habe ich nur ein Urlaubssemester lang Elternzeit gemacht. Zum nächsten Semester, als mein Kind acht Monate alt war, habe ich mir dann einen Praktikumsplatz für das anstehende fünfmonatige Praxissemester, das in meinem Studiengang Pflicht war, besorgt. „Ist ja nicht nur mein Kind“, dachte ich, und fand es völlig selbstverständlich und normal, dass der Vater die zweite Hälfte der Elternzeit machen würde. Dem war dann leider nicht so. Kurz vor Beginn meines Praxissemesters hat er mir mitgeteilt, dass er den Kleinen nicht betreuen würde können oder wollen. Wie sollte ich nun das Praxissemester machen, ohne das ich meinen Hochschulabschluss nicht bekommen würde? Und wie sollte ich ohne Abschluss genug Geld verdienen, um für mich und mein Kind zu sorgen? Fragen, die sich der Erzeuger in unserer Gesellschaft offenbar nicht stellen muss.
Care-Arbeit, also das notwendige Sich-um-jemanden-Kümmern, zum Beispiel in Form von Pflege, Erziehung, Hausarbeit, bleibt meistens an Frauen hängen. Nach der Geburt des ersten Kindes findet in bürgerlichen Heterokleinfamilien in der Regel die sogenannte Retraditionalisierung statt, bei der plötzlich die klassischen Geschlechterrollen und Zuständigkeiten in der Familie gelebt werden, die für Frauen viel Selbstaufgabe und wenig Freiheit bedeuten.
Bei mir hat sich das trotz aller gesellschaftlichen Gegebenheiten, Institutionen, Gesetze, des Drucks und der Geschlechterrollen, die uns alle in diese Richtung drängen, dann anders weiterentwickelt, und zwar im Wesentlichen aus zwei Gründen: Zum einen war einfach kein Partner da, der die klassische Vaterrolle hätte übernehmen können. Ich lebe nicht in einer traditionellen, bürgerlichen Kleinfamilie, weil ich gar nicht die Möglichkeit dazu hatte. Ohne Partner keine klassische Rollenverteilung. Und der andere Grund, warum ich mich nicht in einer traditionellen Kleinfamilie wiedergefunden habe, ist der, dass ich von vornherein wenig Interesse daran hatte, weil ich den Deal der klassischen Rollenverteilung in der Heterokleinfamilie von Anfang an absolut ungerecht fand.
2. Familie in Kapitalismus und Patriarchat
Nicht nur die historische Entwicklung unseres Zusammenlebens, nicht nur die Geschlechterrollen in der Heterobeziehung und das dazugehörige Skript, wie diese Art von Beziehung, zum Beispiel in Form der Ehe, sein sollte, sowie die Notwendigkeit, einer Lohnarbeit nachgehen zu müssen, strukturieren die Art unseres Miteinanders, sondern auch die konkreten finanziellen Rahmenbedingungen in Bezug auf das Leben mit Kindern beeinflussen, wie wir „Familie“ leben.
Wie wir leben, ist nicht nur durch unsere Ideologien beeinflusst, nicht nur dadurch, wie wir verinnerlicht haben, wie Frauen und Männer sind, sondern auch durch die konkreten politischen, gesellschaftlichen, finanziellen Rahmenbedingungen. Diese betreffen nicht nur die allgemeine Funktionsweise des Kapitalismus, sondern auch die konkreten Steuern, die wir zahlen, die Elternzeit, die wir nehmen, die Teilzeitarbeit, der wir nachgehen, und in welcher Form wir unser Leben mit unserer Familie gestalten (können). Wir brauchen Geld, um in diesem kapitalistischen System zu überleben, und wir stecken so sehr in diesem System fest, dass es uns oft alternativlos erscheint, und wir seine Gesetzmäßigkeiten – wie die, dass man erst etwas leisten muss, um dann über Geld Zugang zu anderen Ressourcen zu bekommen – als naturgegeben betrachten.
Da das Geldverdienen als notwendige Voraussetzung eine bestimmte Leistungsfähigkeit hat, die Müttern nicht an jedem Punkt der Mutterschaft gegeben ist, während Mutterschaft aber wiederum gleichzeitig auch für die nächste Generation der (Care-)Arbeiterinnen und (Lohn-) Arbeiter notwendig ist, lassen sich die Themenbereiche Mutterschaft, Erziehungs- und Familienmodelle, Sexismus, Elternzeit, die Ansprüche an Mütter und deren Versorgung nicht abseits von Lohnarbeit und Geld diskutieren. Insbesondere die Ausgestaltung der eigenen Familienform hängt direkt mit unserem gesellschaftlichen und politischen Kontext zusammen.
Familienformen
Die geläufigste Familienform ist wohl die bürgerliche Kleinfamilie, die so sehr das Standardmodell ist, dass sie üblicherweise nur „Familie“ genannt wird, obwohl uns allen auch Alleinerziehende, Regenbogen- und Patchworkfamilien durchaus aus dem persönlichen Umfeld bekannt sind.
Auf die Frage, warum oder wofür wir eigentlich überhaupt eine Familie haben, würde man aus dem Bauch heraus wahrscheinlich so etwas antworten wie: „Wir wollten Kinder“ oder „Wir waren schon ein paar Jahre zusammen, dann haben wir geheiratet“. Familien sind aber nicht nur nice to have, sondern sie haben auch spezifische Funktionen in der Gesellschaft. Eine Funktion, die in unserer Gesellschaft sehr große Relevanz hat, ist die Reproduktion, und das im doppelten Sinne: Reproduktion meint einerseits das Kinderkriegen in der Familie, also die biologische Reproduktion des Menschen selbst. Reproduktion heißt aber auch die tagtägliche Reproduktion der Arbeitskraft, also insbesondere die Care-Arbeit, die beispielsweise in Form von Hausarbeit, Versorgung mit Essen, Kindererziehung in der Familie geleistet wird. Hier setzt auch eine weitere Funktion der Familie an, nämlich die Sozialisation, also die Heranführung und Integration von Kindern in die Gesellschaft. Eine weitere mögliche Funktion, die in unserer Gesellschaft nicht unbedingt vorkommt, ist die Produktion, also das Herstellen von Gütern, wie es in der vorindustriellen Zeit üblich war.
Es gibt Bedingungen, denen Familienmitglieder unterworfen sind, und es gibt Inhalte, die auf Familienmitglieder projiziert werden. Und manchmal kommt da ein bisschen durcheinander, was die politischen und gesellschaftlichen Bedingungen sind, die die Lebenslagen von alleinerziehenden, getrennt erziehenden und anderen Familien erschweren, und was Zuschreibungen sind, wie Familienmitglieder angeblich so sind und fühlen und was sie machen. Individuelle Lebenslagen sind komplexer als eine Kategorie in einer Statistik. Es gibt nicht die bürgerliche Kleinfamilie einerseits, wo immer alles gut läuft, und die defizitären Alleinerziehenden andererseits. Kategorien sind dafür gut aufzuzeigen, welche Gruppen von strukturellen Benachteiligungen betroffen sind. Kategorien sind wenig hilfreich, um Individuen zu beschreiben oder um sich eine Meinung über Menschen zu bilden, die man eigentlich gar nicht kennt.
Wenn wir an die Durchschnittsfamilie denken, haben wir bestimmte Bilder im Kopf: Vater-Mutter-Kind, höchstens zwei Kinder, der Vater arbeitet Vollzeit, vielleicht im IT-Bereich, vielleicht ist er selbstständig und betreibt eine Anwaltskanzlei oder er ist Handwerker. Die Mutter macht den Großteil der Elternzeit, ist Bürokauffrau oder Kulturwissenschaftlerin und arbeitet wegen der Kinder Teilzeit, wobei Teilzeit eher 15 als 32 Stunden meint. Wohnt die Familie in Westdeutschland, hat die Mutter eher bis zu drei Jahre Elternzeit genommen und nicht nur eines, es gibt ja nicht überall für alle einen Kitaplatz, und blöde Sprüche muss man sich dann auch nicht anhören, wenn man „zu früh“ oder „zu viel“ arbeitet, warum hat sie denn sonst überhaupt Kinder bekommen. Der Vater ist vielleicht „modern“ und hat sogar die zwei Vätermonate gemacht, aber nur, wenn er einen „familienfreundlichen Arbeitgeber“ hat. Vielleicht macht er nach der Geburt auch zwei Wochen Urlaub, irgendwer muss ja den von ihr vorgebackenen Kuchen auftauen, wenn der Besuch ans Wochenbett kommt. Alles geht so seinen Gang in der Familie, und viele Leute finden es völlig normal und unauffällig, dass in Bezug auf Kinder und Haushalt die Frau fast alles macht und der Mann nur manchmal „mithilft“, sogar, wenn beide berufstätig sind.
Natürlich gibt es ganz viele Menschen, die gar nicht so leben oder in Teilen ganz anders leben. Es gibt Familien, die sich anders organisieren: Es gibt Eltern, die beide 30 Stunden arbeiten. Es gibt Alleinerziehende und Patchworkfamilien. Es gibt Hausmänner. Es gibt „Karrierefrauen“ – aber übrigens keine „Karrieremänner“, Männer sind einfach Männer, da ist ein hoher Stellenwert für das Berufliche normal. Es gibt Familien, wo die Eltern zwei Mütter sind. Und auch Paare oder umfangreichere Beziehungsgeflechte ohne Kinder, die sich als Familie verstehen. Familienformen sind in der Theorie vielfältig. Trotzdem kommen in der Praxis viele davon selten vor.
Die häufigste Familienform stellen mit 70 Prozent verheiratete Heteropaare mit Kindern dar, gefolgt von 19 Prozent Alleinerziehenden. Unverheiratet zusammenlebende Paare mit Kindern machen noch mal 11 Prozent der Familien aus. Von den verheirateten und unverheirateten Paarfamilien sind jeweils 6000 Lebensgemeinschaften und 4000 Ehepaare gleichgeschlechtliche Paare, die mit minderjährigen Kindern im Haushalt leben. Das entspricht einem Anteil von weniger als 0,1 Prozent.
Auch hinter dem Begriff alleinerziehend verbergen sich unterschiedliche Konstellationen: Von den insgesamt 1,5 Millionen Alleinerziehenden sind 1,3 Millionen alleinerziehende Mütter und lediglich 181000 alleinerziehende Väter. Damit sind fast neun von zehn aller alleinerziehenden Menschen Mütter. Alleinerziehend zu sein bedeutet, als einzige Erwachsene in einem Haushalt mit dem Kind oder den Kindern zu leben. Es bedeutet allerdings nicht, dass alleinerziehende Mütter oder Väter keine Partnerschaft führen. Mehr als jede dritte alleinerziehende Mutter hat eine feste Beziehung, 61 Prozent haben keine feste Partnerschaft.
Dass die Art, wie wir als Familien oder auch als Singles leben, mit den äußeren Bedingungen korrespondiert, sieht man daran, welche Art Häuser wir bauen. Die Bausubstanz ist auf die bürgerliche Kleinfamilie ausgerichtet. Einfamilienhäuser werden so konzipiert, dass Vater, Mutter, ein bis zwei Kinder und der Familienhund reinpassen. Je nach finanziellen Verhältnissen gibt es dann auch noch ein Arbeitszimmer und einen Grill auf der Terrasse für ihn und für sie eine Durchreiche von der Küche ins Esszimmer. Auch in Mietshäusern gibt es vor allem Zwei- und Dreizimmerwohnungen. Familienverhältnisse sind nichts statisch Feststehendes, wenn man den individuellen Fall betrachtet. Eine alleinerziehende Mutter lernt vielleicht jemanden kennen, und es ergibt sich eine Patchworkfamilie mit gemeinsamem Wohnsitz. Oder eine Paarfamilie trennt sich. Die derzeitige Scheidungsrate liegt bei 32 Prozent, das heißt, 32 Prozent aller in einem Jahr geschlossenen Ehen werden im Laufe der nächsten 25 Jahre wieder geschieden, wenn die Scheidungshäufigkeit des jeweiligen Kalenderjahres über einen Zeitraum von 25 Jahren konstant bleibt. Das heißt konkret, ungefähr jede dritte Ehe wird geschieden. Zudem gibt es auch Ehepaare, die sich sozusagen nur intern trennen, aber aus verschiedenen Gründen verheiratet bleiben. Ungefähr 75 Prozent der Eltern halten auch nach der Trennung oder Scheidung Kontakt, sowohl zueinander als auch zum gemeinsamen Kind oder zu den gemeinsamen Kindern, wobei hiervon immerhin zwei Drittel den Kontakt zur Expartnerin beziehungsweise zum Expartner als überwiegend normal bis gut bezeichnen. Frauen bekommen durchschnittlich zwei Kinder, Mütter haben eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 26,7 Wochenstunden2, die Betreuungsquote von Kindern unter drei Jahren liegt bei 34 Prozent, und Mütter, deren jüngstes Kind unter sechs Jahre alt ist, sind zu 64 Prozent erwerbstätig3.
Die meisten Familien mit Kindern leben also in einer bürgerlichen Kleinfamilie oder sind alleinerziehende Mütter. Familien bestehen, wenn man sie sich individuell anschaut, aus ganz vielen Facetten, und die lassen sich nicht immer auf einer Ebene zusammenführen, sodass ein passendes Label herauskommt. Das heißt, auch wenn nicht alle so leben, wie man sich das vorstellt, und auch wenn die Klischeefamilie eben ein Klischee ist und selten jemand in jedem Punkt dem häufigsten Merkmal einer Statistik entspricht, ist diese klischeehafte Vorstellung in Bezug auf die Familienkonstellation nicht weit von der Praxis entfernt. Hier darf man nun allerdings nicht den Fehler machen, daraus zu schließen, dass Familien eben nun mal üblicherweise so sind. Dass die Bedeutung von Familie und die Art des Zusammenlebens sich im historischen Kontext stetig verändert haben, ist nicht zuletzt ein wichtiger Hinweis darauf, dass Familienformen nicht biologisch determiniert sind und dementsprechend nicht notwendigerweise so bleiben müssen, wie sie sind.
Der andere Fehler, den man an dieser Stelle nicht machen sollte, ist der, aus den Mehrheitsverhältnissen darauf zu schließen, dass die „Standardfamilie“ richtigerweise das Ideal sei, das die anderen auch anstreben sollten und nach dem sich deswegen familienpolitische Maßnahmen richten sollten. Die Anzahl der Familien, die anders leben als die bürgerliche Kleinfamilie, ist gering, von der großen Anzahl alleinerziehender Mütter einmal abgesehen. Das heißt aber nicht, dass wir die Bedürfnisse von Familienformen, die selten vorkommen, vernachlässigen sollten. Die Rahmenbedingungen, die uns in die bürgerliche Kleinfamilie bringen, sind dennoch wirkungsvoll. Man muss erst selbst aktiv dagegen vorgehen, aktiv dafür sorgen, sich andere Bedingungen zu schaffen, wenn man anders leben will oder muss, weil man von vornherein nicht ins Klischee passt oder die familienpolitischen Rahmenbedingungen, zum Beispiel, weil man lesbisch oder schwul ist, nicht an der eigenen Lebensrealität ausgerichtet sind.
Natürlich ist das Modell der bürgerlichen Kleinfamilie „Haupternährer – Zuverdienerin“ für den Vater attraktiv, ich kann das gut verstehen. Ich tagträume manchmal auch von einem Mann, der mir Essen kocht und Scones backt, die Fenster putzt – die ich in den sechs Jahren, in denen ich in meiner Wohnung lebe, noch nie geputzt habe –, sich um die Kinder kümmert und den ich dann heirate, damit er über mich krankenversichert ist. Ich wäre ihm eine gute Ehefrau. Ich würde ihn unterstützen, indem ich auch mal im Haushalt helfe. Selbstverständlich würde ich einen Abend die Woche auf die Kinder aufpassen, damit er zum Yoga gehen kann. Ich würde meinem Mann auch erlauben, sich freizügig anzuziehen, und für mich wäre es okay, wenn er schon ein bis zwei Sexpartnerinnen vor mir hatte. Und mir ist auch wichtig, dass er eigenes Geld dazuverdient, damit er sich zum Beispiel etwas Hübsches zum Anziehen kaufen kann.
In der Praxis läuft das natürlich meistens ein bisschen anders: Üblicherweise führt bei Müttern in unserer Gesellschaft eine Mischung aus individuellen und strukturellen Gründen dazu, dass sie das gleiche Leben wie ihre Mütter und Großmütter in Westdeutschland führen. Wenn man bei Heterofamilien mit klassischer Rollenverteilung nachfragt, bekommt man häufig zwei verschiedene Arten von Gründen dafür genannt.4





























