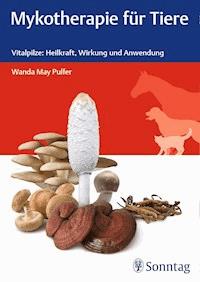69,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Mit Vitalpilzen Tiere erfolgreich therapieren.
Immer mehr Studien belegen die Wirksamkeit von Pilzinhaltsstoffen. Dieses Buch versetzt Sie in die Lage, die vermehrt nachgefragte Mykotherapie gezielt und erfolgreich anzuwenden. Vierzehn ausgewählte Vitalpilze werden Ihnen ausführlich vorgestellt.
Stärken Sie das Immunsystem erkrankter Tiere wirksam und unterstützen Sie deren Heilung bei ausgewählten Erkrankungen:
- Anwendungsspektrum bei Hund, Katze und Pferd bei häufigen Indikationen
- konkrete Angaben zur Anwendung und Dosierung der Pilze
- Vitalpilze als Unterstützung in der Krebstherapie
- umfangreiche Literaturstudien (über 650 Quellen) bieten fundiertes Wissen und Sicherheit
- Indikations- und Wirkstofftabellen zur schnellen Übersicht
- sämtliche Angaben werden unabhängig von Produktherstellern besprochen und bewertet
In der zweiten Auflage wurde das Kapitel zur Produktqualität grundlegend aktualisiert: Treffen Sie im Einzelfall eine noch bessere Wahl.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mykotherapie für Tiere
Vitalpilze: Heilkraft, Wirkung und Anwendung
Wanda May Pulfer
2., akutalisierte Auflage
18 Abbildungen
Danksagung
Meinen herzlichen Dank an alle Personen, die an der Entstehung dieses Buches auf die eine oder andere Weise beteiligt waren. An Patrycja Klimczak meinen Dank für das Foto ihres Hundes Baki. Es freut mich ganz besonders, dass er das aktuelle Buchcover zieren darf. Außerdem danke ich meinen Ansprechpartnern beim Georg Thieme Verlag für die gute Zusammenarbeit.
Innigsten Dank meinem lieben Hund Doshi, mit dem ich 15 Jahre meines Lebens teilen durfte, bevor er im Frühjahr 2016 über die „Regenbogenbrücke“ ging. Er war der zündende Funke, der mein Interesse an der Medizin und der alternativen Heilkunde zum Leuchten brachte. Ohne ihn wäre dieses Buch nie entstanden.
Vorwort zur 2. Auflage
Wissen weiterzugeben, verpflichtet zu sorgfältiger Prüfung desjenigen. Nach dieser Devise habe ich das vorliegende Buch vor mehr als drei Jahren verfasst und dies in der 2. Auflage konsequent weiterverfolgt. Meinungen und Halbwahrheiten von wissenschaftlich fundierten Sachverhalten zu trennen, das ist mir ein persönliches Anliegen. Dies bedeutet auch, die Aussagen unterschiedlicher Akteure kritisch zu hinterfragen und in Relation zu deren ureigenen Interessen zu stellen. Die Lupe anzusetzen, Informationen beharrlich nachzugehen und zu überprüfen, da weiterzugehen, wo andere innehalten – darin habe ich viel Übung erlangt. Nicht zur Begeisterung aller – aber offenbar dennoch von vielen. Denn das vorliegende Werk erfreut sich seit seines Erscheinens großer Anerkennung und Beliebtheit und hat sich zudem unerwartet auch als Lehrmittel etabliert. So freue ich mich, dass es nun mit der überarbeiteten 2. Auflage weitergehen darf.
Zürich, Herbst 2018
Wanda May Pulfer
Vorwort zur 1. Auflage
Im Jahr 2007 setzte ich mich erstmals mit heilsamen Pilzen auseinander, als ich meinen damals sechs Jahre alten und unter fortgeschrittener Arthrose leidenden Akitarüden mit Vitalpilzen zu behandeln begann. Das Leiden meines vierbeinigen Freundes bewegte mich dazu, nach einer nachhaltigen Behandlung zu suchen, welche über die Verabreichung von Schmerzmitteln, Cortison oder Nahrungsergänzungsmitteln hinausreichen sollte. Nach vorangegangener NSAID-Behandlung mit erheblichen Nebenwirkungen überzeugte mich die Wirkung der Pilze, als mein Hund nach nur einer Woche der Verabreichung wieder schmerzfrei herumspringen konnte. Dies ist bis zum heutigen Tag ganz ohne das Zutun anderer Hilfsmittel so geblieben.
In der Folge setzte ich mich als erste Tierheilpraktikerin in der Schweiz intensiv mit der Wirkung von Medizinalpilzen auseinander. In den folgenden Jahren recherchierte und forschte ich nach den Antworten auf meine Fragen. Ich sprach mit vielen Menschen, studierte die international verfügbare Literatur und setze mich schließlich direkt mit den wissenschaftlichen Grundlagen auseinander.
Aufgrund der Informationslücken im deutschsprachigen Raum entschloss ich mich, meine erworbenen Erkenntnisse anderen Menschen zugänglich zu machen. Das vorliegende Buch schenkt einen tiefen Einblick in die Welt der vierzehn wichtigsten Vitalpilze und enthält Material, welches wohl noch nie in dieser Weise veröffentlicht oder dargestellt wurde. Es dient als Werkzeug und Grundlage für die Entwicklung einer ernstzunehmenden und großartigen Therapieform, die ein überaus großes Potenzial besitzt, von Seiten der westlich orientierten Medizin jedoch bislang zu geringe Beachtung erfahren hat.
Mittlerweile haben die heilsamen Pilze meinem Hund, wie auch mir selbst, sowie vielen weiteren Menschen und Tieren Heil und Gesundheit geschenkt und durch teilweise bemerkenswerte Heilerfolge auch den einen oder anderen skeptischen Mediziner in Erstaunen versetzt. Liebe Leser, ich bin sicher, dass auch Sie über die Welt der Vitalpilze staunen werden, denn sie sind einfach bemerkenswerte Wesen, diese Pilze!
Zürich, Sommer 2015
Wanda May Pulfer
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Danksagung
Vorwort zur 2. Auflage
Vorwort zur 1. Auflage
Teil I Grundlagen
1 Tiermykotherapie
1.1 Einführung in die Mykotherapie
1.2 Heilende Pilze für unsere Tiere
2 Das Lebewesen Pilz
2.1 Der Pilz – weder Pflanze noch Tier
2.1.1 Pilze recyceln, regulieren und transformieren
3 Das Wirkprinzip heilsamer Pilze
3.1 Überlebensstrategie der Pilze
3.1.1 Ein perfekt komponiertes Geschenk der Natur
3.1.2 Die drei übergeordneten Wirkprinzipien
3.2 Das Wirkspektrum
3.2.1 Pharmakologische Wirkung
3.2.2 Energetische Wirkung
3.3 Die Wirkstoffe in Vitalpilzen
3.3.1 Ernährungsphysiologisch wichtige Stoffe
3.3.2 Adaptogene
3.3.3 Beta-D-Glucane/Polysaccharide
3.3.4 Glycoproteine und Proteoglycane
3.3.5 Glycolipide
3.3.6 Glycoside
3.3.7 Lektine
3.3.8 Mannitol
3.3.9 Nukleinbasen, Nukleoside und Nukleotide
3.3.10 Peptide
3.3.11 Phenole und Polyphenole
3.3.12 Steroide und Sterole
3.3.13 Terpene
3.3.14 Weitere bioaktive Substanzen
3.4 Heilsame Pilze und ihr Einfluss auf die Immunabwehr
3.4.1 Wirkung auf die natürlichen Barrieren
3.4.2 Die unspezifische (angeborene) Abwehr
3.4.3 Die spezifische (adaptive) Abwehr
3.4.4 Immunreaktionen/Hypersensibilität
3.4.5 Wirkeffekte von heilsamen Pilzen auf Leukozyten- und Zytokinmuster
4 Produkte und Qualität
4.1 Die verschiedenen Vitalpilzaufbereitungen
4.1.1 Pilzpulver
4.1.2 Pilzextrakte
4.1.3 Pilz-Spray
4.1.4 Beta-Glucan-Präparate aus Hefen
4.2 Produktsicherheit und Qualität
4.2.1 Anbau und Herkunft
4.2.2 Qualitätsstandards und Lebensmittelsicherheit
4.2.3 Vermahlungsgrad und Bioverfügbarkeit
4.2.4 Polysaccharidkonzentration und Anteil an Beta-Glucanen
4.2.5 Pilz-DNA
4.2.6 Gesetzliche Grundlagen
Teil II Die Pilze
5 Die einzelnen Pilze im Überblick
5.1 Agaricus blazei Murrill (ABM)
5.1.1 Ökologie und Geschichte
5.1.2 Inhaltsstoffe und Wirkung
5.1.3 Signatur in der TCM
5.1.4 Inhaltsstoffanalysen
5.2 Auricularia polytricha
5.2.1 Ökologie und Geschichte
5.2.2 Inhaltsstoffe und Wirkung
5.2.3 Signatur in der TCM
5.2.4 Inhaltsstoffanalysen
5.3 Chaga
5.3.1 Ökologie und Geschichte
5.3.2 Inhaltsstoffe und Wirkung
5.3.3 Signatur in der TCM
5.3.4 Inhaltsstoffanalysen
5.4 Champignon
5.4.1 Ökologie und Geschichte
5.4.2 Inhaltsstoffe und Wirkung
5.4.3 Signatur in der TCM
5.4.4 Inhaltsstoffanalysen
5.5 Coprinus comatus
5.5.1 Ökologie und Geschichte
5.5.2 Inhaltsstoffe und Wirkung
5.5.3 Signatur in der TCM
5.5.4 Inhaltsstoffanalysen
5.6 Cordyceps sinensis
5.6.1 Ökologie und Geschichte
5.6.2 Inhaltsstoffe und Wirkung
5.6.3 Signatur in der TCM
5.6.4 Inhaltsstoffanalysen
5.7 Coriolus versicolor
5.7.1 Ökologie und Geschichte
5.7.2 Inhaltsstoffe und Wirkung
5.7.3 Signatur in der TCM
5.7.4 Inhaltsstoffanalysen
5.8 Enokitake
5.8.1 Ökologie und Geschichte
5.8.2 Inhaltsstoffe und Wirkung
5.8.3 Signatur in der TCM
5.8.4 Inhaltsstoffanalysen
5.9 Hericium erinaceus
5.9.1 Ökologie und Geschichte
5.9.2 Inhaltsstoffe und Wirkung
5.9.3 Signatur in der TCM
5.9.4 Inhaltsstoffanalysen
5.10 Maitake
5.10.1 Ökologie und Geschichte
5.10.2 Inhaltsstoffe und Wirkung
5.10.3 Signatur in der TCM
5.10.4 Inhaltsstoffanalysen
5.11 Pleurotus ostreatus
5.11.1 Ökologie und Geschichte
5.11.2 Inhaltsstoffe und Wirkung
5.11.3 Signatur in der TCM
5.11.4 Inhaltsstoffanalysen
5.12 Polyporus umbellatus
5.12.1 Ökologie und Geschichte
5.12.2 Inhaltsstoffe und Wirkung
5.12.3 Signatur in der TCM
5.12.4 Inhaltsstoffanalysen
5.13 Reishi
5.13.1 Ökologie und Geschichte
5.13.2 Inhaltsstoffe und Wirkung
5.13.3 Signatur in der TCM
5.13.4 Inhaltsstoffanalysen
5.14 Shiitake
5.14.1 Ökologie und Geschichte
5.14.2 Inhaltsstoffe und Wirkung
5.14.3 Signatur in der TCM
5.14.4 Inhaltsstoffanalysen
Teil III Anwendung der Pilze
6 Anwendung und Dosierung
6.1 Allgemeines
6.2 Empfehlungen für die einzelnen Tierarten
6.2.1 Hund
6.2.2 Katze
6.2.3 Pferd
6.3 Kontraindikationen
6.3.1 Nebenwirkungen
6.3.2 Anwendungseinschränkungen
7 Indikationen
7.1 Allergien
7.1.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.1.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.2 Arthrotische Erkrankungen
7.2.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.2.2 Futterzusätze bei arthrotischen Erkrankungen
7.2.3 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.3 Atopische Dermatitis
7.3.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.3.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.4 Autoimmunreaktionen
7.4.1 Typen und tierartliche Besonderheiten
7.4.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.5 Babesiose
7.5.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.5.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.6 Borreliose (Lyme-Disease)
7.6.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.6.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.7 Chronische Obstruktive Lungenerkrankung
7.7.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.7.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.8 Cushing-Syndrom
7.8.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.8.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.9 Diabetes mellitus
7.9.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.9.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.10 Diarrhö
7.10.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.10.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.11 Epilepsie, idiopathische
7.11.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.11.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.12 Equines Metabolisches Syndrom
7.12.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.12.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.13 Feline Infektiöse Peritonitis (FIP)
7.13.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.13.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.14 Gastritis
7.14.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.14.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.15 Gingivitis-Stomatitis-Pharyngitis-Komplex
7.15.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.15.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.16 Harnwegsinfektionen
7.16.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.16.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.17 Hepatitis/Ansteckende Leberentzündung beim Hund
7.17.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.17.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.18 Herpes
7.18.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.18.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.19 Hufrehe des Pferdes
7.19.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.19.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.20 Hyperthyreose
7.20.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.20.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.21 Hypothyreose
7.21.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.21.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.22 Katzenschnupfenkomplex
7.22.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.22.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.23 Krebserkrankungen
7.23.1 Krebshemmung, Immuntherapie und Anti-Tumor-Wirkung
7.23.2 Begleitende Behandlung bei Chemotherapie
7.23.3 Begleitende Behandlung bei Strahlentherapie
7.24 Kreuzverschlag
7.24.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.24.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.25 Leishmaniose
7.25.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.25.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.26 Leptospirose
7.26.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.26.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.27 Mauke
7.27.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.27.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.28 Mykosen
7.28.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.28.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.29 Papillomatose
7.29.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.29.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.30 Parvovirose beim Hund und Infektiöse Panleukopenie bei der Katze
7.30.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.30.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.31 Scheinträchtigkeit
7.31.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.31.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.32 Toxoplasmose
7.32.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.32.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
7.33 Zwingerhusten (Canine infektiöse Tracheobronchitis)
7.33.1 Definition und tierartliche Besonderheiten
7.33.2 Mykotherapeutischer Behandlungsvorschlag
Teil IV Anhang
8 Übersichtstabellen der Indikationen und Inhaltsstoffanalysen
9 Literaturverzeichnis
Autorenvorstellung
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum
Gerhard Schuster |
Teil I Grundlagen
1 Tiermykotherapie
2 Das Lebewesen Pilz
3 Das Wirkprinzip heilsamer Pilze
4 Produkte und Qualität
2 Das Lebewesen Pilz
2.1 Der Pilz – weder Pflanze noch Tier
Pilze gehören neben den Algen und Bakterien zu den ältesten Lebewesen auf unserem Planeten. Wahrscheinlich besiedeln sie die Erde seit mehr als 1,2 Milliarden Jahren. Ihre Vielfalt wird zurzeit auf ungefähr 1,5 Millionen Arten geschätzt, wovon jedoch nur ungefähr 5% bekannt und mit wissenschaftlichem Namen belegt sind. Innerhalb dieser Artenvielfalt zählt die Welt der Großpilze schätzungsweise 140000 Mitglieder, unter denen jedoch auch nur ungefähr 10% wissenschaftlich bekannt sind und gerade mal 2000 Arten werden als sicher genießbar klassifiziert. Bei 700 Arten ist eine pharmakologische Wirkung nachweisbar ▶ [588].
In der biologischen Klassifikation der Vielzeller bilden Pilze neben Tieren und Pflanzen ein eigenständiges Reich. Bis in die 1960er Jahre wurden Pilze jedoch den Pflanzen zugeordnet. Großpilze bilden ein Geflecht aus, das mit den Wurzeln von Pflanzen und Bäumen vergleichbar ist. Dieses aus sehr dünnen und langen Fäden, sogenannten Hyphen, bestehende Pilzgeflecht (Myzel) befindet sich geschützt und verborgen im Erdboden und bildet das eigentliche Hauptorgan des Pilzes, durch welches er Wasser und Nahrung aufnimmt.
Pilze gewinnen ihre Energie aber nicht wie Pflanzen mit Hilfe von Sonnenlicht und sie produzieren auch weder Chlorophyll noch Sauerstoff. Ihre Zellwände sind auch nicht wie diejenigen der Pflanzen aus Zellulose aufgebaut. Pilze verwenden denselben Baustoff wie Insekten: das Chitin. Sie verfügen wie Mensch und Tier über einen Stoffwechsel und benötigen organische Nahrung zur Energiegewinnung. Jedoch erfolgt die Verdauung nicht wie bei Mensch und Tier innerhalb des Körpers. Der Pilz zersetzt und spaltet das ihn umgebende Substrat mit Hilfe seiner Enzyme und macht auf diese Weise die Nährstoffe für sich verfügbar. Danach nimmt der Pilz die vorverdaute, flüssige Nahrung durch sein unterirdisches Geflecht wieder auf.
Der Fruchtkörper, die sichtbare oberirdische Form des Pilzes, tritt meistens nur zu bestimmten Jahreszeiten in Erscheinung und dient in erster Linie der Fortpflanzung. Die Form des Fruchtkörpers kann neben der klassischen Erscheinung mit Hut und Stiel ganz verschiedene Formen und Größen annehmen und damit auch hinsichtlich des Gewichtes erheblich variieren. Es existieren jedoch auch Fruchtkörper, welche ganz in der Erde verborgen bleiben. Dazu gehört beispielsweise der kulinarisch begehrte Trüffel ▶ [6]. Doch sind nicht alle Pilzfruchtkörper essbar. Einige davon enthalten für uns giftige und Bewusstsein verändernde Stoffe oder sind aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für den Verzehr geeignet.
2.1.1 Pilze recyceln, regulieren und transformieren
Die Existenz und Funktion der Pilze ist entscheidend für den gesamten Nährstoffkreislauf der Erde. Sie dienen als natürliche Wiederaufbereitungsanlagen, indem sie fortwährend totes biologisches Material zersetzen und in lebenswichtige Stoffe umwandeln. Pilzorganismen, deren Gesamtmasse ungefähr ein Viertel der gesammten Biomasse der Erde ausmacht, bauen zusammen mit Bakterien jährlich ungefähr 60 Millionen Tonnen Biomasse ab. Das Wesen der Pilze zeichnet sich damit durch die starke Kraft aus, tote Materie zu recyceln und in lebenswichtige Stoffe zu transformieren. Diverse Mykologen sind der Meinung, dass es ausnahmslos keinen natürlichen Stoff gibt, der nicht von bestimmten Pilzen wieder abgebaut werden könnte. Sogar der eigene Fruchtkörper wird enzymatisch reduziert und zersetzt, sobald der Pilz sich fortgepflanzt und seine Sporen erfolgreich abgesetzt hat. Auf diese Weise gelangen auch die im Fruchtkörper gespeicherten wertvollen Stoffe als Nahrungsgrundlage zurück in den Boden. Großpilze unterscheiden sich durch ihre ökologische Lebensweise. In folgende drei Hauptgruppen werden sie eingeteilt: Saprophyten, Symbionten und Parasiten.
2.1.1.1 Saprophyten
Die meisten Großpilze sind Saprophyten. Sie wachsen in den Überresten von abgestorbenen Pflanzen am Boden oder an toten Bäumen, Baumstümpfen, gelagertem Brennholz oder sogar an Holzzäunen und Holzbänken. Sie zerlegen totes Holz und pflanzliche Reste in ihre ursprünglichen Bestandteile und führen diese Ausgangsstoffe zurück in den Boden. Zusammen mit Bakterien wirken saprophytische Pilze so als Destruenten und „Recycler” von organischem Material und halten durch den Abbau von Lignin, Zellulose, Hemizellulose und Keratin den Wald sauber. Sie schaffen Raum und produzieren auf diese Weise den Humus sowie die Nährstoffgrundlage für das Wachstum künftiger Pflanzen.
2.1.1.2 Symbionten/Mykorrhizapilze
Eine weitere Gruppe, die sogenannten Symbionten, sind Pilze, die eine enge Lebensgemeinschaft mit Bäumen eingehen. Dabei verwächst das Myzel des Pilzes mit den Wurzeln des Baums. Der Pilz umhüllt dessen feine Wurzeln mit seinem Myzel und bildet so einen regelrechten Mantel darum. Solche nervensystemähnliche Systeme zwischen Pilzen und Bäumen werden „Mykorrhizen“ genannt, was so viel wie „Pilzwurzel“ oder „verpilzte Wurzel“ bedeutet. Durch diese Verbindung profitieren beide Partner, denn der Pilz erhält die durch Photosynthese gewonnenen Kohlenhydrate des Baumes und im Gegenzug versorgt er ihn mit Nährstoffen wie Stickstoff und Phosphor. Die Filterfunktion des Pilzes schützt den Baum außerdem vor toxischen Schwermetallen. Es wird vermutet, dass die Mehrzahl aller Pflanzen eine solche Symbiose mit Pilzen eingeht und dass in Mitteleuropa die Wurzeln der allermeisten Bäume durchweg mit Mykorrhizen besetzt sind. Bäume, die eine solche Lebensgemeinschaft mit Pilzen eingehen, sind resistenter gegenüber Stressfaktoren wie Frost oder Krankheitserregern im Boden.
Gewisse Pilze haben sich auf nur eine Pflanzen- oder Baumart spezialisiert. Andere sind weniger wählerisch und verwachsen mit einer breiteren Palette an Arten. Aus diesem Grund sind beispielsweise Steinpilze nur in der Nähe von Fichten zu finden während der Pfifferling weniger wählerisch ist und gleichfalls in Nadel- wie auch Laubwäldern gefunden werden kann.
2.1.1.3 Parasiten
Daneben existieren auch parasitäre Pilze, welche lebende Bäume und andere Pflanzen befallen und aus ihnen ihre Energie beziehen. Der Pilz dringt dabei über die Rinde in das Holz ein oder befällt die unterirdischen Wurzeln der Pflanze. In der Regel führt ein Befall durch parasitäre Großpilze zum Absterben der Pflanze. Viele dieser Pilze können auf totem Holz als Saprophyten weiterexistieren. Einige Pilze, wie der Raupenpilz, befallen sogar tierische Organismen wie Insekten.
Info
Das größte Lebewesen der Welt ist ein Pilz
In den Wäldern von Oregon, USA, steht ein Hallimasch-Pilz, dessen unterirdisches Geflecht 9 Quadratkilometer (965 Hektar) groß ist. Es handelt sich hierbei um das größte Lebewesen auf dieser Welt. Das Gewicht dieses Pilzes wird auf 600 Tonnen und sein Alter auf 2400 Jahre geschätzt. Als „Mastermind“ bildet er mit seinem Myzel eine Art unterirdisches Netzwerk aus und kontrolliert so die ökologischen Bedingungen einer ganzen Region. Im Jahre 2004 entdeckten Wissenschaftler auch im Nationalpark im Schweizer Unterengadin einen Hallimasch, dessen Myzel eine Fläche von 35 Hektar besiedelt und etwa 1000 Jahre alt sein soll. Es handelt sich um den größten bekannten Pilz in Europa.
3 Das Wirkprinzip heilsamer Pilze
3.1 Überlebensstrategie der Pilze
Pilze bilden eine individuelle Gruppe innerhalb der biologischen Klassifikation der Lebewesen. Wie die Zellen von Mensch und Säugetier besitzen die Zellen von Pilzen einen Zellkern sowie ein Zellskelett, welches bei Pilzen aus einer Polysaccharid-Chitin-Protein-Matrix besteht. Pilze verfügen über einen Stoffwechsel, ernähren sich von organischem Material und ihre Zellen atmen Sauerstoff ein, sowie Kohlendioxid aus. Pilze sind biologisch einzigartig. Über Millionen von Jahren hinweg haben sie sich erfolgreich ihrem Lebensraum angepasst. Die feindliche Umgebung in Morast, Fäulnis und Feuchtigkeit hat dazu geführt, dass Pilze Schutzfunktionen und Überlebensstrategien entwickelt haben, welche ihnen ihre Existenz sichern. Sie haben so auch die Fähigkeit gewonnen, selber Stoffe herzustellen, die Bakterien, Viren, aber auch pathogene Pilze daran hindern, sich in ihren Zellen zu replizieren. Zum Schutz vor Fraß durch Tiere bedienen sich einige Pilze auch Giftstoffen und Halluzinogenen. Die gemeinsame Evolutionsspanne von Pilzen und Tieren hatte außerdem zur Folge, dass die Immunabwehr von Pilzen, Menschen und Tieren auf dasselbe mikrobielle Feindbild reagiert. Aus diesem Grund wirken Pilzsubstanzen auch gegen die meisten Erreger, welche Menschen und Tiere potenziell krank machen und führen zu einer Aktivierung der Immunabwehr. Die Überlebensmechanismen und Schutzfunktionen der Pilze lassen sich also auch auf den Körper von Mensch und Tier übertragen.
3.1.1 Ein perfekt komponiertes Geschenk der Natur
Man würde den heilsamen Pilzen nicht gerecht werden, spräche man hinsichtlich ihrer Zusammensetzung von einer mehr oder weniger zufälligen Mischung von Stoffen. Vielmehr handelt es sich um eine geradezu perfekte Komposition von Inhaltsstoffen, so komplex und intelligent arrangiert, wie es nur die Natur über Millionen von Jahren hinweg bewerkstelligen kann. Heilsame Pilze besitzen eine große Vielfalt an höchst wirksamen Inhaltsstoffen, die sich in ihrer Bioaktivität synergetisch optimal ergänzen. Die Metaboliten aus heilsamen Pilzen wie Polysaccharide und Beta-Glucane, Glycoproteine, Proteoglycane, Peptide und weitere Biopolymere regen Prozesse im Körper an, die durch die ebenfalls vorkommenden Enzyme, Vitamine, Mineralstoffe, Lipide und Polyphenole zusätzlich unterstützt und katalysiert werden. Der Pilz vereint also synergetisch alle nötigen Komponenten, um einen tiefgreifenden gesundheitsfördernden Einfluss auf den menschlichen und tierischen Organismus ausüben zu können. Von besonderem Interesse für die Wissenschaft sind dabei die aktivierenden und modulierenden Effekte auf die Immunabwehr. Ihr medizinischer Einsatz wird aus diesem Grund hauptsächlich anhand der Bekämpfung von Krebserkrankungen untersucht. Pilzwirkstoffe üben jedoch auch potente antimikrobielle Wirkeffekte aus und verfügen neben dem medizinischen auch über ein besonders umfangreiches therapeutisches Anwendungsspektrum. Aufgrund der evolutionsbedingten nahen Verwandtschaft des Pilzes mit dem Tier macht seine molekulare Struktur die Inhaltsstoffe für Mensch und Tier zudem hervorragend verfügbar. Sie können durch ihr hohes Molekulargewicht nämlich eine effizientere biologische Aktivität ausüben als Metaboliten aus Pflanzen. Durch Übertragung seiner uralten Überlebensmechanismen schafft das Wesen des Pilzes die nötige Voraussetzung im Körper von Mensch und Tier, welche eine Heilung aus sich selbst heraus erst möglich macht.
Info
In asiatischen Ländern werden heilende Pilze schon seit Jahrtausenden präventiv, zur Gesundheitsförderung oder zur Behandlung von verschiedensten Erkrankungen eingesetzt. Die Mykotherapie gilt neben Operation, Bestrahlung und Chemotherapie in vielen Teilen Ostasiens unterdessen sogar als 4. Säule der klassischen Krebstherapie.
3.1.2 Die drei übergeordneten Wirkprinzipien
Die generelle Charakteristik und Funktion von Pilzen in der Natur spiegelt sich sowohl in ihrer Energetik wie auch in ihrer pharmakologischen Wirkung wider. Pilze wachsen in der Erde, auf pflanzlichen Überresten am Boden, auf Holz oder im symbiotischen Verbund mit Baumpartnern. Es erstaunt darum nicht, dass auch aus der Sicht der Traditionellen Chinesischen Medizin das Wesen der Pilze einen starken Bezug zu den Elementen Erde und Holz der fünf Wandlungsphasen aufweist. Dabei repräsentieren Pilzextrakte eher den Yang-Aspekt und Pilzpulver eher den Yin-Aspekt des Pilzes. Jeder Pilz verfügt über eine individuelle energetische und pharmakologische Signatur. Übergeordnet sind drei grundlegende Wirkprinzipien von Bedeutung.
3.1.2.1 Transformierendes und regulierendes Prinzip
In der Natur übernehmen saprophytisch lebende Pilze die Aufgabe des Abbaus und der Transformation von organischen Abfallprodukten und schaffen dadurch die Grundlage für neues Leben. In der Natur existiert kein Stoff, der nicht von Pilzen wieder zerlegt werden könnte. Pilze regulieren und reinigen durch ihre natürliche Funktion ganze Ökosysteme. Ihre Kraft entfaltet sich überall dort am meisten, wo sie auch am meisten benötigt wird. Je verschmutzter eine Substratgrundlage ist, umso größer wird das Wachstum von Pilzen darauf sein. Diese Wirkung entfalten sie auch im Körper von Mensch und Tier. Pilze regulieren dort, wo Regulation nötig ist. So wird durch die Einnahme von heilsamen Pilzen beispielsweise ein überaktives Immunsystem herunterreguliert oder aber ein schwaches Immunsystem gestärkt. Eine intakte Abwehr jedoch erfährt weder eine Überstimulierung noch eine Supprimierung. Diese intelligente Regulation verhilft zu einem intakten Gleichgewichtszustand und zu einer Balance aller im Körper ablaufenden Prozesse.
3.1.2.2 Stärkendes und entgiftendes Prinzip
Pilze nehmen auch Toxine aus dem Boden oder anderen Substraten auf und entgiften damit die Lebensgrundlage anderer Lebewesen. Dasselbe Konzept von Ausleitung und Entgiftung erfährt der Organismus von Mensch und Tier. Pilzwirkstoffe binden Toxine und führen zu deren Ausleitung. Sie schützen und stärken aber auch die ausleitenden Organe wie Leber, Darm und Nieren in physiologischer wie auch energetischer Hinsicht. Die stark immunaktivierende Wirkung führt außerdem zu einer körperinternen Entgiftung auf Zellebene. Durch ihre neurotrophe und ausgleichende Wirkung werden auch Psyche und Emotionen entspannt, gereinigt und regeneriert.
3.1.2.3 Transportierendes, schützendes und nährendes Prinzip
Die im symbiotischen Verbund mit Bäumen lebenden Mykorrhizapilze repräsentieren ein weiteres wichtiges Prinzip. Diese Pilze transportieren Nährstoffe und schützen ihre Baumpartner durch eine Art Filterfunktion vor Stressoren wie Giftstoffen im Boden. Pilze enthalten neben Lipiden und Kohlenhydraten eine große Bandbreite an qualitativ hochwertigen Aminosäuren sowie weiteres für den Körper von Mensch und Tier ausgezeichnet verfügbares Protein. Pilzkörper stärken und nähren in ernährungsphysiologischer Hinsicht auf hervorragende Weise. Die starke antioxidative Kraft von Pilzen schützt den Körper und seine Organe nachweislich in vielfältiger Weise vor Schäden. Durch eine verstärkte Bildung und Bewegung von Lebensenergie und Lebenssäften entfalten heilsame Pilze diese nährenden, stärkenden und schützenden Eigenschaften auch auf energetischer Ebene.
3.2 Das Wirkspektrum
3.2.1 Pharmakologische Wirkung
Die Wirkungen der Vitalpilze sind durch zahlreiche wissenschaftliche Studien belegt. Jeder Pilz verfügt dabei über ein spezifisches Wirkungsfeld. Das Gesamtspektrum kann wie folgt klassifiziert werden:
adaptogen (= Erhöhung der Stresstoleranz)
analgetisch (= schmerzlindernd)
antiandrogen und antiöstrogen
anticholinergisch
antidiabetisch und blutzuckersenkend
antihypertensiv (= blutdrucksenkend)
antiinflammatorisch (= entzündungshemmend)
antimutagen (= der Entartung von Zellen entgegenwirkend)
antioxidativ und radikalfangend
antitumoral, antikanzerogen, antiangiogenetisch, antimetastatisch
antiviral, antibakteriell, antimykotisch, antiparasitär
atherosklerosehemmend (= die Verkalkung der Gefäße hemmend)
diuretisch (= entwässernd)
entgiftend
GABAerg und krampfhemmend
immunaktivierend und immunmodulatorisch
lipidsenkend, fettstoffwechselregulierend
neurotrop und neuroprotektiv
präbiotisch
protektiv auf Leber, Nieren und Herz wirkend
redifferenzierend (= Rückbildung von Zellen in den ursprünglichen Zustand)
strahlen- und chemoprotektiv
thrombinhemmend (= blutgerinnungshemmend)
thrombozytenaggregationshemmend (= der Verklumpung von Blutplättchen entgegenwirkend)
vasodilatatorisch (= blutgefäßerweiternd)
wundheilungsfördernd
3.2.2 Energetische Wirkung
Aus der Sicht der Traditionellen Chinesischen Medizin hat das Wesen der Pilze einen starken Bezug zu den Elementen Erde und Holz der fünf Wandlungsphasen. Auf energetischer Ebene wirken heilsame Pilze:
ausgleichend
ausleitend
entgiftend
harmonisierend
klärend und beruhigend auf den Geist
nährend
regulierend
stärkend
transformierend
transportierend
3.3 Die Wirkstoffe in Vitalpilzen
3.3.1 Ernährungsphysiologisch wichtige Stoffe
Alle proteingebundenen Aminosäuren
Den höchsten Gehalt weisen dabei Cordyceps sinsensis, Coprinus comatus, Pleurotus ostreatus und Shiitake sowie Agaricus blazei Murrill auf.
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren: Laurinsäure, Lignocerinsäure, Myristinsäure, Palmitinsäure, Pentadecansäure, Stearinsäure
Ungesättigte Fettsäuren: Ölsäure und Palmitoleinsäure
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: Linol- und Linolensäure, alpha-Hydroxytetracosansäure und 2-Hydroxytetracosansäure (Cerebronsäure)
Konjugierte Fettsäuren: Konjugierte Linolsäure (CLS)
Phospholipide
Phosphatidylcholin (Lecithin), Phosphatidylethanolamine (Kephalin), Phosphatidylserin, Phosphatidylinositol
Mineralstoffe
Kalium, Phosphor, Magnesium, Kalzium, Natrium, Chlorid
Spurenelemente
Selen, Kupfer, Eisen, Jod, Mangan, Zink, Chrom, organisches Germanium, Barium, Cäsium, Rubidium, Strontium
Provitamin D2 (siehe Ergosterol) sowie Provitamin A
Vitamine
A, C, D, E, K1, B1 (Thiamin), B2 (Riboflavin), B3 (Niacin), B5 (Panthothensäure), B6 (Pyridoxin), B7 (Biotin), B9 (Folsäure), B12 (Cobalamin)
Enzyme
Ballaststoffe, Chitin
3.3.2 Adaptogene
Als Adaptogene oder auch als „Biological Response Modifiers“ wird eine Gruppe von Substanzen (z.B. Polyphenole, Terpene und Polysaccharide) bezeichnet, die zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und Widerstandskraft des Körpers gegenüber Stress eingesetzt werden können. Sie verbessern die Anpassungsfähigkeit des Körpers gegenüber körperlichem und psychischem Stress, erzeugen dabei selbst keine zusätzlichen Stressfaktoren und haben eine regulative Wirkung auf Hormon-, Nerven- und Immunsystem ▶ [585]. Heilsame Pilze sind reich an adaptogenen Substanzen.
3.3.3 Beta-D-Glucane/Polysaccharide
Polysaccharide sind Vielfachzucker und werden den Kohlenhydraten zugeordnet. Sie sind komplexe, kettenähnliche Moleküle, die in Pflanzen und Pilzen sehr häufig vorkommen und aus mindestens zehn Einzelzuckerbausteinen, den Monosacchariden, zusammengesetzt sind. Man unterscheidet verschiedene Polysaccharid-Fraktionen anhand ihrer Struktur und ihres molekularen Aufbaus. Einige der am häufigsten vorkommenden Polysaccharid-Strukturen auf der Erde sind Cellulose und Chitin. Die Fruchtkörper, Sklerotien und Myzelien von Großpilzen sind besonders reich an bioaktiven Polysacchariden. Die in medizinischer Hinsicht interessantesten darunter sind die Beta-D-Glucane. D-Glucane sind spezifische Polysaccharide, die nur aus miteinander verknüpften D-Glukose-Molekülen aufgebaut sind. Man unterscheidet zwischen Alpha- und Beta-D-Glucanen. Die räumliche Position der glykosidischen Bindung zwischen zwei Molekülen wird durch die Bezeichnungen (1,2), (1,3), (1,4) oder (1,6) angezeigt. Die biologisch aktivsten D-Glucane verfügen über eine Beta-Struktur mit (1,3)-(1,6)-Verknüpfungsmuster und werden aufgrund ihrer immunaktivierenden und antitumoralen Wirkung zu den wirkungsvollsten Stoffen gezählt, die in der Natur vorkommen ▶ [594]. Wissenschaftliche Untersuchungen legen nahe, dass die Ausprägung dieser Wirkung von einem hohen Molekulargewicht sowie einer komplexen dreidimensionalen Struktur abhängt, die aus der Verbindung der Hauptkette mit Seitenketten entsteht. Dabei ist die Art der verbauten Monosaccharide weniger bedeutend, als vielmehr, wie diese miteinander verknüpft sind (räumliche Position der Bindung). Dies bedeutet, dass ein höheres Maß an Größe und struktureller Komplexität mit einer Steigerung der Wirkpotenz verbunden ist. Glucane mit Beta-(1,3)-Grundstruktur bilden im Verbund mit Chitin und Proteinen die Zellwände von Pilzen aus. Sie werden als „Biological Response Modifiers“ (BRM) klassifiziert und können rasch, sogar bereits innerhalb von 30 Minuten nach oraler Aufnahme, über den Dünndarm absorbiert und von den Zellen aufgenommen werden ▶ [595]. Innerhalb des Körpers üben sie eine stimulatorische sowie modulierende Wirkung auf verschiedene Zellen des Immunsystems aus und sind in der Lage, die Immunabwehr in jede Richtung auszugleichen. Durch ihre spezielle molekulare Struktur können sie direkt an die Rezeptoren der Immunzellen von Mensch und Tier andocken, führen dadurch zu einer Abwehrreaktion des Immunsystems und damit zu einer Aktivierung von zytotoxischen Makrophagen, Dendritischen Zellen, T-Helfer-Zellen und NK-Zellen, einer Förderung der T-Zell-Differenzierung und einer Aktivierung des alternativen Komplement-Reaktionsweges. Auf diese Weise verbessern Beta-Glucane auch die körpereigene Tumorabwehr sowie die antibakterielle, antivirale, wundheilungsfördernde und gerinnungshemmende Aktivität ▶ [594]. Neue Studien bestätigen zudem, dass Beta-Glucane ihre bioaktive Wirkung nicht nur über die Bindung an Immunzellen, sondern auch über die Bindung an Rezeptoren anderer Körperzellen ausüben und diese direkt beeinflussen können ▶ [596]. Eine detaillierte Übersicht zum Wirkspektrum der verschiedenen Polysaccharide aus heilsamen Pilzen ist im Anhang zu finden.
3.3.4 Glycoproteine und Proteoglycane
Glycoproteine sind Proteine, deren Aminosäuren kovalent an Kohlenhydrate (Monosaccharide, Di- und Oligosaccharide, Polysaccharide) gebunden sind.
Zu den körpereigenen Glycoproteinen gehören einige Hormone sowie Bestandteile des Immunsystems, wie Immunglobuline und Interferon. Besonders bei Säugetieren nehmen Glycoproteine eine wichtige Rolle bei den Erkennungsreaktionen durch das Immunsystem ein. Auch heilsame Pilze enthalten Glycoproteine, die über immunmodulatorische ▶ [80], ▶ [300], ▶ [305], ▶ [462], antitumorale ▶ [296], ▶ [343] und antidiabetische ▶ [379] Eigenschaften verfügen.
Eine besondere Gruppe sind die Proteoglycane, die eine eigene Klasse innerhalb der Glycoproteine bilden. Während beim klassischen Glycoprotein der Großteil des Moleküls aus Proteinanteilen besteht, überwiegt beim Proteoglycan der Kohlenhydratanteil. Proteoglycane kommen in diversen heilsamen Pilzen vor und verfügen über ähnliche Wirkkräfte wie die Glycoproteine und Polysaccharide. Die in Reishi enthaltenen Proteoglycane üben beispielsweise immunmodulierende, zytotoxische ▶ [512], blutzuckersenkende ▶ [636], antioxidative und nierenschützende Effekte aus ▶ [484]. Agaricus blazei Murrill enthält ein wasserlösliches Proteoglycan mit immunstimulierender Wirkung ▶ [44]. Und im Myzel von Pleurotus ostreatus kommt ein Proteoglycan mit immunmodulierender und krebshemmender Wirkung vor ▶ [409], ▶ [410]. Auch das proteingebundene Polysaccharid PSK aus dem Myzel von Coriolus versicolor ist genau genommen ein Proteoglycan.
3.3.5 Glycolipide
Glycolipide sind Verbindungen aus Fett- und Kohlenhydratmolekülen, die zum Aufbau biologischer Strukturen, insbesondere Zellmembranen beitragen.
3.3.6 Glycoside
Glycoside sind hochwirksame organische chemische Verbindungen, die aus einem Monosaccharid sowie aus einer Nicht-Zucker-Komponente (Aglycon) bestehen. Das Aglycon bestimmt auch die Wirkung des Glycosids. Glycoside kommen in Pflanzen und Pilzen vor. Sie können über antikanzirogene, antimikrobielle, cholesterinsenkende, schmerzstillende, leberschützende, diuretische oder beruhigende Effekte verfügen. Die in Cordyceps sinensis nachgewiesenen Glycoside Cordyol A-C verfügen bespielsweise über eine beachtliche antivirale (HSV-1) sowie über eine schwache antimykobakterielle Wirkung ▶ [178].
3.3.7 Lektine
Lektine sind kohlenhydratbindende Proteine, welche u.a. zelluläre biochemische Reaktionen auslösen können. Sie verfügen oft über antimikrobielle und thrombozytenaggregationshemmende Eigenschaften ▶ [41], ▶ [144], ▶ [148], ▶ [316], ▶ [397], ▶ [495], ▶ [558]. Lektine können sich aber auch mit Polysacchariden zu einer Glycoproteinstruktur verbinden und auf diese Weise ein größeres Wirkspektrum ausüben. Die höchste Lektinaktivität unter den heilsamen Pilzen weist der Coprinus comatus auf ▶ [168].
3.3.8 Mannitol
Das in Pilzen vorkommende D-Mannitol ist ein Zuckeralkohol, welcher aus der Reduktion des Monosaccharid D-Mannose entsteht. Aufgrund seines süßen Geschmacks wird es in der Lebensmittelindustrie als Zuckeraustauschstoff verwendet. D-Mannitol verfügt jedoch auch über eine diuretische und abführende Wirkung und kommt deshalb auch als Arzneistoff zur Anwendung. Inhaliert kann D-Mannitol zur Behandlung von Lungenerkrankungen wie COPD verwendet werden. In Vitalpilzen kommt D-Mannitol in Cordyceps sinensis ▶ [199] und Polyporus umbellatus ▶ [429] vor.
3.3.9 Nukleinbasen, Nukleoside und Nukleotide
Nukleinbasen, Nukleoside und Nukleotide kommen in verschiedenen Formen in einigen heilsamen Pilzen vor. Die Nukleoside setzen sich wie die Nukleotide aus einer Nukleinbase (Adenin, Guanin, Cytosin, Thymin, Uracil) und einem Monosaccharid (Pentosen) zusammen. Nukleotide verfügen jedoch über zusätzliche Phosphatanteile. Je nachdem wie viele Phosphatreste gebunden werden, treten Nukleotide als Mono-, Di-, oder Triphosphat auf. Sie sind Bestandteile von Nukleinsäuren, die in allen lebenden Organismen vorkommen. Der wohl bekannteste Vertreter der Nukleinsäuren ist die DNA (Desoxyribonukleinsäure). Nukleinsäuren können als Signalträger oder als Katalysatoren für biochemische Reaktionen dienen. Nukleosidanaloge Medikamente werden in der medizinischen Therapie gegen retrovirale Infektionen verwendet. Sie kommen besonders in Agaricus blazei murrill ▶ [31], Auricularia ▶ [71], ▶ [77], Coprinus comatus ▶ [173], Reishi ▶ [469], Shiitake ▶ [528], Maitake ▶ [380], Polyporus umbellatus ▶ [431] und Cordyceps sinensis ▶ [225] vor.
3.3.9.1 Adenosin
Adenosin ist ein Nukleosid. Es besteht aus der Nukleinbase Adenin und dem Zucker Beta-D-Ribose. Es wirkt insbesondere blutgefäßerweiternd, verringert die Herzfrequenz und führt zu einer verbesserten Durchblutung der Koronargefäße. Aus diesem Grund wird Adenosin anhand verschiedener Präparate zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen verwendet. Durch seine Wirkung auf das vegetative Nervensystem verhindert Adenosin eine mögliche Überstimulation des Herzens über den Sympathikus-Nerv. Es hemmt außerdem die anregenden Neurotransmitter und unterdrückt damit überschießende Transmissionen im Gehirn, welche beispielsweise zu epileptischen Krampfanfällen führen können. Es wirkt dadurch antikonvulsiv (= krampfhemmend) ▶ [590], ▶ [591]. Adenosin wirkt förderlich auf den Schlaf und es steigert zudem die Durchblutung des Gehirns sowie der Skelettmuskulatur. Es kommt hauptsächlich in Reishi ▶ [469], Codyceps sinensis ▶ [225] und Auricularia polytricha ▶ [71], ▶ [77] vor.
3.3.9.2 Cordycepin
Cordycepin (3’-de-oxyadenosine) ist ein Derivat des Nukleosids Adenosin. Es untescheidet sich von Adenosin durch ein fehlendes Sauerstoffatom an der 3. Position des Zuckers Ribose. Ihm wird neben einer starken antioxidativen Kraft ▶ [199] eine neuroprotektive ▶ [605] sowie antineoplastische und damit tumorhemmende ▶ [179], ▶ [606], ▶ [607] Wirkung zugeschrieben. In vitro wurde zudem eine zytotoxische Wirkung auf Leukämie- und Gliomzellen festgestellt ▶ [604]. Außerdem wirkt Cordycepin TH2-immunmodulierend sowie durch die vermehrte Produktion von Interleukin-10, Hemmung von Interleukin-2 und Suppression von TH1-Immunreaktionen ▶ [231] antiinflammatorisch sowie autoimmunen Reaktionen entgegen ▶ [199], ▶ [215], ▶ [608]. Es kommt in Cordyceps sinensis bzw. militaris vor ▶ [198].
3.3.9.3 Eritadenin
Eritadenin (auch Lentinacin oder Lentysin) entsteht durch Trocknung oder Erhitzung des Pilzes aus einem darin enthaltenen Purinalkaloid. Es ist ein Nukleinsäurebestandteil und ein Derivat von Adenin. In erster Linie führt die Einnahme von Eritadenin zu einer raschen Verwertung und Ausscheidung von Cholesterin über den Darm. Es bewirkt so eine erhebliche Senkung des Serumcholesterins ▶ [556]. Eritadenin kommt in Shiitake vor ▶ [528]. Es wird als wichtigste Substanz im Zusammenhang mit der cholesterinsenkenden, antithrombotischen und atherosklerotischen Wirkung des Pilzes angesehen ▶ [562].
3.3.9.4 Guanosin
Guanosin ist ein Nukleotid, welches aus der Nukleinbase Guanin und dem Zucker Beta-D-Ribose besteht. Es ist Bestandteil der Ribonukleinsäure (RNA). Das in Cordyceps sinensis enthaltene Guanosin erhöht die Ausschüttung von Zytokinen, wie dem Tumornekrosefaktor-alpha sowie Interleukin-1-beta. Die Freisetzung von Stickstoff (NO) durch Makrophagen wird jedoch gehemmt ▶ [227].
3.3.10 Peptide
Peptide sind organische Verbindungen von maximal 100 Aminosäuren, die durch Peptidbindungen miteinander verknüpft sind. Kommen mehr als 100 Aminosäuren vor, wird das Molekül als Protein bezeichnet. Peptide erfüllen eine große Anzahl physiologischer Funktionen. Ihre Wirkungsweise ist in vielen Fällen gut erforscht. Peptide können als Hormone wirken oder entzündungshemmende, entzündungsfördernde, immunmodulierende, antioxidative, antibiotische oder antivirale Effekte ausüben. Cordyceps sinensis enthält zwei spezifische Peptide: Myriocin und Cordymin ▶ [202]. Und auch in Pleurotus ostreatus kommt ein Peptid (Pleurostrin) mit antifungaler Wirkung vor ▶ [396].
Peptide verbinden sich auch mit Kohlenhydratstrukturen zu bioaktiven Glycopeptiden oder Polysaccharid Peptiden. Das „PSP“ aus dem Myzel von Coriolus versicolor ist wohl das bekannteste Polysaccharid Peptid. Besonders in Reishi, aber auch in Maitake, kommen diese Verbindungen gehäuft vor. In Agaricus blazei Murrill wurde ein immunmodulierendes und krebshemmendes Peptid-Glucan gefunden ▶ [32].
3.3.11 Phenole und Polyphenole
Biologisch aktive Polyphenole sind aromatische Verbindungen, die in Pflanzen und Pilzen als sekundäre Inhaltsstoffe in Form von Farb- und Geschmacksstoffen sowie als Tannine vorkommen. Sie üben antioxidative, radikalfangende, antibakterielle und krebsvorbeugende Effekte aus und gelten allgemein als gesundheitsfördernd. Heilsame Pilze sind reich an verschiedenen phenolischen Stoffen. Maitake beispielsweise enthält allein 18 verschiedene phenolische Komponenten ▶ [362].
3.3.11.1 Chrysin
Der antiinflammatorisch, antioxidativ und antikanzerogen wirkende Stoff „Chrysin“ gehört zur Gruppe der Flavonoide ▶ [603]. Unter den Pilzen kommt Chrysin in Pleurotus ostreatus vor. Anhand eines Versuches an hypercholesterämischen Ratten wurde Chrysin als glukose-, lipid- und leberenzymsenkender Wirkstoff identifiziert ▶ [392].
3.3.11.2 Hericenone
Die Hericenone sind teilphenolische Verbindungen aus Hericium erinaceus. Wie die Diterpene aus Hericium erinaceus üben auch die terpenphenolischen Hericenone (C-H) eine schützende und wachstumsfördernde Wirkung auf Nervenzellen aus ▶ [328]. Isohericinone und Hericinon L verfügen über zytotoxische und damit krebshemmende Eigenschaften ▶ [327]. Hericium erinaceus enthält noch einige weitere teilphenolische Substanzen wie die Resorcinole „Hericenol“ und „Erinacerin“, deren Wirkung jedoch noch nicht im Detail erforscht sind ▶ [320].
3.3.11.3 Lenthionin
Lenthionin, der schwefelhaltige aromagebende Bestandteil von Shiitake, verfügt über antimikrobielle Effekte ▶ [533]. Außerdem wirkt Lenthionin thrombozytenaggregationshemmend und damit förderlich auf die Viskosität des Blutes ▶ [615].
3.3.11.4 Melanin-Komplex
Der wildwachsende Chaga-Conk produziert in seiner schwarzen Sklerotiumschicht phenolische Pigmente mit Melanincharakter, welche starke antioxidative und genoprotektive Effekte ▶ [93] ausüben und auch mit antiviralen ▶ [104] sowie blutzuckersenkenden ▶ [111] Wirkeffekten in Verbindung gebracht werden. Melanine bewirken eine Schutzfunktion gegenüber UV-Strahlung, hemmen die Peroxidation von mehrfach ungesättigten Fettsäuren und schützen das Erbgut vor Schäden ▶ [126].
3.3.12 Steroide und Sterole
3.3.12.1 Beta-Sitosterol
Beta-Sitosterol ist ein Phytosterol mit einem ähnlichen Aufbau wie Cholesterol, jedoch verfügt es über bioaktive Eigenschaften. Eine krebshemmende Wirkung bei Darm-, Prostata-, und Brustkrebs durch Stimulation der Apoptose wurde nachgewiesen ▶ [597]. Beta-Sitosterol wird in Europa bei Prostatavergrößerungen eingesetzt. Auch übt es wie andere Sterole einen senkenden Effekt auf den Cholesterinhaushalt aus ▶ [599]. Zudem zeigt die antiinflammatorische Wirkung von Beta-Sitosterol bei Darm- und Lungenentzündungen Erfolg ▶ [598]. Der Stoff ist enthalten in Cordyceps sinensis ▶ [199], Coriolus versicolor ▶ [253] sowie in Hericium erinaceus ▶ [324].
3.3.12.2 Blazein
Blazein ist ein bioaktives Steroid aus Agaricus blazei Murrill. In vitro wurde festgestellt, dass Blazein die DNA von Krebszellen angreift und zu einer erhöhten Apoptoseaktivität führt ▶ [42].
3.3.12.3 Ergosterol/Ergosterol Peroxid
Ergosterol (auch Ergosterin) ist ein Provitamin D2 aus der Gruppe der Mycosterine. Es wird im Körper unter Einwirkung von Sonnenlicht u.a. zu Vitamin D synthetisiert. In Forschungsberichten wurden Ergosterol und sein Derivat Ergosterol Peroxid eindeutig als potente Anti-Tumor-Wirkstoffe klassifiziert. Die beiden Sterole wirken antiangiogenetisch, also hemmend auf die Neubildung von Blutgefäßen innerhalb eines tumorösen Gewebes ▶ [611], ▶ [58] sowie hemmend auf das COX-2 Enzym ▶ [386]. Ebenso hemmen sie den Vorgang der Metastasierung ▶ [58]. Ergosterol ist nicht wasserlöslich. Den höchsten Gehalt weisen Cordyceps sinensis ▶ [208] und Shiitake ▶ [610] sowie Maitake ▶ [386], ▶ [610] und Reishi ▶ [487] auf.
3.3.12.4 Ergostatetraenon
Das in Polyporus umbellatus vorkommende Ergon (ergosta-4,6,8(14),22-tetraen-3-one) ist ein Aldosteron-Antagonist, dessen Einnahme zu einer diuretischen, aber kaliumsparenden Wasserausscheidung führt ▶ [425]. Im Gegensatz zu chemischen Diuretika kommt es bei der Einnahme von Polyporus zu keinem Kaliumverlust. Im Jahr 2011 wurde zudem nachgewiesen, dass Ergostatetraenon durch eine Erhöhung der Apoptoseaktivität ▶ [609] sowie einen hemmenden Effekt auf das COX-2 Enzym ▶ [386] einen positiven Einfluss auf Krebserkrankungen ausüben kann. Die Einnahme von Aldosteron-Antagonisten kann bei gewissen Erkrankungen ▶ kontraindiziert sein.
3.3.12.5 Ganoderol
Die Oxygenosterole aus Reishi, Ganoderole genannt, verfügen über cholesterinhemmende und antiandrogene Effekte. Durch eine Interaktion mit der Vorstufe von Cholesterin (Mevalonsäure) führt Ganoderol zur Unterbindung der Cholesterolsynthese ▶ [454]. Zudem verfügt Ganoderol über die Fähigkeit, an Androgenrezeptoren zu binden und kann dadurch androgenhormoninduzierte Erkrankungen wie Prostatahyperplasien positiv beeinflussen ▶ [476].
3.3.13 Terpene
3.3.13.1 Diterpene
Es gibt rund 5000 bekannte Diterpene (Terpene mit 20 Kohlenstoffatomen). Sie können eine antibakterielle, antivirale sowie antimykotische Wirkung haben. Die Leitsubstanzen aus Hericium erinaceus, die Erinacine, verfügen zudem über eine opiatähnliche schmerzstillende Wirkung ▶ [330] und üben eine schützende und wachstumsfördernde Wirkung auf Nervenzellen aus ▶ [317], ▶ [322]. Aus Chaga wurde im Jahr 2014 zudem ein Diterpen mit der Bezeichnung „Inonotusinsäure“ isoliert ▶ [114].
3.3.13.2 Triterpene
Rund 1700 Triterpene (Terpene mit 30 Kohlenstoffatomen) sind in Pflanzen und Pilzen bekannt. Besonders bei den Pilz-Triterpenen handelt es sich um hochaktive Substanzen, die neben antikanzerogenen Eigenschaften eine Hautschutzfunktion gegenüber UV-Strahlung bewirken und schützend auf die Herzgefäße wirken. Sie regen die Aktivität bestimmter Immunzellen an, hemmen die Ausschüttung von Histamin (wichtig bei Allergien), wirken leberschützend, tumorhemmend, antibakteriell, antiviral, fungizid, entzündungshemmend, cholesterinsenkend, antioxidativ und darüber hinaus blutdrucksenkend, schmerzstillend, antiandrogen sowie zytotoxisch gegen Krebszellen ▶ [433]. Bei den Vitalpilzen sind Triterpene besonders in Porlingen vorhanden. In Reishi wurden bislang über 150 verschiedene Triterpene und Triterpenoide mit einem breit gefächerten Wirkspektrum nachgewiesen ▶ [5]. Triterpene aus Polyporus umbellatus, Polyporusterone A+B ▶ [419], verfügen neben einer haarwachstumsfördernden ▶ [416] sowie krebshemmenden ▶ [418], ▶ [430] Wirkung über eine starke antioxidative sowie antihämolytische Kraft und wirken damit dem krankhaften Abbau der roten Blutkörperchen entgegen ▶ [419]. Auch Chaga enthält eine Vielzahl von Triterpenen und Triterpenoiden mit Lanostan-, Lupan- und Oleanancharakter, darunter Betulin und Betulinsäure, welche der Pilz aus der Rinde der Birke anreichert ▶ [137]. Des Weiteren kommen Inotodiol, Lupeol, Trametonol sowie verschiedene Derivate vor. Bislang wurden ungefähr 30 verschiedene Strukturen benannt, welche sich vor allem durch leberschützende, blutzuckersenkende und gegen Krebszellen zytotoxische Wirkeffekte auszeichnen ▶ [114], ▶ [132], ▶ [137].
3.3.13.3 Sesquiterpene
Die ungefähr 3000 bekannten Sesquiterpene sind Terpene mit 15 Kohlenstoffatomen. Die in Enokitake vorkommenden Sesquiterpene, die Enokipodine, verfügen über eine antimikrobielle Wirkung gegenüber Bakterien und Pilzen ▶ [297]. Und auch aus Chaga wurde im Jahr 2014 ein Sesquiterpen mit der Bezeichnung „Inonolacton C“ isoliert ▶ [132].
3.3.14 Weitere bioaktive Substanzen
3.3.14.1 Ergothionein
Ergothionein (EGT) ist eine schwefelgebundene Aminosäure sowie ein natürliches Antioxidans, das nur von Pilzen und einigen Mykobakterien synthetisiert werden kann. EGT wird von den körpereigenen Zellen aufgenommen und kann diese so von innen heraus gegen eine Vielzahl von Schädigungen schützen. Es handelt sich also um eine potente antioxidative Substanz, die ihre Wirkung intrazellulär ausüben kann ▶ [612]. Ergothionein besitzt außerdem einen entzündungshemmenden Effekt, durch die Hemmung entzündungsfördernder Zytokine ▶ [614]. EGT kommt in Agaricus blazei Murrill ▶ [580], Shiitake ▶ [557], Pleurotus ostreatus ▶ [570], Enokitake ▶ [288], Maitake, Champignon ▶ [155] und Coprinus comatus ▶ [166], ▶ [570] vor.
3.3.14.2 Gamma-Aminobuttersäure (GABA)
GABA, eine nichtproteinogene Aminosäure, ist einer der wichtigsten inhibitorischen (hemmenden) Neurotransmitter im Zentralnervensystem. Gamma-Aminobuttersäure bindet an spezifische GABA-Rezeptoren. Der höchste Gehalt unter den heilsamen Pilzen weist Agaricus blazei Murrill auf ▶ [580] gefolgt von Pleurotus ostreatus ▶ [570]. Daneben enthalten auch Coprinus comatus ▶ [570], Cordyceps sinensis ▶ [202], ▶ [208], Enokitake ▶ [568] sowie Reishi ▶ [441] Gamma-Aminobuttersäure.
3.3.14.3 Konjugierte Linolsäure (CLS)
Als konjugierte Linolsäure werden zwei Derivate der Linolsäure, einer ungesättigten Omega-6-Fettsäure, bezeichnet. Die in Agaricus bisporus ▶ [143] und Agaricus blazei Murrill ▶ [56] enthaltene konjugierte Linolsäure und ihre Derivate üben Studien zufolge eine hemmende Wirkung auf Brust- und Prostatakrebs aus. Als Aromatose-Hemmer unterbinden sie die Umwandlung von Testosteron in Östrogen, welches als Hauptfaktor bei der Entstehung von hormonabhängigem Brustkrebs angesehen wird ▶ [143]. In vitro führte die konjugierte Linolsäure außerdem zu einer Hemmung der Proliferation von Prostatakrebszellen ▶ [141].
3.3.14.4 Lovastatin
Lovastatin gehört zur Gruppe der Statine – Arzneistoffe, die sich durch HMG-CoA-Reduktase positiv auf den Cholesterinstoffwechsel auswirken. Als weitere vorteilhafte Wirkung gilt die Verminderung von atherosklerotischen Ablagerungen. Lovastatin konnte in vielen Pilzen nachgewiesen werden, u.a. in Cordyceps sinensis ▶ [202], Hericium erinaceus ▶ [570], Reishi ▶ [570], Champignon ▶ [568] sowie in Pleurotus ostreatus ▶ [394].
3.3.14.5 ο-Orsellinaldehyd
2,4-Dihydroxy-6-Methylbenzyl ist ein Polyketid und kommt unter den heilsamen Pilzen in Maitake vor. Es wirkt zytotoxisch auf Krebszellen der Leber sowie der Lunge und erhöht dadurch die Apoptoseaktivität ▶ [364].
3.3.14.6 Sodium pyroglutamat
Das Salz der Pyroglutaminsäure, ein ungiftiges Aminosäuren-Derivat, wird u. a. aufgrund seiner Fähigkeit, 60% seines Gewichtes an Wasser zu resorbieren, in der Kosmetikindustrie eingesetzt. Das in Agaricus blazei Murrill vorkommende Sodium pyroglutamat verfügt als Anti-Tumor-Substanz über antiangiogenetische und metastasenhemmende Wirkeffekte ▶ [46].
3.3.14.7 Thioprolin
Das in den gekochten Enoki- und Shiitakepilzen vorkommende Thioprolin (Thiazolidin-4-Carboxylsäure) ist ein Abkömmling der Aminosäure Prolin, in der die Methylgruppe in Position 4 durch ein Schwefelatom ersetzt ist. Für diesen Metaboliten wurden leberschützende, antioxidative und antikanzerogene Wirkeffekte nachgewiesen ▶ [559].
3.3.14.8 Chitin
Grosspilze enthalten in der Trockenmasse zwischen 2% und max. 10% Chitin. Als Ballaststoff hat Chitin positive Eigenschaften, wie entgiftende, basische sowie blutzucker- und cholesterinsenkende Effekte.
3.4 Heilsame Pilze und ihr Einfluss auf die Immunabwehr
Das körpereigene Abwehrsystem ist essentiell für das Überleben von Lebewesen. Alle Organismen sind den ständigen Einflüssen ihrer Umwelt ausgesetzt und damit auch einer ständigen Bedrohung. Schädliche Krankheitserreger wie Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten und Einzeller können, wenn sie in den Körper eindringen, zu Störung, Krankheit oder sogar zum Tod führen. Aber auch körperinnere Vorgänge können die Gesundheit bedrohen. So werden auch abgestorbene körpereigene Zellen abgebaut oder entartete Zellen (z.B. Krebszellen) bekämpft.
Einfluss von Pilzwirkstoffen auf die Immunabwehr:
Verstärkung und Gesunderhaltung der natürlichen Barrieren des Körpers
direkte antimikrobielle Wirkung auf eine Vielzahl von Erregern
Aktivierung und Potenzierung der unspezifischen Abwehr
Aktivierung, Modulation, Potenzierung und Rebalancierung der spezifischen Abwehr
Unser Immunsystem ist sehr komplex. Organe, verschiedene Abwehrzellen und lösliche Proteine übernehmen spezifische Aufgaben. Dabei greifen alle Mechanismen ineinander und beeinflussen sich gegenseitig. Dieses System besteht neben den natürlichen Barrieren aus vier Teilsystemen, welche in ▶ Tab. 3.1 zu sehen sind.
Tab. 3.1
Immunabwehr
Unspezifische Abwehr
Spezifische Abwehr
Humorale Abwehr
Komplementsystem
Lysozym
Zytokine
Tumornekrosefaktor
Antikörper/Immunglobuline
B-Zellen
Plasmazellen
B-Gedächtniszellen
Zelluläre Abwehr
natürliche Killerzellen
Makrophagen/Monozyten
Granulozyten
dendritische Zellen
T-Zellen
T-Helferzellen
(+ TH1/TH17/TH2)
Regulatorische T-Zellen
T-Gedächtniszellen
Zytotoxische T-Zellen
3.4.1 Wirkung auf die natürlichen Barrieren
Die natürlichen mechanischen und physiologischen Barrieren des Körpers bilden die erste Verteidigung gegen Krankheitserreger. Sie sorgen dafür, dass krankmachende Organismen und Stoffe erst gar nicht in den Körper eindringen können oder ihn möglichst schnell wieder verlassen.
Die Haut Die Haut bildet über der Muskel- und Fettschicht die erste äußere Barriere. Sie setzt sich aus drei Schichten zusammen und bildet so das größte Organ des menschlichen Körpers. Der PH-Wert von 5,5 sowie Talg und Schweiß hemmen das Wachstum von Mikroorgansimen auf der Haut.
Die in Pilzen enthaltenen Triterpene erzeugen eine antioxidative, schützende und regulierende Wirkung auf die Haut. Der allgemeine entgiftende, stärkende und regulierende Effekt von Pilzwirkstoffen auf die inneren Organe und das Immunsystem wirkt sich zudem positiv auf die Hautgesundheit aus.
Die Schleimhäute Sie bilden die erste Barriere in Körperöffnungen wie Augen- und Maulhöhle oder Darm. Schleimhäute produzieren Schleim, um damit das Eindringen von Krankheitserregern zu stoppen. Durch eine entzündungshemmende, antimikrobielle und befeuchtende Wirkung schützen und stärken Pilzwirkstoffe die verschiedenen Schleimhäute des Körpers.
Die Augen Die Tränen erfüllen die Funktion des Abtransportes von Krankheitserregern oder Fremdstoffen. Das antimikrobielle Enzym „Lysozym“ bekämpft zudem Mikroorganismen. Pilzwirkstoffe steigern die Freisetzung von Lysozym in der Tränenflüssigkeit und schützen die Augenschleimhaut vor Entzündungen und Infektionen. Das in Polyporus umbellatus enthaltene Vitamin A unterstützt zudem die Gesundheit der Augen.
Die Atemwege Flimmerhärchen transportieren die in Schleim gebundenen Krankheitserreger oder Fremdstoffe ab. Pilzwirkstoffe aus Reishi, Cordyceps sinensis und Coriolus versicolor unterstützen die Gesundheit von Bronchien und Lungen. Sie wirken außerdem schleimlösend und antibakteriell.
Die Maulhöhle Das im Speichel enthaltene antimikrobielle Enzym „Lysozym“, welches durch Pilzwirkstoffe vermehrt freigesetzt wird, bekämpft Mikroorganismen. Sekundäre Inhaltsstoffe heilsamer Pilze wirken zudem antimikrobiell und entzündungshemmend bei Infektionen und Erkrankungen der Maulhöhle.
Der Magen Die Magensäure enthält Salzsäure und bakterizide Enzyme, welche Mikroorganismen abtöten. Pilzwirkstoffe, z.B. aus Hericium erinaceus, Pleurotus ostreatus, Enokitake oder Chaga, wirken sich durch antibakterielle, entzündungshemmende und schützende Effekte besonders positiv auf die Gesundheit der Magenschleimhaut aus.
Der Darm 70–80 % aller Zellen, die Antikörper produzieren, befinden sich in der Schleimhaut des Darmes. Darüber hinaus schützen die guten Bakterien der Darmflora vor Infekten. Der Dickdarm führt die im Körper unerwünschten Stoffe in Form von Kot ab. Durch ihren vielfältigen positiven Einfluss auf die Gesundheit der Darmschleimhaut sowie des darmbezogenen Immunsystems führen Pilzwirkstoffe zu einem ausgewogenen Darmmilieu und zu einer geregelten Verdauung.
Der Harntrakt Durch einen diuretischen Effekt kann die Harnausspülung und damit der Abtransport von Krankheitserregern erhöht werden. Die antimikrobielle und entzündungshemmende Wirkung von Pilzwirkstoffen schützt den Harntrakt außerdem vor Infektionen.
3.4.2 Die unspezifische (angeborene) Abwehr
Die Mechanismen der unspezifischen Abwehr sind angeboren und richten sich gegen körperfremde Antigene (Fremdstoffe). Wenn Krankheitserreger die natürlichen Barrieren überwinden, werden sie von den Immunzellen der angeborenen Abwehr sofort erkannt und bekämpft. Diese Reaktion allein kann bereits ausreichen, um Erreger innerhalb weniger Stunden zu beseitigen. Gelingt dies nicht, wird zusätzlich die spezifische Abwehr stimuliert und aktiviert.
Die Erkennung dieser Fremdstoffe durch die angeborene Immunabwehr erfolgt durch bestimmte, auf den Immunzellen exprimierte Rezeptoren, welche die molekularen Muster der evolutionär wichtigsten Krankheitserreger erkennen. Dabei hat sich die Evolution auf die am häufigsten vorkommenden molekularen Strukturen beschränkt. Zu diesen „pathogen-assoziierten molekularen Mustern“ (PAMPs) gehören beispielsweise Lipopolysaccharide, Peptidoglycane, Lipoteichonsäuren, Mannane, Glycane, bakterielle DNA und doppelsträngige RNA. Alle diese Strukturen sind zwar sehr unterschiedlich, kommen jedoch im Körper von Mensch und Tier normalerweise nicht vor. Dafür jedoch sind sie in einer Vielzahl von Mikroorganismen zu finden.
Die Mechanismen der angeborenen Immunabwehr steuern jedoch auch die Toleranz des Immunsystems gegenüber körpereigenen Strukturen. Störungen der sogenannten Selbsttoleranz und damit der Fähigkeit, zwischen fremden und körpereigenen Strukturen zu unterscheiden, können zu Angriffen des Immunsystems auf den eigenen Körper und dadurch zu Autoimmunerkrankungen führen.
Die molekulare Struktur von Beta-Glucanen aus Pilzen gleicht dem molekularen Muster von Mikroorganismen. Durch diese Übereinstimmung wird das Immunsystem in einen Alarmierungszustand versetzt, ohne dass dabei zwingend eine echte Infektion vorhanden sein muss.
3.4.2.1 Wirkung auf die unspezifische humorale Abwehr
Pilzwirkstoffe aktivieren das Komplementsystem und damit mehr als 30 verschiedene Proteine, welche im Blutplasma gelöst oder an Zellen gebunden vorkommen. Ihre Hauptaufgabe ist die Abwehr von Mikroorganismen wie Bakterien, Pilzen oder Parasiten. Sie haften sich an deren Oberfläche und kennzeichnen damit die Fremdorganismen für die Eliminierung durch die chemisch angelockten körpereigenen Fresszellen. Darüber hinaus bekämpfen sie Bakterien auch direkt durch die Zerstörung deren Zellmembranen.
Es kommt zudem zur vermehrten Produktion von Zytokinen (Immunbotenstoffe), insbesondere von Gamma-Interferon, Interleukinen und dem Tumornekrosefaktor.
Pilzwirkstoffe steigern auch die Freisetzung des in Speichel, Schweiß, Tränen und diversen Schleimhäuten vorkommenden antimikrobiellen Enzyms „Lysozym“, welches die Zellwände von Bakterien angreift und zu deren Zerstörung führt.
3.4.2.2 Wirkung auf die unspezifische zelluläre Abwehr
Pilzwirkstoffe aktivieren die natürlichen Killerzellen sowie Phagozyten (Granulozyten und Makrophagen inkl. Monozyten), welche alle zu den Leukozyten gezählt werden, und steigern deren Aktivität und Zytotoxizität. Während Phagozyten Gewebstrümmer und Mikroorganismen in sich aufnehmen und verdauen, lösen natürliche Killerzellen bei durch Krebs oder Viren befallenen Zellen Apoptose aus. Dieser programmierte Zelltod wird durch die Anlagerung von Pilzwirkstoffen (Beta-Glucane) an der Oberfläche von Tumorzellen und der damit erhöhten Erkennbarkeit zusätzlich gefördert.
Auch dendritische Zellen, welche sich je nach Typ aus Monozyten oder den Vorläufern von T-Zellen entwickeln, nehmen als Phagozyten Krankheitserreger auf. Ihre wichtigste Aufgabe ist jedoch die Antigenpräsentation und damit die Aktivierung und Regulierung der spezifischen Abwehr. Ihnen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, denn ihre Aktivität bestimmt über die Art der Immunantwort. Eine einzige dendritische Zelle ist in der Lage, mehrere tausend T-Zellen zu stimulieren. Pilzwirkstoffe sind in der Lage, die Aktivierung und Reifung von dendritischen Zellen zu erhöhen sowie ihre Aktivität zu regulieren und bei Bedarf zu hemmen oder zu fördern. Auf diese Weise nehmen Pilzwirkstoffe durch Modulation direkten Einfluss auf die Art der Immunantwort.
Die Aktivierung der Immunzellen erfolgt über deren Rezeptorbindung an den Pilzwirkstoffen. Über folgende Rezeptoren vermitteln Pilzwirkstoffe ihre Wirkung: Dektin-1, Komplementrezeptor (CR3), C-Type-Rezeptor (DC-SIGN1), Scavenger-Rezeptor, Lactosylceramid-Rezeptor (LacCer), Toll-Like-Rezeptoren (TLR) ▶ [592].
3.4.3 Die spezifische (adaptive) Abwehr
Die spezifische (adaptive) Abwehr richtet sich gezielt gegen bestimmte Antigene (Fremdstoffe) und wird erst durch den Kontakt mit bestimmten Erregern erworben. Dieser Teil des Immunsystems ist durch die Gedächtniszellen im Stande, zu lernen und damit befähigt bestimmte Antigene wiederzuerkennen. Es werden dadurch antigenspezifische Antikörper und Abwehrzellen gebildet.
3.4.3.1 Wirkung auf die spezifische humorale Abwehr
Pilzwirkstoffe erhöhen oder modulieren die Ausschüttung und Aktivierung von B-Zellen.B-Zellen sind mit Hilfe ihrer Rezeptoren in der Lage, körperfremde Stoffe, sogenannte Antigene, zu erkennen und spezifische Antikörper gegen sie zu produzieren. Nach der Aktivierung aufgrund ihrer Bindung an ein Antigen wandert die B-Zelle in die Milz oder in die Lymphknoten, um sich zu vergrößern und sich zu teilen (Proliferation) und sich schließlich zur B-Plasmazelle zu differenzieren, welche wiederum Antikörper produziert. Diese Antikörper binden an dasselbe Antigen wie die ursprüngliche B-Zelle, können ihre Klasse aber auch wechseln. Die meisten B-Zellen sind für eine vollständige Aktivierung von der Beteiligung von T-Zellen abhängig. Eine T-Zell-unabhängige Aktivierung wird jedoch durch Polysaccharide aus Pilzen begünstigt.