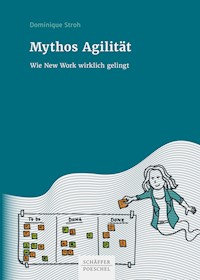
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Viele Unternehmen haben sich bereits entschieden, agile Methoden einzusetzen oder gar das ganze Unternehmen zu transformieren. Tradierte Unternehmen wagen den Sprung in das unbekannte Gefilde New Work. Doch auf der Kulturebene ist davon noch wenig angekommen. Führungskräfte kontrollieren immer noch, obwohl Vertrauen viel wichtiger wäre. Und ganze Organisationen schaffen es nicht, ehrlichen Pioniergeist zu entwickeln, weil Fehler auf dem Weg zum Umsatzwachstum noch immer nicht gerne gesehen werden. Das Buch hinterfragt die Transformation. Echte Insights, Fallbeispiele und Interviews zeigen, wie eine bessere Umsetzung zu "echter Agilität" führt, und was eine Organisation wirklich tun muss, um New Work nachhaltig als Antwort auf die aktuellen Herausforderungen zu etablieren. Denn am Ende geht es weniger um Agilität, sondern darum, welche Kultur eine Organisation hat oder entwickeln sollte, um am Markt zu bestehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
[7]Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum UrheberrechtImpressumVorwortEinleitung1 Die Agilitätslüge1.1 Irrglaube: Agilität als Umsatz-Booster1.2 Das AGIL-Schema falsch verstanden?1.2.1 Tool: Agile Journey Quadrants1.3 Change ist out1.4 Der Homo Oeconomicus ist tot1.4.1 Was bedeutet eigentlich Homo Oeconomicus?1.4.2 Menschliche Entscheider sind anders1.4.3 Entscheidungen kollektiver gestalten1.5 Frust statt Lust – und wie sich das drehen lässt1.6 Die eigentliche Verantwortung: Vertrauen schaffen2 New Work Stories – Sichtweisen, Erkenntnisse und Tipps2.1 Meine Abenteuer mit Frithjof Bergmann und die Frage, was man wirklich, wirklich will (Ömer Atiker)2.2 Den Sinn bestimmst du2.3 Erst New School, dann New Work2.4 Nimm dich selbst mit zur Arbeit (Meike Leue)2.5 Ein neues Maß für Leistung?2.6 Wilde Gedanken über Führung – magst du mitdiskutieren? (Michel Zimmermann)2.7 Good Old Leading – Brand New Working? (Heidrun Strikker, Frank Strikker)2.7.1 Agile Führung und Moderation2.7.2 Entstehender Gegenwind oder Gegentrend2.7.3 SPOC – vier agile Qualitätsmerkmale für erfolgreiche Zusammenarbeit in der analogen und digitalen Welt2.7.4 Aus der Praxis: Der Workshop-Prozess2.8 New Work als Schlüssel zur Entkopplung des Menschen von der klassischen Lohnarbeit (Sinisa Jovanovic)2.9 Bleib dir treu, also verändere dich(Über quäntchen +und glück und eine Begegnung mit Philipp Hormel)2.10 Das Einheitsgehalt (Philipp Hormel)2.11 Was hat Musik mit Agilität zu tun? (Matthias Orgler)2.12 Visualisierungen sind dein Schweizer Messer (Anja von Klitzing-Bantzhaff)2.12.1 Visualisierungen erzeugen Transparenz2.12.2 Bilder laden ein, sich zu beteiligen2.12.3 Visualisierungen schaffen Klarheit2.12.4 Aktivierung weiterer Ressourcen2.12.5 Bilder bleiben länger in Erinnerung2.13 Anekdoten – Old Work goes New Work (Kim Nena Duggen)2.13.1 Typische New-Work-Anfänge …2.13.2 … und was daraus zu lernen ist3 Transformation-Werkstatt3.1 Kerngedanke des Vorgehens3.2 Umsetzung der Transformation-Werkstatt3.2.1 Transformation als Prozess: Vision bilden3.2.2 Initiativen bilden3.2.3 Befähigen: Lernformate zur selbstorganisierten Transformation3.2.4 Ausbilden von Transformation Coaches3.2.5 Ablauf der Transformation-Werkstatt3.2.6 Projektieren und Lernen3.2.7 Nachhaltige Prozessgestaltung4 Scheiterst du schon?4.1 Die fünf New-Work-Sünden4.1.1 Habgier4.1.2 Hochmut4.1.3 Eifersucht4.1.4 Kontrolle4.1.5 Ignoranz4.2 Lass es einfach sein!5 Mach aus dem Mythos ein ErlebnisPersönliches New-Work-BacklogLiteraturverzeichnisStichwortverzeichnisAutorin und IllustratorinAutor:innen der GastbeiträgeHinweis zum Urheberrecht:
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart
[4]Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de/ abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-5238-0
Bestell-Nr. 10653-0001
ePub:
ISBN 978-3-7910-5239-7
Bestell-Nr. 10653-0100
ePDF:
ISBN 978-3-7910-5240-3
Bestell-Nr. 10653-0150
Dominique Stroh
Mythos Agilität
1. Auflage, September 2021
© 2021 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
www.schaeffer-poeschel.de
Bildnachweis (Cover): © Anja v. Klitzing-Bantzhaff
Produktmanagement: Dr. Frank Baumgärtner
Lektorat: Elke Renz, Stutensee
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/ Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart
Ein Unternehmen der Haufe Group
[5]Vorwort
Dieses Buch ist anders.
In den letzten Jahren haben wir uns eine Arbeitswelt geschaffen, die in einem neuen Glanz erscheint. Es werden New-Work-Awards verliehen, obwohl New Work doch, ideologisch betrachtet, keinen Wettbewerb untereinander darstellen sollte?! Oder doch: Ellenbogen raus? Manche arbeiten ganz wie Spotify in Chaptern. Sie haben keine Führungskräfte und wenn doch, werden diese inzwischen von den Mitarbeitenden gewählt. Und die »Nicht-Führungskräfte« heißen Product Owner oder Scrum Master und führen zum Schluss doch nach klassischen Prinzipien. Und nicht zuletzt haben wir Methoden aus der agilen Welt, die uns näher am Markt arbeiten lassen. Komplex und so.
Aber ist das wirklich agil? Oder New Work? Frithjof Bergmann bringt es eigentlich auf den Punkt: »Für viele ist New Work etwas, was Arbeit ein bisschen reizvoller macht, quasi Lohnarbeit im Minirock« (Bergmann 2018)!
Ist die Debatte um New Work vielleicht zu einseitig? Und wieso muss es ohne Führung gehen, wenn Mitarbeitende gleichzeitig gerne jemanden hätten? Und muss es überhaupt nur eine Antwort geben?!
Der Arbeitgeber soll den Purpose in den Fokus stellen. Aber wie sieht es mit jedem einzelnen Mitarbeitenden aus – nun, dieser soll sich doch bitte nicht mehr wie ein »Konsument« verhalten. Immerhin möchten wir uns doch alle selbst verwirklichen! Also soll dieser bitte ab sofort autonom arbeiten.
Ja, ja. Diese Trends. Erst springt man nicht auf, auf den Zug der Veränderung. Dann kann es nicht schnell genug gehen. Die Unternehmensgeschichte bleibt dabei gerne auf der Strecke. Das, was die Organisation bisher ausgemacht hat. Hauptsache dabei sein. Schnell agil werden.
Was läuft da schief? Und war damit New Work gemeint?
Wir gehen dem Mythos auf den Grund. Dabei wird dir als Leser:in einiges auffallen. Nämlich dass kein(e) Berater:in, Expert:in oder Führungskraft die Antwort auf die Frage hat. Es gibt nämlich sehr viele Antworten und sicherlich doppelt so viele Fragen.
[6]Aber eine Antwort möchte ich doch vorwegnehmen. Es geht um Werte. Kein »Mindset-Geschwätz«, sondern das Bewusstsein um die Basis jeglicher Arbeit: Vertrauen. Und damit um Fragen, die wir noch nicht ernsthaft beantwortet haben: Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Wie sollten wir »selbstbestimmten Menschen« unsere Zukunft gestalten?
Dieses Buch klärt, ob die aktuelle New-Work-Debatte den richtigen Weg eingeschlagen hat. Und Agilität überhaupt richtig verstanden wird – gar gebraucht wird?
Also, was ist wirklich wichtig in einer heutigen Arbeitswelt? Und wie wird der Rahmen dafür aus kulturellen Aspekten geschaffen? Muss der Weg agil sein? Was müssen wir heute schon unternehmen, um das Morgen zu gestalten? Und inwieweit sollten wir auch gesellschaftliche Fragen klären, die mit der Arbeitswelt eng verbunden sind?
Wir werden vielen Fragen gemeinsam auf den Grund gehen. Es wird darum gehen, Kultur – also die Idee eines komplexen Systems aus Werten, Normen, Verhaltensstrukturen – und das Selbstverständnis eines Unternehmens zu hinterfragen, aber auch neu zu denken in einer dynamischen Zeit wie dieser.
Wir werden Agilität in der systemischen Perspektive ihres Erfinders Talcott Parsons betrachten, um darauf aufbauend New Work in dessen Grundidee zu diskutieren und dabei auch Frithjof Bergmanns Wegbegleiter zu hören. Aber wir werden auch Überlegungen anstellen, wie unsere Gesellschaft von morgen arbeiten wird.
Diese vielen Fragen kann kein Einzelner beantworten. Daher habe ich ganz unterschiedliche Menschen und Organisationen eingeladen, mit mir ihre Perspektive von New Work zu teilen. Ganz subjektiv. So, wie jeder von uns die (Arbeits-) Welt betrachtet, auf unterschiedliche Weise. Wenn wir lernen, gemeinsam die Arbeitswelt zu hinterfragen und zu verbessern, dann können wir echte Diskussionen führen. Gemeinschaftlich.
Es geht nicht ums »Rechthaben«, es geht darum, unterschiedliche Blickwinkel zu nutzen, um ein Ganzes daraus zu gestalten.
Nebenbei vergessen wir gerne, dass das Hinterfragen der Arbeitswelt in unserem Naturell liegt. Schon seit der damaligen Industrialisierung noch vor dem Taylorismus, nämlich in der Textilindustrie, zu Beginn in England, hatte sich das damalige Proletariat gefragt, inwieweit es gesund ist, 16 Stunden am Tag zu arbeiten.
Also ist dieses Buch ein Gemeinschaftsprojekt. Einige Gastbeiträge – aus ganz unterschiedlichen Bereichen und manche gar nicht agil, andere umso mehr – schreiben mit mir gemeinsam über die Zukunft der Arbeit. Dies auf ganz unterschiedliche Art und Weise, weder zu wissenschaftlich noch zu pragmatisch. Eine gesunde Mischung, mit der Idee, es einfach und zugänglich zu machen. Für alle Interessierten.
[7]Dieses Buch ist aber auch eine Einladung an dich als Leser:in. Wir gestalten New Work und agiles Arbeiten nur, wenn wir lernen, im Morgen zu denken und im Heute zu handeln. Nicht unsere Meinung in den Fokus zu rücken, sondern unterschiedliche Meinungen zu akzeptieren, auf diesen aufzubauen und Lösungen zu finden.
Theorie und Praxis geben sich hier die Hand. Mach mit und lass uns die nächste Etappe zukünftigen Arbeitens gemeinsam gestalten.
[11]Einleitung
Veränderung ist inzwischen Status quo. Viele Organisationen haben bereits verstanden, dass es wichtig ist, sich an die komplexe Welt anzupassen. Aber eines scheint noch völlig ignoriert zu werden: was Agilität im Sinne des Erfinders wirklich bedeutet. Das zeigt die Projektlandschaft, wenn es um Change-Initiativen geht, die Transformationen projektieren. Wenn Organisationen nämlich immer noch glauben, dass eine Transformation und die damit einhergehende Kulturveränderung ein abgeschlossenes Projekt darstellen, werden sie womöglich morgen nicht mehr existieren.
Dementsprechend möchte ich in diesem Buch eine Einladung aussprechen, New Work und Agilität in deren aktuellen Ideen nicht als gesetzt zu betrachten, sondern im Rahmen der Veränderung einen intellektuellen, gerne auch pragmatischen Diskurs zu starten.
Transformation bedeutet »Prozess der Veränderung«. Aber dieser Prozess ist weder abgeschlossen noch als Projektziel zu verstehen. Vielmehr ist es ein andauerndes »Mit-sich-selbst-Beschäftigen«, angepasst an Welt- und Marktereignisse, also gepaart mit dem einhergehenden gesellschaftlichen Wandel. Und wenn das Verständnis folgt, dass wir in einer komplexen Welt stetig in der Lage sein müssen, uns zu verändern und weiterzuentwickeln, müssen wir gleichzeitig Organisationen bis hin zum Individuum dazu befähigen, dies auch zu tun. Das Konzept organisationales Lernen ist eine mögliche Antwort, die sicherlich weiter ausgearbeitet werden muss. Und genau dafür ist dieses Buch gedacht. Als Leser:in findest du ganz konkrete Ideen zur direkten Umsetzung, manchmal auch Fragen oder wilde Thesen. Immer mit dem Ziel, nichts final zu beschreiben, aber permanent gemeinsam zu diskutieren.
Wir werden uns zu Beginn des Buches damit auseinandersetzen, wieso Agilität eher einer Lüge gleicht (Kap. 1). Ebenso mit der Wichtigkeit, das Konzept zu hinterfragen und weiterzudenken, angepasst auf die jeweilige Organisation.
Dabei betrachten wir Change-Konzepte mit der Überlegung, ob Lewin nicht sogar selbst sein Konzept längst überarbeitet hätte. Auch der Homo Oeconomicus bekommt sein Fett weg. Aber es soll nicht darum gehen, alles kritisch zu hinterfragen und dem neuen Glanz der New-Work-Szene zu huldigen. Nein! Gerade alte Theorien und Geschichten von Unternehmen haben ihren Wert. Deswegen hören wir uns auch an, was viele unterschiedliche Persönlichkeiten über Arbeiten denken (Kap. 2). Mit Geschichten, Wünschen, Thesen und pragmatischen Vorschlägen erzählen Mitarbeitende, Berater:innen und Expert:innen, wie sie New Work sehen oder sehen wollen. Von Mensch zu Mensch. Und um das immer wieder zu betonen: Jeder hat eine Idee, wie Arbeiten aussehen kann. Unterschiedliches beschäftigt sie dabei: Wörter, die in den Köpfen der Menschen durch leichte Tools zu Bildern werden; ein Ansatz, Lohnsysteme neu zu denken oder die Frage, was Führung ausmachen kann. Aber auch, welches Schulsystem die Zukunft von New Work prägen könnte.
[12]Jeder kann dazu mitdiskutieren, um aus dem Mythos ein nahbares New-Work-Erlebnis zu machen.
Genau das passiert in der Transformation-Werkstatt (Kap. 3), in der ich dir als Leser:in beschreibe, wie eine Transformation bottom-up gestaltet werden kann. Es zeigt sich auch hier, dass die Mitarbeitenden die besten Unternehmensberater:innen sind. Und irgendwie auch, dass es weniger um hippe Methoden geht als um den Wunsch nach einer Kultur, die einen jeden Tag gerne zur Arbeit kommen lässt.
Auch die Schattenseiten finden ihren Platz (Kap. 4). Denn was bringt all der Wandel, wenn kulturell der Weg dafür noch gar nicht geebnet ist? Wenn Vertrauen gepredigt und Kontrolle geflüstert wird?
Final werden wir dann dem Mythos Agilität die Stirn bieten und das Buch gemeinsam reflektieren (Kap. 5). Welche offenen Fragen weiterhin nicht geklärt sind, aber deine Ideen brauchen. Welche Antworten gefunden wurden und welche Chancen das ermöglicht, New Work als Konzept zu leben oder eben nicht.
[13]1Die Agilitätslüge
1.1Irrglaube: Agilität als Umsatz-Booster
Ideology is a system of beliefs, held in common by the members of a collectivity.
Talcott Parsons (1951, S. 349–50)
Haben wir um die New-Work-Debatte ein Glaubenssystem geschaffen? Und ketzerisch betrachtet: Lassen wir es auch nicht zu, den eingeschlagenen Weg zu hinterfragen?
Die letzten Jahre haben sich reichlich Anhänger gefunden, die Arbeitswelt von morgen, meist dann doch eher die von heute, neu zu denken. Dabei wurden Methodik und Prozesse aus der Scrum-Welt oder dem Design Thinking in vielen Organisationen etabliert, Innovation Labs geschaffen und Führung teilweise abgeschafft, da wir ja nun selbstorganisiert sind. Schon zu Beginn hat sich allerdings abgezeichnet, dass viele der Mitarbeitenden und auch die Führungsebene dem Ganzen kulturell nicht gewachsen waren.
Noch nicht.
Damit ging die Feststellung einher, dass wir an unserem Mindset arbeiten müssen. Mit dem dynamischen Growth Mindset – eben statt des statischen Fixed Mindset – war ein neuer Meilenstein gefunden: die Entwicklung von Persönlichkeiten, individuell.
Was haben wir uns dabei erhofft? – Richtig! Eine Antwort auf die stetig wachsende Komplexität.
Aus humanistischem Blickwinkel ist die Entwicklung der New-Work-Debatte sensationell. So viele unterschiedliche Themen werden berücksichtigt, seien es Gender-Debatten, Arbeitsplatzgestaltung oder, wie oben angeführt, die Art, Arbeit neu zu denken.
Kommen wir aber zu dem Irrglauben der Agilität.
Macht Design Thinking gleich innovativ? Und helfen Sprints wirklich, die Schnelllebigkeit des Marktes zu »bekämpfen«? Und überhaupt, ist unter der Betrachtung von Scrum-Werten wie Transparenz, Offenheit oder Fokus, die im Scrum Guide oder auch anderen »Methologien« entworfen werden, nicht schon die Lüge offensichtlich?
ZERTIFIKATE MACHEN NOCH KEINE NEW-WORK-MEISTER
Wir haben in Deutschland schon immer ein Faible für Nachweise gehabt. Während die USA »Think big!« schreien und den Studienabbrecher von Stanford feieren, würde hier jemand, der keine Scrum-Zertifizierung hat, wohl kaum als Scrum Master tätig werden. Also was ist passiert? Wir haben unsere Mitarbeitenden in das Zwei-Tage-Seminar [14]gesteckt, schnell den Stresstest machen lassen, in dem man 60 Minuten Zeit hat, 80 Fragen (aber nur auf Englisch) zu beantworten, um dann fertige Coaches zu empfangen. Prächtig, oder? So effizient kann Ausbildung sein.
Wozu brauchen wir überhaupt Agilität? – Die Idee ist, mit unklaren Marktbedingungen und einem nicht mehr langfristig planbaren Weg sinnvoll umgehen zu können. Es ist aber ebenso die Idee vieler Methoden und Prozesse aus dem agilen Werkzeugkoffer, dass Fehler gemacht werden (dürfen). Also eine echte Lernkultur zu schaffen. Stetig besser zu werden. Es geht um schnelles Erkennen von Fehlern und deren Evaluierung, um dann abzuleiten, wie es weitergeht.
Warum kann das nicht so einfach funktionieren?
Eine Organisation lässt sich sehr gut auf drei Ebenen betrachten. Das eigentliche System, die Organisation. Hierunter fallen die Kultur und der Organisationsaufbau. Es folgt die Struktur, die Ablauforganisation. Also wie werden Informationen verteilt, welche Prozesse sind dahinter bzw. gibt es grundsätzlich, usw.
Abb. 1: Organisation als System
Dann folgt eine Variable, die zu selten tiefgreifender betrachtet wird – das Individuum, der oder die Mitarbeitende. Dass der Blick da an der Oberfläche bleibt, hat einen Grund: Sich auf jeden einzelnen Mitarbeiter konzentrieren kostet zu viele Ressourcen. Dabei vernachlässigen wir allerdings einen wesentlichen Faktor: Der Mensch macht die Kultur. Und nur, wenn die Unternehmenskultur ausgeglichen ist und man gerne zur Arbeit kommt, funktionieren die Pro[15]zesse – also die Struktur. Und stehen wir nicht alle auf eine hohe Arbeitsproduktivität?! Nicht zuletzt auf stetiges Wachstum?
Na, endlich wir kommen der Sache näher!
Menschen, also unsere Mitarbeiter:innen, machen den Nutzen und den Wert des Unternehmens (der Organisation) aus. Mit ihrer Arbeitskraft und ihrem Wissen. Manager:innen zeigen die Richtung – kein unwesentlicher Faktor. Aber wer macht die Arbeit?
Das Ziel jeglicher Transformation ist zumeist das Problem. John Kotter hat vor allem in einer Sache recht behalten, wenn es um Veränderungsprozesse geht: Wir brauchen einen »sense of urgency« – uns muss die Dringlichkeit bewusstwerden.
Aber was ist dringend? In der Regel wird es unbequem, sobald die Zahlen nicht mehr stimmen. Also der Umsatz oder der Aktienwert fällt. Daraufhin sind die eigentlichen Denker, unsere Strategen – das Management – meist sehr hektisch, es wird kurzfristig gedacht, anstatt nachhaltig die Organisation für diese schnelle und neue Welt zu gestalten. Anstatt eine lernende Organisation zu schaffen, die wirklich Innovationskraft beweist, folgt dann eine Reihe von Workshops zu Scrum und Design Thinking. Für den Kunden, versteht sich.
1.2Das AGIL-Schema falsch verstanden?
In einer sich schnell verändernden (Wirtschafts-)Welt glauben wir, mit schnellen Antworten den richtigen Weg einzuschlagen. Das macht auch schon den ersten Teil der Agilitätslüge aus. Als sich um die 2010er die neu gedachte Form agilen Arbeitens als Scrum- und Design-Thinking-Mode ausdrückte, haben viele Organisationen anfänglich mit Design Thinking, dann mit Scrum experimentiert und neue Prozesse eingeführt. Es wurde dabei weder nach der Sinnhaftigkeit gefragt noch danach, wie agiles Arbeiten kulturell und bis zum Individuum nachhaltig eingeführt werden kann.
»Moment mal!«, denken nun einige Leser:innen. Aber lass uns auch gleich weiter sinnieren. Denn es gibt viel aufzuholen ...
So, Moment zu Ende, Einwand abgewürgt. Ja, du hast richtig gelesen. Aber dieses Tempo, diese Idee von Change, wie sie teilweise bis heute gelebt wird, ist nicht die Antwort, um agiles Arbeiten zu etablieren. Der stetige Umsatzdruck ist eine Idee aus den Jahren des großen Wachstums, in denen ein Change-Projekt auf das andere folgte. Es ging darum, stetig mehr aus dem bisher Erarbeiteten zu holen. Der Effizienzgedanke ist immer noch sehr von unserem industriellen Leben geprägt – an der Stelle können wir kurz Taylor winken, er freut sich, seit über 100 Jahren noch so sehr glorifiziert zu werden.
Zurück zum Wesentlichen.
[16]Wir haben einen entscheidenden Fehler bei der Einführung agiler Arbeitsweisen gemacht: Ein Change-Projekt aufgesetzt, schnell neue Arbeitsweisen ausgerollt, die uns den Kundenbedürfnissen näherbringen sollten. Da wir aber keine großen Umsatzeinbrüche haben wollten, stürzten wir uns auf die Methoden und Prozesse, anstatt die Kultur und die Individuen in den Fokus zu nehmen. Agiles Arbeiten wurde zu sehr auf der Strukturebene etabliert und betrachtet. Dabei war der Kerngedanke von Talcott Parsons ein anderer.
HOMMAGE AN TALCOTT!
Parsons’ Hauptinteresse war die Erarbeitung allgemeiner Muster für Veränderungsprozesse aller menschlichen Gesellschaften. Seine Theorie sollte zeit- und gesellschaftsunabhängig sein. Sie sollte genau eine theoretische Grundlage für alle sozialen Vorgänge in jeder Gesellschaft bieten. Hierbei war Parsons gleichermaßen von der Ökonomie und der Psychologie geprägt.
Im Verlauf hat er sich mit der Stabilität einzelner Systeme beschäftigt, geprägt von der funktionalistischen Sozialanthropologie. Diese war von einem überaus spannenden Ansatz begeistert, der gerade heute für uns relevant wäre (vgl. Kap. 3): Gesellschaft stellt einen Organismus dar, in dem die Einzelteile eine bestimmte und bestimmbare Funktion für die Erhaltung des Gesamtsystems haben.
Und jetzt nochmal zum AGIL-Schema. Parsons hat dieses Modell anfangs für die Handlungstheorie entworfen, später aber auch auf soziale Systeme angewendet.
»Der bedeutsamste Startpunkt unserer Vorgehensweise liegt in der Konzeption, dass Persönlichkeitssysteme und soziale Systeme beide Handlungssysteme sind, und Kultur ein verallgemeinerter Aspekt der Organisation solcher Systeme ist« (Parsons/Bales 1955, S. 32/33).
Im Zuge seiner Ausführungen bezüglich sozialer Systeme muss für Parsons ein System vier Funktionen erfüllen, nämlich Adaption (Anpassung), Goal Attainment (Zielverfolgung), Integration (Eingliederung) und Latency (Aufrechterhaltung).
Fangen wir mit Latency an und warum diese Funktion am meisten von allen verraten wurde durch die heutigen New-Work- und Agilitäts-Initiativen. Wenn wir uns diese Funktion der Aufrechterhaltung anschauen, so ist es die Idee, Stabilität durch Werte, Muster und Strukturen zu erreichen. Weitergedacht und sinnvoll hinterfragt: Was macht uns als Organisation, System, Gesellschaft aus? Was sollten wir aufrechterhalten?
Es geht um Fragen der Kultur! Und zwar bitte nicht erst dann, wenn gerade auf der »Gefühlseben« einiges im Argen liegt, was sich meist in Fluktuationsquoten und Krankheitstagen zeigt.
Kultur ist z. B. die Art und Weise, wie wir unter Kolleg:innen miteinander kommunizieren, wie Meetings gestaltet werden. Also der Umgangsstil: Ist er eher distanziert oder wird sich am Mor[17]gen erstmal ein flotter Spruch zugeworfen? Aber auch das Logo, die Gestaltung der Arbeitsplätze, die Routinen, das gemeinsame Mittagessen, womöglich in der Kantine, zählen zum Kulturgefüge. Letztendlich schenkt dies Mitarbeiter:innen Sicherheit und Zugehörigkeit. Und die wurde vielen sehr schnell entrissen.
Im Verlauf der New-Work- und Agilitätsdebatte haben sich viele Organisationen anpassen wollen, also dem A des AGIL-Schemas gerecht werden. Grundsätzlich nicht abwegig, aber schlichtweg auch nicht richtig. Wenn eine Organisation sich nachhaltig weiterentwickeln möchte, gilt es, sich auch ihre Historie bewusst zu machen, zu begreifen, was gut am schon Bestehenden ist und wie es nun weiterentwickelt werden kann. Womöglich sollten wir sogar Veränderung als Begriff streichen und Entwicklung lieber als Transformation betrachten – nämlich als Prozess. Dieser berücksichtigt allerdings die Kultur, die Identität der Organisation mit all ihren Werten, und baut darauf auf. Das Goal entsteht, wenn die Basis steht – die Kultur. Das I des AGIL-Schema möchte ich weiter deuten: Integration der Mitarbeitenden. Selbstorganisation ist nicht von heute auf morgen passiert. Viele Individuen müssen wieder lernen, dass sie mehr Freiraum erhalten und dass ihre Ideen gehört werden. Dann können der Markt und das Geschehen außerhalb viel besser integriert werden und es kann daraus Innovation wachsen. Aber dafür bedarf es echter Integration und Selbstorganisation der Mitarbeitenden.
Und dann noch etwas. AGIL ist eine Haltung. Keine Methode. Ich erlebe immer wieder, wie ein Scrum-Guide zum Heiligtum wird und es Streit darüber gibt, ob Design Thinking fünf oder sechs Phasen hat.
Also fangt von vorne an! Und hinterfragt die Muster des Denkens, Fühlens und Handelns in eurer Organisation. Gestaltet erst die Kultur und dann die Methoden neu. Bindet eure Leute ein, stellt die Kultur in den Mittelpunkt, wertschätzt das bisher Geschehene und baut darauf auf. Ihr seid ein Tanker und wollt ein Schnellboot werden? Was wäre, wenn ihr überlegt, was der Tanker gut kann, und lieber drauf aufbaut, euch treu bleibt? Vielleicht muss ja nur das Steuerboard schneller werden?
1.2.1Tool: Agile Journey Quadrants
Tool AGILE JOURNEY QUADRANTS
Das Tool Agile Journey Quadrants soll eine Unterstützung sein, um einerseits die agile Reise nochmals zu hinterfragen. Oder sie überhaupt zu beginnen. Es soll aber auch gleichzeitig als Startpunkt betrachtet werden, um wesentliche Fragen zu klären, die dem AGIL-Schema gerecht werden. Besonders ist darauf zu achten, eben nicht alles neu und hipp machen zu wollen, um sich im Glanz der New-Work-Szene sonnen zu können. Es soll vielmehr dazu dienen, sich bewusst zu machen, für was die eigentliche Organisation bisher steht, was besonders gut an ihr ist, welche Werte einen getragen haben. Dann erst kann [18]man die Zukunft betrachten. Also geht es um eine wertschätzende und nachhaltige Organisationsentwicklung.
Abb. 2: Agile Journey Quadrants
Vorbereitung ist alles!
Um das Tool anzuwenden, empfiehlt sich ein Workshop. Dafür muss die erste Entscheidung getroffen werden: zum Teilnehmerkreis. Idealerweise ist es ein heterogener Kreis aus Mitarbeitenden verschiedener Abteilungen, dem Management und Stabstellen.
Es sollten maximal 8–10 Teilnehmer sein. Sie sollten den für die Teilnahme nötigen Freiraum geschaffen bekommen, also für diesen Workshop frei vom daily business sein. Auch alles Ablenkende sollte zu dem Zeitpunkt außen vor sein.
Sinnvoll kann es auch sein, die Teilnahme auszuschreiben, anstatt willkürlich einen Personenkreis festzulegen.
Dann mal los!
Der Workshop kann 2–3 Stunden dauern, worin jeder Quadrant ca. 30–45 Minuten Erarbeitungszeit hat. Idealerweise wird für dieses Format ein ganzer Workshop-Tag eingeräumt, denn dann ist die Ausarbeitung umso intensiver und qualitativer.
[19]Der Quadrant Stabilität klärt das Bestehende: Historie, vergangene Erfolge und Leistungen, Werte und die Kultur dahinter. Was macht euch stolz? Was würde ein Kunde sagen, was er an euch schätzt? Was mögen die Mitarbeitenden? Was ist euer Qualitätssiegel? Und manches mehr.
Der Quadrant Anpassung klärt die Lücke zu neuen Erfolgen, Innovationen und Errungenschaften. Was bremst euch? Wo passieren Fehler, die sich wiederholen, ihr aber nicht daraus lernt? Was passiert auf dem Markt?
Im dritten Schritt besprecht ihr mit dem vorher geschärften Blick auf die Dinge eure Vision. Habt ihr eine? Passen eure Ziele dazu? Oder müssen sie angepasst werden? Ist eure Vision sinnstiftend und wegweisend? Formuliert zum Abschluss des Quadranten eine Vision mit den Teilnehmern. Hierzu kann jeder eine Vision formulieren und die Gruppe hat die Aufgabe, aus allen eine gemeinsame Vision zu gestalten.
Als letzten Quadranten besprecht ihr die Integration der Mitarbeiter:innen. Wie könnt ihr gemeinsam die Vision verfolgen? Und stimmt die Vision mit dem Markt ab – passt die Reise?
Ein kleiner Tipp zum Schluss: Es besteht auch die Möglichkeit, mehrere kleine 2–3-Stunden-Workshop-Formate umzusetzen, so können mehr spannende Ideen und Meinungen der Mitarbeitenden gesammelt werden.
1.3Change ist out
The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence; it is to act with yesterday’s logic.
Peter Drucker
Change heißt ja schlichtweg nichts Anderes als Verändern. Also wir »managen« die Veränderung. Allerdings managt die Veränderung doch schon längst uns! Mit dem ersten Tool von vorhin (Agile Journey Quadrants) möchte ich euch nicht einladen, danach ebenso in einen Projektmodus zu verfallen. Denn wir kommen nun zur nächsten Agilitätslüge: Change-Management.
Wir betrachten New Work, Agilität, Digitalisierung etc. immer noch sehr stark unter dem Blickwinkel von »Projekt aufsetzen und los geht’s«. Allerdings ist das ein völlig falsches Vorgehen, eben mit der Logik von gestern.





























