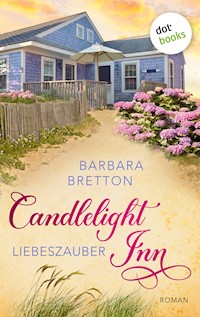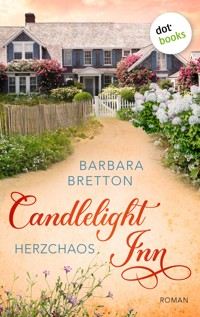Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Happy Ends warten nur darauf, eingefangen zu werden! Das Romantik-Highlight »Nächte aus Sternenlicht« von Barbara Bretton jetzt als eBook bei dotbooks. Die junge Single-Mutter Kate weiß vor lauter Trubel nicht mehr, wo ihr der Kopf steht: Sowohl in ihrem kleinen Antiquitätenladen an der Jersey-Küste als auch in ihrer chaotischen Familie ist sie die Frau für alles. Zeit zum Luftholen? Pustekuchen! Kein Wunder also, dass sie auf dem Weg zu ihrem nächsten Termin auf einmal ohnmächtig wird. Aber wer ist der attraktive Traumprinz, der sie in seinen starken Armen auffängt? Noch bevor Kate wieder klar denken kann, ist er verschwunden. Schon bald spricht die ganze Stadt von Kate und dem geheimnisvollen Fremden als wären sie Romeo und Julia. Als sie ihn tatsächlich wiedertrifft, möchte sie jedoch am liebsten im Boden versinken: Warum nur trägt Mark ein Priestergewand?! »Barbara Bretton verzaubert von der ersten Seite an in dieser Geschichte über die große Liebe und neue Anfänge.« Romantic Times Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Liebesroman »Nächte aus Sternenlicht« von USA-Today-Bestsellerautorin Barbara Bretton – Band 1 ihrer »Jersey Love«-Reihe, in der jeder Roman unabhängig gelesen werden kann. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die junge Single-Mutter Kate weiß vor lauter Trubel nicht mehr, wo ihr der Kopf steht: Sowohl in ihrem kleinen Antiquitätenladen an der Jersey-Küste als auch in ihrer chaotischen Familie ist sie die Frau für alles. Zeit zum Luftholen? Pustekuchen! Kein Wunder also, dass sie auf dem Weg zu ihrem nächsten Termin auf einmal ohnmächtig wird. Aber wer ist der attraktive Traumprinz, der sie in seinen starken Armen auffängt? Noch bevor Kate wieder klar denken kann, ist er verschwunden. Schon bald spricht die ganze Stadt von Kate und dem geheimnisvollen Fremden als wären sie Romeo und Julia. Als sie ihn tatsächlich wiedertrifft, möchte sie jedoch am liebsten im Boden versinken: Warum nur trägt Mark ein Priestergewand?!
»Barbara Bretton verzaubert von der ersten Seite an in dieser Geschichte über die große Liebe und neue Anfänge.« Romantic Times
Über die Autorin:
Barbara Bretton wurde 1950 in New York City geboren. 1982 veröffentlichte sie ihren ersten Roman, dem bis heute 40 weitere folgten, die regelmäßig die Bestsellerlisten eroberten. Ihre Bücher wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Sie lebt mit ihrer Familie in Princeton, New Jersey.
Die Website der Autorin: www.barbarabretton.com
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Bretton in ihrer »Shelter Rock Cove«-Reihe die Romane »Ein Traum für jeden Tag« und »Ein Sommer am Meer«.
Auch bei dotbooks erscheint ihre »Candlelight Inn«-Reihe mit den Bänden »Liebeszauber« und »Herzchaos« sowie ihre »Jersey Love«-Reihe mit den unabhängig voneinander lesbaren Romanen »Nächte aus Sternenlicht«, »Das Glitzern der Wellen« und »Das Leuchten der Morgenröte«.
***
eBook-Neuausgabe August 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2007 unter dem Originaltitel »Just like Heaven« bei Jove, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2008 unter dem Titel »Himmel der Liebe« bei Weltbild.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2007 by Barbara Bretton
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2008 by Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-013-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Nächte aus Sternenlicht« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Bretton
Nächte aus Sternenlicht
Roman
Aus dem Amerikanischen von Maria Mill
dotbooks.
Kapitel 1
Coburn, New Jersey ‒ 9.30 Uhr
Kate French verlagerte den Telefonhörer von der linken Schulter auf die rechte und griff tiefer in ihre Wäscheschublade.
»Mom!« Ihre Tochter Gwynn war kein Teenager mehr, ihrer Stimme aber war das nicht anzuhören. »Hörst du mir zu?«
»Ich höre jede Silbe.« Kate zerrte eine einsame Stricksocke und ein rosa Seidenmieder (vorsintflutlich, noch aus der Disco-Ära) heraus und warf sie auf das Bett hinter sich.
»Und was soll ich tun?«
Leider hatte Kate bei diesem Gespräch nach fünf Minuten den mütterlichen Autopilot eingeschaltet und den Faden verloren. War Gwynn noch immer bei ihrer Mitbewohnerin Laura und deren übertriebener Verehrung der New York Giants, oder hatte sie bereits zu einem alten Lieblingsthema aller French-Frauen übergeleitet: der Zergliederung von Kates nicht existierendem Liebesleben?
Sie beugte sich hinunter und spähte tiefer in die parfümierten Ecken. Ein schlichter Baumwollschlüpfer. War das etwa zu viel verlangt? »Erklär’s mir doch noch mal, Schatz.«
»Ich weiß, was du machst«, sagte Gwynn. »Du beantwortest E-Mails, während ich dir hier mein Herz ausschütte. Das solltest du wirklich nicht tun.«
»Ich bin nicht am Computer, Gwynnie.«
»Ich höre doch die Tasten klicken.«
»Du hörst nur deine Mutter, die ihre Wäscheschublade nach einem …«
»Bleib dran! Ich krieg gerade noch einen Anruf.« Der Abstand zwischen dem dreizehnjährigen Mädchen, das ihre Tochter einmal gewesen war, und der inzwischen dreiundzwanzigjährigen Frau entpuppte sich als nicht ganz so gewaltig, wie Kate es sich erhofft hatte. Sie warf einen Blick auf ihren Wecker auf dem Nachttisch. Mach schon, Gwynnie. Ich hab zu tun.
»Das war Andrew.« Gwynn, die Verliebte, hatte Gwynn, die Tochter, abgelöst. Sie klang völlig verzückt. Ein Ton, der sich in Kates Ohren wie ein Griffel auf der Schiefertafel anhörte. »Er hat vom Schiff aus angerufen! Ist das nicht der …«
»Ich leg jetzt auf«, sagte Kate. »Ich habe eine Verabredung in Princeton, und ich bin spät dran. Wir können doch ein andermal weiterreden, oder?«
»Aber Mom, ich hab dir doch immer noch nicht …«
»Ich weiß, ich weiß, aber es hilft einfach nichts. Ich will wirklich alles hören, Schatz, aber nicht jetzt.«
»Du fährst nach Princeton?«
»Ja, aber nicht, wenn ich nicht in den nächsten zehn Minuten hier draußen bin.«
»Wenn ich jetzt losgehe, könnte ich dich zum Mittagessen beim Mexikaner treffen und dir persönlich von meinen Neuigkeiten berichten.«
»Ich dachte, unter der Woche machst du bei O’Malleys die Mittagsschicht.«
»Montags ist nichts los. Es wird ihnen gar nicht auffallen.«
»Du kannst doch nicht einfach wegbleiben, Gwynn. So hast du auch schon deinen letzten Job verloren!« Und wenn du hingehst, kommst du andauernd zu spät. So wirst du nie was erreichen.
»Das machst du immer mit mir.«
»Was denn?« Sie warf einen Blick auf ihre Uhr. War sie denn die Einzige in der Familie, für die Pünktlichkeit eine Bedeutung hatte?
»Immer wird aufgerechnet und Buch geführt. Warum kannst du nicht einfach akzeptieren, dass mein beruflicher Werdegang anders verläuft als deiner, und mich mein eigenes Leben leben lassen?«
»Müssen wir dieses Gespräch unbedingt jetzt führen, Gwynnie?« Ihr Biorhythmus war noch immer auf Londoner Zeit eingestellt, und sie hatte keine Lust, mit einer eigentlich selbstständigen jungen Frau, die immer noch erwartete, dass Mommy ihr die Kfz-Versicherung bezahlte, persönliche Rechte und Freiheiten zu erörtern.
»Du klingst sauer.«
»Was du da hörst, ist der Jetlag.« Sie wartete auf die zu erwartende Reaktion ihres einzigen Kindes, doch sie kam nicht. »Hast du vergessen, dass ich fast zehn Tage in England war? Vom Zeitgefühl her bin ich immer noch in London.« Klingelt da was bei dir, Gwynn? Irgendwie bildete sie sich ein, dass es die meisten Töchter bemerken würden, wenn ihre Mütter außer Landes waren.
»Du warst ewig weg. Deswegen hab ich dir ja auch so viel zu erzählen.«
»Es hilft alles nichts, Schatz. Ich muss wirklich weg.«
»Geht’s dir denn gut?«, fragte Gwynn. »Du bist ganz anders als sonst.«
»Wir reden später, Schatz«, sagte sie und legte auf.
Normalerweise hätte Kate sich schuldig gefühlt, ihrer Tochter derartig das Wort abzuschneiden, doch an diesem Tag fühlte sich sich lediglich erleichtert. Sie liebte Gwynn mehr als ihr Leben, aber die melodramatischen Ausbrüche ihrer Tochter hatten etwas an sich, das ihr buchstäblich den Atem raubte.
»Okay«, sagte sie, als sie das Handy aufs Bett warf. »Und jetzt zur Sache.«
Es musste doch noch irgendetwas Tragbares im Haus sein. Eine zehntägige Reise nach England konnte doch nicht sämtliche Wäschevorräte einer Frau erschöpfen. Sie zog die zweite Schublade ihrer Kommode heraus und kippte den Inhalt auf einen Haufen. T-Shirts aus diversen Inselparadiesen. Strapse mit winzigen, auf handgeklöppelte Spitze gestickten Rosen, Relikte einer längst vergangenen Valentinsfeier. Mehr BHs, als jede Frau mit Größe 75B in drei Leben gebraucht hätte. Eine Muschelkette. Die schwarze Spitzenmantille, die sie während ihres letzten Urlaubs als Ehefrau in einem Laden in Sevilla gefunden hatte. Eintrittskarten, ein Programm des McCarter-Theaters, ein verschrumpelter Dackel-Ballon und das mit Sicherheit schlimmste Geburtstagsgeschenk, das ihr ihre Mutter Maeve je gemacht hatte: der berüchtigte rote Spitzentanga.
Maeve war Anfang der turbulenten Sechziger jung gewesen und meinte, die Flamme der Rebellion entzünden zu müssen, wo immer sich ihr eine Gelegenheit dazu bot. Und wie ließ sich bei ihrer vierzigjährigen Tochter wohl besser so etwas wie Leidenschaft entfachen, als wenn sie ihr vor sämtlichen Freunden, Kollegen, Verwandten sowie einem halben Dutzend potenzieller Liebhaber unerhört aufregende Unterwäsche überreichte? Leider hatten die Gefühle, die Maeve damit bei ihrer Tochter auslöste, überhaupt nichts mit Liebe, aber viel mit Verlegenheit zu tun gehabt. Kate hatte zwar versucht, es sportlich zu nehmen, aber sie hatte ihre ganze Selbstbeherrschung aufbieten müssen, um ihrer Mutter nicht an die Gurgel zu springen.
Sie hielt den Tanga in die Höhe. Er hätte nicht mal eine Barbiepuppe notdürftig bedeckt, von einer ausgewachsenen Frau ganz zu schweigen. Was, um Himmels willen, hatte Maeve sich bloß dabei gedacht?
Sie überlegte, noch rasch zu Target zu fahren und einen Dreierpack Unterhosen zu kaufen. Aber die Uhr tickte, und Professor Armitage war nicht für seine Geduld bekannt. Dazu kam die Tatsache, dass sie mehr als erschöpft war. Der Jetlag setzte ihr eigentlich nur selten zu, an diesem Tag aber hatte sie Mühe, die Augen lange genug offenzuhalten, um mit dem Anziehen fertig zu werden.
Sie zwängte sich mühsam in das Nichts aus Spitze und Elastik und warf einen Blick in den Spiegel. Das war ja besser als ein Koffeinstoß! Der Tanga hätte einen Warnaufkleber gebraucht. So viel Realität so früh am Morgen war schwer zu verkraften.
Sie betrachtete sich genauer. Das konnte doch wohl nicht wahr sein! So viele Dellen konnte der menschliche Körper nicht besitzen. Vielleicht sollten sie ein Etikett mit Anweisungen für Dessous-Geschädigte hinzufügen. Sie schlüpfte aus dem Tanga, wirbelte ihn herum und versuchte es noch einmal.
Eine Einundvierzigjährige in rotem Spitzenhöschen war ein Bild für die Götter. Aber zum Glück war es ja ein Anblick, den kein anderer Irdischer je zu sehen bekommen würde.
Rocky Hill, New Jersey ‒ 9.45 Uhr
»Herzlichen Glückwunsch«, meinte die Mäklerin, als Mark Kerry ihr die vier unterschriebenen Kopien des Vertrags überreichte. »Jetzt ist es offiziell: Ihr Haus ist verkauft.« Es war auch der Punkt, von dem an es kein Zurück mehr gab. »Und nun?«, fragte er und hätte sich gewünscht, mehr Begeisterung über den Verkauf zu empfinden.
Bev überflog die Blätter mit den Unterschriften und schob sie in einen großen Ordner. »Die voraussichtliche Auflösung ist in sechs Wochen. Ich kümmere mich um die Begutachtung, die Hausabnahme, Radon-Test, Rauchmelder und so weiter und so fort. Sie müssen lediglich packen und umziehen«, sagte sie und lächelte vergnügt.
»Und die Genehmigungen der Gemeinde fürs neue Dach, besorgen Sie die?«
»Sehen Sie!« Bev verdrehte die Augen. »Wenn er nicht angewachsen wäre, würde ich meinen Kopf vergessen. Wir brauchen die Dach-Genehmigungen, die unterschriebene Auskunft über die Verwendung von Bleifarbe und den Namen Ihres Anwalts. Sie können sie mir zufaxen, und ich hole mir die Originale dann ab.«
»Bis jetzt war es ja fast schmerzlos.«
»Fünf Tage vom Aufgeben des Angebots bis zum Vertrag«, meinte Bev mit unverkennbarer Befriedigung, »und wir haben einen guten Preis erzielt. Viel mehr ist nicht drin.«
Sie gab ihm ein Formular mit wichtigen Telefonnummern und tätschelte ihm metaphorisch den Rücken.
»Sie wirken ein bisschen irritiert«, sagte sie, als er sie den Kiesweg hinunter zu ihrem Wagen begleitete. »Den unangenehmen Teil haben Sie hinter sich, das verspreche ich Ihnen.«
Sie hatte leicht reden. Demnächst, am Memorial-Day-Wochenende, würde er sich auf dem Rückweg nach New Hampshire befinden, um zu sehen, ob eine Heimkehr wirklich möglich war.
Wo war es eigentlich, sein Zuhause? Dieses kleine Stein-Cottage in New Jersey hatte zwar nicht sehr viele Pluspunkte, aber irgendwie war es ihm in den letzten zwei Jahren doch zur Heimat geworden. Oder so nahe dran, wie das eben möglich war.
Zwei briefmarkengroße Schlafzimmer. Winzige Küche. Kein Esszimmer. Kein Wohnzimmer. Ein Kellergeschoss mit den üblichen Problemen. Als er damals durch die Haustür getreten war, hatte er gewusst, das war der Ort, wo er hingehörte.
Doch nichts währte für immer.
Der zweite Vertrag, den er unterschreiben musste, lehnte am Toaster ‒ zusammen mit einer Notiz seiner alten Freundin Maggy Boyd, die ihn durch das gesamte Verfahren lotste.
Das Komische war, dass er mit mehr Zeit gerechnet hatte. Bev hatte ihn zur Geduld gemahnt. Der Immobilienmarkt in New Jersey sei nicht mehr so heiß wie früher einmal, und es könne schon eine Weile dauern.
Doch das tat es nicht.
Kris und Al Wygren tauchten am Sonntag, seinem ersten Besichtigungstermin, bei ihm auf und verliebten sich Hals über Kopf in das Häuschen. Sie liebten die schiefen Fenster, den großen offenen Steinkamin, die knarrenden Dielen, einfach alles. Er wies sie auf sämtliche Mängel und Unzulänglichkeiten hin, und sie mochten es nur noch mehr.
Die Wygrens waren höchstens fünf- oder sechsundzwanzig. Frisch verheiratet. Sie war gerade schwanger geworden. Bereit, sich ein eigenes Nest zu bauen.
Er und Suzanne waren genauso gewesen. Jung und verliebt, ihre ganze Zukunft vor ihnen ausgebreitet wie eine Blumenwiese. Nicht, dass er auf diesen Vergleich verfallen wäre. Das war Suzanne in Reinkultur. Sie hatte das Leben derart optimistisch betrachtet, dass es ihn im Nachhinein noch verblüffte.
Ihre Mutter hatte immer gemeint, Gott habe bei der Erschaffung Suzannes einen großzügigen Tag gehabt. Er hatte ihr Schönheit, Esprit, Intelligenz und ein gutes Herz geschenkt und einen Sinn für Humor, der Mark nach all den Jahren manchmal noch immer ein Schmunzeln entlockte.
Doch das eine, was Gott ihr nicht hatte schenken wollen, war gerade das, worauf es ankam: ein langes Leben.
Sie hatte einen Helden in ihm gesehen. Die Sorte von Mann, die sein Vater gewesen war und die er gern hätte sein wollen. Doch die Zeit war nicht auf ihrer Seite gewesen. Sie war ihm geraubt worden, als er sich noch mitten in seiner persönlichen Entwicklung befand.
Wenigstens hatte Suzanne ihn nie straucheln und fallen sehen. Hatte ihn nie vor ihrem Hauseingang auf der Nase liegen sehen, nie gerochen, wie er nach billigem Whiskey und Schmerzen stank. Sie war nicht mehr da gewesen, hatte seine Fluchtversuche vor den Erinnerungen an ihre Vergangenheit nicht miterlebt. Die verlorenen Tage, die dunklen Nächte gehörten ihm allein, und dafür war er dankbar.
Nie hatte sie erfahren, dass ihr Held auch nur ein Mensch war.
Coburn, New Jersey ‒ ungefähr halb elf
Kate stand auf der 287 in der Nähe der Abfahrt Bedminster im Verkehr, als eine Welle über sie hinwegschwappte, die unangenehm an Brechreiz erinnerte. Jetlag auf leeren Magen war ja schon schlimm genug, aber weil es so scheußlich war, gab sie dem Tanga die Schuld.
Als sie sich der Bridgewater Commons Mall näherte, ließ der Verkehr zwar nach, aber ständig klingelte ihr Handy. Zweimal meldete sich ihre Assistentin Sonia. Clive rief aus England an, um ihr zu sagen, dass sie ihre Sonnenbrille vergessen hatte. Armitages Sekretärin wollte sich vergewissern, dass sie auch pünktlich kommen würde. Jackie, die Polsterin, kam mit einem weiteren ihrer kleinen Notfälle, um ihren Preis um weitere zehn Prozent in die Höhe zu treiben.
Alle riefen sie aus verschiedenen Gründen an, doch jeder Anruf endete gleich. Du klingst erschöpft… Du brauchst einen Urlaub, keine Einkaufsreise … Ich mach mir Sorgen um dich …
Ein Segen, dass es Anklopfen gab, die großartigste Ausweichstrategie, die je erfunden worden war. Was hatten die bloß alle? Sicher, ihr waren die dunklen Ringe unter ihren Augen auch schon aufgefallen, aber das lag in der Familie. Die hatte auch Maeve, und Maeves Mutter hatte sie ebenfalls gehabt. Und wenn sie nicht ganz falsch lag, durfte sich auch Gwynn darauf gefasst machen. Kate war keine Zwanzig mehr. Nicht mal Estee Lauder konnte die Uhr zurückdrehen.
Sie rutschte auf dem Fahrersitz herum, zerrte an dem elastischen Gurt, der auf ihren Hüftknochen drückte. Ihre Mutter hatte ihr versichert, der Tanga werde ihre innere Göttin befreien und sie in eine Sirene verwandeln, die imstande war, Männer vom Sportfernsehen und von Baywatch-Wiederholungen fortzulocken, doch bis jetzt zeigte die innere Göttin nicht viel Wirkung.
Als sie sich der Abfahrt zur Route 1 näherte, begann ihr Handy, die Wilhelm-Tell-Ouvertüre zu spielen. Die Erkennungsmelodie ihrer Mutter.
»Was hast du Gwynn erzählt? Sie hat heulend bei mir angerufen.«
»Hallo, Mutter. Ich dachte, du wärst in New Mexico.«
»Bin ich ja auch, aber unser Mädel hat mich mit ihrer Leidensgeschichte aufgeweckt. Was ist los bei euch?« Maeve befand sich am anderen Ende des Landes, um für ihren neuen Selbsthilfe-Ratgeber zu recherchieren, doch das Familiendrama überwand alle geographischen Entfernungen.
»Das war nur wieder mal Gwynn, wie sie leibt und lebt«, meinte Kate. »Sie wollte reden, aber ich musste mich anziehen und losfahren.«
»Du hast sie verletzt. Sie hatte dir was zu sagen.«
»Einmal in dreiundzwanzig Jahren lege ich den Hörer auf ‒ und das ist dann ein schwerwiegender Zwischenfall?« Sie atmete mehrere Male tief durch und versuchte, sich zu beruhigen. »Ich habe seit fast sechsunddreißig Stunden kein Auge zugetan, Maeve, und mein Körper glaubt, es ist drei Uhr nachmittags.«
»Du klingst irgendwie anders«, bemerkte Maeve. »Was ist los mit dir, Schätzchen? Wir machen uns Sorgen um dich.«
»Ist Merkur etwa wieder rückläufig? Mir fehlt nichts, was sich durch einmal Ausschlafen nicht kurieren ließe. Warum fragen mich plötzlich alle, ob’s mir gut geht?« Jetlag war ja kein neues Phänomen.
»Vielleicht, weil du eindeutig anders bist als sonst. Du kommst mir ein bisschen deprimiert vor, zerstreut …«
»Ma!« Kate schrie geradezu in das winzige Mikrofon ihres Telefons. »Ich glaube, jetzt geht deine Fantasie mit dir durch.«
»Vielleicht kommst du ja doch so allmählich in die Wechseljahre«, meinte Maeve.
Dieser Morgen wurde wirklich immer schlimmer. Nicht die Möglichkeit!
»Und wie ist es in London mit Liam gelaufen? Hat es gefunkt?« Ihre Mutter war absolut unverwüstlich.
»Wir haben an meinem ersten Tag dort Tee miteinander getrunken. Und damit hatte sich’s.«
»Sharon meinte, er sei perfekt für dich. Sie wird maßlos enttäuscht sein.«
»Soll Sharon doch nächstens mal dich mit all den Liams und Nigels dieser Welt verkuppeln. Ich sag es dir doch immer wieder, dass ich nicht auf der Suche bin, und ich meine es ernst.«
»Mag ja sein, dass du nicht auf der Suche bist, aber würdest du einen Guten ‒ sofern einer auftauchen würde ‒ denn abweisen?«
»Ich weiß nicht so recht, ob es überhaupt Gute gibt«, erwiderte Kate. »Wenigstens keine, an denen ich Interesse hätte.«
»Das ist doch nicht normal, Schatz. Du klingst, als hättest du aufgegeben.«
»Das ist doch nichts Neues, Mom. Ich bin als Single völlig zufrieden, auch wenn das alle anderen in helles Erstaunen zu versetzen scheint. Können wir’s nicht einfach dabei belassen?«
»Sara Whittakers Sohn ist wieder in der Stadt. Er hat die letzten paar Jahre in Tokio gearbeitet, er ist Graphiker. Ich glaube, ihr zwei würdet euch gut verstehen.«
»Mom, ich hab noch einen Anruf in der Leitung. Wir müssen das auf später verschieben.«
»Mir brauchst du nicht mit dem Anklopf-Vorwand zu kommen, Schätzchen. Ich weiß, wann du genug hast.«
Kate musste lachen. »Diesmal ist es wirklich ein Anruf«, sagte sie, während ihre Gereiztheit verflog. »Ich ruf dich heute Abend an. Versprochen.«
Paul Grantham, ihr alter Freund und Vertrauter, war als Nächster an der Reihe.
»Lang genug hat’s ja gedauert, French.« »Gott sei Dank bist du es«, sagte sie und rückte ihren Kopfhörer zurecht. »Seit ich aus dem Flieger gestiegen bin, hört dieses Ding nicht mehr auf zu klingeln.«
»Und ‒ wie war die Einkaufsreise? Gibt es denn noch was auf der anderen Seite des großen Teichs?«
»Nicht viel«, gestand sie. »Aber ich bin vielleicht auf eine Goldader gestoßen.« Sie erzählte ihm von dem Stapel von Briefen aus der Zeit des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges, die sie in einem winzigen Laden unweit der Grenze von Lincolnshire gefunden hatte und die an die Frau eines Oberst in New Jersey geschrieben worden waren.
»Und wann weißt du, ob du die Hauptader gefunden hast?«
Wie aus dem Nichts tauchte plötzlich mit plärrender Hupe ein Lastwagen hinter ihr auf. »Oh, verdammt! Tut mir leid!« Sie schwenkte mit heftig klopfendem Herzen in ihre Spur zurück. »Was hast du eben gesagt?«
»Alles in Ordnung?«, fragte er. »Du klingst mir ein bisschen außer Atem.«
»Ich bin nicht außer Atem. Das muss die Verbindung sein.« Die und ihr ansteigendes Adrenalin.
Sie wartete, während Paul die Frage einer Assistentin beantwortete.
»Tut mir leid«, sagte er. »Verrückter Morgen. Wir gehen doch immer noch auf die Klinik-Gala diese Woche, oder?«
»Dann steht Lisa wohl nicht mehr zur Verfügung.«
»Lisa sucht jemanden, der bereit ist, sich ganz auf sie einzulassen«, sagte er, »und wir wissen ja beide, dass ich mich für dich auf spare.«
Es war ein alter Scherz zwischen ihnen, doch in letzter Zeit hatte sie das Gefühl, dass sich hinter den Worten ihres alten Freundes mehr verbarg, als sie beide sich eingestehen wollten.
Paul war Partner in einer renommierten Anwaltskanzlei in Manhattan, noch einer aus der Coburner Highschool-Klasse von 1982, der es geschafft hatte. Er gehörte zu ihrem Leben, so lange sie denken konnte, hatte sie vom Kindergarten bis zum Ende der Highschool begleitet. Er hatte sich mit ihnen in Rutgers herumgetrieben, als Kate erfolglos versuchte, Ehe, Mutterschaft und College unter einen Hut zu bringen, und er war ihr ein guter Freund geblieben, auch nachdem ihre jeweiligen Ehen in die Scheidungsstatistik eingegangen waren. Sie hatten es früher schon mal mit einem Date probiert, doch die Absurdität der Situation ‒ sich in Schale zu werfen und einander bei Kerzenlicht und einer Flasche Taittinger in die Augen starren zu sollen ‒ hatte sie beide in hilfloses Gelächter ausbrechen lassen, wobei es dann mehr oder weniger geblieben war.
Wenigstens hatte sie dies bis vor Kurzem gedacht.
»O mein Gott«, stieß sie plötzlich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Ich bin fast auf einen Bullen aufgefahren.«
»Bist du auch wirklich okay?«, fragte er. »Vielleicht solltest du dir mal einen Tag frei nehmen und dich ausschlafen.«
»So was sagt man höchstens zu seiner alten Tante«, schnappte sie zurück. »Fürs Altersheim bin ich noch nicht reif, Paul.«
»Weißt du was«, meinte er. »Wie wär’s, wenn wir zwei uns nach unserer Pensionierung zusammentäten: Wir legen unsere Renten zusammen und gründen eine Wohngemeinschaft.«
»Sehr charmant!« Sie brachte den Wagen zum Stehen. »Kein Wunder, dass Lisa am Wochenende nicht mit dir zur Gala will.«
»Sie ist achtundzwanzig. Ich kann nicht warten, bis sie in Rente geht.«
Sie suchte nach etwas Passendem, Witzigem, das sie darauf erwidern konnte, doch ihr Hirn war völlig leer gepustet.
»Kate?« Pauls Stimme stieß durch den Nebel. »Bist du noch dran?« »Tut mir leid«, sagte sie einmal mehr. »Ich weiß gar nicht, was heute mit mir los ist.«
»Hast du was gegessen? Wahrscheinlich hast du Hunger.«
»Ich hab mir am Flughafen ein Brownie und einen Frappuccino gekauft, während ich auf die Zollabfertigung meiner Koffer wartete.«
»Und jetzt klappst du gleich zusammen. Fahr zu einem McDonald’s und kauf dir einen Egg McMuffin.«
Er klang ungewohnt besorgt, sodass sie sich fragte, wie schlimm sie eigentlich klang.
»Ich habe keine Zeit. Armitage erwartet mich in zwanzig Minuten.«
»Scheiß auf Armitage. Besorg dir was zu essen. Du pfeifst auf dem letzten Loch.«
Eine zweite Übelkeitswelle packte sie. Vielleicht hatte er ja recht. »Ich bin jetzt gleich bei der Princeton Promenade«, sagte sie und wechselte auf die rechte Fahrspur. »Die haben eine tolle Cafeteria.« Sie konnte sich einen Sportriegel und eine Flasche Wasser kaufen und unverzüglich weiterfahren.
»Gute Idee.«
»Oh, warte! Ich muss gar nicht halten. Ich hab noch Nüsse im Handschuhfach.« Sie beugte sich über den Beifahrersitz und ließ auf der Suche nach den geräucherten Mandeln -Überbleibsel ihrer letzten Fahrt an die Küste zur halbjährlichen Atlantique City Extravaganza ‒ das Handschuhfach aufschnappen. Die Antiquitätenmesse in Atlantic City war ein Muss für jeden Antiquitätenhändler aus New Jersey, und Kate machte da keine Ausnahme. French Kiss behauptete sich zweimal im Jahr an prominenter Stelle. Sie ging ihre Versicherungskarte, Fahrzeugschein, Benutzerhandbuch durch, schob eine kleine Taschenlampe und eine aufgerissene Tempo-Packung beiseite. Wo waren die Mandeln?
Sie schwenkte auf den Kotflügel eines weißen Escalade zu und steuerte, von einem Chor verärgerter Hupen begleitet, in ihre eigene Spur zurück.
»Was zum Teufel ist denn da los?«, fragte Paul. »Das klingt ja, als wärst du bei einem Rollschuhrennen.«
Sie erblickte sich kurz im Rückspiegel, und das seltsame Gefühl in der Magengrube verstärkte sich. Eine einzelne Schweißperle rann ihr über die Stirn auf das rechte Auge zu. Draußen waren kaum fünfundzwanzig Grad. Bei solchem Wetter brach niemand in Schweiß aus, und sie am allerwenigsten.
»Du hast recht«, sagte sie. Alle hatten sie recht. »Ich stelle eine Gefahr dar. Ich sollte wohl sofort von der Straße runterfahren.«
»Soll ich kommen und dich abholen?«
Sie setzte ihren Blinker und bog nach rechts auf den Parkplatz der Princeton Promenade. »Sei nicht albern. Du bist in Manhattan. Wenn ich was gegessen habe, geht es mir wieder gut.«
»Ich schick dir einen Wagen. Wir benutzen Fahrdienste im gesamten Einzugsgebiet von New York.«
Sie entdeckte eine Parklücke zwei Reihen weiter und steuerte darauf zu. »Ich halte hier an. Esse was. Und alles ist wieder in Ordnung.«
»Ich verlass mich auf dich.«
Sie kurvte um das Ende der ‒ vom Eingang her gesehen ‒ dritten Reihe und glitt in die Parklücke, als ein verbeulter blauer Honda sich hinter ihr quer stellte. »Aha«, sagte sie.
»Was ist denn los?«
»Ein Kerl in einem alten blauen Auto starrt mich an. Meint anscheinend, dass ich ihm den Parkplatz weggeschnappt habe.«
»Und, hast du?«
»Er hat nicht geblinkt.« Sie zögerte und vergegenwärtigte sich das Ganze noch einmal. »Kann schon sein.«
»Wo ist er?«
»Steht direkt hinter mir.«
»Versperrt er dir den Weg?«
Sie ließ sich tief in den Sitz sinken. »Ich mach so was nie. Ich bin die höflichste Autofahrerin der Welt.«
»Ist er immer noch da?«
»Ja.«
»Soll ich die Mall-Security anrufen? Ich kann einen anderen Anschluss benutzen.«
Sie zögerte. »Vielleicht könntest du ‒ oh, Gott sei Dank! Er fährt weg.« Sie verfolgte ihn im Rückspiegel. Gut aussehende Männer ihrer Altersgruppe hatten nicht das Recht, Grateful-Dead-T-Shirts zu tragen.
Paul wollte während ihres gesamten Besuchs im Einkaufszentrum mit ihr quatschen, doch ihr Akku war fast leer. Sie wurde ihn nur los, wenn sie ihm versprach, ihn nach ihrem Besuch bei Professor Armitage zurückzurufen.
Normalerweise hätte sie sich solche Fürsorge verbeten, doch bis jetzt war nichts an diesem Morgen auch nur annähernd normal verlaufen. Diese ganze Fürsorglichkeit sah ihm überhaupt nicht ähnlich. So besorgt hatte er das letzte Mal geklungen, als seine Tochter ihm mitgeteilt hatte, dass sie Model werden wolle.
Ein vages Gefühl von Bedrohung schnürte ihr die Brust zu und wollte sie nicht mehr loslassen.
»Okay«, sagte sie laut. »Nun dreh mir bloß nicht noch ganz durch.«
Das Problem war so offensichtlich, dass es geradezu lächerlich war: Sie brauchte etwas zu essen und zu trinken, und zwar sofort. Die Cafeteria befand sich in der Nähe des Multiplex am Südende des Einkaufszentrums. Eine riesige runde Uhr zur Linken des Sushi-Palasts gab ihr eine Auskunft, die sie nicht benötigte. Armitage erwartete sie in exakt dreizehneinhalb Minuten an seiner Haustür. Selbst wenn sie sich hier nichts zu essen kaufte, würde sie es nicht mehr rechtzeitig schaffen.
Warum hatte sie die Sache nicht einfach abgesagt, als sie am Morgen am Flughafen festsaß und auf ihre Kisten und Koffer wartete? Warum war sie so versessen darauf gewesen, so viel wie nur möglich in diesen Tag hineinzustopfen?
Sie schluckte schwer gegen die plötzliche, bittere Übelkeit in ihrer Kehle. Die Luft war weich, süß und frühlingsfrisch, und sie sog große Schlucke davon ein, um so das Unbehagen loszuwerden, doch es half nichts.
Sie klappte ihr Handy auf, sagte »Ruf Armitage an«, und wartete, während es eine Verbindung herzustellen versuchte.
»Ruf Armitage an«, sagte sie noch einmal.
Doch auch diesmal hatte sie kein Glück.
Sie musste sich in der Cafeteria ein Telefon suchen und …
Und dann?
Professor Armitage. Das war’s. Konzentrier dich! Der Gedanke an den Zorn des Professors war nicht halb so entnervend wie dieses merkwürdige Gefühl von Abgetrenntheit, das immer intensiver zu werden schien. Wenn Armitage die Dokumente nicht in der Notaufnahme der nächsten Klinik begutachten wollte, dann würde er einfach Verständnis haben müssen.
Aber für was denn Verständnis? Eine Sekunde lang wurde ihr schwarz vor Augen, während wirre Bilder ihr Gehirn überschwemmten. Professor Armitage’ wolliger grauer Bart. Seine wilden kleinen Augen. Die kalte, glatte Metallbox in ihren Händen. Die Art, wie dieser blöde Tanga sie genau an einer Stelle kniff, wo kein vernünftiger Mensch gekniffen werden wollte. Das zischende Geräusch in ihrem Kopf …
Bloß nicht in Ohnmacht fallen!, ermahnte sie sich. Sie würde ja sterben vor Scham, wenn die in der Notaufnahme entdeckten, was sie unter ihrem pfirsichfarbenen Baumwoll-Twinset und den Perlen trug.
Ein Schauder lief ihr die Wirbelsäule hinauf, und sie verdrängte den Gedanken so weit als möglich. Offenbar war auch ihre Einbildungskraft jetlag-geschädigt und aus dem Gleichgewicht wie der ganze Rest von ihr, und sprang ohne Vorwarnung von einem bizarren Gedanken zum nächsten.
Vom Kranksein hatte sie nicht die geringste Ahnung. Ihr letzter Krankenhausaufenthalt lag dreiundzwanzig Jahre zurück, als sie Gwynn geboren hatte. Sie besuchte eher Kranke und brachte ihnen Blumen, Pralinen und Erzeugnisse der Regenbogenpresse mit, damit sie sich die Zeit vertreiben konnten. Und sie ging immer erst nach Hause, wenn die Besuchszeit vorbei war.
Der Tanga kniff sie bei jedem Schritt und zwickte noch mehr, wenn sie stehen blieb. Sie wollte nur zwischen den geparkten Wagen verschwinden und ihn schnell ein wenig lockern, doch das war ja klar: Der Kerl, dem sie beim Parken zuvorgekommen war, stand zwei Reihen weiter und guckte genau zu ihr herüber.
Schlimm genug, dass sie Unterwäsche trug, die ihr zehn Jahre zu jung und zwei Größen zu klein war. Dass sie von einem zornigen Mann in einem Grateful-Dead-T-Shirt dabei erwischt wurde, wie sie in aller Öffentlichkeit daran herumfummelte, durfte sie sich gar nicht erst vorstellen. Eine Sekunde lang begegneten sich ihre Blicke, dann sah sie weg. Sein Blick war beunruhigend direkt, allerdings nicht zornig, und das verunsicherte sie. Sie hatte Ärger oder Gereiztheit erwartet, entdeckte aber weder das eine noch das andere. Er flirtete nicht mit ihr, doch es war etwas in seinem Blick, das sie nicht genau benennen konnte. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie ein Männerblick das letzte Mal derart aus der Fassung gebracht hatte. Nun beeinträchtigte der dumme Tanga schon ihr Urteilsvermögen.
Sie warf ihm einen weiteren raschen Blick zu. Groß, hager. Dichtes dunkles Haar, das in der Sonne glänzte. Außerdem trug der Typ ein Grateful-Dead-T-Shirt. Was gab es da noch zu sagen?
Eine Frau mit drei kleinen Kindern im Schlepptau hastete in einer Duftwolke aus Babypuder und Seife an ihr vorbei. Der süßliche Geruch brachte ihren Magen zum Schlingern, und eine Sekunde lang dachte sie, sie müsste in Ohnmacht fallen. Durch tiefes Einatmen der frischen Frühlingsluft versuchte sie, sich noch einmal zu stabilisieren, doch plötzlich wurde ihr eng um die Brust, als ob irgendeine unsichtbare Kraft ein Band um ihren Brustkorb schlänge und immer fester zuziehe, und sie merkte, dass sie zu Boden ging.
Oder lag sie vielleicht schon dort? Sie war sich nicht sicher. Sie nahm die Welt um sich herum nur noch verschwommen wahr ‒ wenn man von dem ekelerregenden Geruch nach eingemachtem Ingwer, altem Juicy Fruit und Motoröl absah.
Ich schlafe, dachte sie. Denn welche andere Erklärung konnte es dafür geben? Das hatte nichts mit dem wirklichen Leben zu tun. Mach die Augen auf, Kate. Diesen Traum kannst du wirklich nicht gebrauchen.
Das Zimmer roch wie ein Müllcontainer. Die Matratze war steinhart, die Laken hatten sich um ihre Beine verheddert, und sie hatte ein Gefühl, als ob sie …
Sie schlug die Augen auf und brüllte. Das heißt, sie versuchte zu brüllen, bekam aber nicht genug Luft, um mehr als ein lautes Flüstern zustande zu bringen.
Der Typ im Grateful-Dead-T-Shirt, derselbe Kerl, dem sie den Parkplatz weggeschnappt hatte, beugte sich über sie und zupfte an ihrem Rocksaum.
»Schön, dass Sie wieder da sind«, sagte er, als plauderten sie Cocktails schlürfend bei T.G.I. Friday’s. »Ich hab mir schon Sorgen gemacht.«
Er zupfte erneut, und sie versuchte, nach ihm zu schlagen, doch ihre Arme waren bleischwer.
»Aua!« Er tat, als wollte er ihr ausweichen. »Immer mit der Ruhe. Ich bin auf Ihrer Seite.«
Sie überlegte sich ein halbes Dutzend Antworten, die sie ihm entgegenschleudern konnte, brachte jedoch keine einzige über die Lippen. Was war nur los mit ihr? Normalerweise war sie um kluge Antworten nicht verlegen. »Nehmen Sie Ihre Hände weg«, stieß sie hervor. Mehr bringst du nicht zustande? Ist ja erbärmlich.
»Sie wollen doch nicht, dass ganz Princeton diese rote Spitze zu sehen bekommt, nicht wahr?«
O Gott… der Tanga … lass mich einfach liegen, damit ich vor Scham vergehen kann …
»Was ist denn passiert? Sind Sie gestolpert? Eben sind Sie noch auf die Promenade zugegangen, und im nächsten Augenblick …« Er machte eine Geste, ließ rasch die Hand sinken.
Sah er nicht, dass sie am liebsten unter einen Wagen gerollt wäre, um sich dort zu verkriechen? Warum versuchte er, Konversation zu machen?
Es war keine komplizierte Frage, aber es wollte ihr einfach nichts darauf einfallen.
»Passiert Ihnen das öfter?«
»Nie.« Sie räusperte sich. »Absolut nie.«
»Ich werde Ihnen noch mal den Puls messen.«
Noch mal?
»Als ich ihre Carotisarterie kontrolliert habe, lag er bei über hundert. Das ist nicht gerade toll.«
Nicht jeder Grateful-Dead-Fan konnte die Vokabel »Carotisarterie« mit solcher Leichtigkeit in seine Rede einflechten. War es möglich, dass er tatsächlich wusste, was er da tat?
»Nein, danke.« Aber gegen eine extrastarke Ibuprofen-Tablette hätte sie nichts gehabt. Ihre Schulter. Ihr Rücken. Ihre Hand. Sogar die Zähne taten ihr weh vom Sturz. Ihre linke Kieferseite pochte richtiggehend.
»Ich bin Sanitäter.« Er zog einige Karten aus seiner Tasche, und sie tat, als mustere sie sie, tatsächlich aber verschwamm ihr der Text vor den Augen. »Fünfzehn Jahre Erfahrung. In New Hampshire und New Jersey.«
»Das ist wirklich nicht nötig«, sagte sie. Oder wollte es wenigstens sagen. Sie hatte Mühe, dem Gespräch zu folgen, und noch mehr Mühe, ihre Gedanke und Worte zu synchronisieren.
»Tun Sie mir einen Gefallen, und legen Sie sich hin. Sie sehen aus, als würden Sie gleich wieder in Ohnmacht fallen.«
Sie wollte protestieren, doch plötzlich klang der Vorschlag, sich mitten auf dem Parkplatz der Princeton Promenade flach auf dem Boden auszustrecken, wie die beste Idee, von der sie je gehört hatte. Er breitete eine Zeitung aus und legte sie unter ihrem Kopf auf den Boden, doch die Geruchskombination aus Ingwer, Motorenöl und ausgelutschtem Kaugummi drang durch und brachte sie zum Würgen.
Er legte ihr zwei Finger auf den Puls an der Innenseite des Handgelenks und kontrollierte die zweite Hand mit Hilfe seiner Armbanduhr. »Hundertzwanzig. Ist Ihnen schlecht?«
Sie nickte. Schon im Wagen war dir übel. Vielleicht solltest du ihm das sagen.
»Leiden Sie unter irgendwelchen Beschwerden, die das hier verursacht haben könnten?«
Sie war kerngesund. Warum sah er das denn nicht selbst?
»Nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein?«
»Vitamine.«
»Haben Sie Schmerzen?« Der Mann war unerbittlich.
»Nein ‒ Schmerzen nicht direkt.«
»Unbehagen?«
O Gott. Sogar durch die sie umgebenden Nebelschwaden konnte sie sehen, wohin das führte. »Ja.« Gib’s zu, French: Du sitzt ganz schön in der Patsche.
»Wo?«
»Im Rücken.«
»Ein durchdringender Schmerz?«
»Nicht durchdringend … Druck.« Drei Worte, und sie war völlig fertig. Was ging denn bloß mit ihr vor?
»Okay. Ich will Sie nicht beunruhigen, aber wir müssen 9-1-1 anrufen.« Er zog ein Handy aus seiner Gesäßtasche und tippte die Zahlen ein.
Das Band um ihre Brust wurde enger, und der Schweiß brach ihr aus.
»Ja, ich bleibe bei ihr … danke.« Er schob das Handy zurück in die Hosentasche. »Wahrscheinlich haben Sie recht. Ich glaube auch nicht, dass es was zu besagen hat, aber Sie werden sich sehr viel besser fühlen, wenn Sie das aus dem Mund eines Arztes hören als von einem Typen mit einem Dead-T-Shirt.«
Sie hätte gern über seinen Witz gelacht, brachte jedoch nur ein flüchtiges Lächeln zustande. Sie schwitzte. Wie war das nur möglich? Sie wollte sagen: »Das sieht mir überhaupt nicht ähnlich«, doch es erforderte mehr Energie, als sie aufbringen konnte. Er wischte ihr mit dem Handrücken über die Stirn, und sie hätte fast geheult über die Freundlichkeit seiner Geste. »Herzinfarkt?«, flüsterte sie.
»Ja«, sagte er. »Das könnte durchaus sein.«
»Lügen Sie mich an«, presste sie hervor. »Es ist mir egal.« Sie versuchte, sich zum Lachen zu zwingen, doch das eiserne Band um ihren Brustkorb ließ es nicht zu.
Er hielt sich nicht zurück, doch wegen des tiefen Mitgefühls in seinem Blick fühlte sie sich sicher.
»Es kann eine Verdauungsstörung sein, eine Panikattacke, ein gezerrter Muskel. Aber wenn es das Herz ist, sollten wir lieber heute als morgen Hilfe holen.«
»Sind Sie sicher, dass Sie kein …«
Sie wollte »Arzt« sagen, aber der Schmerz explodierte und riss alles mit sich fort. Ein tiefer, vernichtender Schmerz aus der Mitte ihres Körpers, der sie ihrer Identität, ihrer Erinnerungen, ihrer Zukunft beraubte, ihr alles nahm und nur alles durchdringenden Schrecken zurückließ.
»O Gott…« Sagte sie es oder dachte sie es nur? Sie wusste es nicht. Ihr war, als ob sie wie ein Heliumballon an einem sehr dünnen Faden über dem Parkplatz schwebe.
Er beugte sich über sie. Sie spürte seinen warmen Atem an ihrer Wange. »Was ist? Möchten Sie beten? Ist es das, was Sie mir sagen wollen?«
Nein … nein … sorgen Sie dafür, dass es aufhört…
»Bleiben Sie bei mir.« Seine Stimme flog auf dem lauten Windstoß in ihrem Kopf zu ihr hin. »Ich lasse Sie nicht gehen.«
Nicht gehen lassen … lass mich nicht gehen … ich habe Angst… das passiert wirklich alles … o Gott… Gwynnie … Ich muss Gwynnie sehen … muss ihr sagen, dass ich sie liebe … ich weiß nicht mal Ihren Namen, und Sie sind derjenige, der es meiner Tochter sagen muss …
»Der Krankenwagen ist unterwegs … Sie kommen wieder in Ordnung … Sie müssen nur noch ein bisschen durchhalten … ich bleibe bei Ihnen …«
Ich schaffe es nicht mehr … ich will, aber ich kann nicht … lass mich nicht gehen … lass mich nicht gehen …
»Reden Sie mit mir … los … sehen Sie mich an … öffnen Sie die Augen und schauen Sie mich an … nehmen Sie meine Hand und halten Sie sich fest … ich lasse Sie nicht los.«
Irgendwo in einem anderen Universum nahm er ihre Hand und hielt sie fest, doch es war zu spät. Seine Worte waren die letzten, die sie hörte.
Kapitel 2
Er merkte es, als es geschah. Ihr Lebensfunke erlosch. Der Krankenwagen war immer noch gute sechs bis sieben Minuten von ihnen entfernt. Aber sie hatte keine sechs Minuten mehr. Die Gelegenheit zu ihrer Rettung, das dafür verfügbare Zeitfenster, schrumpfte mit jeder Sekunde.
»Kommen Sie!«, drängte er. »Gehen Sie jetzt nicht!«
Sie atmete nicht mehr. Der rasche Puls war verschwunden.
»Was ist los?« Eine Frau mit zwei Kindern blieb stehen.
»Was ist?« Ein Mann lehnte sich aus seinem offenen Wagenfenster.
»Er sagt, sie hat das Bewusstsein verloren«, rief die Frau.
»Weiß er denn, was er tut?«
Die Frau mit den Kindern trat näher heran. »Kennen Sie sich auch aus?«, fragte sie.
»Herz-Lungen-Wiederbelebung«, sagte er, als er den Atemweg frei machte. »Ich bin ausgebildet.«
»Ist ihr schlecht?«, ertönte eine andere Stimme von hinten. »Soll ich jemanden anrufen?«
Er machte den Atemweg der rothaarigen Frau frei und versuchte, alles auszublenden, was ihn von seiner Aufgabe ablenkte.
»Was macht er denn da?«, fragte ein Mann. »Ist die Polizei verständigt?«
»Sie hat einen Herzinfarkt. Der Krankenwagen ist unterwegs.«
»Wer sind Sie?«, fragte wieder die erste Stimme. »Wissen Sie, was Sie da tun?«
Alle redeten gleichzeitig, und ihre Stimmen vermischten sich mit dem Wind und dem Vogelgezwitscher und dem leisen Brummen der Autos, die über Route 1 glitten, während die rothaarige Frau immer weiter von ihnen fortdriftete.
Konzentriere dich, ermahnte er sich.
In der Ferne hörte er eine Sirene.
Blende alles aus und konzentriere dich.
Er betastete ihre Halsschlagader und suchte einen Puls. Keinerlei Anzeichen für eine Atmung.
Ein plötzlicher Zorn ließ ihm die Brust schwellen. Ihre Zeit war noch nicht um, das spürte er instinktiv. Nichts geschah ohne Grund. Gott hatte ihn in diesem Moment an diesen Ort geführt, und an ihm war es nun, die Sache zu übernehmen.
Er füllte seine Lungen, kippte ihren Kopf nach hinten, kniff ihre Nase zusammen, blies dann langsam Luft in ihren offenen Mund und sah zu, wie die Brust sich langsam hob.
Er wartete eine Sekunde, füllte wieder die Lungen und wiederholte das Ganze.
Immer noch nichts.
Die Sirene klang nun schon näher.
Er legte seine Hände auf ihre Brust und drückte hart und fest nach unten.
Einszweidreivierfünfsechssiebenachtneunzehn …
»Sie tun ihr weh!« Eine schrille Stimme durchschnitt seine Konzentration.
»Er weiß, was er tut.« Eine andere Stimme, ebenfalls aus der Nähe.
Nichts. Immer noch kein Puls. Keine Atmung.
Er kippte ihren Kopf nach hinten, drückte ihre Nase zusammen und versuchte, Leben in ihren reglosen Körper zu atmen, einmal und noch einmal.
Wieder legte er die Hände auf ihre Brust. Ihre Knochen fühlten sich zart und zerbrechlich an. Sie würde blaue Flecken davontragen. Er brachte seine Hände in Stellung und drückte wieder rasch nach unten und wieder und wieder. »Komm schon … nun komm schon … ich lass dich nicht gehen … hilf mir … atme … du schaffst es … du musst nur atmen!«
Die Kommentare um ihn herum rissen nicht ab.
»So macht man das nicht.«
»Doch, genau so.«
»Er hat doch keine Ahnung!«
»Sie hat sich bewegt! Ich hab gesehen, wie sich ihr Arm bewegt hat!«
… elfzwölfdreizehnvierzehn … fünfzehnsechzehnsiebzehn …
Das Geräusch war hart und kratzend, das schönste Geräusch, das er je gehört hatte. Sie atmete wieder selbstständig. Ihr Puls war schwach, aber es war ein Puls, und er schickte ein dankbares Stoßgebet gen Himmel. Ihre Lippen bewegten sich, aber er konnte nicht hören, was sie sagte. Es spielte auch keine Rolle. Sie weilte noch unter den Lebenden.
»Alles wird wieder gut«, sagte er, als der Krankenwagen einige Meter vor ihnen knirschend anhielt. »Jetzt ist Hilfe da.«
Ihre Blicke begegneten sich. Er wollte weitersprechen, merkte jedoch, dass es auf seine Worte gar nicht ankam. Sie blickte direkt durch ihn hindurch, sah ihm mitten ins Herz. Er nahm ihre Hand, und sie hielt sie fest, und einen Moment lang war nichts anderes auf der Welt von Bedeutung.
»Was haben wir denn hier?«, fragte eine hochgewachsene Rettungssanitäterin. Auf ihrer Brusttasche war der Name Emily eingestickt.
»Möglicherweise Herzinfarkt«, erwiderte Mark. »Sie hatte einen Atemstillstand, aber ich habe sie wiederbelebt.«
»Sehr gut. Wie lange war sie weg?«
»Zehn Sekunden. Nicht länger.«
Emily beugte sich über die rothaarige Frau. »Ich bin Emily, und das da drüben ist Bill. Wir sind da, um Ihnen zu helfen. Haben Sie Schmerzen?«
Ihre haselnussbraunen Augen schlossen sich zuckend und öffneten sich wieder.
»Ich nehme das als ein Ja. Können Sie mir Ihren Namen sagen?«
Sie versuchte es, doch es gelang ihr nicht. Ihr Griff um Marks Hand wurde fester. Ihr Atem ging schnell und flach, und er spürte, dass sie ihm wieder entglitt. Ihre Hände waren lang und schlank. Die Nägel waren in einem blassrosefarbigen Elfenbeinton lackiert. Als einzigen Schmuck trug sie eine runde Männerarmbanduhr an einem schwarzen Lederband. Emily griff nach der kleinen Schultertasche, die die rothaarige Frau umgehängt hatte, öffnete sie und schaute hinein.
»Gut. Sie hat eine Brieftasche dabei. Dann kann die Verwaltung die Identität überprüfen.«
Emily schob die Menge der Schaulustigen zurück. Bill zog eine Trage aus dem Krankenwagen und rollte sie herbei. Rasch hoben die beiden Sanitäter die rothaarige Frau darauf und eilten mit ihr zum Krankenwagen zurück.
»Sie können nicht mitkommen«, sagte Emily zu ihm. Sie war eine auch körperlich beeindruckende Erscheinung. Und er hatte keinen Zweifel, dass sie, wenn nötig, auch Gewalt anwenden würde.
»Ich lasse sie nicht allein.« Kam nicht in Frage, so wie sich die Frau an ihm festklammerte. Wie sie ihn mit ihren haselnussbraunen Augen fixierte, als sei er alles, was zwischen ihr und dem großen Unbekannten stand.
»Ich habe versprochen, bei ihr zu bleiben«, sagte er.
»Sind Sie mit ihr verwandt?«
Er schüttelte den Kopf.
»Es tut mir leid. Sie können uns ja folgen, wenn Sie wollen.«
»Ich bleibe bei ihr«, sagte er, zog dann seinen eigenen Ausweis aus der Tasche und hielt ihn ihr unter die Nase. Er würde sein Versprechen nicht brechen.
Emily warf einen Blick darauf und zuckte die Schultern.
»Ich denke, wir können schon mal eine Ausnahme machen«, meinte Bill über Emilys Schulter.
Es wurde eng im Krankenwagen. Bill kletterte wieder hinter das Steuer, und Mark versuchte, Emily nicht zu behindern, während sie Elektroden auf Brust und Beinen der rothaarigen Frau befestigte. Sie würden ein Zwölf-Elektroden-EKG anbringen, das alle Informationen über Handy direkt in die Notaufnahme übertrug, sodass sie sie zur geeignetsten Einrichtung bringen konnten.
»Scheiße.« Emily kontrollierte ihre Bildschirme.
Die Angst ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. »Was ist los?«
»Ich kriege keine gescheite Verbindung zustande. Wir müssen sie direkt nach St. Francis bringen, damit die die Sache klären.« Sie schüttelte angewidert den Kopf und griff nach dem an der Seitenwand befestigten Hörer. »Die Verbindung ist zusammengebrochen … Wir bringen sie jetzt rein … weiblich … fünfundreißig … atmet selbstständig … Puls hundertzweiundzwanzig … Atmung achtundsiebzig … Blutdruck achtundneunzig zu zweiundfünfzig … hat, bevor sie das Bewusstsein verlor, über Brust- und Rückenschmerzen und Übelkeit geklagt … Ein Passant führte nach Atemstillstand Wiederbelebungsmaßnahmen durch … Wir sind seit vier Minuten im Einsatz … das reicht.«
Dünner Schweiß bedeckte das Gesicht der rothaarigen Frau. Ihre schönen haselnussbraunen Augen waren weit aufgerissen vor Angst und Schmerz.
Emily öffnete eine Packung und drückte eine Pille heraus. »Kauen Sie die. Sie schob der Frau die weiße Tablette zwischen die Lippen. Das ist Aspirin. Es wird die weitere Behandlung nicht behindern.«
Die Rothaarige blickte zu ihm auf, und er nickte. Als sie zu kauen begann, fühlte er sich geradezu lächerlich glücklich. Ob sie wohl begriff, was da vor sich ging, oder ob sie das alles mehr oder weniger mechanisch tat? Es war lange her, dass er einem Menschen so wichtig gewesen war. Nicht einmal sich selber.
»Wir sind fast da«, sagte er zu ihr, den Mund an ihr Ohr gepresst. »Sie machen ein EKG, kontrollieren Ihre Blutgase … Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen … es kommt alles wieder in Ordnung.«
Das war hier nicht der Platz für Wahrheiten. Er wusste nicht, ob sie wieder gesund würde. Sie waren hier in der wirklichen Welt, einem Ort, wo Menschen, die viel Besseres verdient hatten, Unaussprechliches erlebten. Man musste sich an etwas Größerem als am eigenen Ego festhalten können, einem Glauben an irgendetwas, das dem Chaos einen Sinn gab.
Und wenn er ihr das vermitteln konnte, war er schon glücklich.