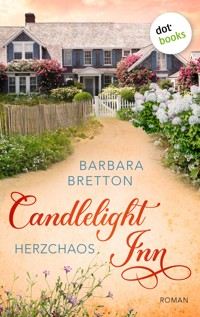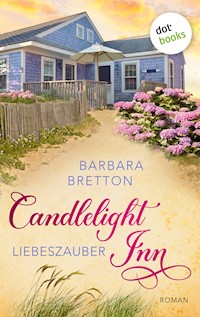
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Candlelight Inn
- Sprache: Deutsch
Das Licht auf den Wellen: Der Cosy-Romance-Roman »Candlelight Inn – Liebeszauber« von Barbara Bretton jetzt als eBook bei dotbooks. So hatte sich Großstadtpflanze Maddy die Rückkehr in das Küstenstädtchen Paradise Point eigentlich nicht vorgestellt: alleinerziehend – und ohne Mann und Job! Doch bevor Maddy sich versieht, hat das trubelige Kleinstadtchaos sie voll wieder … Ihre Familie spannt sie im heimischen Bed & Breakfast »Candlelight Inn« ein – und dann ist da noch dieser geheimnisvolle Unbekannte. Zuerst liefert sich Maddy mit ihm im Internet einen Bieterwettstreit zu einer antiken Lampe – und dann schreibt er ihr plötzlich so verflixt romantische Mails, als könnte er ihr direkt ins Herz schauen. Aber wo könnte sich dieser Traumprinz in Paradise Point bloß verstecken? Schließlich gibt es da doch nur Männer wie Aidan O'Malley, den ebenso dreisten und viel zu gutaussenden Besitzer des Irish Pubs, der Maddy regelmäßig auf die Palme bringt ... »Keine schreibt wie Barbara Bretton über große Gefühle.« Bestsellerautorin Susan Elizabeth Phillips Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Wohlfühlroman »Candlelight Inn – Liebeszauber« von Bestseller-Autorin Barbara Bretton – für alle, die amerikanische Kleinstadtromanzen wie »Virgin River« und die »Redwood«-Reihe von Kelly Moran lieben. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
So hatte sich Großstadtpflanze Maddy die Rückkehr in das Küstenstädtchen Paradise Point eigentlich nicht vorgestellt: alleinerziehend – und ohne Mann und Job! Doch bevor Maddy sich versieht, hat das trubelige Kleinstadtchaos sie voll wieder … Ihre Familie spannt sie im heimischen Bed & Breakfast »Candlelight Inn« ein – und dann ist da noch dieser geheimnisvolle Unbekannte. Zuerst liefert sich Maddy mit ihm im Internet einen Bieterwettstreit zu einer antiken Lampe – und dann schreibt er ihr plötzlich so verflixt romantische Mails, als könnte er ihr direkt ins Herz schauen. Aber wo könnte sich dieser Traumprinz in Paradise Point bloß verstecken? Schließlich gibt es da doch nur Männer wie Aidan O’Malley, den ebenso dreisten und viel zu gutaussenden Besitzer des Irish Pubs, der Maddy regelmäßig auf die Palme bringt ...
»Keine schreibt wie Barbara Bretton über große Gefühle.« Bestsellerautorin Susan Elizabeth Phillips
Über die Autorin:
Barbara Bretton wurde 1950 in New York City geboren. 1982 veröffentlichte sie ihren ersten Roman, dem bis heute 40 weitere folgten, die regelmäßig die Bestsellerlisten eroberten. Ihre Bücher wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Sie lebt mit ihrer Familie in Princeton, New Jersey.
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Bretton auch den zweiten Band ihrer »Candlelight Inn«-Reihe: »Candlelight Inn – Herzchaos«. Außerdem erscheint bei dotbooks ihre »Shelter Rock Cove«-Reihe mit den Romanen »Ein Traum für jeden Tag« und »Ein Sommer am Meer«.
***
eBook-Neuausgabe August 2021
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2003 unter dem Originaltitel »Shore Lights« bei Berkley Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2008 unter dem Titel »Licht auf den Wellen« bei Weltbild.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2003 by Barbara Bretton
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2008 Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / EQRoy / David Barren / Sorbis / MM_photos / IndustryAndTravel
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96655-622-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Candlelight Inn 1« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Bretton
Candlelight InnLiebeszauber
Roman
Aus dem Amerikanischen von Ingeborg Dorsch
dotbooks.
Kapitel 1
Seattle, Washington – Spätsommer
Es war einmal, da lebte in der Emerald City eine Frau namens Maddy Bainbridge, die glaubte, sie könnte zurück nach Hause zu ihrer Mutter ziehen, ohne Gefahr zu laufen, den Verstand zu verlieren.
Mittlerweile war Maddy alt genug, um zu wissen, dass alles, was einen mit siebzehn verrückt gemacht hatte, einen mit zweiunddreißig nur noch verrückter machen würde, doch der Vorschlag ihrer Mutter kam zu einer Zeit, als sie dem nichts entgegenzusetzen hatte und ihr eigentlich keine andere Wahl blieb.
»Ich brauche Hilfe, und du brauchst dringend einen Job«, erklärte Rose in jenem schicksalhaften Telefongespräch, das ihrer beider Leben verändern sollte. »Ich muss schon Gäste an andere Häuser verweisen und würde doch viel lieber den Gewinn mit meiner Tochter teilen als mit einem völlig Fremden.«
»Ich finde die Idee wirklich sehr nett, Mutter, aber das hier ist nur eine vorübergehende Durststrecke.« Eine zwar schon acht Monate dauernde Durststrecke, doch Maddy hatte nicht vor, sich darüber genauer auszulassen. »Ich bin fest davon überzeugt, dass die Sache mit der Synchronisation demnächst ins Rollen kommt.«
»Du bist Buchhalterin, Madelyn. Mit einem Hochschulabschluss. Du kannst mehr, als deine Stimme für Werbespots für Gebrauchtwagen auszuleihen.«
»Ich war Buchhalterin«, erinnerte sie ihre Mutter. »Der Bedarf an Erbsenzählern ist gering, wenn es nicht genug Erbsen zu zählen gibt.« Der große Einbruch im Internetgeschäft vor einigen Jahren hatte das Land mit den gescheiterten Existenzen ihrer Buchhalterkollegen von Washington bis hinunter nach Baja übersät.
»Wie dem auch sei, du hast ein Kind zu versorgen und keinen Ehemann, der dir unter die Arme greifen kann. Du brauchst eine Möglichkeit, wieder auf die Beine zu kommen, und ich brauche jemanden Vertrauenswürdigen, der mir im Geschäft hilft. Nenn mir nur einen guten Grund, wieso das nicht die optimale Lösung für uns beide ist, und ich werde nie wieder ein Wort darüber verlieren.«
Hörst du zu, lieber Gott? Nur einen guten Grund ...
An jedem anderen Tag hätte Maddy ihr zwanzig Gründe aufzählen können, doch an jenem Abend fiel ihr nicht ein einziger ein.
»Hannah hat seit Kurzem einen jungen Hund«, sagte sie schließlich, da sie die ablehnende Haltung ihrer Mutter allem Haarigen und Vierbeinigen gegenüber kannte. Die Hälfte ihrer Kindheit hatte sie sich gewünscht, Rose in einen Irish Setter verwandeln zu können. »Sie heißt Priscilla und ist nicht so ganz pflegeleicht.«
»Was für eine Art Hund?«
Oh, wie froh wäre sie gewesen, hätte es sich um etwas Großes, Sabberndes gehandelt.
Eine Dogge! Einen Bernhardiner! Einen Irischen Wolfshund mit Überbiss!
»Einen Pudel«, murmelte sie, in der Hoffnung, es klinge an Rose’ Ende wie Bulldogge.
»Hast du Pudel gesagt?«
»Ja«, erwiderte Maddy. »Einen Pudel.«
»Einen wie großen Pudel?« Rose klang belustigt.
Maddy blickte hinunter auf das winzige, lockige Fellbündel, das auf ihrem Schoß schlief. Die Wahrheit war manchmal zu ärgerlich. »Kann man jetzt noch nicht sagen«, erklärte sie, »doch sie hat riesige Pfoten.« Für ein Stofftier. Es bestand immer noch die Chance, Priscilla würde satte fünf Pfund erreichen, wenn sie sie gehörig füttern würde.
»Macht nichts«, erwiderte Rose seelenruhig. »Hauptsache, sie pinkelt nicht in die Aufenthaltsräume.«
War das ihre »Vogel friss oder stirb« Mutter, die da sprach, die Frau, die in drei Staaten als unumstrittene Sauberkeitskönigin verehrt wurde? Rose war dafür bekannt gewesen, ihr Bett nach einem viertelstündigen Nickerchen frisch zu beziehen. »Okay«, sagte Maddy, »jetzt ist es mir klar. Meine wirkliche Mutter wird in einem Kabuff im Keller hinter der Waschmaschine und dem Trockner gefangen gehalten.«
Rose’ Antwort war ein überraschend langer Moment des Schweigens. Keine bissige Retourkutsche. Keine vernichtende mütterliche Bemerkung. Nur gerade so viel Stille, um ihr einziges Kind zu nerven.
Maddy hätte ihr gerne mit gleicher Münze herausgegeben, doch Rose hatte ihr dreißig Jahre voraus, und sie war sich sicher, ihre Mutter könnte dieses Schweigen bis Weihnachten durchhalten, wenn sie es sich in den Kopf setzte. »Das war ein Scherz, Mutter. Du hättest lachen und es nicht ernst nehmen sollen.«
Rose räusperte sich. »Ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, was dich da oben in Seattle noch hält, jetzt nachdem Tom ... weggezogen ist.«
»Er ist nicht nur weggezogen. Du kannst es ruhig aussprechen. Ich verspreche, ich gehe daran nicht zu Grunde. Tom hat eine andere geheiratet. Ich bin darüber hinweg.« Bei dieser Lüge hätte ihre Nase eigentlich auf eine Größe anwachsen müssen, die der der Männer von Mount Rushmore ebenbürtig gewesen wäre.
»Du vielleicht schon«, erwiderte Rose, »aber Hannah bestimmt nicht. An sie solltest du denken.«
Schlagartig überkam Maddy das schlechte Gewissen. Das war nicht der Kidnapper, der sich als ihre Mutter ausgab, das war ihre Mutter.
»Gerade wegen Hannah bleibe ich ja in Seattle. Hier ist ihr Zuhause.« Sie schwieg und wartete auf eine Antwort. Rose jedoch blieb stumm. Nie zuvor hatte sich Rose so geschickt ausgeschwiegen. »Außerdem beginnt Hannahs Vorschule in ein paar Wochen.«
»Hier in New Jersey gibt es auch Schulen.«
»Alle ihre Freunde sind hier.«
»Sie ist vier Jahre alt, Madelyn. Sie wird neue finden.«
»Seattle ist unser Zuhause.«
»Zuhause ist da, wo deine Familie ist. Was Hannah jetzt um sich braucht, sind Menschen, die sie lieben.« Menschen, die sie nicht alleinlassen. Rose sprach diese Worte zwar nicht aus, doch das war auch gar nicht nötig. Sie hatte bereits die schweren Geschütze aufgefahren und sie direkt auf Maddys Herz gerichtet.
Oh Gott, Mutter, du hast ja recht. Natürlich hast du recht. In dem Punkt kann ich dir nicht widersprechen. Erging es dir damals auch so, als Daddy zurück nach Oregon ging? Bist du damals auch jede Nacht wach gelegen, hast die Decke angestarrt und dir um mich die gleichen Sorgen gemacht wie ich mir um Hannah? Es ist schon so lange her, dass ich sie lachen hörte. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange schon. Ich gehe zwar nicht mehr in die Kirche, aber vielleicht sollte ich, denn ich fürchte, es bedarf eines Wunders, Hannah wieder glücklich zu machen.
Doch nichts von alledem kam über ihre Lippen. Zu viele Jahre der Entfremdung, der Meinungsverschiedenheiten, mal größere, mal kleinere, lagen zwischen ihnen. Der Geist des einsamen kleinen Mädchens von damals war plötzlich wieder da und ließ sich nicht beiseiteschieben. Nur, jetzt trug das kleine Mädchen die Züge von Hannah.
Und wie betete Hannah ihren Vater an! Im Mittelpunkt ihrer Welt hatte ihr sonntäglicher Brunch gestanden, die Ausflüge zur Space Needle und zu den Spielen der Mariners, die Spaziergänge am Meer, wo er ihr beibrachte, wie man Krebse aß. Der Verlust dieser wöchentlichen Unternehmungen hatte ihr glückliches Kind in ein kleines Mädchen mit traurigen Augen verwandelt, das Maddy kaum noch wiedererkannte. Wie erklärte man dem Kind, das man mehr als sein Leben liebte, dass nicht jeder Mann dazu geeignet ist, rund um die Uhr Vater zu sein?
»So war das nicht geplant«, hatte Tom Lawlor erklärt, als Maddy ihm eröffnete, sie sei schwanger. Auch sie hatte es so nicht geplant, doch es kam vor, dass das Leben einer Frau ein Wunder bescherte und sich darauf verließ, dass diese damit zurecht kam. Toms Kinder hatten bereits eigene Kinder, und er hatte den Ausstieg aus der Firma, die ihm gehörte, herbeigesehnt und ein Leben, das nichts mit Töpfchengehen und Zahnfee zu tun hatte.
Nicht einmal in Maddy war der Kinderwunsch bereits gereift. Kinder lagen für sie noch in nebliger Ferne, waren eine Vorstellung, mit der man sich später irgendwann beschäftigen würde. Sie war davon überzeugt gewesen, dass Tom sich eines Tages für den Gedanken an ein weiteres Kind erwärmen könnte, doch bis dahin war sie mit dem Leben, das sie beide führten, recht zufrieden. Sie nahm die Antibabypille äußerst gewissenhaft jeden Morgen mit ihrem Orangensaft ein und vertraute auf Gott, Vaterland und die moderne Pharmazie.
Eine schwere Grippeerkrankung – und eine vergessene Pille – hatte sie eines Besseren belehrt.
Die unbeschwerte, sorglose Beziehung, die sie und Tom vor ihrer Schwangerschaft miteinander gehabt hatten, gehörte schon bald der Vergangenheit an. Er mochte sie noch immer, und sie wusste, dass er Hannah liebte, doch manchmal schien es Maddy, als liebte er ihre Tochter eher so, wie man einen Golden Retriever liebt. Ein Teil seines Herzens verweigerte sich, und auch das Wunder ihres kleinen Mädchens hatte daran nichts ändern können.
Warum sagte einem keiner die Wahrheit, wenn man dieses schreiende, glitschige, kostbare Neugeborene ausgehändigt bekam? Alle gratulierten und wünschten ihr alles Gute. Es gab Gutscheine für Wegwerfwindeln und Feuchttücher, doch über das Wichtigste verlor niemand auch nur ein Wort. Wieso sagte einem keiner, dass Füttern und Windelnwechseln noch der einfachste Teil waren; ein Baby schrie, wenn es Hunger hatte, und quengelte, wenn es nass war. Auch die noch so unerfahrene Mutter fand dies problemlos heraus. Wenn ihr doch nur irgendjemand, irgendwann verraten könnte, wie man einem kleinen Mädchen mit gebrochenem Herzen helfen konnte.
»Versprich mir, dass du über den Vorschlag nachdenkst«, bat Rose sie eindringlich, als sie sich verabschiedeten.
»Ich werde darüber nachdenken«, versprach Maddy und tat dann ihr Möglichstes, das Ganze aus ihrem Gedächtnis zu streichen.
Doch es geschah etwas Seltsames. Je mehr Mühe sich Maddy gab, nicht an Rose zu denken, desto öfter kreisten ihre Gedanken um ihre Mutter. Zweimal innerhalb der nächsten paar Tage ertappte sie sich, wie sie nach dem Telefon griff und gerade noch mitten im Wählen auflegen konnte. Was in aller Welt sollte sie ihr sagen? Sie und Rose waren schließlich keine Freundinnen. Sie hatten nicht den gleichen Geschmack bei Büchern oder Filmen. Ihre Auffassungen über Kindererziehung hätten nicht unterschiedlicher sein können. Rose war Realistin und glaubte nur, was sie sehen, hören und anfassen konnte. Maddy glaubte zwar auch an diese Dinge, war aber davon überzeugt, dass es mehr gab, als mit dem bloßen Auge erkennbar war.
Als Maddy das erste Mal einen unsichtbaren Freund mit nach Hause brachte, schleppte Rose die ganze Familie zur Gruppentherapie, um zu ergründen, wo sie etwas falsch gemacht hatten.
Als Hannah zum ersten Mal mit ihrem unsichtbaren Freund ankam, legte Maddy ein weiteres Gedeck auf.
Und dieses seltsame Sehnen nach ihrer Mutter hielt sich hartnäckig. Rose galt der letzte Gedanke, wenn sie einschlief, und der erste am Morgen auch. Es war so viel Zeit vergangen, seit sie zuletzt unter einem Dach gelebt hatten. So vieles hatte sich geändert. Vielleicht war die Idee, zurück nach Hause zu ziehen, gar nicht so verrückt, wie sie klang.
»Von Seattle nach Jersey ziehen?«, lautete die E-Mail ihrer Cousine Denise, als sie von Rose’ Angebot hörte. »Bist du übergeschnappt?« Welche Frau, die noch alle Tassen im Schrank hatte, würde das Leben in der Emerald City für eine einfache Fahrkarte zurück in den Garden State eintauschen, fragte sie. Verrückt sei noch das Harmloseste, was ihr zu dieser Idee einfalle.
»MACH DAS BLOSS NICHT!« Die Warnung ihrer Cousine Gina sprang ihr vom Computerbildschirm geradezu ins Gesicht. »Du bist die Einzige von uns, die es über den Delaware nach Westen geschafft hat. Ruinier jetzt nicht alles!«
Die älteren Familienmitglieder hielten mit ihrer Meinung auch nicht hinter dem Berg.
»Deine Mutter wird überglücklich sein«, mailte Tante Lucy und überließ die Tastatur dann Tante Connie, die hinzufügte: »Ich verstehe sowieso nicht, warum du überhaupt dorthin gezogen bist. Bei uns in New Jersey gibt es auch Kaffee, Madelyn.«
Jeden Morgen fand Maddy eine In-Box voller E-Mails vor mit Überschriften wie »Komm nach Hause, Maddy« und »Mach es ja nicht!!!«, bis sie das Gefühl hatte, ihre eigene Familie fahre eine Spam-Attacke gegen sie.
Wochen vergingen, und sie war einem Entschluss keinen Deut näher als an dem Tag, an dem Rose ihr das Angebot gemacht hatte.
Am Tag bevor Hannah in die Vorschule kam, kramte Maddy in einem großen Koffer voller alter Kleider, den sie in der Abstellkammer ihrer Eigentumswohnung verstaut hatte, und fand dort die wunderschöne Jacke im Aranmuster, die Rose ihr gestrickt hatte, als sie in die Grundschule kam. Die dicke, eierschalenfarbene Wolle hatte weder an Elastizität noch Leuchtkraft eingebüßt und roch nur ganz schwach nach Woolite und Mottenkugeln. Große Hornknöpfe zierten die Vorderseite und passten exakt in die wunderschön gearbeiteten Knopflöcher. Rose war eine Perfektionistin, und das sah man ihren Handarbeiten auch an. Jeder Stich, jeder Saum war sorgfältig ausgeführt und auf Strapazierfähigkeit ausgelegt. Nur die Taschen zeigten deutliche Gebrauchsspuren: Sanfte Beulen von kleinen Fäusten, die tief in sie vergraben worden waren, von Stiften und Schokoriegeln und halb gegessenen Sandwiches mit Erdnussbutter und Gelee.
Diese Jacke war wahrscheinlich das letzte Geschenk von Rose an Maddy, das sie ohne Vorhaltungen bekommen hatte. Sogar die Geschenke für das Baby waren von Warnungen vor der Treulosigkeit der Männer begleitet, vor der Wankelmütigkeit der Liebe. Ihre Ratschläge gipfelten in dem Hinweis, dass Maddy, wenn sie auch nur halbwegs bei Verstand sei, aufhören würde, an das Glück zu glauben und anfing, ihre Betriebsrente aufzupolstern. Alles Dinge, die ihre im neunten Monat schwangere Tochter bestimmt nicht hören wollte.
Und alles hatte sich als schmerzliche Wahrheit entpuppt.
Der September verstrich, und sie wich nach wie vor Rose’ Wunsch nach einer Antwort aus, doch ihr Bedürfnis nach einer engeren Beziehung zu ihrer Mutter als zuvor hielt sich hartnäckig und wurde sogar stärker. Anfang Oktober verfrachtete sie Hannah und Priscilla in den Mustang und fuhr hinunter nach Oregon zum siebzigsten Geburtstag ihres Vaters. Er wusste von Rose’ Angebot und Maddys Unentschlossenheit, und seine Einschätzung der Lage überraschte sie.
»Es ist Zeit, dass du nach Hause zurückgehst«, sagte Bill Bainbridge, während sie Hannah zusahen, die so tat, als machte es ihr Spaß, mit den Kindern seiner Nachbarn zu spielen. »Du brauchst deine Mutter. Ihr beide braucht sie.«
Maddy dachte über seine Behauptung nach. Sollte er recht haben? Sie war eine erwachsene Frau, die alleinstehende Mutter eines kleinen Kindes. Sie brauchte schon lange niemanden mehr. Sie war diejenige, die Hannahs Tränen trocknete, sie war es, die vor der Zimmertür innehielt, um den Geräuschen des geheiligten Schlafes eines Kindes zu lauschen. Rose hatte nichts von alledem für Maddy getan, als sie heranwuchs. Jedenfalls konnte sich Maddy an nichts dergleichen erinnern. Rose war viel zu sehr damit beschäftigt gewesen, teure Grundstücke an Leute zu verkaufen, die mehr Geld als Verstand besaßen, davon überzeugt, dass das, was sie ihrer Tochter vorlebte, Maddy auf den Weg des Erfolgs leiten würde.
Rose war mitnichten auf die renitente Leistungsverweigerin mit dem Dickschädel vorbereitet gewesen, die ihrem Schoß entsprang.
»Es ist ja nicht so, dass ich Rose nicht lieben würde«, erklärte sie ihrem Vater, während sie die Überreste von Kuchen und Eiscreme beseitigten, die in seiner Küche klebten. »Ich glaube nur, es bekommt uns besser, wenn ein Kontinent zwischen uns liegt.«
»Sie sehnt sich nach dir«, sagte Bill und warf ein schmutziges Stück Küchenpapier in den Abfalleimer.
»So, wie ich mich nach ihr gesehnt habe, als ich mit Hannah schwanger war? Sie ist ja nicht einmal zur Geburt erschienen.«
»Hast du sie je nach dem Grund dafür gefragt?«
»Der Grund ist mir egal. Es gibt nichts, womit sie ihr Fernbleiben erklären könnte.«
»Die Menschen benehmen sich manchmal seltsam, Maddy. Manchmal denken sie einfach nicht richtig nach. Das ist halt so.«
»Wieso ergreifst du immer ihre Partei?«
»Ich ergreife nicht ihre Partei. Ich sage nur, vielleicht ist es an der Zeit, ihr eine zweite Chance zu geben.«
»Du hast leicht reden«, brummelte Maddy, als ihr Vater sie etwas ungelenk in den Arm nahm. Sie wollte nur zu gerne das Thema wechseln. »Du warst ja nur mit ihr verheiratet. Ich bin ihre Tochter: Ich hab lebenslänglich.«
Beide lachten, doch Maddy merkte, dass es bei Bill etwas gezwungen klang. Sie hätte sich am liebsten geohrfeigt wegen ihrer gedankenlosen Bemerkung. Es war kein Geheimnis, dass ihr Vater nie so ganz über seine erste Frau hinweggekommen war. Er war zwar eine harmonische zweite Ehe eingegangen, die mit dem Tod seiner geliebten Irma endete, doch es bestand kaum ein Zweifel daran, dass die Liebe seines Lebens der stolze, selbstbewusste Rotschopf aus New Jersey gewesen war, der glaubte, dass es ein »und-sie-lebten-glücklich-bis-an-ihr-Ende« nur im Kino gab.
»Man bekommt in diesem Leben nicht oft eine zweite Chance«, sagte Bill, als er sie zum Abschied küsste. »Geh zurück nach Hause, Maddy. Versuch es Hannah zuliebe, wenn schon nicht deinetwegen. Du wirst es nicht bereuen.«
»Hannah und ich könnten ja zu dir ziehen«, erwiderte sie, nur zur Hälfte im Scherz. »Ich bin eine recht gute Köchin, und Hannah ist sehr unterhaltsam.«
Er lächelte und schüttelte den Kopf. »Du weißt doch, dass sich dein alter Herr nächste Woche auf die Landstraße begibt. Ich habe Irma versprochen, die Reise, die wir geplant hatten, zu machen, und ich beabsichtige, mein Versprechen zu halten.« Von Oregon nach Florida und zurück, mit jeder Menge Stopps unterwegs. Irma war gerade dabei gewesen, die letzten Einzelheiten der Reiseroute auszuarbeiten, als sie den langen Kampf mit dem Brustkrebs verlor.
Maddys Augen füllten sich bei dem Gedanken an ihre Stiefmutter mit Tränen. »Ist es etwas leichter geworden?«
»Nein.« Er wandte den Blick ab, in Richtung ihres an der Straße geparkten Mustangs. »Hab ich auch nicht erwartet.« »Du kommst aber vorbei und besuchst uns in Seattle auf deiner Reise, ja?«
Er grinste und zupfte sie an einer Haarsträhne. »Nicht, wenn ihr in New Jersey seid.«
»Das glaubst du doch selbst nicht.«
»Sechs Monate«, sagte er, als er sie zum Abschied umarmte. »Gib deiner Mutter sechs Monate. Was hast du zu verlieren?«
»Meinen Verstand«, erwiderte Maddy, und beide lachten, doch nun war die Wahrheit ausgesprochen, und sie konnte sie nicht mehr zurücknehmen. Sie wollte diese zweite Chance, um ihre Beziehung in Ordnung zu bringen, denn auch die selbstständigste Frau ist im Grunde ihres Herzens nur eine Tochter.
Kapitel 2
Paradise Point, New Jersey – drei Wochen vor Weihnachten
Rosemary DiFalco hatte im August 1992 den Männern abgeschworen, und das war, soweit sie es beurteilen konnte, der Moment, in dem ihr Glücksstern aufging. Ihr ganzes Leben lang hatte Rose auf den Glücksstreifen am Horizont gewartet, und als er endlich auftauchte, packte sie ihn mit beiden Händen und ließ ihn nicht mehr los.
Es gab nichts auf dieser Welt zu gewinnen, wenn man schüchtern war, und schon gar nicht, wenn man darauf wartete, dass ein Mann es einem auf einem silbernen Tablett überreichte.
Solange sie denken konnte, hatte ihre Mutter Fay in ihrem baufälligen viktorianischen Haus Zimmer vermietet, ihren Lebensraum mit pensionierten Lehrern, mittellosen Künstlern und einer Ansammlung vom Pech Verfolgter geteilt, deren einziger Berührungspunkt die gemeinsame Benutzung des Badezimmers im ersten Stock war. Als Fay vor knapp fünf Jahren starb, hinterließ sie das Haus ihren vier Töchtern, von denen drei absolut nichts damit zu tun haben wollten. Rose jedoch witterte hinter dem bröckelnden Gips und den verblichenen Teppichen ungeahnte Möglichkeiten, zahlte ihre Schwestern aus und machte sich an die schwierige Aufgabe, sich ein neues Leben zu zimmern. Es war genau der richtige Zeitpunkt.
Sie ging in Frührente und verkaufte ihre elegante Eigentumswohnung am Eden Lake. Dann ließ sie sich ihre Betriebsrente ausbezahlen und steckte den gesamten Erlös in das Haus, in dem sie aufgewachsen war, eine viktorianische Bruchbude, die sich zufälligerweise damit brüsten konnte, von nahezu jedem Schlafzimmer einen Blick aufs Meer bieten zu können.
Das Candlelight Inn war geboren, und mit Rose ging es stetig aufwärts. Sie stellte mit Vergnügen fest, dass ihr das ständige Kommen und Gehen der Gäste Spaß machte, und nahm gerne die Herausforderung an, den Wehwehchen und Eigenheiten eines Bauwerks des neunzehnten Jahrhunderts immer einen Schritt voraus zu sein. Und am allermeisten freute sie die Tatsache, dass der Erfolg des Candlelight es ihr ermöglichte, ihrer Tochter einen Weg aus dem Schlamassel, in dem sie steckte, anzubieten.
Von welcher Perspektive man es auch immer betrachtete, das musste doch ein Glückstreffer sein. Rose brauchte Hilfe, um das Inn zu führen; Maddy brauchte einen Job. Ein perfektes Beispiel für Angebot und Nachfrage.
Warum also erwachte Rose jeden Morgen mit dem Gefühl, sich auf einen Kampf vorzubereiten? Sie hatte eine Oase der Ruhe und des Friedens für ihre zahlenden Gäste geschaffen, einen Ort, den sie aufsuchten, wenn sie die Belastungen der wirklichen Welt hinter sich lassen wollten. Man sollte meinen, dass sich wenigstens ein kleines bisschen dieser Ruhe auf die Familie der Wirtin übertragen würde. Heute Morgen zum Beispiel. Maddy hatte sich im Büro verschanzt und arbeitete schon seit Stunden an der Webseite des Inns. Rose hatte sie nicht mehr zu Gesicht bekommen, seit sie schweigend gemeinsam das Frühstücksbuffet aufgebaut hatten. Es hatte gestern spätabends einen Wortwechsel gegeben, über irgendeine Nebensächlichkeit, an die sich Rose nicht einmal mehr erinnern konnte. Hinterher jedoch fragte sie sich zum ersten Mal, ob sie nicht doch einen großen Fehler gemacht hatte, als sie Maddy und Hannah einlud, nach Hause zurückzukommen.
Es war nur allzu offensichtlich, dass sie nicht glücklich waren. Ihre Tochter war kratzbürstig und streitsüchtig und glich eher dem siebzehnjährigen Mädchen von einst als der erwachsenen Frau, die sie dem Foto auf ihrem Führerschein nach war. Und Hannah – oh, Hannah, die brach einem das Herz. Das entzückende kleine Mädchen, das Rose mit seinen Liedern und Geschichten letzte Weihnachten in Seattle so nett unterhalten hatte, war nun ein verschlossenes und furchtbar trauriges Kind, dessen Lächeln es meist nicht ganz bis in ihre ausdrucksvollen blauen Augen schaffte.
Rose war sich bewusst, dass die Trennung von Tom und Maddy nichts mit ihr zu tun hatte, doch ihre über Jahrzehnte angehäuften Schuldgefühle waren schwer abzuschütteln. Sie hatte Maddy nicht auf das wirkliche Leben von Männern und Frauen vorbereitet. Sie hatte sie gelehrt, mit dem Scheckbuch umzugehen, den günstigsten Kredit für ein Auto auszuhandeln und kleinere Reparaturen im Haushalt auszuführen, doch die hohe Kunst, mit einem Mann zusammenzuleben, hatte sie ihr nicht beigebracht.
Der Punkt war, sie hatte davon selbst nicht die leiseste Ahnung. Rose war in einer Welt von Frauen aufgewachsen, mit einem Vater, der durch Abwesenheit glänzte, drei Schwestern und jeder Menge Tanten und Nichten, und alle miteinander hatten darin, einen Mann zu behalten, genauso viel Glück wie an den Spielautomaten in Atlantic City.
Manche Frauen hatten Glück in der Liebe. Manche hatten Glück im Spiel. Ein Blick auf die nackten Ringfinger und auf die florierenden Unternehmen der vier DiFalco-Schwestern, und man wusste, woher der Wind wehte. Lucy, die Älteste, behauptete, eine DiFalco könne nicht einmal einen Mann an ihrer Seite halten, wenn er mit Sekundenkleber angeklebt wäre. Im Lauf der Jahre hatte Rose erkannt, wie zutreffend diese Feststellung war.
Sogar zu ihren glücklichsten Zeiten war die Liebe für Rose ein unergründliches Rätsel geblieben. Sie hatte einen wundervollen Mann geheiratet, das Salz der Erde, und es war ihr dennoch nicht gelungen, diese Liebe auf Dauer festzuhalten. Er legte ihr die Welt zu Füßen, und sie hätte lieber die Sterne gehabt. Sie hatte eine schöne Tochter, intelligent, begabt und liebevoll, doch irgendwie war auch das nicht genug für Rose. Sie wünschte sich für Maddy alles, was sie selbst nie hatte, und alles, was sie nie sein konnte, und als sich herausstellte, dass Maddy das Gen für Ehrgeiz fehlte, war ihre Enttäuschung grenzenlos.
Maddy war eine Träumerin, genau wie ihr Vater. Sie folgte der Stimme ihres Herzens, wo auch immer die sie hinführte, und wäre gar nicht auf den Gedanken gekommen, Brotkrumen hinter sich zu streuen, um wieder nach Hause zu finden. Maddys ungeplante Schwangerschaft versetzte Rose in eine Mischung aus Euphorie und Besorgnis. Sie hatte Tom Lawlor nicht allzu gut gekannt, doch sie wusste, dass er sich als Vater schon seine Sporen verdient hatte und an einer Wiederholung nicht interessiert war. Er war schließlich in ihrem Alter, und sie verstand ihn, auch wenn sie es nicht guthieß.
Aber nicht so Maddy. Nicht ihre tagträumende, unvernünftige Optimistin von einer Tochter. Sie hatte es nicht wahrhaben wollen, nicht einmal dann, als er es ihr in meterhohen Neonlettern vorbuchstabierte. Sie hatte noch immer daran geglaubt, dass alles ein gutes Ende nehmen würde. Bis zu dem Moment, als Tom und Lisa nach Vegas flogen zu einer dieser Blitzhochzeiten in einer Kapelle auf dem Strip.
Zu gerne hätte sie Maddy und Hannah in die Arme genommen und ihre Tränen weggeküsst, ihre gebrochenen Herzen gekittet, bis sie so gut wie neu waren.
Eben all das, wozu sie keine Zeit hatte, als Maddy ein kleines Mädchen war.
Stattdessen stand sie nun da, eine erfolgreiche zweiundsechzigjährige Geschäftsfrau, Besitzerin der gefragtesten Pension zwischen Rehoboth Beach und Martha’s Vineyard, und versuchte, den Mut aufzubringen, an die Tür ihres eigenen Büros zu klopfen, um sich bei ihrer Tochter zu erkundigen, wie es mit der Website voranging. Rose hatte sich zu den härtesten Bankern in deren Bau gewagt, hatte desinteressierte örtliche Radiosender herumgekriegt, kostenlos für sie Werbung zu machen, hatte aus Stroh Gold gesponnen. Fünf stressfreie Minuten mit ihrem einzigen Kind zu verbringen, sollte dann doch eine ihrer leichtesten Übungen sein.
Na gut, Maddy und sie waren gestern Abend aneinandergeraten. Es war ja nicht das erste Mal und würde, weiß Gott, nicht das letzte Mal sein. Sie waren Mutter und Tochter und dazu verdammt, einander auf die Nerven zu gehen. Daran war nun mal nichts zu ändern, doch sie konnte etwas daran verbessern. Sie wusste, dass sie das konnte.
Wenn sie sich bloß dazu überwinden könnte, an diese Tür zu klopfen.
»Oh nein!« Maddy drückte dreimal auf die Rücksetztaste und tippte die Zahl erneut ein. Nur jetzt keinen Fehler machen, jetzt, da die letzten Minuten der Versteigerung anbrachen und sie darum kämpfte, einen höheren Bieterstatus zu erlangen als dieser erstaunlich hartnäckige Konkurrent namens FireGuy. Wer hätte gedacht, dass ein verbeulter Teekessel für so viel Tamtam sorgen würde, doch sie hatte ihr Höchstgebot in der letzten Stunde schon zweimal erhöhen müssen, um mithalten zu können.
Auf dem Bildschirm war nichts mehr zu sehen. Das Laufwerk grummelte, und dann ächzte es. Sie hielt den Atem an, bis sich das neue Bild aufbaute und ihr letztes Gebot erschien.
»Okay«, sagte sie und grinste ihrem Spiegelbild zu. »Das sieht schon besser aus.« Jetzt musste sie nur noch die Tatsache ignorieren, dass ihre Mutter in der Diele herumschlich wie ein mieser Spanner, und sich darauf konzentrieren, dass dieser alte Samowar an Weihnachten für Hannah unter dem Christbaum stand.
Priscilla kratzte an der Tür. Sie sah mit ihren hellen braunen Augen zu Maddy auf und fiepte dieses hohe Pudelfiepen, das noch in der übernächsten Stadt die Limonadengläser zum Zerspringen bringen konnte.
»Ja, ich weiß schon, dass sie seit zehn Minuten da draußen steht, Priscilla, und nein, ich weiß nicht warum.«
Wie aufs Stichwort ging die Tür auf.
»Sehr witzig«, bemerkte Rose mit feuerroten Wangen. »Ich habe den Tisch in der Halle poliert, nur zu deiner Information.«
»Ich habe ihn gestern poliert«, erklärte Maddy und hielt ihre Augen auf den Bildschirm geheftet.
»Wir putzen hier jeden Tag«, erwiderte ihre Mutter. Der sonst oft harte Ton fehlte diesmal ihren Worten. »Die zahlenden Gäste erwarten das.«
Maddy zwang sich, entspannter zu reagieren. »Ich muss noch eine Menge dazulernen als Wirtin. Gestern Nacht bin ich oben im Gang mit den Loewensteins zusammengestoßen, das hat mich fast fünf Jahre meines Lebens gekostet.«
»Du gewöhnst du dich schon noch daran.« Rose zögerte, kam dann aber doch ins Zimmer. Sie roch nach Pledge und Chanel Nr.5, eine Kombination, die für sie absolut ideal war. »Ich will dich nicht bei der Arbeit an der Website stören.«
Maddy griff nach der Maus, um auf eine andere, sicherere Seite zu klicken, doch sie war nicht schnell genug. Ihre Mutter beugte sich über ihre Schulter und betrachtete das Bild und die dazugehörigen Informationen.
»Für Hannah?«, wollte Rose wissen.
Maddy nickte und wünschte sich dabei, sie hätte schnellere Finger oder eine weniger neugierige Mutter. Beides zu wollen, hieße, die Götter herauszufordern. »Du weißt doch, wie sehr sie sich für Aladin interessiert. Sofort als ich das sah, dachte ich mir, es würde die ideale Wunderlampe abgeben.«
»Ich dachte, du bist mit den Weihnachtseinkäufen für Hannah bereits fertig.«
»Dachte ich auch, doch dann kam sie nach Hause und sprudelte nur so über wegen einer Wunderlampe, die sie in einem Malbuch in der Schule gesehen hatte und – tja, es ist Weihnachten, und sie ist mein einziges Kind.« Sie sah zu ihrer Mutter auf. »Du kennst das doch.« Ist es dir denn nicht genauso gegangen, als ich klein war? Hättest du denn nicht auch am liebsten die Sterne eingesammelt und sie in meinen Weihnachtsstrumpf gepackt?
»Du verziehst das Kind.«
»Sie hat es verdient, ein bisschen verzogen zu werden. Das Jahr war für sie nicht leicht.«
»Daran wird der Teekessel auch nichts ändern.«
Maddy hielt die Maus so fest gepackt, dass sie sich fast wunderte, wieso die nicht vor Angst aufschrie. »Ich denke, ich weiß, was für mein Kind am besten ist.« Wie konnte eine Frau von einsfünfundsechzig ihre erwachsene Tochter durch ihre bloße Anwesenheit auf die emotionale Stufe eines beleidigten Teenagers reduzieren?
»Ich dachte, sie hätte die Sache mit Aladin vergessen.«
»Ich weiß nicht, wie du auf diese Idee kommst.«
»Sie ist zu alt für diese Art von Mumpitz.«
»Du hättest wahrscheinlich sogar Stephen King geraten, auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren.«
»Was soll das nun wieder heißen?«
Halt doch den Mund, Maddy. Sei wenigstens einmal im Leben ruhig.
Sie vertiefte sich noch mehr in den Bildschirm vor sich und hoffte, Rose würde den Wink verstehen. Da kämpfte sie drei Stunden lang mit der Textverarbeitung für die neue Website des Gasthauses, und nirgends war die Chefin zu sehen, doch in dem Moment, in dem sie zu Shoreline Auktionen umschaltete, erschien sie wie herbeigezaubert und schaute ihr über die Schulter.
Es war hoffnungslos. Hannah, die alles liebte, was mit Aladin zu tun hatte, brauchte eine Wunderlampe, und Maddy war fest entschlossen, wenigstens einen ihrer Wünsche wahr werden zu lassen. Der Samowar hatte zwar schon bessere Tage gesehen, doch wenn er erst mal repariert und auf Hochglanz poliert war, würde er ihrem kleinen Mädchen eine riesige Freude machen, und das war das Wichtigste. Da die Auktion in fünf Minuten enden würde, hatte sie nicht vor, ihren Status als Meistbietende jetzt noch zu verlieren.
»Du weckst unrealistische Erwartungen in ihr, Maddy. Je eher Hannah begreifen lernt, dass sie nicht alles haben kann, was sie will, desto besser für sie.«
Rose zu ignorieren, war das Gleiche, wie einen Tsunami zu ignorieren, wenn man hundert Meter vom Ufer entfernt in einem Ruderboot saß.
»Es ist doch nur ein Teekessel, Ma, und kein Porsche.«
Rose gab eine Mischung aus Schnauben und Seufzen von sich. »Dieses Kind braucht einen Teekessel genauso dringend, wie ich mehr Zimmer zum Sauberhalten brauche.«
Der genervte Augenaufschlag bei bestimmten Äußerungen ihrer Mutter war schon ein Reflex. Die Zahlen auf dem Bildschirm änderten sich. Maddy stöhnte und tippte schnell ihr neues Höchstgebot ein. »Das hast du davon, wenn du dich mit JerseyGirl anlegst.«
Rose zog rasch die Brille aus der Tasche ihrer hellblauen Jacke. »Sag mir, dass das nicht der Preis ist.«
»Das ist nicht der Preis.« Dummerweise war das nicht einmal gelogen. Der endgültige Preis würde noch höher sein. Sie aktualisierte die Seite und sah zu, wie die Zahlen sich wieder veränderten. »Du bist ja ein ganz hartnäckiger, FireGuy, aber gewinnen wirst du nicht.« Sie tippte ein neues Gebot ein und drückte die Enter-Taste.
»FireGuy?«
»Das ist sein Pseudonym.«
»Stimmt was nicht mit seinem richtigen Namen? Hat er etwas zu verbergen?«
»Ich bin mir sicher, sein ganzes Leben ist ein offenes Buch, Mutter, aber jeder, der ins Internet geht, verwendet ein Pseudonym. So macht man das eben.«
Rose musterte sie über den Rand ihrer Brille. »Hast du auch einen?«
»Natürlich habe ich einen.«
»Hoffentlich keinen anstößigen.«
Wenn Rose in dieser Stimmung war, hätte sie sogar den Namen Jane Fonda für anstößig erklärt.
»Ich verstehe das ganze Getue mit Online-Auktionen nicht«, fuhr ihre Mutter fort. »Du könntest auch einfach rüber zum Spielwarengeschäft fahren und eine dieser hübschen Teekannen aus der Barbieserie kaufen, die nur halb so viel kosten.«
»Das kannst du gerne machen, Mutter, wann immer du willst. Ich bin absolut zufrieden mit Shoreline Auctions.«
»Kein Mensch sollte so viel für einen verbeulten Teekessel ausgeben.« Rose’ Seufzer konnte Töchter mittleren Alters durch den ganzen Garden State jagen. »Manchmal mache ich mir wirklich Sorgen um das Kind.«
»Weil sie Fantasie besitzt?«
»Du hast ihr den Kopf mit Märchen vollgestopft. Was hat sie davon? Sie sollte sich mit ihren Schulfreunden zum Spielen treffen und nicht von verzauberten Teekannen und fliegenden Teppichen träumen.«
Und da gab es Leute, die sich wunderten, wieso sie mit siebzehn von Zuhause weggegangen war. Maddy biss sich so fest auf die Zunge, dass sie beinahe blutete.
»Hast du auch nur ein Wort von dem gehört, was ich gesagt habe?«
»Jeden einzelnen Buchstaben.« Maddy wandte den Kopf vom Bildschirm ab. »Mutter, wenn du Schuld daran bist, dass ich diesen Teekessel an irgend so einen Primitivling verliere, der ihn benützen wird, um seine Köder zum Angeln darin aufzubewahren, dann sehe ich mich gezwungen, allen Leuten in Paradise Point zu erzählen, dass dein echt rotes Haar so ungefähr seit 1981 nicht mehr echt rot ist.« Rose öffnete den Mund, um zu protestieren, doch Maddy hob die Hand. »Mir bleiben nur noch weniger als vier Minuten in dieser Auktion. Du kannst mit deiner Predigt fortfahren, nachdem ich mir die Kanne gesichert habe.«
Das hätte sie nicht sagen sollen. Schlagartig war sich Maddy dessen bewusst. Wenn sie einen Weg zu einem friedlichen Zusammenleben suchte, war es vielleicht an der Zeit, anzuhalten und in die richtige Richtung zu gehen.
»Mom, es tut mir leid. Würdest du bitte nur ...«
Doch es war zu spät. Rose drehte sich auf dem Absatz um und stolzierte aus dem Zimmer, und Maddy war sich sicher, dass der Rest des Clans über ihren neusten Verstoß informiert sein würde, noch ehe es Zeit war, den Radicchio für den abendlichen Salat zu waschen.
Sie wusste, dass sie Rose nachlaufen und sich entschuldigen sollte. Sie umarmen und irgendeinen albernen Scherz machen sollte, um die Spannung, die sich zwischen ihnen aufgebaut hatte, zu mildern. Doch die Zeit lief ihr bei der Auktion davon, und wenn sie den Schreibtisch auch nur für eine Sekunde verließ, würde sie den Kessel verlieren und somit auch die einzige Möglichkeit, Hannah wieder zum Lächeln zu bringen.
Sie hatte fünfzehn Jahre gewartet, um ihr Verhältnis zu ihrer Mutter ins Reine zu bringen. Da kam es auf fünfzehn Minuten nun auch nicht mehr an.
Kapitel 3
O’Malley’s Bar & Grill – am anderen Ende der Stadt
SIE SIND VON JERSEYGIRL ÜBERBOTEN WORDEN.UM EIN NEUES GEBOT ABZUGEBEN, HIER KLICKEN.
Aidan Michael O’Malley schlug mit der Faust auf die auf Hochglanz polierte Bar, sodass die Maus über den Rand schlitterte. Er erwischte das Ding gerade noch, bevor es runterfiel, und stellte es eilends wieder auf den kleinen Stapel Servietten, der als Mauspad diente. Noch neunzig Sekunden bis zum Ende der Auktion. Wenn er nicht sofort ein neues Gebot abgab, würde er leer ausgehen und sich den Zorn seiner Tochter zuziehen.
»Du musst einfach gewinnen«, hatte Kelly ihm heute Morgen aufgetragen, als sie sich die hellrote Daunenjacke über die schmalen Schultern zog. »Er sieht genauso aus wie der auf dem Bild von ihr und Urgroßvater Michael im alten Restaurant.«
Er kannte das Foto genau.
Es war die letzte Aufnahme, die von Irene und Michael O’Malley gemacht worden war, bevor am Ostersonntag 1952 der Hurrikan über die Bucht fegte und alles, was sich ihm in den Weg stellte, mit sich riss. Den Pier. Die Boote, die an ihren Leinen schaukelten. Das Restaurant, das sie aus dem Nichts aufgebaut hatten.
Und Michael O’Malley auch.
»Was meinst du?«, fragte Kelly. »Vielleicht beschert er ihr ja an Weihnachten ein paar glückliche Erinnerungen.«
Er brachte es nicht übers Herz, sie daran zu erinnern, dass es schon sehr lange her war, seit sich Großmutter Irene für verbeulte Teekessel interessierte. Ganz zu schweigen für die Familie. Feiertage dienten für sie nur noch dem Zweck, die Jahre verrinnen zu sehen.
Diese Einstellung verstand er nur allzu gut.
»Bist du sicher, dass sie so was mag? Sieht für mich aus wie rostiges altes Gerümpel.«
Kelly seufzte hörbar. »Also, Daddy, wirklich. Es ist genau das Richtige. Du wirst schon sehen. Du brauchst dich nur auf der Seite der Auktion einzuloggen und dafür sorgen, dass dich keiner überbietet.«
»Brr«, machte er. »Da wollen wir uns doch gewisse Grenzen setzen.«
Kelly bedachte ihn mit dem Ich-kann-nicht-glauben-dass-du-tatsächlich-mein-Vater-bist-Blick, den sie in den vergangenen siebzehn Jahren perfektioniert hatte. »Er sollte nicht mehr als fünfundsiebzig Dollar kosten«, bemerkte sie beiläufig. »Aber du kannst bis auf einhundert hochgehen.«
Er machte große Augen. »Du kannst hundert Dollar ausgeben?«
»Ich besitze viel mehr als hundert Dollar«, erwiderte sie und griff nach ihren Büchern auf der Anrichte. »Es ist das Geld, das ich für das College gespart habe.«
Andere Kinder baten um Geld, liehen es sich oder stahlen es ihren Eltern. Sein Kind konnte mit dem, was sie vom Babysitten, Kellnern im Sommer in der Muschelbar und Nachhilfestundengeben zurückgelegt hatte, eine Bank aufmachen.
Manchmal fragte er sich, wie er in einem Leben, das ihm mehr als ein gerüttelt Maß an Unglück beschert hatte, zu diesem absoluten Goldstück gekommen war.
Und dann wieder dankte er Gott nur einfach dafür. Das musste reichen.
»Sei vorsichtig«, sagte er, als sie ihre Autoschlüssel vom Schlüsselbrett neben der Tür nahm. »Es ist glatt draußen. Vielleicht sollte ich dich zur Schule fahren.«
Ihr Gesichtsausdruck spiegelte blankes Entsetzen wieder.
»Okay«, sagte er lachend. »Ich ziehe das Angebot zurück. Mach einfach langsam und denk dran, die Bremsen gehen auf alle Räder.«
»Du machst dir zu viele Gedanken.« Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihn auf die Wange zu küssen. Im nächsten Moment war sie weg, nur ein Hauch von Ahornsirup und Kräutershampoo hing noch in der Luft.
Du wärst stolz auf sie. Sie ist genauso, wie du in diesem Alter warst. Genau so, wie wir sie uns gewünscht hatten.
Eigentlich hatte er schon vor Jahren die Gewohnheit, mit seiner verstorbenen Frau zu sprechen, abgelegt, doch seit kurzem wünschte er, Sandy könnte für eine Stunde – oder auch nur fünfzehn Minuten – zurückkommen, wenigstens lang genug, um zu sehen, zu welchem wunderbaren Menschen sich ihr kleines Baby entwickelt hatte. Kelly war gescheit, hübsch und liebenswert. Sie war beliebt in der Schule; sowohl ihre Mitschüler als auch die Lehrkräfte mochten sie sehr.
Es war für sie nicht leicht gewesen, ohne Mutter aufzuwachsen, doch das würde niemand merken, so wie sie mit einem Lächeln für jeden durchs Leben ging.
»Du hast das großartig gemeistert mit ihr«, hatte Claire, seine Schwägerin, neulich gesagt, als er ihr von dem Stipendium erzählte. Er hätte sich das ja gerne zur Ehre gereichen lassen, doch ihm war klar, dass er mit dem Erfolg seiner Tochter genauso viel zu tun gehabt hatte wie mit der letzten Präsidentschaftswahl. Kelly war ein Naturtalent. Er hatte ihr lediglich den richtigen Weg gewiesen und den Rest ihr überlassen.
Inzwischen hatte er allerdings das Gefühl, es die letzten paar Jahre damit übertrieben zu haben. Seit dem Unfall hatte sich alles hauptsächlich um Billys Tod und seine eigene Genesung gedreht, und Kellys Belange waren ins Hintertreffen geraten. Mach dir keine Sorgen um Kelly, sagten sie alle. Diesem Mädchen ist es in die Wiege gelegt, das Richtige zu tun.
Darauf sollte er eigentlich stolz sein, doch manchmal hatte er tatsächlich ein schlechtes Gewissen. Sie war ein so braves Kind, so zuverlässig, dass ihm ab und zu der Gedanke kam, er hätte sich nicht so um sie gekümmert, wie sie es verdient hätte. Sie schien über den Dingen zu stehen, traf immer die richtigen Entscheidungen, übertraf immer alle Erwartungen, wohingegen ihr alter Herr tagtäglich darum kämpfte, mit der Welt zurechtzukommen, und soundso oft als Verlierer dastand. Was zum Teufel hätte er ihr also sagen können, was sie nicht schon von Geburt an wusste?
Er hämmerte ein neues Gebot in die Tasten und knirschte mit den Zähnen, als er sah, dass die Ziffern einer dreistelligen Zahl gefährlich nahe kamen. Was wollte Kelly überhaupt mit diesem alten Trödel? Seine Großmutter würde einen müden Blick darauf werfen, eine abfällige Bemerkung machen und sich wieder in ihre Erinnerungen an eine längst vergangene Zeit versenken. Kellys Euphorie würde sich schnell in Enttäuschung verwandeln, und er würde wieder versuchen müssen, ihr zu erklären, dass das nichts mit ihr zu tun hatte.
Ein siebzehnjähriges, vor Leben sprühendes Mädchen mit einem Herz aus Gold und genug Begeisterungsfähigkeit, die Welt mitzureißen, würde die Ironie des Ganzen nicht begreifen. Sie glaubte, etwas verändern zu können, sein kleines Mädchen.
Sie glaubte, dass gute Menschen viel bewerkstelligen konnten, und wenn er in ihre Augen sah, die aussahen wie die ihrer Mutter, dann glaubte er es fast selbst.
Was spielten schon zwanzig Dollar mehr für eine Rolle? Wenn sie den Teekessel für Irene haben wollte, dann würde er, verdammt noch mal, dafür sorgen, dass sie ihn bekam.
Er tippte die Zahl ein, drückte auf Enter und lehnte sich dann zurück, um abzuwarten, was JerseyGirl darauf antworten würde.
Maddy traute ihren Augen nicht. Eine Minute noch und FireGuy hatte sie um zwanzig Dollar überboten. Für solche Bieter gab es bestimmt einen Namen. Was für ein fieser Kerl lauert bis zur allerletzten Sekunde im Dunkel, um sich dann mit einem überhöhten Gebot in den Kampf zu werfen, in der Absicht, einem den Schatz aus den Händen zu reißen, ehe man noch eine letzte Zahl eintippen konnte.
Sie scrollte eilends nach unten, hämmerte eine völlig irrsinnige Zahl ein, eine die Rose zum Telefon hätte stürzen lassen, um die 911 zu wählen, und schlug auf Enter.
»Sieh zu, wie du damit klarkommst!«, schrie sie in den Bildschirm. Die Zahl war so hoch, dass es sich auch der noch so verwegenste Bieter zweimal überlegen würde. Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und beobachtete finster den Monitor, als wollte sie FireGuy dazu herausfordern, den Einsatz ein letztes Mal zu erhöhen. Sie würde ihm schon zeigen, wie das ging. JerseyGirl lässt sich nicht unterkriegen, nicht solange noch ein Funken Leben in ihren tippenden Fingern ist. FireGuy hatte nicht die leiseste Ahnung, worauf er sich da eingelassen hatte.
Achtzehn Sekunden. Siebzehn. Sechzehn ...
Claire Meehan O’Malley, Aidans Schwägerin und Geschäftspartnerin, beugte sich über seine Schulter und warf einen Blick auf den Bildschirm.
»FireGuy!«, sagte sie und lachte schallend. »Sag bloß nicht, du machst die Chatrooms unsicher, Aidan!«
»Klappe«, entgegnete er und hämmerte wie wild auf das Keyboard ein.
Fünfzehn Sekunden ...vierzehn ...
»Shoreline Singles, stimmt’s?« Claire konnte vor Lachen kaum reden. »›Wo sich die Elite trifft ... die wahre Liebe wartet nur einen Klick weit entfernt.‹«
Er warf ihr einen kurzen Blick zu. »Klingt, als wärst du selbst schon dort gewesen.«
»Meine Lippen sind versiegelt«, antwortete Claire. »Komm schon. Gib’s zu. Einsam zu sein ist kein Verbrechen, Schwager. Ich mach dir keinen Vorwurf, wenn du jemanden online anmachst. Ist sowieso Zeit, dass du wieder mitmischst nach ...« Sie hielt inne. Es war nicht nötig, den Satz zu vollenden.
»Ich bin in keinem Chatroom.«
»Ist ja gut.« Sie trat einen Schritt zurück, die Hände beschwichtigend erhoben. »Du brauchst mir nichts zu sagen. Du weißt, ich werde es früher oder später doch herausfinden. Wir O’Malley Frauen sind unerbittlich.«
»Hör auf, ja?«
»Wenn es kein Chatroom ist, dann muss es eine Auktion sein.« Sie lachte erneut, diesmal lauter. »Eine Auktion! Ausgerechnet derjenige, der Einkaufen für eine besonders grausame Art von Strafe hält. Ich glaub es nicht!«
Zehn Sekunden ... neun ...
Was zum Teufel war mit dem Computer los? Er drückte einmal auf Enter und ein zweites Mal, und nichts geschah. Er gab die Zahlen erneut ein und drückte wieder auf Enter.
»Nicht jetzt«, murmelte er in den Bildschirm hinein. »Komm, mach schon, nur eine Sekunde noch, jaaa!« Der Bildschirm flackerte, und er hielt den Atem an, während sich das Bild wieder aufbaute.
DIESE AUKTION IST BEENDET.
GEWONNEN HAT: JERSEYGIRL (53).
Er stöhnte und sah dann Claire mit traurigen Augen an. »Ich hab verloren.«
»Du siehst aus, als wäre es das Ende der Welt«, stellte Claire fest und begann, zwölf rote Plastikschälchen mit gesalzenen Erdnüssen zu füllen. »Worauf hast du denn geboten? Die geheime Geschichte des Captain Kirk?«
»Sehr witzig.« Er klickte weiter, um sich seine South-Jersey-Lieblingsseite anzusehen. Seine Begeisterung für alles, was mit Star Trek zu tun hatte, bot Anlass für so manches, was die O’Malleys für Spaß hielten. »Es war für Kelly.«
»Ach, Schatz, das tut mit leid.« Sie stibitzte eine Erdnuss aus einem der Schälchen und steckte sie in den Mund. »Für einen Teenager etwas zu kaufen, ist die reinste Hölle. Ein Geschenkgutschein wäre einfacher für dich.«
»Diesmal nicht. Sie hat mich gebeten, den Teekessel für Großmutter Irene zu ersteigern.«
Claires sonst so heiterer Gesichtsausdruck verfinsterte sich. »Ich verstehe nicht, wieso ihr beiden euch die Mühe macht. Diese alte Dame hat noch nie für jemanden aus der Familie etwas getan, außer für sich selbst.«
Die Diskussion war schon alt.
»Sie ist meine Großmutter. Sie hat Billy und mich aufgenommen, nachdem unsere Eltern gestorben waren. Sie ist Kellys einzige Verbindung zu ...«
»Was für ein Haufen Mist. Dieses Miststück besitzt kein Fünkchen Mitgefühl.«
»Woher willst du das wissen?«
»Und ob ich das weiß. Die alte Vogelscheuche hat nicht einmal kondoliert, als Billy starb. Ihr eigener Enkel ...« Ihr versagte die Stimme, und es dauerte einen Augenblick, bis sie sich wieder gefasst hatte. »So etwas vergisst man nicht so leicht, Aidan.«
Er hätte Claire an den Vorfall bei Billys Beerdigung erinnern können, als sie Irene weggeschickt hatte, doch wozu. Ein jeder von ihnen hatte an seinem eigenen Bündel von Schuldgefühlen und Schmerz zu tragen.
»Sie ist eine alte Frau. Sie hat genug mitgemacht.«
»Wir etwa nicht? Es geht nur um sie. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Kelly bemüht sich seit dem Tag, an dem sie geboren wurde, die Liebe dieser Gewitterhexe zu erringen – wie kommst du darauf, dass es ihr nun gelingen wird?«
Er schob seinen Stuhl zurück und stand auf. »Ich glaube ja auch nicht, dass es funktioniert. Ich halte es sogar für absolut unwahrscheinlich, dass Irene sich ändern wird. Nicht deinen Kindern zuliebe und auch nicht meinen.«
»Hör zu, ich ...«
»Ich werde mich nicht immer wieder mit dir um den gleichen alten Kram streiten, Rotschopf.« Er streckte die Hand aus und zerzauste ihre silbergesprenkelte kastanienrote Lockenmähne, doch sie wich ihm aus.
»Ich meine es ernst, Aidan. Vergeude nicht deine Zeit mit dem alten Drachen. Du bist ihr nichts schuldig. Keiner von uns ist das.«
Ihr Schmerz und ihr Zorn erfüllten den Raum und schoben alles andere beiseite.
Claire war in einer großen glücklichen Familie aufgewachsen, in der man mit seinen Gefühlen nicht hinter dem Berg hielt. Auch wenn es ganz dick kam – und das geschah nicht selten –, war die Liebe für sie eine Konstante, eine verlässliche Größe, auf der alles andere aufbaute. Irenes Gleichgültigkeit ihren Enkeln und Urenkeln gegenüber überstieg Claires Begriffsvermögen.
Aidan hatte schon vor langer Zeit seinen Traum von einer großen Familienvereinigung, wo sich am Schluss alle umarmten und im Chor »Home sweet home« sangen, begraben. Irene hatte zwar Aidan und Billy ihr Haus geöffnet, nachdem ihre Eltern gestorben waren, doch es war ihr nicht gelungen, ihnen ihr Herz zu öffnen. Er hatte sich lange Zeit seines Lebens gefragt, warum seine eigene Großmutter ihn nicht liebte, doch er war zu dem Schluss gekommen, dass Irene die Antwort ebenso wie alle anderen Geheimnisse für sich behalten würde.
»Das ist Kellys Angelegenheit«, sagte er schließlich. »Wenn sie Irene zu Weihnachten einen Teekessel schenken möchte, werde ich ihr das nicht ausreden.«
»Und Kel glaubt, ein Teekessel kann dieses Wunder vollbringen?«
»Sie hofft, er ruft glückliche Erinnerungen wach aus der Zeit, als Irene und Mike das Restaurant besaßen.«
Claire seufzte hörbar. »Ich hätte nicht gedacht, dass es bei den O’Malleys solche Optimisten gibt.«
»Ich auch nicht«, erwiderte er und griff nach dem Trockentuch. Niemand konnte behaupten, die O’Malleys hätten das Glück gepachtet.
Kapitel 4
»Ja!« Maddy lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und las zufrieden die Anzeige auf ihrem Bildschirm. »Oh, Hannah, wenn du das siehst!«
GRATULATION, JERSEYGIRL! SIE HABEN DEN POSTEN #5815796 ERSTEIGERT:ECHT ANTIKER RUSSISCHER SAMOWAR.HIER KLICKEN, UM ...
Sie drückte auf Enter, gab ihr Passwort ein, klickte JA, JA und wieder JA, und wartete, während das Bild verschwand und sich dann wieder aufbaute. Der Verkäufer versprach den Versand innerhalb von achtundvierzig Stunden, und mit etwas Glück läge nächste Woche um diese Zeit Hannahs Wunderlampe gut verpackt und versteckt im Schrank.
Sie schloss das Programm, schob ihren Stuhl zurück und rannte dann den hinteren Gang entlang zur Küche, wo ihre Mutter und Tante Lucy Orangen für den Salat der Gäste zerteilten.
»Glückwünsche werden entgegengenommen!«, verkündete sie strahlend und nahm sich ein Stück Orange. »Ich habe gewonnen!«
»Im Lotto?«, fragte Lucy, während sie mit dem Schälmesser geschickt zwischen die dünnen Häutchen einer Orange fuhr. »Und was hast du: einen Dreier, oder Vierer? Den Sechser hätte ich in der Zeitung gesehen.«
»Nicht im Lotto«, erklärte Maddy und küsste die Estée-Lauder-Wange ihrer Tante. »Ich habe einen Samowar gewonnen.«
Lucy wandte sich verwundert ihrer Schwester zu. »Einen was?«
»Einen verrosteten Teekessel«, erwiderte Rose und schüttelte den Kopf. »Stell dir das mal vor.«
Sie küsste sicherheitshalber auch Rose auf die Wange.
Ich gebe mir ja Mühe, Mutter, aber du machst es mir nicht leicht.
»Er ist fast schon eine Antiquität.«
»Es ist nur alter Plunder.«
Sie ignorierte den Spott ihrer Mutter. »FireGuy bemühte sich nach Kräften darum, doch ich war eine Frau, die eine Mission zu erfüllen hatte, und nichts konnte mich aufhalten.«
Rose sah zu ihrer Schwester hinüber. »Du glaubst ja nicht, was sie bei diesen Auktionsseiten für diesen Trödel bekommen.«
»Er ist für Hannah«, erklärte Maddy und hätte dabei gerne etwas weniger nach Entschuldigung geklungen. Auch sie war eine erwachsene Frau und eine Mutter. Sie hatte es nicht nötig, sich bei irgendjemand dafür zu entschuldigen, was sie für ihre Tochter aussuchte, egal wie lächerlich es auch für den Rest ihrer nüchternen, praktisch veranlagten, kühlen Familie klingen mochte. »Sie wollte schon immer eine Wunderlampe, und das hier kommt ihr am allernächsten.«
Tante Lucy runzelte die Stirn. »Ich dachte, du sagtest, es sei ein Teekessel.«
»Es ist ein Teekessel«, erklärte Rose. »Ein einfacher, gewöhnlicher, rostiger, viel zu teurer Teekessel.«
»Ja, aber es ist ein rostiger Teekessel mit magischen Kräften.« Hah, warum nicht? Sie hielten sie doch sowieso für verrückt. Da konnte sie ruhig noch etwas Öl ins Feuer gießen.
»Magische Kräfte?« Tante Lucy bekreuzigte sich. »Das gefällt mir aber gar nicht.«
»Ach, glaub doch nicht alles«, sagte Rose und schlug mit dem nassen Ende eines Geschirrtuches nach ihrer großen Schwester. »Das einzig Magische an dem Topf ist die Art und Weise, wie er Maddys Geld schrumpfen lässt.«
Lucy brach in Lachen aus, und Rose sah aus wie eine zufriedene Katze, die gerade einen besonders schmackhaften Kanarienvogel gefangen hat.
»Es freut mich, dass ihr beide das so spaßig findet.« Maddy starrte ihre Mutter über den Berg von Lebensmitteln auf dem Küchentisch böse an. »Es gibt nichts, was den DiFalco-Mädchen besser gefällt, als auf den Vorstellungen anderer Menschen herumzutrampeln.« Beinahe hätte sie »Träume« gesagt, doch sie fürchtete, sie würden ein Medley aus Songs von Frank Sinatra anstimmen.
»Maddy, also wirklich! Warum nimmst du denn immer alles so ernst? Ich wollte doch nur ...«
Wer hatte eigentlich behauptet, Zeitreisen seien nicht möglich? Fünfzehn Worte aus dem Mund einer Frau mit rot gefärbten Haaren, und Maddy fühlte sich zurückversetzt in die ruhmreichen Tage ihrer Jugend, als schon der Tonfall in Rose’ Stimme genügte, sie Hals über Kopf in die Nacht hinausrennen zu lassen. Den hinteren Gang entlangzulaufen, machte zwar nicht ganz so viel Eindruck, nicht wenn man zweiunddreißig und selbst Mutter war, doch eine zugeknallte Tür konnte auch die noch so dickköpfigste Frau der Welt nicht ignorieren. Ihr Herz schlug so wild, dass sie sich auf die Kante des Schreibtisches setzte und überlegte, ob das Notarztteam von Paradise Point einen Defibrillator besaß.
»Hallo?« Eine sanfte Stimme erklang von der Tür her, die sie gerade beinahe aus den Angeln gerissen hätte.
O Gott. Bloß nicht schon wieder Mrs Loewenstein. Wusste diese Frau denn nicht, dass sie eigentlich mit Mr Loewenstein unterwegs sein sollte, um die wunderbar romantischen Sehenswürdigkeiten des Garden State zu genießen?
»Ist bei Ihnen alles in Ordnung?«
Maddy verschluckte eine Reihe von Wörtern, die man normalerweise im Candlelight nicht zu hören bekam. Wann würde sie endlich lernen, daran zu denken, dass dies nicht mehr das Haus von Großmutter Fay war, sondern Rose’ Beitrag zur Romantik des Kapitalismus?
»Alles in bester Ordnung, Mrs Loewenstein.« Sie öffnete die Tür des Büros einen Spalt weit und lächelte der alten Dame zu. »Tut mir leid, wenn der Lärm Sie erschreckt hat. Ein Luftzug ließ die Tür zuknallen.«
»Luftzug?« Mrs Loewenstein schielte über Maddys Kopf hinweg ins Zimmer. »Die Fenster sind aber geschlossen.«
Sie rang sich ein noch netteres Lächeln ab.
»Ach, Sie wissen doch, wie zugig es in so alten Häusern sein kann.«
»Sie brauchen eine bessere Isolierung«, erklärte Mrs Loewenstein mit einem weisen Nicken. »Ich werde Ihnen die Telefonnummer meines Sohnes Buddy geben. Da sind Sie in den besten Händen.«
Maddy bedankte sich und schloss die Tür. Sie dachte schon daran, sie zuzusperren, doch das war wahrscheinlich nicht mit dem Ehrenkodex der Wirtin zu vereinbaren.
»Das wird nie klappen«, sagte sie laut. »Nicht in einer Million Jahren.«
Rose seufzte, als sie die Tür des Büros ein zweites Mal zuschlagen hörte. »Das hat sie als Teenager auch gemacht. Ich hatte gehofft, sie hätte es sich bis zu ihrem dreißigsten Geburtstag abgewöhnt.«
Lucy wandte sich zu ihrer Schwester um. »Habe ich etwas Falsches gesagt? Das mit dem Sechser hätte ich wahrscheinlich nicht sage sollen.«
»Nein«, beruhigte Rose sie. »Es war meine Schuld.« Sie ging auf eine der Orangen mit dem Hackbeil los. »Alles, was ich im Moment sage, ist falsch.«
»Maddy hatte immer schon einen Hang zum Dramatischen.« Lucy war mit der letzten Orange in ihrer Schüssel fertig und wusch sich die Hände im Doppelspülbecken. »Mich wundert nur, dass sie nicht zum Theater gegangen ist.«
»Ma sagte immer, Maddy sei nur einen Wutanfall davon entfernt, einen Oscar zu gewinnen.« Ganz und gar nicht wie die unerbittlich praktischen, äußerst erdgebundenen DiFalco-Schwestern. Hätte Rose nicht dreiundzwanzig Stunden Wehen durchgestanden, um dieses Kind auf die Welt zu bringen, sie hätte nicht geglaubt, dass dies ihr eigenes Fleisch und Blut sei. Maddy war sprunghaft, gefühlsbetont und impulsiv. Alles, was ihre Mutter nicht war und auch nie sein würde.
All das, was Rose nicht verstand.
»Vielleicht ist es ganz gut, dass ich keine Kinder habe«, sinnierte Lucy, während sie sich die Hände an dem schneeweißen Küchenhandtuch abtrocknete.
»Ich habe keine Ahnung, was ich mit einer Tochter wie Maddy angefangen hätte.«
»Du hättest es nicht schlechter machen können als ich.« Die harte Kante der Anrichte drückte gegen ihren Hüftknochen, während sie eine Orange mit hektischen Schnitten zerlegte. »Ich habe das Gefühl, mich auf Glatteis zu bewegen.«
»Mit anderen Worten, es hat sich nichts geändert.«
Am liebsten hätte sie eine der Orangen mit dem Fleischklopfer malträtiert, doch sie besann sich eines Besseren. Orangenstückchen in der Sauce hollandaise waren im Vier-Sterne-Candlelight untragbar. »Es ist schlimmer denn je, Lucia. Wir geraten alle paar Sekunden aneinander. So als hätte es die letzten fünfzehn Jahre nicht gegeben, und wir stünden wieder am Anfang.«
Lucy spielte mit einem unsichtbaren Schnipsel weißer Haut. »Ist ja richtig gemütlich für Hannah.«
»Das brauchst du mir nicht zu sagen. Ich wollte, dass es funktioniert. Ich wollte, dass ihr gefällt, was ich aus dem Haus gemacht habe, und dass sie sich ins Zeug legt, um das Geschäft mit mir voranzubringen.«
»Sie scheint doch wirklich daran interessiert zu sein.«
Rose stach mit der Spitze ihres Messers in die Orange und schwieg.
»Du willst, dass sie so ist wie du«, stellte Lucy ruhig fest, »und das wird nie der Fall sein, Rosie.«
»Ist das denn etwas so Schreckliches?« Rose drehte sich um und fuchtelte mit dem Messer in der Luft herum. »Ich bin eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Ich bin bei den Leuten beliebt. Ich begegne jeden Tag interessanten Menschen, ohne dazu das Haus zu verlassen, und ich habe genügend Geld auf der Bank, dass ich schon morgen sagen könnte, zum Teufel mit alledem, und mir dennoch keinerlei Sorgen machen müsste.« Sie machte eine effektvolle Pause. »Ist das ein so schreckliches Schicksal, das ich meinem einzigen Kind wünsche?«
»Vielleicht ist es nicht das, was Maddy sich wünscht.«
»Sie weiß gar nicht, was sie sich wünscht. Wenn sie wüsste, was sie will, hätte sie ...« Sie hielt inne, beschämt über das, was sie hatte sagen wollen. Voller Scham darüber, dass sie so etwas Schreckliches gedacht hatte.
Lucy nahm ihr das Fleischmesser aus der Hand und brachte es auf der Anrichte in Sicherheit. »Es ist Maddys Leben, Rosie, nicht deines. Sie wird ihren Weg früher oder später schon finden. Haben wir doch alle.«
»Es lag alles vor ihrer Nase, sie hätte nur zugreifen brauchen«, erwiderte Rose, deren Enttäuschung überkochte wie ein unbeaufsichtigter Suppenkessel. »In ihrem Job ist sie die Karriereleiter emporgeklettert. Sie und Tom hatten eine solide, dauerhafte Beziehung und eine Zukunft vor sich und dann ...«
Lucy seufzte. »Hannah.«