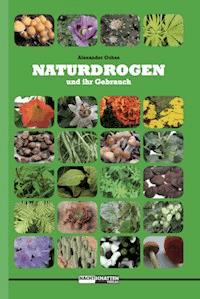
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nachtschatten Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Gebrauch von Naturdrogen ist mittlerweile keine exotische Randerscheinung mehr, sondern im Mainstream vieler, meist junger Konsumenten angekommen. Dieses Buch enthält wissenschaftlich fundierte Informationen über dieses Phänomen, besonders für Menschen, die viel mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tun haben, wie z.B. Pädagogen und Sozialarbeiter. Der Autor verzichtet auf eine unsachlich-verteufelnde Darstellung, die gerade für den Praktiker alles andere als hilfreich wäre. Aber auch jeder andere Leser, der sich für dieses aktuelle Thema interessiert, wird nicht nur von der ausführlichen Beschreibung aller wichtigen Naturdrogen profitieren, sondern findet in den Abschnitten über die Kulturgeschichte und den generellen Gebrauch weitere wichtige und interessante Informationen. Ein sehr ausführliches Quellenverzeichnis rundet dieses Werk ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Verlegt durch:
Nachtschatten Verlag AG
Kronengasse 11
CH - 4502 Solothurn
Tel: 0041 32 621 89 49
Fax: 0041 32 621 89 47
www.nachtschatten.ch
© 2007 Nachtschatten Verlag © 2007 Alexander Ochse
2. korrigierte und leicht ergänzte Auflage 2011
Lektorat: Bert Marco Schuldes, [email protected],
www.schuldes.org/textwerkstatt
Wissenschaftliche Durchsicht: Dr. habil. Jochen Gartz u. Prof. Dr. Ewald Rumpf
Umschlaggestaltung und Satz:gewo.com
Umschlagfotos: Markus Berger, Michael Ganslmeier u. Alexander Ochse
Druck: Druckerei Steinmeier, Deiningen
eISBN 978-3-03788-224-5
Kontakt zum Autor:
www.alexanderochse.de
Alle Rechte der Verbreitung durch Funk, Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, elektronische Medien und auszugsweiser Nachdruck sind vorbehalten.
Hinweis:
Wenn in diesem Buch von Sozialarbeitern, Lehrern usw. die Rede ist, so sind Sozialarbeiterinnen, Lehrerinnen usw. selbstverständlich impliziert. Leider ist mir keine – politisch und ästhetisch – befriedigende Lösung des Anredeproblems bekannt. Deshalb habe ich mich im Text auf eine Geschlechtsform beschränkt. Die einfache und übersichtliche Sprache wurde der fachspezifischen vorgezogen.
Haftungsausschluss:
Dieses Buch soll nicht zum Gebrauch von Naturdrogen auffordern. Ich übernehme keine Haftung für etwaige Schäden, die durch den Konsum von Naturdrogen entstehen können. Diese, auf wissenschaftlicher Basis dokumentierten, Informationen sollen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, da objektive Aufklärung von großer Wichtigkeit ist.
Inhaltsverzeichnis
Titel
Impressum
Danksagung
Vorwort
Vorwort: Dr. habil. Jochen Gartz (Leipzig)
1. Einleitung
1.1 Begriffserklärungen
1.2 Klassifikation von Naturdrogen
2. Die Kulturgeschichte der Naturdrogen
2.1 Die prähistorische Verwendung von Naturdrogen
2.2 Naturdrogen und Religion
2.3 Die „moderne“ Erforschung von Naturdrogen
3. Generelle Anmerkungen zum Gebrauch von Naturdrogen
3.1 Der zeitgemäße Trend zu den Naturdrogen
3.2 Die Wirkungen von Naturdrogen
3.3 Die Gefahren des Gebrauchs von Naturdrogen
3.4 Der Bezug von Naturdrogen
3.5 Naturdrogen und das Internet
4. Die primär psychedelisch wirkenden Naturdrogen (Psychedelika)
4.1 Psychoaktive Pilze
4.2 Psychoaktive Nachtschattengewächse (Solanaceae)
4.3 Psychoaktive Kakteen (Cactaceae)
4.4 DMT-haltige Naturdrogen
4.5 Lysergsäurehaltige Naturdrogen
4.6 Alkoholische Naturdrogenprodukte
4.7 Psychoaktive Salbei-Arten (Salvia spp.)
4.8 Cannabis (Cannabis spp.)
5. Die primär stimulierend wirkenden Naturdrogen (Stimulantia)
5.1 Der Kokastrauch (Erythroxylum coca und Erythroxylum novogranatense)
5.2 Die Meerträubelgewächse (Ephedraceae)
5.3 Purinhaltige Naturdrogen
5.4 In Europa weniger bekannte stimulierend wirkende Naturdrogen
6. Die primär sedierend wirkenden Naturdrogen (Narkotika)
6.1 Das Opium
6.2 Kava-Kava (Piper methysticum)
7. Die weniger bekannten psychoaktiv wirkenden Naturdrogen
8. Präventionsarten und Naturdrogen
8.1 Akzeptanzorientierte Sekundärprävention und Naturdrogen
8.2 Das Konzept der Drogenmündigkeit
9. Zusammenfassung
10. Anhang - Endnoten
Literatur
Abkürzungsverzeichnis
Bildnachweis und Bildlegende
Glossar
Index
Zum Autor
Danksagung
Im Rahmen der Erstellung dieses ursprünglich als Diplomarbeit verfassten Buches bin ich folgenden Personen zu tiefstem Dank verpflichtet:
Jochen Gartz (Leipzig), Bert Marco Schuldes (Tuguegarao City), Markus Berger (Knüllwald), Joachim Eul (Berlin), Ulrich Holbein (Knüllwald), Michael Ganslmeier (Kassel), EwaldRumpf (Knüllwald), Boris Göbel (Kaufungen), RogerLiggenstorfer (Solothurn), Georg Woelfel (Spangenberg) und natürlich meinen lieben Eltern.
Nur durch die großzügige Unterstützung der oben genannten Personen konnte dieses Buch entstehen.
Vorwort
Schon seit vielen Jahren faszinieren mich die Natur und unser menschliches Bewusstsein. Durch ausgiebige Studienreisen lernte ich nicht nur unseren wunderschönen Planeten kennen, sondern auch Techniken, die das menschliche Bewusstsein verändern können. Mir fiel dabei auf, dass psychoaktive Pflanzen oftmals ein Hilfsmittel sind, um das Bewusstsein zu verändern.
Während meines Studiums hatte ich die Möglichkeit, mich mit diesem Themenbereich vertiefend zu beschäftigen. So interessierte mich weitgehend alles, was mit Spiritualität, Natur und unserem Bewusstsein zu tun hat. Natürliche Rauschmittel waren dabei die eindeutige Schnittmenge, da diese uns von der Natur zur Verfügung gestellt und mit Religiosität und Spiritualität in Verbindung gebracht werden. Außerdem können sie nur durch unser hochkomplexes Gehirn auf unser Bewusstsein wirken, denn ohne die spezifischen Rezeptoren in unserem Gehirn würden Naturdrogen keine Wirkungen hervorrufen.
Die Chance, eine Diplomarbeit über Naturdrogen zu schreiben und mich somit auf interdisziplinärer Ebene wissenschaftlich mit der Thematik auseinanderzusetzen, ließ ich mir nicht entgehen. Dass diese Diplomarbeit nun in Form eines Buches einem größeren Leserkreis zugänglich wird, freut mich von ganzem Herzen. Ich kann sogar behaupten, dass bis heute noch kein vergleichbares kompaktes Werk über den Gebrauch von Naturdrogen existiert, welches einen solchen Charakter aufweist und die aktuelle rechtliche sowie epidemiologische Situation wiedergibt. Dieses Buch kann den in der präventiven Arbeit tätigen Personen als Leitfaden dienen, um das tatsächliche Risikopotenzial der zurzeit am häufigsten gebrauchten Naturdrogen besser einschätzen zu können.
Ich hoffe, mit dem vorliegenden Buch diese klaffende Lücke zu schließen und wünsche der Leserschaft viel Erhellung bei der Lektüre dieser Arbeit.
Alexander Ochse Kassel im Sommer 2006
Vorwort: Dr. habil. Jochen Gartz (Leipzig)
Psychoaktive Pflanzen und Pilze üben seit Jahrtausenden eine besondere Faszination auf Menschen in den unterschiedlichsten Kulturkreisen aus. Die beim Verzehr oder bei der Inhalation entsprechender Zubereitungen oder auch schon der unbearbeiteten, frischen Rohprodukte erzielten Wirkungen sind sehr vielseitig und reichen von der Kreislaufstimulation bis hin zu charakteristischen visionären Wahrnehmungen. Durch den spezifischen und unmittelbaren Effekt auf die Psyche werden solche, dem Zeitgeist entsprechend „Naturdrogen“ genannte Präparationen auch schon seit Jahrhunderten kontrovers angesehen und z. T. staatlich verfolgt. Diese Verfolgung resultiert aus religiös-ideologischen Gründen bis hin zu – meist mehr vermuteten – gesundheitlichen Folgen, aber teilweise auch zur Unterdrückung unliebsamer Konkurrenz zur legalen Alkohol-, Tabak- und Pharmaindustrie, deren Produkte recht ähnliche Wirkungen erzeugen können.
Die Faszination der Naturdrogen für den Erforscher dieser Wirkstoffe erklärt sich vor allem aus der notwendigen interdisziplinären Vorgehensweise, die geradezu vorbildlich bei der „Entzauberung“ der so genannten mexikanischen Zauberpilze durch R. G. Wasson, R. Heim und A. Hofmann ab 1953 zur Isolation der Wirkstoffe Psilocybin und Psilocin führte. Bei meiner 25-jährigen botanischen und chemischen Erforschung vieler weiterer solcher Pilzarten rund um die Welt erwies sich dieser methodische Ansatz genauso notwendig und sinnvoll wie es bei diesen klassischen Untersuchungen vorbildlich demonstriert wurde. Es ist das Verdienst des Autors, das Gebiet der Naturdrogen umfassend und unter Berücksichtigung der interdisziplinären Aspekte darzustellen.
Die wichtigsten Pflanzen und Pilze dieses Bereiches werden hinsichtlich der Botanik, der geschichtlichen Aspekte und ihrer heutigen Verwendung vorgestellt. Gleichzeitig wird mit Recht darauf verwiesen, dass oftmals die Sachverhalte um ihre Verwendung und mögliche Gesundheitsfolgen oft einseitig dargestellt werden, so von Autoren, die in Suchtkliniken arbeiten und denen sowohl die Kenntnis der Ethnopharmakologie, der Botanik und des Gebrauchs außerhalb ihrer speziellen Klientel fehlt. Auch scheintin diesen Fällen das Wissen über die historische „Meskalin-Perioden“ nach dem Religionswissenschaftler Karl Kerenyi (1897-1973) völlig zu fehlen. Es ist daher sehr verdienstvoll, dass der Autor sich kritisch mit einzelnen rezenten Darstellungen auseinandersetzt, die dem interdisziplinären Charakter der Betrachtung solcher Pilze und Pflanzen nicht entsprechen. Ich begrüße es daher, dass diese Untersuchung, die ursprünglich als Diplomarbeit („sehr gut”) eingereicht wurde, einem nun größeren Leserkreis in Buchform zugänglich wird.
1. Einleitung
Dieses Buch behandelt das brisante und aktuelle Thema Naturdrogen. Wissenschaftliche Studien belegen, dass in den letzten Jahren ein eindeutiger Trend hin zu den Naturdrogen zu verzeichnen ist. Im Schatten des Ecstasy-Booms hat sich deren Gebrauch bei den hauptsächlich jugendlichen Konsumenten etabliert. In vielen Umfragen ist nicht mehr Ecstasy die am zweithäufigsten konsumierte illegale Substanz (nach Cannabis), sondern die psilocybinhaltigen Pilze, welche eine Naturdroge par excellence darstellen. Deshalb bilden die psilocybinhaltigen Pilze auch einen Schwerpunkt dieses Buches. An ihrem Beispiel lässt sich die Thematik Naturdrogen sehr deutlich exemplarisch darstellen.
Das Bild der Naturdrogen wird hauptsächlich durch Sensationsmedien geprägt. Es vergeht kaum eine Woche im Sommer, in der nicht in reißerischer Art über die „Teufelsdrogen aus der Natur“ berichtet wird. Verunsicherte Eltern, Sozialarbeiter, Lehrer und Erzieher wissen nicht, wie sie mit ihren Naturdrogen gebrauchenden Heranwachsenden umgehen sollen. Kompetentes und vorurteilsfreies Wissen über die Naturdrogen ist selbst bei den helfenden Institutionen Mangelware. In der Präventionsarbeit werden Naturdrogen bisher nur stiefmütterlich behandelt. Ziel dieses Buches ist es, das Reizthema Naturdrogen interdisziplinär zu untersuchen und dem Leser naturwissenschaftliche Fakten sowie historische Hintergründe über die zurzeit am häufigsten gebrauchten Naturdrogen in komprimierter Form zu liefern. Dieses fachliche Wissen ist für eine erfolgreiche sekundärpräventive Arbeit unabdinglich.
Dieses Buch erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da wir es mit einer schier unendlichen Fülle psychotroper Substanzen zu tun haben, die uns die Natur zur Verfügung stellt. Ich stelle hier nur die wichtigsten Naturdrogen vor, die seit einigen Jahren vermehrt in Gebrauch sind. Eine wesentlich größere Auswahl an Naturdrogen findet sich in der bisher ausführlichsten Arbeit zum Thema: „Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen“ von Christian Rätsch.1 Außerdem spare ich mir die ausführliche Beschreibung von Alkohol, Cannabis, Kaffee und Tabak, da der langjährige kulturintegrierte Gebrauch dieser Pflanzen bereits ausführlich untersucht und beschrieben wurde und auch nicht dem Trend zum Gebrauch von Naturdrogen zuzuordnen ist. Es werden auch Naturdrogen vorgestellt, die in unserem Kulturkreis nicht weit verbreitet, für die soziale Arbeit mit Immigranten aber von Relevanz sind. Einige der hier aufgeführten Rauschmittel sind bisher noch wenig im Gebrauch. Bei diesen liegen jedoch eindeutige Hinweise vor, die den Schluss nahelegen, dass sie in naher Zukunft in Mode kommen könnten.
Das vorliegende Buch ist nicht nur für die oben genannte Zielgruppe von großer Signifikanz. Auch potentielle User können es benutzen, um sich vorurteilsfrei über mögliche Risiken des Naturdrogenkonsums zu informieren. Denn die wichtigste Safer-Use-Regel lautet: Erst informieren und dann konsumieren! Dies ist bei den Naturdrogen besonders wichtig, da unter ihnen Substanzen zu finden sind, die bei unsachgemäßem Gebrauch tödlich giftig wirken können.
Nach einigen wichtigen Begriffserklärungen gehe ich einleitend auf die Kulturgeschichte dernatürlichen Rauschmittel ein. Anschließendliefere ich generelle Hinweise über den aktuellen Trend zu Naturdrogen. Im Hauptteil werden die einzelnen Rauschmittel systematisch dargestellt. Abschließend werden beispielhafte Präventionskonzepte vorgestellt, die für die Prävention des Naturdrogengebrauchs von Bedeutung sind.
Wie aus dem ausführlichen Literaturverzeichnis ersichtlich ist, habe ich mich bemüht, Daten aus Fachbüchern der Toxikologie, Pharmakologie, Medizin, Botanik, Ethnobotanik, Sozialarbeit sowie der so genannten Szene-Literatur zu verwenden. Dabei musste ich leider feststellen, dass ein Teil der Fachliteratur – trotz neuer Auffagen – einen veralteten Wissensstand wiedergibt und somit dem neuen Trend zur Naturdroge nicht gerecht wird. Gerade in den letzten Jahren wurde eine Vielzahl von Naturdrogen erforscht und wiederentdeckt. Die heute verwendeten Naturdrogen sind nicht immer die gleichen wie in den 60er Jahren, als ebenfalls ein solcher Trend zu beobachten war. Selbst wenn es Parallelen zu dieser Zeit gibt, sind das Wissen um und die Anzahl der verwendeten Naturdrogen ständig gewachsen. Ziel dieses Buches ist es deshalb, die neuesten wissenschaftlichen Fakten und Trends darzustellen.
Auch die Internetrecherche wurde zu einem wichtigen Fundament dieses Buches. Wie ich noch darstellen werde, spielt das Internet eine große Rolle, wenn es um den Gebrauch von Naturdrogen geht. Weiterhin kann ich auf langjährige persönliche Erfahrungen – u. a. als Veranstalter von sekundärpräventiven Informationsveranstaltungen zum Thema Naturdrogen – zurückblicken. Hilfreich bei der Erstellung dieses Buches waren mir auch die vielen persönlichen Kontakte zu Autoren, Verlegern und Wissenschaftlern, die über diese Thematik forschen oder berichten. Obendrein hatte ich im Laufe der letzten Jahre immer wieder die Möglichkeit, internationale Kongresse und Exkursionen zu besuchen und somit über den aktuellen Forschungsstand informiert zu sein. Ich wünsche dem Leser viel Spaß und Freude mit diesem Buch und hoffe, dass es zu einer Versachlichung des emotionsgeladenen Themas beitragen wird.
1.1 Begriffserklärungen
Zu Beginn dieses Buches ist es unumgänglich, die wichtigsten gebräuchlichen Begriffe des umfassenden Themenbereiches Drogen zu klären, um dem Leser zu einem besseren Verständnis dieser Thematik zu verhelfen. Viele dieser Begriffe werden in der professionellen Suchtarbeit sowohl von Medien als auch von Laien sehr unscharf und unreflektiert gebraucht. So findet sich alleine in den Titeln der von mir benutzten Literatur eine Vielzahl von Begriffen, welche den Sachverhalt gut verdeutlichen. Die so genannten Rauschmittel werden ganz unterschiedlich betitelt, je nachdem welcher Zielgruppe die Literatur primär dienen soll. Beispielsweise entdeckt man die psilocybinhaltigen Pilze bzw. deren Wirkstoff, das Psilocybin, in der medizinischen Literatur in Büchern mit den Titeln „Biogene Gifte“2, „Gifte in Natur und Umwelt”3 oder in einer älteren Abhandlung mit dem Titel „Magische Gifte“4. Weiterhin werden die psilocybinhaltigen Pilze in Büchern mit den Titeln „Pflanzen der Götter”5, „Zauberdrogen“6, „Rauschgiftesser erzählen”7 und „Rauschdrogen“8 erwähnt. Daran kann man schon sehr gut erkennen, wie verschieden das gleiche Rauschmittel von den Autoren eingeordnet und betitelt wird.
1.1.1 Begriffserklärungen: Droge und Rauschmittel
Der Begriff Droge wurde im ursprünglich medizinischen Sinn „für getrocknete Arzneipflanzen od. deren Teile, die direkt od. in versch. Zubereitungen als Heilmittel verwendet od. aus denen die Wirkstoffe isoliert werden“9 gebraucht. Nach Lutz Mackensen wurzelt der Begriff Droge in dem niederdeutschen Wort Droge, welches trocken bedeutet.10 Heute wird das Wort Droge für alle Substanzen benutzt, welche eine bewusstseinsverändernde Wirkung auf den Menschen ausüben. Der Begriff Droge ist aber oft zusätzlich mit einer negativen Konnotation besetzt. In diesem Buch wird Droge für alle in der Natur (pflanzlich, pilzlich, mineralisch und tierisch) vorkommenden Rauschmittel verwendet, ohne dabei die isolierten Reinsubstanzen einzuschließen.
Bei der oftmals vorgenommenen Unterscheidung zwischen natürlichen und synthetischen Substanzen taucht ein weiteres Problem auf: Es ist in der Geschichte der Erforschung von pflanzlichen Wirkstoffen schon des Öfteren vorgekommen, dass eine bis dato rein synthetische Substanz erst viele Jahre später im Pflanzenreich gefunden und somit zu einer natürlichen wurde. Als klassisches Beispiel ist das psychoaktive Tryptamin N,N-DMT zu nennen, welches 1931 synthetisiert und erst 24 Jahre später erstmals aus Pflanzenmaterial isoliert wurde. Des Weiteren kann das bekannte Benzodiazepin Diazepam („Valium“) aufgeführt werden, das 36 Jahre, nachdem es synthetisch hergestellt worden war, in der Natur entdeckt wurde.11
Auch die Begriffe Rauschgift, Rauschmittel, Rauschdroge, Suchtmittel, Suchtgift und Betäubungsmittel werden sehr unklar gebraucht und oftmals fälschlicherweise gleichgesetzt. Selbst unser Betäubungsmittelgesetz (BtMG) unterliegt im Grunde genommen diesem Irrtum. So fallen alle Substanzen unter das BtMG, die in den 3 Anlagen des Gesetzes aufgeführt sind, auch wenn diese faktisch keine Betäubungsmittel sind. Dies ist beispielsweise bei LSD, Psilocybin und DMT der Fall, da diese Substanzen die Sinne anregen und die Wahrnehmung stimulieren und nicht betäuben. Wenn ich in diesem Buch von Rauschmitteln spreche, sind damit alle psychoaktiven (auch synthetische) Substanzen, Pflanzen, Pilze, Mineralien und Tiere – inklusive ihrer isolierten Reinsubstanzen – gemeint. Die Begriffe Rauschgift und Suchtgift werden von mir nicht verwendet, da ich mich der noch heute gültigen Meinung des berühmten Arztes Paracelsus anschließe, die besagt, dass „Alle Ding’ (...) Gift [sind] und nichts ohn’ Gift; alleine die Dosis macht, das ein Ding’ kein Gift ist“12.
1.1.2 Begriffserklärung: Psychedelika
Wie ich bereits in meiner Arbeit „60 Jahre LSD“ ausgeführt habe, wurden im Laufe der Jahre viele verschiedene Begriffe zur Beschreibung der Substanzklasse, zu der beispielsweise die psilocybinhaltigen Pilze, die meskalinhaltigen Kakteen oder das Ayahuasca gehören, eingeführt. Die jeweiligen Begriffe spiegeln den Hintergrund wider, in dem sie verwandt wurden. Alle benutzten Begriffe sind somit ideologisch belastet. Die Substanzen wurden Halluzinogene, Psychotomimetika, Psycholytika, Phantastika, Entheogene oder Psychedelika genannt, um nur einige Begriffe zu nennen.13
Der Begriff Halluzinogene scheint mir unpassend, da keine echten Halluzinationen hervorgerufen werden, wie sie bei Schizophrenen geläufig sind. Der nach Hanscarl Leuner bezeichnete „Ich-Rest“ bleibt bei kleineren Dosierungen meistens vorhanden, was den Unterschied zu den „echten” Halluzinationen bei Schizophrenen ausmacht.14 Psychotomimetika oder Psychotika bedeutet, einen psychoseähnlichen Zustand erzeugend15, was nur einen Teilaspekt der Erfahrung beschreibt und somit auch eine unzutreffende Beschreibung ist. Als Psycholytika werden Pharmaka bezeichnet, die ein “Auflösen” der Psyche – im Sinne der Therapie – hervorrufen und dadurch zur Unterstützung einer psychotherapeutischen Behandlung verwandt werden.16 Dieser Terminus wurde von Ronald A. Sandison geprägt und deutet auf die Auflösung von krankhaften Symptomen der menschlichen Psyche hin, die mit Hilfe der Psycholytika erreicht werden soll.17 Der Begriff Phantastica wurde bereits von Louis Lewin im Jahre 1924 zum ersten Mal gebraucht und stellt die von vielen Usern als phantastisch erlebten Sinnestäuschungen in den Vordergrund.18 Neuerdings hat sich der Begriff Entheogene verbreitet, der sich u. a. auf den rituellen Gebrauch der Substanzen im Schamanismus bezieht und „das Göttliche hervorrufend“ bedeutet.19 Ich möchte in diesem Buch den Begriff Psychedelika verwenden, da dieser meiner Meinung nach den Wirkungscharakter dieser Substanzen am besten trifft. Er bedeutet „die Seele (Geist oder Psyche) enthüllend (hervorbringend oder manifestierend)” und wurde von Humphry Osmond, einem der ersten LSD-Forscher und englischer Psychiater, 1956 in einer Korrespondenz mit Aldous Huxley zum ersten Mal gebraucht.20 Dieser berühmte Romancier verarbeitete in den Büchern „Die Pforten der Wahrnehmung“ und „Himmel und Hölle” seine Erfahrungen mit Meskalin und dann auch mit LSD.21
1.1.3 Begriffserklärung: Naturdroge
Der Begriff Naturdroge muss ebenfalls genauer erläutert werden, da dieser neben anderen Begriffen wie biogene Drogen, biogene Suchtmittel, pflanzliche Suchtmittel, biologische Drogen, Ökodrogen und psychoaktive Pflanzen gebraucht wird. Diese Bezeichnungen wurden in jüngerer Zeit überwiegend für Rauschmittel verwandt, die von lebenden Organismen – meist pflanzlichen Ursprungs – stammen und wegen ihrerpsychoaktiven Inhaltsstoffe direktkonsumiertwerden können. Als Naturdrogen werden aber auch Rauschmittel bezeichnet, die einer gewissen Zubereitung, wie einfaches Trocknen oder Auskochen, bedürfen, damit diese ihre Wirkung entfalten. Die aus pflanzlichen, pilzlichen und tierischen Drogen isolierte Reinsubstanz wird hierunter meist nicht verstanden. Es gibt aber auch hier unterschiedlich weite Auffassungen, was als Naturdroge bzw. biogene Droge betrachtet werden muss und was nicht. So definiert Frank Löhrer – Leiter und leitender Arzt eines REHA-Zentrums für junge Abhängige – in seinem Buch „Biogene Suchtmittel“ einerseits Kokain als biogene Droge, da es aus dem Pflanzenmaterial durch relativ einfache chemische Veränderungs- und Fermentationsprozesse hergestellt werden kann.22 In einem anderen Aufsatz betont er andererseits, dass isolierte Reinsubstanzen nicht zu den biogenen Drogen zählen.23 Dieses Beispiel zeigt, dass die Grenze, welches Rauschmittel zu den biogenen zählt und welches nicht, sehr schwammig ist. Auch Meskalin – der Wirkstoff des Peyote-Kaktus – kann in relativ einfachen chemischen Arbeitsschritten aus Kakteen gewonnen werden.24 Der Terminus biogene Droge (= von lebenden Organismen erzeugt)25 erscheint mir als Bezeichnung für diese Art von Rauschmitteln zu weitläufig. Heute können mittels Mikroorganismen und gelenkter Biosynthese eine Vielzahl von biogenen Substanzen (auch psychoaktive) erzeugt werden26, die nichts – außer ihrem biogenen Ursprung – mit den in diesem Buch behandelten Naturdrogen gemeinsam haben. So wurde schon von Jochen Gartz in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) ein Verfahren entwickelt, welches – mit Hilfe der Biotransformation in höheren Pilzen – Wirkstoffe für die experimentelle Neurobiologie und Arzneimittelsynthese gewinnt.27 Diese „neuen” Modellsubstanzen für die Neurobiologie müssten somit im ursprünglichen Sinn auch als biogene Drogen bezeichnet werden.
Abb. 1 Patentschrift zum Verfahren zur Gewinnung von Tryptophanderivaten durch Kultivierung höherer Pilze vom Patentamt der Deutschen Demokratischen Republik aus dem Jahre 1990
In diesem Buch werde ich die isolierten Reinsubstanzen sowie die durch gelenkte Biotransformation hergestellten Substanzen nicht als Naturdrogen definieren, da der Großteil der User die chemischen Arbeitsvorschriften – welche zur Isolierung der Reinsubstanzen notwendig sind – nicht beherrschen und anwenden können. Somit werden die Begriffe Naturdroge und Droge von mir identisch benutzt. Der Zusatz Natur hebt den Aspekt des natürlichen Ursprungs dieser Rauschmittel und die direkte Konsummögfichkeit bzw. die einfache Zubereitungsform nochmals hervor. Ich werde in diesem Buch die Begriffe so klar wie möglich gebrauchen, um Missverständnissen vorzubeugen.
1.2 Klassifikation von Naturdrogen
Auch die Klassifikation von psychoaktiven Substanzen und Naturdrogen stellt ein weitläufiges Problem dar. Im Grunde existieren zwei unterschiedliche Klassifikationsarten von sämtlichen Rauschmitteln nebeneinander. Zum einen kann man Rauschmittel nach ihrem Wirkungstyp einteilen. Der Vorteil dieser Klassifikation ist, dass der Leser einen groben Überblick über die verschiedenen Wirkungen der psychoaktiven Substanzen und Drogen erhält. Diese Art der Klassifikation wird im Großteil der von mir benutzten Literatur verwendet.28 Der Nachteil dieses Systems ist, dass bestimmte Rauschmittel keine spezifische Wirkung aufweisen und häufig Überschneidungen im Wirkspektrum vorkommen, sodass diese sich nicht eindeutig bestimmten Klassen zuordnen lassen. Auch können abhängig von der Dosierung verschiedene Wirkungen auftreten, was die Einteilung in eine bestimmte Kategorie ebenfalls erschwert.
Abb. 2 Der berühmte Berliner Pharmakologe Louis Lewin
Der bereits genannte Lewin verwandte als Erster diese Art der Klassifikation und unterteilte die geistesbewegenden Rauschmittel in folgende Kategorien: Euphorica (Seelenberuhigungsmittel), Phantastica (Sinnestäuschungsmittel), Inebriantia (Berauschungsmittel), Hypnotica (Schlafmittel) und Excitantia (Erregungsmittel).29 Seit dieser Zeit differenzieren und modifizieren andere Autoren diese Einteilung von Lewin, sodass heute zusätzliche Substanzklassen, wie die Empathogene (Mitgefühl stimulierend) und die Entaktogene (innere Berührung verursachend) benutzt werden. Auch innerhalb einer Klasse werden Unterteilungen vorgenommen. So unterscheidet Adolf Dittrich zwischen Halluzinogenen I. und II. Ordnung.30
Die Einteilung nach der chemischen Struktur liefert wahrscheinlich die klarsten Grenzen zwischen den Klassen. Es muss allerdings hierbei beachtet werden, dass nicht unbedingt von der chemischen Struktur auf die Wirkung der Rauschmittel geschlossen werden kann. Zu den β-Phenylalkylaminen gehören beispielsweise Substanzen vom Typ der Psychedelika, Entaktogene und Stimulantia.31 Die Schwierigkeiten, die aus der Unterteilungin natürliche und synthetische Rauschmittel resultieren, habe ich bereits im Kapitel 1.1.1 ausgeführt. Andere Autoren umgehen dieses Problem und beschreiben die Rauschmittel ihrer alphabetischen Reihenfolge nach.32
Ich werde mich in diesem Buch bewusst keiner dieser Klassifikationen stringent anschließen und eine Mischform von botanischer, chemischer und auf dem Wirktyp beruhender Klassifikation benutzen, da ich so auf die Besonderheiten der von mir dargestellten Naturdrogen besser eingehen kann. Eine suffiziente und hundertprozentig befriedigende Einteilung ist – wie ich dargestellt habe – nicht zu erreichen. Um dem Leser jedoch einen ersten Überblick zu verschaffen, werde ich den Hauptteil dieser Arbeit in drei Kapitel gliedern, welche die Grundwirktypen der Naturdrogen darstellen: die Psychedelika, die Stimulantia und die Narkotika.
2. Die Kulturgeschichte der Naturdrogen
2.1 Die prähistorische Verwendung von Naturdrogen
Der Gebrauch von Rauschmitteln scheint so alt wie die Menschheit zu sein.33 Rauschmittel sind seit Menschengedenken auf allen Kontinenten im Gebrauch.34 Jörg Conradi führt an, dass Cannabis, Betel, Opium und Tabak schon in der Steinzeit gebraucht wurden.35 Laut Ronald K. Siegel hat der Mensch ein natürliches Bedürfnis nach ekstatischer Erfahrung.36 Durch Archäologen werden in neuerer Zeit immer mehr Entdeckungen gemacht, die den Gebrauch von Naturdrogen vor etlichen tausenden Jahren belegen. Erstaunlich ist beispielsweise die Entdeckung von Felszeichnungen auf dem afrikanischen Kontinent, welche im Gebiet der Sahara zwischen Tassili (Südalgerien), Acacus (Libyen) und Ennedi (Tschad) gefunden wurden. Auf diesen Felszeichnungen, die aus der so genannten Rundkopfphase – vor ca. 9000 bis 7000 Jahren – stammen, sind eine Vielzahl von mythologischen Wesen mit anthropomorphen und zoomorphen Eigenschaften zu sehen, die u. a. neben Pilzen, aber auch mit Pilzen in den Händen, dargestellt sind. Auf einer Abbildung sind die Pilze mit gestrichelten Linien mit dem Kopf der anthropomorphen Wesen verbunden. Nach Gartz sind damit eindeutige Belege für den Gebrauch von psychoaktiven Pilzen in dieser Zeit gegeben.37
Abb. 3 Felszeichnung aus Tassili von mythologischen Wesen mit Pilzen in den Händen
Abb. 4 Pilzstein in Kerala (Süd-Indien)
Im Jahre 1999 hatte ich persönlich die Gelegenheit in Kerala (Süd-Indien) eine ethnomykologisch interessante Beobachtung zu machen. Durch einen Artikel von Giorgio Samorini angeregt38, besuchte ich die in der Malayalam-Sprache als „kuda-kallu“ (= Schirm-Stein) bezeichneten Steinbauten, welche zu einer Megalith-Kultur auf dem indischen Subkontinent gehören, die in die Zeit von 1400 v. Chr. bis 100n. Chr. fällt. Bei diesen zwischen 1,5 und 2 m hohen Steinstrukturen handelt es sich, laut Meinung zahlreicher Experten, um die Darstellung von Pilzen. Samorini stellt die Hypothese auf, dass es sich dabei um psychoaktive Pilze gehandelt haben muss, die mit diesen Pilzsteinen besonders verehrt wurden. In Mittelamerika wurden ebenfalls prähistorische Pilzsteine bei Ausgrabungen von Mayatempelruinen gefunden, die ca. 30 cm hoch und etwa 2000 Jahre alt sind. Diese dienten wahrscheinlich in gleicher Weise der Verehrung von psychoaktiven Pilzen, welche dort im rituellen Rahmen eingenommen wurden.39
Abb. 5 Prähistorischer Pilzstein aus Mittelamerika
Ein anderes Beispiel sind die Fundstücke von Schnupfpulverbestecken, die bei Ausgrabungen von Gräbern in Nordchile entdeckt wurden. Bei der chemischen Analyse der anhaftenden Pulverzubereitungen wurden die psychedelischen Wirkstoffe DMT und Bufotenin identifiziert. Rätsch schreibt hierzu: „Die archäologische Analyse ergab, dass über 20% der männlichen Bevölkerung am psychoaktiven Geschnupfe aktiv beteiligt waren.“40
2.2 Naturdrogen und Religion
Es gibt einige Autoren, die den Gebrauch von Rauschmitteln mit der Entstehung von Religion in Zusammenhang bringen. John M. Allegro stellte z. B. 1970 die These auf, dass die Entstehung des Christentums auf den Gebrauch des Fliegenpilzes zurückzuführen ist.41 Auch Terence McKenna vertritt in seinem Buch „Die Speisen der Götter“ die Theorie, dass Religion durch den Gebrauch von Psychedelika entstanden ist.42 Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass es zwei mir bekannte Darstellungen des biblischen Baums der Erkenntnis gibt, die Pilzen sehr ähnlich sehen. Zum einen ist dies das von Allegro erstmals veröffentlichte Fresko aus dem 13. Jahrhundert in der Kapelle von Plaincourault (Frankreich, Gemeinde Merigny), welches den Baum der Erkenntnis unmissverständlich als Fliegenpilz darstellt.43 Zum anderen das von Gartz „entdeckte” Relief der biblischen Szene „Das Gericht im Paradies“ auf der 472 cm hohen und im Jahre 1015 vollendeten bronzenen Bernwardstür im Dom von Hildesheim (UNESCO Kulturerbe), auf dem der Baum der Erkenntnis ebenfalls pilzähnlich dargestellt ist.44 Auf der wenige Jahre später entstandenen Bernwardssäule sind ebenfalls pilzähnliche Abbildungen zu erkennen. Bei einer persönlichen Besichtigung überzeugte mich allerdings die Darstellung der Pilze – welche von Paul Stamets als Spitzkegelige Kahlköpfe (Psilocybe semilanceata) gedeutet werden – nicht.45 Aber ebenso wenig überzeugt die Auffassung der Kunsthistoriker, die den Baum der Erkenntnis als Feigenbaum interpretieren.46
Abb. 6 Fresko aus der Kapelle von Plaincourault (Frankreich)
Ein weiteres christliches Artefakt, welches mit psychoaktiven Pflanzen in Verbindung steht, ist das „wundertätige“ Wurzelkreuz in der Wallfahrtskirche von Maria Straßengel in der Steiermark. Das 18,5 cm hohe, gegabelte Kruzifix, welches den Gekreuzigten mit ausgestreckten Händen und zusammengebundenen Füßen sowie mit realistischen – vom Todesschmerz gekennzeichneten – Zügen darstellt, wurde 1870 von dem österreichischen Botaniker Franz Xaver Unger als die sagenumwobene, menschengestaltige Wurzel der Alraune (Mandragora officinalis) identifiziert. Die Einwirkungen eines Schnitzmessers wurden durch pflanzenphysiologische Untersuchungen ausgeschlossen.47 Über die Alraune stellen Rätsch und Müller-Ebeling fest, dass diese schon in der Bibel – wegen der aphrodisischen und fruchtbarkeitsfördernden Qualität ihrer reifen Früchte – mit dem Namen „dûdâ ’îm“ erwähnt wurde.48
Über den geheimnisvollen Soma-Kult der alten Indoeuropäer wurde ebenfalls viel spekuliert. Richard Gordon Wasson – der Begründer der Ethnomykologie und Wiederentdecker der mexikanischen Pilzkulte – war der Ansicht, dass es sich bei Soma um den Fliegenpilz (Amanita muscaria) handelte, auch wenn er, laut Aussage von McKenna, persönlich keine ekstatischen Erfahrungen nach dem Verzehr von Fliegenpilzen machte.49 Gartz ist der Auffassung, dass die psychoaktive Wirkung des „pharmakologisch eher uninteressanten”50 Fliegenpilzes in vieler Hinsicht überbetont wird.51 Andere Autoren sind der Meinung, dass es sich bei Soma um die Steppenraute (Peganum harmala) oder um psilocybinhaltige Pilze gehandelt haben könnte.52 Die Suche nach dem Soma der Veden – den ältesten religiösen indischen Zeugnissen – wird wohl noch weitergehen.
Abb. 7 Relief der biblischen Szene „Das Gericht im Paradies“ auf der Bernwardstür im Dom von Hildesheim
Abb.8 Bernwardssäule mit Pilzmotiv im Dom von Hildesheim (Deutschland, ca. 1020 n. Chr.)
Fest steht, dass in vielen traditionellen Kulturen der Gebrauch von Naturdrogen mit dem Göttlichen in Verbindung gebracht wurde, was sehr gut an den Entstehungsmythen dieserpsychoaktiven Pflanzen und Pilze ablesbar ist.53 Laut Samorini wurden psychoaktive Pflanzen und Pilze „überall als Geschenk betrachtet, das den Menschen von der Gottheit gegeben wurde, und hin und wieder wurden sie sogar vollständig mit einem Gott gleichgesetzt“54.
2.3 Die „moderne“ Erforschung von Naturdrogen
Die systematische Erforschung der Naturdrogen begann erst im 19. Jahrhundert durch den liberal gesinnten Ernst Freiherr von Bibra. Bibra stellte schon 1855 fest, dass nirgends „auf der ganzen weiten Erde wird ein Land gefunden [wird], dessen menschliche Bewohner sich nicht irgendeines narkotischen Genussmittels bedienen, ja fast alle haben deren sogar mehrere, und während einige dieser Narcotica vielleicht nur von einzelnen Stämmen gebraucht werden, ist die größere, überwiegendere Menge derselben von Millionen Menschen angenommen“55. Heute nimmt laut Hartmut Laatsch jeder vierte Mensch Rauschmittel irgendwelcher Art ein. Zählt man die „legalen” Rauschmittel hinzu, ist es jeder zweite.56 Durch Bibra wurde in Deutschland eine Welle der interdisziplinären Drogenforschung ausgelöst, wobei sich erst im 20. Jahrhundert die Ethnologen für den Gebrauch von psychoaktiven Pflanzen, Pilzen und Tieren interessierten.57 Hier ist das bereits erwähnte Werk „Magische Gifte“ von Victor A. Reko zu nennen, der schon im Vorwort zur ersten Auflage aus dem Jahre 1936 feststellte, dass die „Einstellung der modernen Menschheit zum Problem der betäubenden Genussmittel (...) heute noch ebenso uneinheitlich und unlogisch [ist], wie sie es im tiefsten Mittelalter war.”58
Die frühe chemische Erforschung der Naturdrogen fokussierte sich auf das Opium, woraus Friedrich Wilhelm Sertürner Anfang des 19. Jahrhunderts das Morphin isolierte und damit eine neue Klasse von Pffanzeninhaltsstoffen – die Alkaloide – entdeckte.59 Als weiterer Meilenstein kann die Entdeckung und Reindarstellung des wirksamen Prinzips des Kokastrauchs (Erythroxylum coca und Erythroxylum novogranatense) –des Kokains – aus dem Jahre 1859 durch Albert Niemann bezeichnet werden.60 Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wandte sich das Interesse der Forscher dem Peyote-Kaktus (Lophophora williamsii) zu, den der Berliner Pharmakologe Lewin 1886 erstmalig von seiner Amerikareise mitbrachte.61 Der zeitgleich mit Lewin forschende Leipziger Arthur Heffter war der erste Mensch, der die Wirkung eines reinen Psychedelikums und eines isolierten Pflanzenwirkstoffes – des Meskalins, der Hauptwirkstoff aus dem Peyote-Kaktus – an sich selber testete. Die Ergebnisse wurden am 8. Februar 1898 veröffentlicht.62 Die frühe Meskalinforschung gipfelte in der 1927 erschienenen Habilitationsschrift des an der Psychiatrischen Klinik in Heidelberg forschenden Kurt Beringers, mit dem Titel „Der Meskalinrausch“, welche bis heute die vollständigste „Klinik des Meskalinrausches”63 darstellt.64 Der Vollständigkeit halber muss hier noch auf den „Vater der psychoaktiven Ethnobotanik“65 Richard Evans Schultes – ein ehemaliger Harvard Professor – hingewiesen werden, dessen Forschungen in Mexiko und Südamerika zur Entdeckung zahlreicher psychoaktiver Pflanzen geführt hat. Außerdem ist in diesem Zusammenhang noch der New Yorker Bankier R. Gordon Wasson zu nennen, der als Begründer der Ethnomykologie gilt.
Abb.9 Der Leipziger Pharmakologe Arthur Heffter
Abb. 10 Die bisher umfangreichste Bibliographie der psychoaktiven Pilze von John W. Allen u. Jochen Gartz
Ab den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts bis zur heutigen Zeit erschien eine Fülle von Publikationen über Rauschmittel. Alleine über die psychoaktiven Pilze sind seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts mehr als 2400 Veröffentlichungen international weit verstreut erschienen.66 Wenn man den Status quo im Bereich der Naturdrogenforschung betrachtet, muss das bisher umfangreichste Werk zum Thema – die „Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen“ des Ethnopharmakologen Christian Rätsch – erwähnt werden.67
3. Generelle Anmerkungen zum Gebrauch von Naturdrogen
3.1 Der zeitgemäße Trend zu den Naturdrogen
Fast alle Autoren, die über die aktuelle Situation des Rauschmittelgebrauchs berichten, stellen übereinstimmend fest, dass in den letzten Jahren ein vermehrter Trend zu den natürlichen Rauschmitteln festzustellen ist.68 „Zurück zur Natur“ scheint der Slogan der heutigen Jugend zu sein. Im weiteren Verlauf der Arbeit werde ich immer wieder auf die Hintergründe dieses Trends zu sprechen kommen. Besonders in den Kapiteln 4.1.1.3 und 4.1.1.8 erläutere ich dieses Phänomen anhand der psilocybinhaltigen Pilze ausführlicher.
An dieser Stelle sollen die möglichen Gründe für diesen Trend kurz angeführt werden. Einige Autoren sprechen von ideologischen Vorteilen der Naturdrogen gegenüber den synthetischen Rauschmitteln. Diese Feststellung muss in ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang gesehen werden. Der Gebrauch von Ecstasy wird beispielsweise immer wieder mit der vom Kindesalter an erlernten Gewohnheit in Verbindung gebracht, Pillen zur Manipulation der psychischen Befindlichkeit sowie zur Steigerung des psychischen und physischen Leistungsvermögens einzusetzen. Der bereits in der Kindheit erlernte leichtfertige Umgang mit legalen Pharmapillen erhöht gewissermaßen die Bereitschaft der Jugendlichen, die synthetischen Rauschmittel – denen das saubere Image eines Heilmittels anhaftet – zu konsumieren.69
In den letzten Jahren scheint sich selbst bei den Durchschnittsbürgern ein gegenteiliger Trend – weg von den „harten“ synthetischen Pharmapräparaten undhin zu den „sanften” natürlichen Heilmitteln – durchzusetzen. Traditionelle alternative Heilverfahren sind weltweit so populär, wie schon lange nicht mehr.70 Als Beispiele sind die traditionelle chinesische Medizin (TCM), die Homöopathie, die Mycotherapie und die Phytopharmakotherapie zu nennen. Diesem allgemeinen Trend zum Natürlichen schließen sich auch die Rauschmittelkonsumenten an. Naturdrogen sind ihrer Meinung nach unschädlicher, sauberer und nebenwirkungsärmer als ihre synthetischen Verwandten.71 An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass die möglichen Nebenwirkungen von natürlichen und synthetischen Heilmitteln ein umfangreiches Diskussionsthema darstellen. Die Befürworter der Phytopharmaka behaupten, dass diese weit weniger Nebenwirkungen aufweisen, als die Produkte der Pharmaindustrie. Die behauptet natürlich das Gegenteil und ist der Meinung, dass durch Phytopharmaka wegen des schwankenden Gehalts der Wirkstoffe unberechenbare undgesundheitsschädliche Nebenwirkungen zu erwarten sind.72 Wie ich in diesem Buch noch zeigen werde, kann die Frage, ob die Naturdrogen oder die synthetischen Rauschmittel gefährlicher sind, nicht pauschal beantwortet werden. Als besonders verheerend sehe ich in diesem Zusammenhang verallgemeinernde Aussagen, wie die von Dr. Rieder, der behauptet, dass Naturdrogen „bedrohlicher als Heroin“73 sind. Es kann immer nur das einzelne Rauschmittel für sich betrachtet werden. Wie bei den synthetischen Substanzen gibt es auch in der Natur Rauschmittel, deren Einnahme relativ ungefährlich ist und wiederum andere, deren Einnahme extreme Risiken birgt.
Derzunehmende Gebrauch von Naturdrogen drücktnach Klerings und Schmaal ein „tiefes Bedürfnis nach Kontakt mit der Natur“74 aus. Dies kann als Zeichen einer Sinnsuche der heutigen Jugend gedeutet werden, welche größtenteils in einer primär materialistisch ausgerichteten Welt aufgewachsen ist. Naturdrogenkonsum ist als Teil einer „Gegenbewegung zur entmystifizierten Leistungsgesellschaft zu verstehen”75. Parallelen zur Hippiebewegung der 60er Jahre sind offensichtlich und werden im Kapitel 4.1.1.8 näher betrachtet.
Als weiterer Vorteil der Naturdrogen gegenüber den synthetischen Substanzen wird immer wieder der juristische Aspekt genannt.76 Auch hier können keine pauschalen Aussagen gemacht werden. Sicherlich ist es richtig, dass ein Großteil der in diesem Buch beschriebenen Naturdrogen frei erhältlich ist und dem Konsumenten keine rechtlichen Konsequenzen bei Besitz und Konsum drohen, weshalb auch immer wieder von Ersatzdrogen gesprochen wird.77 Dies ist aber auch bei einigen synthetischen Rauschmitteln der Fall. So kann z. B. das potente Psychedelikum Dextromethorphan (DXM) rezeptfrei und kostengünstig als Hustenblocker in jeder Apotheke erworben werden.78 Auch das in der Bundesrepublik legal im Chemikalienhandel erhältliche Trifluoromethylphenylpiperazin (TFMPP) ist zu einem beliebten entheogenen Entaktogen in der Technoszene avanciert.79 Das bekannte „Hase und Igel Spiel“ trifft am besten die größtenteils erfolglosen Bemühungen der Regierungen, alle möglichen Rauschmittel zu verbieten. Der Untergrund ist immer einen Schritt voraus. Wenn wieder psychoaktive Substanzen durch eine erneute Verordnung zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften in das BtMG aufgenommen werden, stehen schon die nächsten „noch legalen” Rauschmittel für den Verkauf bereit.
Der rechtliche Status der Naturdrogen ist seit 1998 extremen Änderungen unterworfen. Seit dieser Zeit wurden insgesamt zehn Verordnungen zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften verabschiedet, die auch in besonderem Maße die Naturdrogen betreffen. Im Kapitel 4.1.1.6 gehe ich auf die wichtigsten Änderungen ein, die für dieses Thema besondere Relevanz aufweisen: die 10. BtMÄndV, die 15. BtMÄndV und die 19. BtMÄndV. Besonders grotesk erscheint in diesem Zusammenhang der Umstand, dass die verhältnismässig harmlosen Naturdrogen verboten sind, während Naturdrogen, deren Einnahme mit einem hohen gesundheitlichen Risiko verbunden sind, nicht dem BtMG unterliegen. Der rechtliche Status der einzelnen Naturdrogen ist immer den jeweiligen Kapiteln zu entnehmen. Ich kann allerdings nur den derzeit aktuellen Stand des BtMG (Stand: Februar 2006) wiedergeben. Plötzliche und vorher nicht angekündigte Änderungen des Gesetzes sind leider eher die Regel als die Ausnahme.
3.2 Die Wirkungen von Naturdrogen
3.2.1 Die Wirkungen der Stimulantia und Narkotika
Es gibt bei den Naturdrogen ein weites Spektrum unterschiedlicher Wirkungen. Schematisch kann allerdings eine Dreiteilung in Psychedelika, Narkotika und Stimulantia vorgenommen werden. Ich denke, dass es nicht notwendig ist, die Wirkungen einer stimulierenden Substanz (Stimulantia) zu erläutern, da der Grossteil der Leserschaft mit der Wirkungsweise von Kaffee vertraut sein wird und somit das stimulierende Prinzip bereits am eigenen Leib erfahren hat. Natürlich wirken nicht alle Stimulantia gleich. Die unterschiedlichen Nuancen der psychischen Wirkung sowie die verschiedenen körperlichen Wirkungen der stimulierend wirkenden Naturdrogen werden in den einzelnen Kapiteln separat beschrieben.
Die dämpfende Wirkung der Narkotika dürfte dem Leser durch den Alkoholgenuss ebenfalls bekannt sein. Deshalb werde ich auf das sedierende Wirkungsspektrum auch nicht näher eingehen. Wie bei den Stimulantia werden die unterschiedlichen Nuancen sowie die physischen Wirkungen der einzelnen Narkotika in den separaten Kapiteln beschrieben.
3.2.2 Die Wirkungen der Psychedelika
Lediglich die psychischen und physischen Wirkungen der Psychedelika benötigen meines Erachtens einige einleitende Worte, da diese doch sehr speziell sind. Aber auch diese Anmerkungen zu den Psychedelika sind generalisiert. Die spezifischen Wirkungen der einzelnen Psychedelika müssen ebenfalls in den jeweiligen Kapiteln nachgelesen werden. Dies gilt insbesondere für die physischen Wirkungen, da es hier doch erhebliche Unterschiede gibt. So muss beispielsweise bei den psychoaktiven Nachtschattengewächsen mit erheblichen körperlichen Wirkungen bzw. Nebenwirkungen gerechnet werden, während die psilocybinhaltigen Pilze beinahe frei von eindeutig somatischen Wirkungen sind. Es ist anzumerken, dass die oft beschriebenen körperlichen Wirkungen der psilocybinhaltigen Pilze und vieler anderer Psychedelika psychosomatischen Ursprungs sind, da diese als Katalysator wirken und unbewusstes Material zum Vorschein bringen, welches durchlebt werden muss. Somit sind die körperlichen Erscheinungen in der Regel mit psychischen Inhalten verknüpft.80
Psychedelika haben eine außerordentlich variable Wirkung auf die menschliche Psyche. Leuner bemerkt hierzu: „Die meisten Autoren, die auf dem Gebiet halluzinogener Einflüsse auf den Menschen arbeiten, stimmen überein, dass die Wirkung der gleichen Substanz und der gleichen Dosis am gleichen Individuum von Sitzung zu Sitzung erheblich variiert.“81 Von besonderer Berücksichtigung für den Verlauf einer psychedelischen Sitzung sind die drei Variablen Dosis, Set (= Erwartungshaltung und psychische Befindlichkeit des Konsumenten) und Setting (= physische Umgebung, in der das Rauschmittel eingenommen wird), die Timothy Leary als Erster postulierte und die mittlerweile als anerkannte Größen in psychotherapeutischen Behandlungen zu finden sind.82
Pharmakologen und Toxikologen, die normalerweise gewohnt sind, dass eine Substanz immer die gleiche Wirkung auf das Individuum hat, bescheinigten den Psychedelika – aufgrund von deren enorm variablen Wirkung – eine Unberechenbarkeit und Unwissenheit um die psychodynamischen Effekte, welche diese auslösen. Stanislav Grof postuliert, dass „die psychedelischen Drogen aller Wahrscheinlichkeit nach nur Katalysatoren oder unspezifische Verstärker sind, die die tiefen Schichten des Unbewussten im Menschen aktivieren“83.
Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang Stanislav Grof’s Buch „Topographie des Unbewussten“ ,in demerversucht, die ungewöhnlichen Phänomene der Psychedelika-Erfahrung zu ordnen und in einen größeren Zusammenhang zu bringen.84 Da Grof’s Phänomenologie psychedelischer Erfahrungen ein unter Wissenschaftlern anerkanntes Konzept ist, möchte ich beispielhaft auf diese näher eingehen.85 Grof kann auf über 2000 psychedelische Sitzungen mit Patienten der unterschiedlichsten seelischen Erkrankungen sowie „normale” freiwillige Probanden zurückblicken. Er unterscheidet folgende Schichten des Unbewussten, die bei einem Halluzinogen induzierten Erlebnis in Erscheinung treten können: abstrakte und ästhetische Erfahrungen, psychodynamische Erfahrungen, perinatale Erfahrungen und transpersonale Erfahrungen. Es gibt noch verschiedene andere Modelle der Beschreibung von außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen, wie z. B. Adolf Dittrich’s Einteilung in drei ätiologieunabhängige Grunddimensionen: ozeanische Selbstentgrenzung, angstvolle Ich-Auflösung und visionäre Umstrukturierung86 oder Leuner’s transphänomenales dynamisches Steuerungssystem (tdyst), auf welche ich hier aber nicht näher eingehen werde, da sich Grof’s System unter den meisten praktizierenden Therapeuten durchsetzte.
3.2.2.1 Abstrakte und ästhetische Erfahrungen
In der Anfangsphase eines Psychedelika-Trips kommt es häufig zu solchen Erfahrungen. In der Literatur werden oft optische und akustische Täuschungen beschrieben, d. h. die Gegenstände in der Umgebung werden nicht mehr so wahrgenommen, wie sie sind. Die Musik wird entweder mit himmlischem Vergnügen oder abgrundtiefer Angst assoziiert und das Zeiterleben ist nicht mehr linear, so dass z. B. Sekunden als Stunden erlebt werden. Synästhesien als Verknüpfung verschiedener Sinnesebenen (z. B. „Farbenhören“) sind wahrscheinlich die unglaublichsten Wahrnehmungsstörungen, die in dieser Phase des psychedelischen Erlebens auftreten können.87
3.2.2.2 Psychodynamische Erfahrungen
Die psychodynamischen Erfahrungen entsprechen dem individuellen Unbewussten der Persönlichkeit, die in „normalen“ Bewusstseinszuständen nicht zugänglich sind. Grof vertritt die Meinung, dass diese Erscheinungen mit psychodynamischen Begriffen deutbar sind und verstanden werden können. So kommt es beispielsweise zum Wiedererleben von bedeutsamen Erinnerungen, schweren Traumen (Operationen, Krankheiten, seelische und körperliche Misshandlungen) und ungelösten Konflikten. In diesem Zusammenhang definierte Grof die COEX-Systeme (Systems of condensed experience), welche als „eine spezifische Konstellation von Erinnerungen, die aus verdichteten Erfahrungen verschiedener Lebensabschnitte mit ähnlichem Grundthema und starken Emotionen von gleicher Qualität besetzt sind”88, verstanden werden können.89
3.2.2.3 Perinatale Erfahrungen
Unter dem Begriff perinatale Erfahrungen werden von Grof alle Erfahrungen zusammengefasst, die sich mit den Problemen der biologischen Geburt, des Alterns, Sterbens und des Todes befassen. Er unterscheidet vier verschiedene Bereiche, die er Matrizen nennt. Als Matrix 1 bezeichnet er die “Ureinheit mit der Mutter – intrauterine Erfahrung vor dem Einsetzen der Geburt”, in der, wenn alles gut gelaufen ist, das Kind eine kosmische Einheit mit der Mutter empfindet, in welcher alle libidinösen Bedürfnisse befriedigt sind. Die perinatale Matrix 2 ist eher eine unlustvolle Erfahrung und wird von Grof als “Antagonismus mit der Mutter – Kontraktionen in einem geschlossenen uterinen System” betitelt. Die Matrix 3 „Synergie mit der Mutter – Vorwärtsbewegung durch den Geburtskanal“ ist durch Elemente des Ringens um Tod und Wiedergeburt gekennzeichnet und ist mit regelrechten Kämpfen um das Überleben verbunden. Die vierte Matrix „Trennung von der Mutter – Beendigung des symbiotischen Einsseins und Bildung einer neuen Beziehungsform” wird oft von den Probanden als „Befreit- und Erlöstsein“ beschrieben. Interessanterweise können die wieder erlebten perinatalen Erfahrungen durch unabhängige Befragungen von Zeugen nicht falsifiziert werden, was hauptsächlich auf die vierte Matrix zutrifft, da sich dort alle Einzelheiten nachvollziehen lassen.90
3.2.2.4 Transpersonale Erfahrungen
Unter den transpersonalen Erfahrungen werden sehr vielfältige Erlebnisse zusammengefasst, „wobei das Gefühl im erlebenden Menschen vorherrscht, dass sich sein Bewusstsein über die normalen Ich-Grenzen hinaus erweitert und dabei die Begrenzung von Raum und Zeit transzendiert werden“91. Dazu gehören beispielsweise embryonale und fötale Erfahrungen sowie kollektive rassische Erfahrungen, die in Beziehung zu C. G. Jungs Konzeption des kollektiven Unbewussten stehen. Auch Inkarnationen aus früheren Leben, die eng mit dem hinduistischen Glauben verbunden sind, können erlebt werden.92
3.3 Die Gefahren des Gebrauchs von Naturdrogen
3.3.1 Allgemeine Risiken des Naturdrogen-Gebrauchs
Die Nennung allgemeiner Risiken des Naturdrogen-Gebrauchs birgt natürlich die Gefahr einer Verallgemeinerung. Besonders durch die enorme Vielfalt der in diesem Buch behandelten Naturdrogen erscheint dies fast unmöglich. Dennoch möchte ich einige generelle Hinweise auf mögliche Gefahrenquellen geben. In den einzelnen Kapiteln gehe ich dann auf die spezifischen Risiken der jeweiligen Naturdrogen ein.
Ein ernstes Risiko stellt der schwankende Wirkstoffgehalt der meisten Naturdrogen dar. Bei vielen Naturdrogen kommt es dabei zu regionalen, genetisch bedingten und saisonalen Schwankungen. Teilweise enthalten sogar die verschiedenen Teile einer Pflanze ganz unterschiedliche Wirkstoffkonzentrationen oder sogar ein ganz unterschiedliches Bukett an psychoaktiven Inhaltsstoffen. Diese Schwankungen können bei der Einnahme ein großes Risiko darstellen, da es schnell zu ungewollten Überdosierungen kommen kann.93 Besonders deutlich wird dies bei dem Fliegenpilz, bei dem von einer Variation um das 12fache der Wirkstoffe berichtet wird.94





























