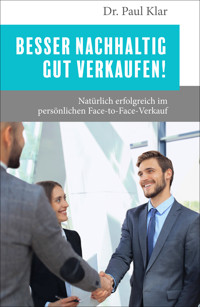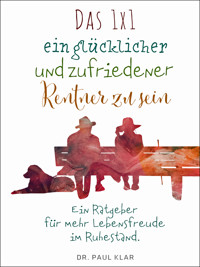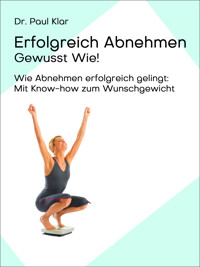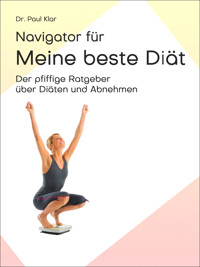
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Dieser Diätratgeber richtet sich an alle, die genug haben von erfolglosen Abnehmversuchen, die sich endlich eine Diät wünschen, die wirklich zu ihnen passt. Die beste Diät nutzt nämlich nichts, wenn sie nicht zum gewünschten Erfolg führt. Und nicht jede beste Diät eignet sich tatsächlich für alle am besten.
Wer erfolgreich abnehmen will, tut deshalb gut daran, zunächst zu bestimmen, welche der zahlreichen Diäten für sich selbst die Beste wäre. Diejenige Diät, mit der man selbst am besten klarkäme und mit der man seine Diätziele am besten erreichen kann.
Dafür gibt es diesen beste Diät Ratgeber.
Er klärt ungeschminkt auf, worauf es beim Abnehmen ausschlaggebend ankommt und wie die verschiedenen Diäten ihrem tatsächlichen Grunde nach funktionieren. Pfiffig bringt der Ratgeber Klarheit ins Dickicht der Diäten - für Ihr erfolgreicheres Abnehmen mit Ihrer eigenen besten Diät!
Auch verrät der Diät Ratgeber, wie Abnehmen viel leichter gelingt. Erfahren Sie in dem Ratgeber zudem, wie man einen Jojo-Effekt infolge der Diät geschickt vermeidet.
Dieser Diätratgeber für die eigene beste Diät ist ein Must-Read sowie ein nützlicher Ernährungs-Ratgeber für alle, die erfolgreich abnehmen und dauerhaft schlank bleiben wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Kapitel
Titel
Was diesen Diät-Ratgeber besonders macht
Darf ich vorstellen: die Protagonisten
Die vier Hauptnährstoffe im Rampenlicht
Nebenbestandteile gar nicht nebensächlich
Energie!
Was passiert beim Abnehmen im Körper?
Was eine Diät wirklich ausmacht
Was schafft Sport?
Wie schnell lässt sich abnehmen?
Wie lässt sich eine Diät leichter durchhalten?
Die einfachen Prinzipien aller Diäten
Diäten auf nur drei Grundtypen reduziert
Fasten und Fastendiäten
So ermitteln Sie Ihre beste Diät
Diätkonzepte auf den Punkt gebracht
Fasten
Eine frei gestaltete Diät
Und nach der Diät? Jojo-Effekt wirksam vermeiden!
Bildnachweise
Autor und Buch
Ebenfalls vom Autor erschienen
Impressum
Navigator für meine beste Diät
Der pfiffige Ratgeber über Diäten und Abnehmen
Dr. Paul Klar
Was Ihnen dieser Diät-Ratgeber bietet
Jetzt muss endlich was passieren! Runter mit den Pfunden! Eigentlich wollte man es ja schon lange.
Fragt sich nur wie? Behaupten doch so viele Diäten von sich, den wirksamsten Weg zum Abnehmen zu bieten. Schließlich möchte man nicht unnötig herumexperimentieren. Wenn schon auf all die Leckereien verzichten, dann wenigstens mit schnellem Erfolg. Mit welchem Konzept würde das gelingen? Mit Fett? Ohne Kohlenhydrate? Im Schlaf? Mit fettverbrennenden Enzymen? Oder ganz ohne Diät? Was wäre die beste Diät für mich?
Auch ich stand einst vor dieser Frage. Als Naturwissenschaftler wusste ich einiges darüber, wie sich Lebensmittel zusammensetzen und was mit ihnen im Körper passiert. Also ging ich damit zahlreichen Diätkonzepten auf den Grund. Das Ergebnis war überraschend. Es wurde plötzlich ganz einfach, den wahren Kern der Diäten zu erkennen, was an ihnen besonders ist und was nur werbewirksame Verpackung.
Die Prinzipien, nach denen ich damals vorging, waren so klar und einfach, dass sie jeder anwenden kann. Mit nur ein wenig Hintergrund, mit dem, worauf es wirklich ankommt, gewinnen auch Sie Klarheit.
Mit meiner Methode gelingt es Ihnen zu erkennen,
was eine funktionierende Diät ausmacht,
wie schnell man erfolgreich abnehmen kann,
wie Sie leicht erkennen, was an Diätversprechen wirklich dran ist,
wie Abnehmen viel leichter durchzuhalten ist,
welches Konzept zum Abnehmen und welche erfolgreiche Diät einfach am besten zu Ihnen passt,
wie Sie einen Jojo-Effekt wirksam vermeiden.
Begleiten Sie mich auf meiner spannenden Reise durch die Welt der Lebensmittel. Erkennen Sie ihre wahre Bedeutung für den Körper und wie sich mit ihnen wirksam abnehmen lässt. Finden oder gestalten Sie auf diese Weise Ihre ganz persönliche beste Diät!
Werden Sie Ihr eigener Diät-Coach mit Erkenntnissen, die Ihnen ein Leben lang nützlich sein werden.
Dr. Paul Klar
Die Protagonisten
Wie sich unsere Nahrung im Innersten zusammensetzt
Beginnen wir die Reise dort, wo alles anfängt, nämlich bei den Lebensmitteln. Was macht sie aus, was unterscheidet sie und was bedeutet das für unsere Ernährung oder für eine Diät?
Wie sich Nahrungsmittel zusammensetzen, lässt sich am leichtesten verstehen, wenn man ihre Bestandteile in zwei Gruppen aufteilt. Eine von ihnen umfasst ihre hauptsächlichen Komponenten. Aus diesen bestehen die Lebensmittel also weit überwiegend. Die andere Gruppe ist die der Nebenanteile, die nur in geringeren Mengen in der Nahrung vorkommen.
Für gesundes Ernähren sind beide Gruppen gleichermaßen wichtig. Dennoch finden sich die Akteure, die für ein Zunehmen oder das Abnehmen verantwortlich sind, ausschließlich bei den Hauptbestandteilen. Deshalb gilt dieser Gruppe unser erster, vorrangiger Blick.
The Big Four: Die vier Hauptbestandteile unserer Nahrung
Bei aller Vielfalt unserer Lebensmittel bestehen sie alle in der Hauptsache doch nur aus maximal vier Bestandteilen. „In der Hauptsache“ bezieht sich dabei nicht darauf, wie wichtig diese sind oder welchen Einfluss sie auf Aussehen, Konsistenz und Geschmack haben. Es besagt nur, dass sie den mengenmäßig größten Anteil der Lebensmittel ausmachen.
Die vier Hauptkomponenten sind:
Kohlenhydrate
Fette
Proteine, auch „Eiweiße“ oder „Eiweißstoffe“
Wasser
Diese Nährstoffe müssen nicht immer alle zugleich in einem Lebensmittel vorkommen. So enthält Trinkwasser als Hauptnährstoff nur das Wasser, jedoch keine Kohlenhydrate, keine Fette und auch keine Proteine. Reines Pflanzenöl enthält als Hauptkomponente praktisch nur flüssiges Fett. Mehr als diese lediglich vier Hauptnährstoffe sind es bei Lebensmitteln aber niemals. Es reicht daher schon aus, nur diese „Big Four“ etwas näher kennenzulernen und zu wissen, in welchen Nahrungsmitteln sie besonders reichlich oder kaum vorkommen. Damit wären Sie dann bereits in der Lage, selbst einschätzen zu können, welches Lebensmittel diätgeeignet ist und welches nicht – ganz ohne Kalorien zählen zu müssen. Ich habe jedem der vier Hauptnährstoffe ein eigenes, überschaubares Unterkapitel gewidmet. Darin werden Sie erfahren, welche Rolle diese Komponenten bei der Ernährung, im Körper und bei einer Kalorienreduktionsdiät spielen. Außerdem zeige ich Ihnen, in welchen Lebensmitteln sie besonders vorkommen.
Klein, aber fein: die Nebenbestandteile Vitamine, Mineralstoffe & Co.
Doch zuvor werfen wir einen kurzen Blick auf die zweite Gruppe der Nährstoffe, die der Nebenbestandteile. „Neben“ steht hier nicht etwa für „nebensächlich“. Ganz im Gegenteil! Die Nebenanteile der Nahrung spielen sogar eine ganz besonders wichtige Rolle in unserer Ernährung. Mit ihnen nimmt man zwar weder ab noch zu, doch ohne sie oder bei einem ausgeprägten Mangel, würden viele wichtige Funktionen im Körper eingeschränkt werden oder ganz zum Erliegen kommen. Die Nebenbestandteile der Nahrung sind lebensnotwendig. Deshalb muss man gerade bei einer Diät, bei der es um eine eingeschränkte Nahrungsaufnahme geht, ein besonderes Augenmerk auf sie legen. Sie dürfen dabei keinesfalls über eine längere Zeit zu kurz kommen.
Die wohl bekanntesten Vertreter der Nebenbestandteile sind Vitamine und Mineralstoffe. Doch es gibt auch noch weitere, wie zum Beispiel sekundäre Pflanzenstoffe, Enzyme, Purine, Glycolipide, Phospholipide oder die unverdaulichen Ballaststoffe.
Aber keine Sorge, so viele müssen Sie gar nicht bis ins letzte Detail kennen. Um ihre Rolle in der Ernährung und bei einer Diät einschätzen zu können, reichen ein paar wenige, grundsätzliche Erkenntnisse völlig aus. Auch diese werde ich Ihnen auf ganz einfache Weise im Anschluss an die Hauptnährstoffe nahebringen, ganz frei von unnötigem Ballast.
Die vier Hauptnährstoffe im Rampenlicht
Kohlenhydrate - ob süß oder nicht: alles aus Zucker
Kohlenhydrate werden von Pflanzen gebildet und kommen daher besonders in pflanzlicher Kost vor.
Im Zusammenhang mit Diäten wird für sie häufig die Kurzform „Carb“, verwendet, die von ihrer englischen Bezeichnung „Carbohydrates“ stammt. Um die Nützlichkeit der Kohlenhydrate für die menschliche Ernährung zu erfassen, sollten Sie zunächst ihre Bedeutung für die Pflanzen verstehen. Dann wird alles viel klarer.
Kohlenhydrate erfüllen für die Pflanzen je nach ihrer Komplexität ganz unterschiedliche Aufgaben. Für unsere Zwecke reicht es völlig aus, nur die wichtigsten Typklassen und die wichtigsten Vertreter kennenzulernen. Dabei fange ich mit den einfachsten Ausführungen an.
Einfache Süßzucker
Um es leicht zu machen, symbolisiere ich die einfachen Kohlenhydrate mit einem ebenso einfachen Kreis:
Das Wort „einfach“ ist in diesem Zusammenhang bewusst zweideutig gewählt, nämlich (1.) im Sinne von „schlicht“ und (2.) zu verstehen als ein Kreis. Bei den später folgenden komplexeren Kohlenhydraten werden nämlich weitere Kreise hinzukommen. Solche Kohlenhydrate sind dann nicht mehr „einfach“, sondern z. B. „zweifach“ (zwei Kreise) oder „mehrfach“ (mehrere Kreise).
Pflanzen können süße Kohlenhydrate nicht nur herstellen, sondern auch wieder zu Kohlendioxid und Wasser abbauen. Aus diesem Rückbau gewinnen sie die Energie, von der sie leben. Süßer Zucker ist also der direkte Energiespender für die Pflanzenwelt.
Einfache Süßzucker, insbesondere Glucose (Traubenzucker), sind auch für Menschen der Haupt-Energielieferant. Nur können Menschen süße Einfachzucker nicht aus Kohlendioxid, Wasser und Sonnenlicht herstellen. Sie müssen sie entweder über die Nahrung aufnehmen oder in ihrem Stoffwechsel aus anderen Nährstoffen herstellen. Einfachzucker können aus dem Darm direkt in den Körper aufgenommen werden, ohne dass die Verdauung sie weiter zerlegen müsste. Sie stehen auf diese Weise besonders schnell zum Energiegewinnen bereit. Viele Anbieter von Traubenzucker, im Handel auch Dextrose genannt, werben mit dessen schnell verfügbarer Energie. Das klingt soweit alles sehr schön, hat aber einen Haken. In vielen Lebensmitteln kommt reine Glucose nämlich gar nicht oder nur in geringen Mengen vor. Doch auch hier weiß sich die Natur zu helfen. Schauen wir dafür zunächst wieder ins Pflanzenreich, dem Herkunftsland der Kohlenhydrate.
Haushaltszucker süßer Zweifachzucker Saccharose
In der Küche und in Lebensmitteln, wie Getränken und Fertiggerichten, gibt es noch einen süßen Zucker, der in der Ernährung und auch bei einer Diät eine wichtige Rolle spielt, nämlich den „Haushaltszucker“ („Saccharose“, der Wortabschnitt Saccha wird trotz der zwei „c“ gesprochen wie Sache – nur hinten mit einem „a“ anstatt mit einem „e“). Dieser ist zwar auch ein Süßzucker, aber er ist nicht „einfach“, sondern „zweifach“. Gemeint ist damit, dass Haushaltszucker aus zwei miteinander verknüpften Einfachzuckern besteht, nämlich aus Traubenzucker (Glucose) und Fruchtzucker (Fructose).
Andere gebräuchliche Namen für Haushaltszucker sind Kristallzucker, Rohrzucker, Rübenzucker, Würfelzucker, Puderzucker oder Kandis. Trotz der unterschiedlichen Namen handelt es sich immer um denselben Zucker. Saccharose ist ebenfalls pflanzlicher Herkunft. Wie die Namen „Rohrzucker“ und „Rübenzucker“ schon andeuten, wird dieser Zweifachzucker besonders vom Zuckerrohr und von Zuckerrüben gebildet. Raffinierter, das heißt gereinigter Haushaltszucker ist weiß oder genauer gesagt, farblos.
Brauner Zucker ist kein anderer Zucker als der weiße. Ihm verleihen lediglich verbliebene Rückstände aus dem Aufarbeitungsprozess seine braune Farbe und seinen typischen Beigeschmack.
Damit der Mensch Saccharose aus der Nahrung aufnehmen kann, muss er sie zunächst verdauen. Dabei wird der Zweifachzucker in seine beiden Einfachzucker Glucose und Fructose zerlegt. Diese können dann ohne weiteren Verdauungsschritt direkt über den Darm in den Blutkreislauf gelangen. Wegen der zuvor erforderlichen Spaltung des Haushaltszuckers sind die daraus gebildeten Einfachzucker für den Körper nicht so schnell verfügbar, als hätte er sie direkt zugeführt bekommen. Für die Energiegewinnung ist Saccharose deshalb ein etwas „langsamerer“ Zucker.
Nicht nur die menschliche Verdauung, auch Bienen können zusammengesetzten Zucker in seine Bausteine zerlegen. Die Süße des Honigs besteht daher im Wesentlichen aus einer Mischung von Glucose und Fructose.
Saccharose wird auch industriell in seine beiden Bausteine zerlegt.
Die dabei entstehende Mischung von gleichen Teilen Traubenzucker und Fruchtzucker wird häufig zum Süßen z. B. von Getränken verwendet, weil dieses Zuckergemisch, das „Invertzucker“ genannt wird, etwas süßer ist als die gleiche Menge Haushaltszucker, aus dem es gewonnen wurde.
Stärke – der pflanzliche Energiespeicher
Um die eigene Existenz zu sichern, ist es ratsam, sich etwas von dem zurückzulegen, wovon man in guten Zeiten reichlich hat. Das sehen auch Pflanzen so und bauen sich einen Vorrat von ihrem Energiebringer auf. Aber süße Kohlenhydrate lassen sich aufgrund ihrer sehr leichten Wasserlöslichkeit in den wässrigen Säften der Pflanze nicht „einlagern“. Deshalb haben sich die Pflanzen einen Trick einfallen lassen. Sie verknüpfen die einzelnen Einfachzucker zu langen Ketten, die mitunter auch Verzweigungen haben können. So werden die Kohlenhydrate sehr komplex (100 bis 10.000 miteinander verknüpfte Kringel) und weniger wasserlöslich. Auf diese Weise lassen sie sich viel besser speichern.
Solche „Einlagerungs-Kohlenhydrate“ heißen im allgemeinen Sprachgebrauch „Stärke“. Stärke ist ein Gemisch verschiedener „Einlagerungs-Kohlenhydrate“. Die Kartoffelpflanze z. B. legt sich regelrechte Knollen aus Stärke an ihren Wurzeln zu, eben die Kartoffeln.
Aus Stärke kann die Pflanze aber nicht direkt Energie gewinnen. Dazu muss sie die zusammengesetzten Kohlenhydrate erst wieder in ihre Bausteine, die einfachen Süßzucker, zerlegen. Stärke ist für die Pflanze also keine Verwertungsform, sondern nur eine Lagerform Ihres Energieträgers Zucker. Stärke schmeckt nicht süß, sondern eher mehlig.
Stärkereiche Lebensmittel sind z. B.
Kartoffeln
Reis
Teigwaren
Mehl (Stärke aus Getreide)
Brot
Pastinaken
Stärkehaltig sind auch Gemüse und Obst, jedoch weniger ausgeprägt. Dafür ist ihr Wassergehalt höher. Obst enthält als weitere Kohlenhydrate auch noch süße Zucker, wie an ihrem lieblichen Geschmack leicht zu erkennen ist.
Auch solch „höhere“ Kohlenhydrate wie Stärke, kann der menschliche Organismus nicht direkt aus der Nahrung aufnehmen. Wie die Zweifachzucker muss auch Stärke dafür zunächst verdaut, also in seine Bausteine, die süßen Einfachzucker zerlegt werden. Stärke ist aus Glucosebausteinen aufgebaut. Wird Stärke verdaut, entsteht daraus Traubenzucker, der dann seinerseits direkt über den Darm in den Stoffkreislauf des Körpers gelangen kann. Im Vergleich zu Zweifachzuckern dauert das Verdauen von Stärke aber länger. Der Energieträger Glucose wird aus ihr langsamer freigesetzt, dafür aber auch länger anhaltend. Auch das ist für die Ernährung von Bedeutung, weil man Energie ja nicht nur für den Moment braucht, sondern ständig. Langsam verdauliche, komplexe Kohlenhydrate, wie Stärke, werden auch „langsame“ Kohlenhydrate genannt. Aus ihnen leitet sich sogar ein ganzes Diätkonzept ab, die Slow-Carb-Diät. Darüber erfahren Sie später noch mehr.
Süßer Zucker im Blut – der Blutzucker
Der Körper nimmt über seine Verdauung also stets Einfachzucker, vor allem Glucose auf. Erst einmal im Stoffwechsel angekommen, bieten ihm solche Süßzucker leicht verfügbare Energie. Wie die Pflanzen bauen wir dabei die einfachen Kohlenhydrate zu Kohlendioxid und Wasser ab. Um solche Energieträger stets und überall griffbereit zu haben, befindet sich immer ein Anteil des Traubenzuckers im Blut. Das ist der „Blutzucker“. Ein weiterer Anteil kann von Körperzellen aufgenommen und bei Bedarf wieder ins Blut freigesetzt werden. Mit diesem Vorrat reguliert der Körper seinen Blutzuckerspiegel bei kurzfristigen Schwankungen. Sein Hormon Insulin, das bei erhöhtem Glucoseangebot vermehrt ausgeschüttet wird, sorgt dafür, dass der Überschuss in Körperzellen eingeschleust wird. Verbraucht der Körper Blutzucker und wird er nicht schnell genug mit neuer Glucose über die Ernährung versorgt, schüttet der Organismus vermehrt das Hormon Glucagon aus. Dieses bewirkt, dass der Glucosevorrat aus den Körperzellen wieder ins Blut zurückgegeben wird. Außerdem kann Glucagon auch die Neubildung von Glucose aus anderen Stoffwechselprodukten anregen. Das spielt vor allem in Hungerzeiten eine Rolle sowie bei Diäten.
Glykogen – die tierische Stärke
Die in Körperzellen zwischengespeicherte Glucose reicht nur zum Ausgleich kurzfristiger Schwankungen aus. Wie die Pflanzen können daher auch Menschen aus überschüssigem Süßzucker eine längerfristige Lagerform aufbauen. Diese heißt dann aber nicht „Stärke“, sondern „Glykogen“ (glyko“ steht für „süß“ und „gen“ für „entstehen“: „entsteht aus Süßem“).
Wegen seiner Ähnlichkeit mit der pflanzlichen Stärke sowohl in seiner Zusammensetzung als auch in seinem Zweck, wird Glykogen auch als „tierische Stärke“ bezeichnet. Menschen speichern Glykogen vor allem in ihren Muskeln und in der Leber. Analog zu den Pflanzen kann der Mensch aus Glykogen nicht direkt Energie gewinnen. Auch er muss sein Vorrats-Kohlenhydrat zuvor wieder zu Glucose abbauen. Diese Energievorräte aus komplexen Kohlenhydraten spielen beim Abnehmen eine wichtige Rolle. Sie werden Ihnen daher noch an vielen Stellen dieses Ratgebers begegnen.
Zellulose – Gerüststoff der Pflanzen
Doch das ist noch nicht alles, was Kohlenhydrate zu bieten haben. Damit Pflanzen nicht schlapp und welk am Boden liegen, brauchen sie ein inneres Gerüst, das sie stützt. Doch woher den Baustoff dafür nehmen? Was sich Pflanzen bei genügend Licht in größerer Menge herstellen können, sind ja Zucker und daraus höhere Kohlenhydrate. Also haben sie gelernt, auch ihre Stützsubstanz aus den einfachen Kohlenhydratbausteinen herzustellen. Der Weg dorthin sieht so ähnlich aus, wie zu der Stärke. Das Ergebnis dieses Prozesses ist dann aber völlig unlöslich in Wasser und es lässt sich auch nicht mehr ohne weiteres in Einfachzucker zurückverwandeln. Diese Kohlenhydrate heißen Zellulose und sind Ihnen z. B. bekannt als:
Zellstoff (z. B. Watte)
Pflanzenfasern, wie Baumwolle, Leinen, Sisal, u. a.
Selbst Bäume verwenden das Kohlenhydrat Zellulose für Ihre Stämme, allerdings in Kombination mit noch anderen Materialien.
Zellulose kann von Menschen nicht verdaut werden. Dennoch spielt auch dieses Kohlenhydrat eine Rolle in ihrer Ernährung. Als „Ballaststoff“ vergrößert es nämlich das Füllvolumen der Nahrung in Magen und Darm und regt dadurch die Verdauung an.
Wie Sie gesehen haben, können Kohlenhydrate in völlig unterschiedlichen Erscheinungsformen auftreten. Dennoch bestehen sie immer aus denselben Grundbausteinen, nämlich aus einfachen Süßzuckern.
Fette – gehaltvolle Geschmacksträger
Fette haben es in sich. Sie liefern dem Körper etwa doppelt so viel Energie, wie Kohlenhydrate und sie lassen sich von ihm leicht in noch größeren Mengen speichern. Fett wird vor allem unter der Haut eingelagert, wo es Depots bildet und den Körperumfang vergrößert.
Fette kommen vielfältig in Lebensmitteln vor. In manchen kann man sie leicht erkennen, in anderen kaum. So ist ein weißer Fettrand an einem Stück Fleisch gut sichtbar.
Aber wie viel Fett in Wurstwaren verarbeitet wurde, lässt sich meist nicht erkennen. Auf fertigverpackten Fleisch- und Wurstwaren wird der Fettgehalt ausgewiesen, zumeist aber nicht auf den Beschriftungsschildern der Frischware an der Fleisch- und Wursttheke.
Anders beim Käse. Zwar sieht man auch ihm seinen Fettgehalt nicht an, dafür geben die Auszeichnungen an den meisten Käsetheken Auskunft über den jeweiligen Fettgehalt. Der will allerdings richtig verstanden sein, weil er auf verschiedene Weise mit unterschiedlichen Werten angegeben werden kann.
Wohl am wenigsten leicht ist die Angabe des prozentualen Fettgehalts „i. Tr.“ („in der Trockenmasse“) zu verstehen. Wozu gibt es die überhaupt? Die Antwort ich einfach: weil sie am genauesten ist. Der prozentuale Fettgehalt bezieht sich ja auf das Gesamtgewicht des Käses. Das kann aber wegen seines veränderbaren Wassergehalts schwanken. Wenn Wasser aus dem Käse verdunstet, wie es mit der Zeit geschieht, vermindert sich dadurch das Gesamtgewicht des Käses. Der unveränderten Fettmenge steht dann ein geringeres Gesamtgewicht des Käses, als vor dem Verdunsten gegenüber. Rechnerisch erhöht sich dadurch der prozentuale Fettgehalt, obwohl sich die absolute Fettmenge gar nicht verändert hat.
Enthält 100 g Käse zum Beispiel 20 Gramm Fett, dann ist sein relativer Fettgehalt 20 Prozent. Verliert der Käse Feuchtigkeit, wird er dadurch leichter. Nehmen wir an, er wiegt dann nur noch 80 Gramm. Bei einer gleich gebliebenen Fettmenge von 20 Gramm läge der relative Fettgehalt dann bei 25 Prozent. Je leichter der Käse durch Verdunsten seines Wassergehalts wird, desto höher steigt sein prozentualer Fettgehalt, ohne dass sich die tatsächliche Menge an Fett dabei ändert. Der prozentuale Fettgehalt bleibt erst dann unverändert, wenn kein Wasser im Käse mehr enthalten ist, also in der „Trockenmasse“ des Käses. Der Fettgehalt in der Trockenmasse ist also ein zuverlässigerer Wert, weil er sich nicht mit der Zeit verändert. Aber er ist auch weniger anschaulich, weil der Käse, wie wir ihn kaufen, gar nicht trocken ist, sondern Wasseranteile enthält. Auch aus diesem Grund findet man immer häufiger Angaben ohne „i. Tr.“, d. h. mit dem Fettgehalt des nicht entwässerten Käses. Dieser liegt immer etwas niedriger als der jeweilige Referenzwert für die Trockenmasse und regt deshalb Kunden leichter zum Kauf an.
Eine weitere, für Käse verbreitete Angabe des Fettgehalts sind die Fettstufen:
Magerstufe: weniger als 10 % Fett i. Tr.
Viertelfettstufe: 10 % bis unter 20 % Fett i. Tr.
Halbfettstufe: 20 % bis unter 30 % Fett i. Tr.
Dreiviertelfettstufe: 30 % bis unter 40 % Fett i. Tr.
Fettstufe: 40 % bis unter 45 % Fett i. Tr.
Vollfettstufe: 45 % bis unter 50 % Fett i. Tr.
Rahmstufe: 50 % bis unter 60 % Fett i. Tr.
Doppelrahmstufe: 60 % und mehr Fett i. Tr.
Fette kommen nicht nur in tierischen Lebensmitteln vor, sondern auch in pflanzlichen, und zwar vor allem in Samen, Nüssen und Keimen. Aus Kürbiskernen, Weizenkeimen oder Sonnenblumenkernen, um nur ein paar typische Vertreter zu nennen, kann das jeweilige Pflanzenöl gewonnen werden. Fetthaltiges Fruchtfleisch findet sich z. B. in Oliven oder in Avocados.
Fette sind nicht nur nach ihrer Herkunft oder nach ihrer Konsistenz unterteilbar, sondern auch nach ihrem Verwendungszweck. So gibt es zum Beispiel Bratfette, etwa Schmalz (tierisch) oder Palmöl (pflanzlich) und Streichfette, Butter (tierisch) und Margarine (pflanzlich).
Fette, die bei normaler Zimmertemperatur flüssig sind, bezeichnet man als Öle. Es gibt auch Öle, die keine Fette sind, z. B. Mineralöl, Synthetiköl oder Siliconöl. Sie haben mit den Fett-Ölen nur die äußeren Eigenschaften gemeinsam, d. h. sie sind „ölig“. Hier sollen aber nur solche Öle betrachtet werden, die als flüssige Fette eine Bedeutung für die Ernährung haben, die Fett-Öle. Alle anderen gehören nicht zur Ernährung, ja sie wären zumeist sogar gesundheitsschädlich.
Manche flüssigen Fette können bei Kühlschranktemperaturen oder im Froster fest werden. Dennoch bezeichnet man sie als Öle, weil sie ja bei üblicher Raumtemperatur flüssig (ölig) sind.
Auf mögliche gesundheitliche Unterschiede zwischen tierischen und pflanzlichen Fetten, festen und gehärteten Fetten und Fett-Ölen will ich hier nicht eingehen. Das wäre ein ganz anderes Thema. Für das Abnehmen gilt: auch vermeintlich gesünderes Fett ist Fett. Also auch in „natives, kaltgepresstes Öl“ gedippte Häppchen sind dafür nichts anderes als eine fettreiche Speise.
Über die Zusammensetzung von Fetten braucht man zum Abnehmen nicht allzu viel zu wissen - lediglich, dass „Fettsäuren“ zu den Bausteinen gehören, aus denen Fette aufgebaut sind. Beim Verdauen werden die Fette in ihre Bausteine gespalten, die dann direkt vom Körper aufgenommen werden können.
Der menschliche Körper braucht bestimmte Fettsäuren und einige von diesen kann er nur über die Nahrung zu sich nehmen ("essentielle" Fettsäuren). Eine fettfreie Ernährung wäre deshalb ungesund.
Auch bestimmte Vitamine (E, D, K, A) sind Fettbegleiter und werden über die Nahrungsfette vom Körper aufgenommen. Auch für diese kann sich bei zu fettarmer Ernährung ein gesundheitsschädlicher Mangel einstellen („Hypovitaminose“).
Proteine - lebenspendendes Eiweiß
Proteine werden nach Ihrer Entdeckung im Eiweiß („Eiklar“), auch als "Eiweißstoffe" oder inzwischen meist verkürzt als „Eiweiß“ bezeichnet.
Dieser im Deutschen verbreitete Ausdruck verleitet aber zu Verwechslungen, weil an ihm nicht zu erkennen ist, ob man damit das „Weiße“ im Ei oder Proteine meint.
Deshalb empfiehlt es sich, im Zweifel besser die international übliche Bezeichnung „Protein“ zu verwenden. Diese stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie „erstes“ oder „vorrangiges“. Und eine so wichtige Rolle spielen Proteine auch in unserer Ernährung.
Trotz der umgangssprachlichen Bezeichnung als „Eiweiß“ ist der Proteingehalt im Eiklar mit ungefähr 10 % gar nicht besonders hoch. Im Eigelb liegt er mit etwa 16 % immerhin schon im Bereich von magerem Fleisch oder von Tofu, einer Art Sojabohnenquark, bzw. -käse.
Proteine sind für den Organismus eigentlich gar nicht als Energielieferant und auch nicht als Energiespeicherstoff gedacht. Proteine erfüllen ganz andere lebenswichtige Funktionen. Zum einen geben sie den Organen Gestalt und Funktionen. Fast alle Organe des Menschen einschließlich Muskeln, Haut und Haare bestehen überwiegend aus Proteinen. Ohne Proteine würden die Organe nicht existieren. In den Körperzellen und im Blut bewirken spezialisierte Eiweißstoffe lebenswichtige Stoffwechselvorgänge.
An nahezu allen Lebensfunktionen sind Proteine wesentlich beteiligt. Ohne Proteine kann der Organismus nicht funktionieren.
Trotzdem baut der Körper täglich einen Teil seiner Proteine ab und gewinnt dabei etwa so viel Energie, wie beim Abbau von Kohlenhydraten. Der Grund dieses Abbaus ist aber normalerweise nicht der Energiegewinn. Vielmehr erneuert der Körper seine Proteine fortlaufend, damit sie nicht mit der Zeit durch Alterung ihre Funktion verlieren. Deshalb werden abgebaute Proteine vom Körper im Rahmen eines Erneuerungsprozesses zugleich durch frische ersetzt.
Proteine kommen vor allem in tierischer Kost, in einem geringeren Maße aber auch in pflanzlichen Lebensmitteln vor.
Tierisches Eiweiß findet sich in den Lebensmitteln genau dort, wo es auch im menschlichen Körper vorkommt, nämlichen in den Organen. Das Magere des Fleisches ist zumeist Muskelfleisch und sehr eiweißreich. Aber auch andere Organe wie Leber, Herz, Niere, Hirn, etc. sind wichtige Proteinträger. Das Protein der Haare, Finger- und Zehennägel ist für den Menschen unverdaulich und dient daher nicht seiner Ernährung. Weitere gehaltvolle Eiweißlieferanten sind Fisch, Milch und Milchprodukte. Auch in Eiern, seinem Namensgeber, sind Eiweißstoffe enthalten.
Pflanzliche Lebensmittel lassen ihre Proteine nicht ganz so leicht erkennen. Pflanzliches Eiweiß kommt vor allem vor:
in Hülsenfrüchten (z. B. Erbsen, Bohnen, Soja und Soja-Produkten, wie Sojamehl, Sojamilch oder Tofu)
in Nüssen
in Samen (z. B. in Getreide und Getreideprodukten, wie Mehl, Brot und in getreidehaltigen Produkten, wie Teigwaren)
Auch Kohl, insbesondere Brokkoli, Rosenkohl oder Grünkohl liefern noch eine gewisse Menge Protein, während Obst und Salate fast proteinfrei sind.
Proteine bestehen aus kleineren Bausteinen, die wie an einer Perlenschnur zu langen Ketten verknüpft sind.
Diese Eiweiß-Ketten werden bei der Verdauung in die einzelnen Bausteine, die sogenannten „Aminosäuren“ zerlegt (genauer: „L-alpha-Aminocarbonsäuren“). Diese einzelnen Bausteine können vom Körper aufgenommen werden, nicht aber das Protein als Ganzes.
Dort angekommen, knüpft der Stoffwechsel die Aminosäuren wieder zu Proteinen zusammen, aber in anderer Bausteinreihenfolge. Es entstehen daraus also andere, körpereigene Proteine.
Etwa 20 verschiedene Aminosäure-Arten benötigen Menschen zum Aufbau ihrer Proteine. Einige davon kann sich der Organismus selbst herstellen, andere nicht. Diese anderen, die „essenziellen“ Aminosäuren, muss man mit der Nahrung aufnehmen. Doch nicht alle Nahrungsproteine enthalten alle essenziellen Aminosäuren. Oder sie enthalten einzelne essenzielle Aminosäuren in zu geringer Menge. Je vollständiger und ausgewogener der Aminosäuregehalt von Nahrungsproteinen ist, als desto „wertiger“ gelten sie.
Als „vollwertig“ gelten das Molken-Eiweiß der Milch und die Proteine der Eier.
Zu den hochwertigen Eiweißlieferanten zählen vor allem Soja und Soja-Produkte, Fisch, Fleisch, Milch und Milchprodukte (Käse, Quark, Joghurt & Co.) und Quinoa. Pflanzliche Proteine haben oftmals eine niedrige Wertigkeit, weil nicht alle Aminosäuren darin so enthalten wären, wie der Mensch sie bräuchte.
Aber deshalb muss man pflanzliches Eiweiß nicht meiden. Auch ist es gar nicht erforderlich, eine Wissenschaft daraus machen, wie man zu all seinen essenziellen Aminosäuren kommt. Am sichersten ist es, Proteine stets aus verschiedenen Eiweißquellen zu sich zu nehmen. Das ist umso wichtiger, je niedriger die Wertigkeit der Eiweißträger in der persönlichen Nahrungszusammenstellung ist.
Der tägliche Bedarf an Proteinen wird für Männer und Frauen gleichermaßen mit derzeit ca. 0,8 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht angegeben, d. h.:
bei 50 kg Körpergewicht: 40 g Proteine pro Tag
bei 60 kg Körpergewicht: 48 g Proteine pro Tag
bei 70 kg Körpergewicht: 56 g Proteine pro Tag
bei 80 kg Körpergewicht: 64 g Proteine pro Tag
bei 90 kg Körpergewicht: 72 g Proteine pro Tag
Menschen über 65 Jahre sollten etwas mehr Eiweiß zu sich nehmen. Für sie liegt die Empfehlung bei 1 g Proteine pro Kilogramm Körpergewicht.
Eine durchschnittliche Hauptmahlzeit aus Mischkost, d. h. mit Fisch, Fleisch oder Tofu, Gemüse und Sättigungsbeilage (Kartoffeln, Teigwaren o. ä.) bringt etwa 20 bis 30 Gramm Proteine auf den Teller. Natürlich kann dieser Wert je nach Zusammensetzung der Speise und der Größe der Portionen auch stärker abweichen. Solch eine Durchschnittsmahlzeit deckt noch nicht einmal den Eiweißbedarf eines nur 50 kg leichten Menschen. Um Ihren täglichen Bedarf zu decken, benötigen Sie daher in der Regel mehrere proteinliefernde Mahlzeiten.
Obwohl Proteine für den Körper eine so vorrangige Bedeutung haben, kann er nur recht wenig davon bevorraten, um in Phasen proteinarmer Ernährung darauf zurückgreifen zu können. Dazu dient sein „Aminosäurepool“ im Blut, der ein paar Tage ohne Proteinzufuhr ausgleichen kann. Ist dieser aufgebraucht, kann der Abbau der eigenen Organe, zunächst vor allem der Muskeln, bei weiterem Eiweißmangel nicht mehr durch einen entsprechenden Neuaufbau kompensiert werden. Unter dem Strich verliert man dann Muskelmasse.
Bei wieder erhöhter Proteinzufuhr kann diese sich zwar zumeist wieder regenerieren. Im Falle eines ausgeprägteren, langanhaltenden Eiweißabbaus muss aber mit einer Schwächung des Körpers, bis hin zur Funktionsunfähigkeit einzelner Organe gerechnet werden.
Natürlich läuft man durch eine Diät nicht gleich Gefahr, magersüchtig zu werden und Organschäden davonzutragen. Aber ein fortgesetzter Abbau von Proteinen, also von aktiver Lebenssubstanz, aufgrund proteinarmer Ernährung kann Vitalfunktionen schwächen.
Wasser – bringt es wirklich Energie?
Wasser gehört zu den Nährstoffen, die keine Nahrungsenergie liefern. Das verwundert Sie? Ist in der Werbung nicht immer wieder von der vitalisierenden Energie zu hören, die man beim Trinken von Wasser gerade dieser oder jener Marke erhält?
Das ist halt nur Werbung. Wasser trinken bringt dem Körper keine Energie, egal welchen Namen es auch trägt. Wenn man zu wenig Wasser trinkt, kann man zwar träge und schwach werden und ausreichend Wasser zu sich zu nehmen bewahrt davor, mehr aber nicht.
Menschen bestehen überwiegend aus Wasser – Neugeborene mit bis zu 75 % im Verhältnis am reichlichsten und ältere Menschen mit oft nur noch etwa zu 50 % am wenigsten. Damit ist Wasser der mengenmäßig überwiegende Bestandteil des menschlichen Körpers. Bei einem größeren Anteil an Fettgewebe ist der Wassergehalt niedriger und bei größerer Muskelmasse höher. Das meiste Wasser befindet sich im Blut, gefolgt von den Organen Gehirn, Leber, Muskeln und Haut.
Wasser ist für den Organismus unentbehrlich. Es ermöglicht Stoffwechselprozesse, die nur in wässriger Lösung funktionieren. Wasser dient als Transportmittel für Stoffwechselprodukte und verteilt die Wärme im Körper, um nur ein paar Aufgaben zu nennen.
Verliert man mehr als 0,5 % bis 3 % des Körpergewichts an Wasser, bekommt man Durst.