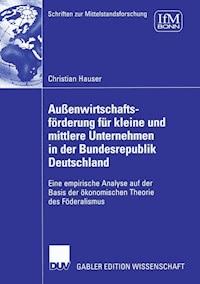Neue Organisationsformen von Arbeit mit Fokus auf hierarchiefreie und hierarchiereduzierte Unternehmen in Österreich E-Book
Christian Hauser
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Konventionelle hierarchische Organisationen vermögen den komplexer und dynamischer werdenden Anforderungen unserer Umwelt nicht mehr ausreichend Rechnung zu tragen. Mechanistische Kontroll- und Steuerungsmethoden versagen zunehmend. Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Motive, warum sich Unternehmen von der klassischen Organisationsform verabschieden und mit neuen Organisationsformen von Arbeit experimentieren und den aus der Transformation resultierende Nutzen für das Unternehmen. Untersucht wird, wie sich "neue" Organisationsformen nun von konventionellen Unternehmen unterscheiden. Welche anderen Praktiken weisen sie auf und setzen sie im Unternehmensalltag ein? Welche Bedingungen braucht es, damit eine Transformation gelingen kann? Welche speziellen Effekte treten in Unternehmen auf, die unterscheidbar sind von den bekannten Phänomenen in konventionellen Organisationen? Im Forschungsinteresse stehen auch die Herausforderungen, die in "neuen" Organisationformen auftreten und wie diese gelöst werden. Was sind die Gründe, die eine Rückkehr zu einer konventionellen Organisationsform sinnvoll erscheinen lassen? Die Gliederung der theoretischen Grundlagen beschreibt das Überblicksschema von Organisationsmodellen nach Frederic Laloux und stellt relevante Aspekte der Unternehmensführung, der Organisationsentwicklung und der Wirtschaftspsychologie dar. Die empirische Untersuchung wurde in Form fünf Unternehmens-Fallstudien durchgeführt, die kürzlich eine Transformation in Richtung hierarchiefreie oder hierarchiereduzierte Organisationsform gestartet haben oder sich bereits länger in einer Transformationsphase befinden. Herausgearbeitet werden Wirkungsphänome neuer Organisationsformen von Arbeit wie z.B. das sozio-moralische Klima, die psychologische Eigentümerschaft, das Organisationale Commitment und die veränderte Qualität des psychologischen Vertrages. Die Masterarbeit erhebt den Anspruch eines Grundlagenwerkes. Aus den Ergebnissen kann prinzipielle Gültigkeit für alle Organisationen jener Kulturbereiche abgeleitet werden, die am Übergang vom postmodernen pluralistischen Paradigma zum integral evolutionären Paradigma stehen. Das vorliegende Werk wurde an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien (Institut für Beratungs- und Managementwissenschaften) als Masterarbeit eingereicht und im Dezember 2017 mit "Sehr gut" beurteilt (34 von 36 Punkten).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das vorliegende Werk wurde an der Sigmund Freud Privatuniversität (Institut für Beratungs- und Managementwissenschaften) als Masterarbeit eingereicht und im Dezember 2017 mit „Sehr gut“ beurteilt (34 von 36 Punkten).
Danksagungen:
Meinem Freund Dr. Michael Reiner danke ich aufrichtig für die erwartet pointierten, kritischen und hilfreichen Rückmeldungen zum Entwurf dieser Arbeit.
Bei Herrn Univ. Prof. Dr. Michael Müller-Camen (WU Wien) bedanke ich mich für das kurzfristige Gegenlesen einzelner Abschnitte und das nützliche Feedback.
Meiner lieben Frau Mag. Claudia Hauser sage ich herzlichen Dank für ihre fortwährende großartige Unterstützung, ganz besonders in den heiklen Phasen der Finalisierung dieser Masterarbeit.
Zur Erlangung des akademischen Grades
Master of Science – MSc (Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung)
Wien, im September 2017
Fakultät für Psychologie der Sigmund Freud Privat Universität Institut für Beratungs- und Managementwissenschaften
Studienrichtung:
Universitätslehrgang Beratungswissenschaften und Management sozialer Systeme Studienschwerpunkt: Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung
Begutachter:
Mag. Michael Stadlober
Abstract
Konventionelle hierarchische Organisationen vermögen den komplexer und dynamischer werdenden Anforderungen unserer Umwelt nicht mehr ausreichend Rechnung zu tragen. Mechanistische Kontroll- und Steuerungsmethoden versagen zunehmend.
Die vorliegende Masterarbeit untersucht einerseits die Motive, aus welchem Grund Unternehmen sich von der klassischen Organisationsform verabschieden und mit neuen Organisationsformen von Arbeit experimentieren. Auf der anderen Seite wird der aus der Transformation resultierende Nutzen für das Unternehmen beleuchtet und dargestellt.
Im Rahmen einer qualitativen Fallstudie wurden fünf Unternehmen untersucht, die eine neue Organisationsform implementiert haben. Die Untersuchung zeigte, dass acht Aspekte der Organisationsgestaltung als Wesenskerne von neuen Organisationsformen grundlegend sind. Eine unbedingte Transparenz von innerbetrieblichen Informationen und neue Wege der Entscheidungsfindung sind an erster Stelle zu nennen. Sichtbar gemacht wurde ein Bündel von Nutzen für alle Stakeholder. Das Ordnungsprinzip der Hierarchie wird auch in neuen Organisationsformen genutzt. Allerdings keine Hierarchie, die auf personeller Macht beruht, sondern eine Hierarchie von Sinn, Komplexität und Umfang.
Unternehmen, die ihre Organisationsform im Zuge eines Paradigmenwechsels der Unternehmensführung verändern, nützen das volle Potenzial ihrer MitarbeiterInnen.
Neue Organisationsformen stellen eine organisationale Antwortmöglichkeit auf veränderte Rahmenbedingungen in unserer Arbeitswelt dar und werden in Zukunft die Organisationslandschaft vermehrt bereichern.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen
1.3 Forschungsstrategie
Theoretische Grundlagen
2.1 Das traditionelle konformistische Paradigma
2.2 Das moderne leistungsorientierte Paradigma
2.2.1 Führung und Management
2.2.2 Motivation
2.2.3 Ziele
2.2.4 Human Relations Ansatz, Humanisierung der Arbeitswelt, New Work
2.2.5 Zusammenfassung
2.3 Das postmoderne pluralistische Paradigma
2.3.1 Organisationskultur
2.3.2 Karriere
2.3.3 Vertrauen
2.3.4 Systemische Organisationssicht
2.3.5 Zusammenfassung
2.4 Das integrale evolutionäre Paradigma
2.4.1 Komplexität
2.4.2 Agilität
2.4.3 Transparenz
2.4.4 Partizipation und Entscheidungsmodelle
2.4.5 Purpose und Sinn
2.4.6 Organisationsmodelle und Betriebssysteme
2.4.6.1 Soziokratie
2.4.6.2 Holacracy
2.4.7 Selbstorganisation
2.4.8 Zusammenfassung
2.5 Abschluss
Empirische Vorgangsweise
3.1 Forschungsmethode
3.2 Sampling und Interviewdurchführung
3.3 Auswertung der Interviews und Kategoriensystem
Darstellung und Analyse der Ergebnisse
4.1 Beweggründe von Unternehmen für Transformation
4.1.1 Entlastung für GründerInnen / GeschäftsführerInnen
4.1.2 Geschäfts- und Entscheidungsabläufe zu langsam
4.1.3 Möglichkeit der Potenzialentfaltung für MitarbeiterInnen
4.1.4 Modell für Wachstum
4.1.5 Hoffnung auf größeren wirtschaftlichen Erfolg
4.1.6 Andere Beweggründe
4.1.7 Interpretation und Deutung
4.2 Neue Aspekte der Organisationsgestaltung
4.2.1 Transparenz
4.2.2 Entscheidungs- und Abstimmungsabläufe
4.2.3 Beteiligung
4.2.4 Gehaltssystem
4.2.5 Zielvereinbarungen
4.2.6 Karriere- und Karriereverständnis
4.2.7 Gruppendruck
4.2.8 Peer-Feedback
4.2.9 Interpretation und Deutung
4.2.10 Exkurs: Sozio-moralisches Klima, psychologische Eigentümerschaft, Subjektivierung von Arbeit
4.3 Bedingungen und Effekte von und in neuen Organisationsformen
4.3.1 „Erster bewegter Beweger“
4.3.2 Der Hüter / Bewahrer
4.3.3 Hierarchiereduktion
4.3.4 Macht und Status
4.3.5 Interpretation und Deutung
4.4 Nutzen der Transformation
4.4.1 Nutzen für GründerInnen und GeschäftsführerInnen
4.4.2 Nutzen für MitarbeiterInnen
4.4.2.1 Angenehmes Arbeitsklima
4.4.2.2 Flexibilität
4.4.2.3 Freie Arbeitseinteilung
4.4.2.4 Höhere Bindung
4.4.2.5 Offene Gesprächskultu
4.4.2.6 Partizipation
4.4.2.7 Persönliche Entwicklung
4.4.2.8 Vertrauen
4.4.2.9 Zufriedenheit und Motivation
4.4.3 Nutzen für Unternehmen
4.4.4 Nutzen für Gesellschaft
4.4.5 Interpretation und Deutung
4.4.6 Exkurs: Organisationales Commitment, Organizational Citizenship Behavior, psychologischer Vertrag
4.5 Herausforderungen
4.5.1 Selbstorganisation
4.5.2 Passung zum Unternehmen
4.5.3 Abläufe ohne formale Führungskräfte
4.5.4 Gemeinsame Richtung
4.5.5 Umsetzung
4.5.6 Duales Betriebssystem
4.5.7 Andere Herausforderungen
4.5.8 Interpretation und Deutung
4.6 Gründe, um zu einer konventionellen Organisationsform zurückzukehren
4.6.1 MitarbeiterInnen wollen es
4.6.2 Weggang GründerIn / GeschäftsführerIn
4.6.3 Wirtschaftlicher Druck
4.6.4 Interpretation und Deutung
Zusammenfassung und Ausblick
5.1 Zusammenfassung der empirischen Untersuchungsergebnisse
5.1.1 Die konkreten Ergebnisse im Detail
5.2 Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Anhang
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Heraklits Aussage, „Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung“, zeugt nach 2500 Jahren von einer scheinbar zeitlosen Gültigkeit. Kein Satz könnte die derzeitigen individuellen und organisationalen Suchbewegungen unserer Gesellschaft treffsicherer beschreiben. Vielen Menschen mögen die Konstanten in unserer Gesellschaft fehlen, dennoch: Die Sicherheiten der Vergangenheit bestehen nicht ihre Überprüfungen an der Eintrittspforte der Zukunft. Der permanente Wissenszuwachs, die Digitalisierung, die Globalisierung und der demografische Wandel verändern unsere Gesellschaft wie Brandbeschleuniger und prägen die Zukunft (vgl. Schermuly, 2016, S. 31).
Mit Fokus auf das Arbeitsleben zählen die zunehmende Vernetzung durch neue Technologien und Wirkungen des Internets zu den Veränderungstreibern sowie die Entgrenzung von Unternehmen in physischer, regionaler und zeitlicher Hinsicht. Exponentielles Technologiewachstum und globale Märkte beschleunigen das Wirtschaftsleben und verändern Beziehungsstrukturen durch erhöhte Transparenz von Informationen in Bewertungsportalen, sozialen Netzwerken oder im Zuge der Sharing Economy. Wesentliche Teile der Leistungserbringung - Produkte oder Services - wandern in den virtuell-digitalen Raum und führen zur Entflechtung der digitalen von der physischen Leistung. Kapital ist nicht mehr die entscheidende knappe Ressource. Wissen und Innovationsfähigkeit werden wichtiger und die Senkung der Kapitalschwelle für den Markteintritt schafft neue Wettbewerber. Die Folgen dieser Entwicklungen sind vielfältig, sie verändern die Grundlagen des Wirtschaftens komplett (Weinreich, 2016, S. 5ff).
Das World Economic Forum beschreibt in seinem Global Challenge Insight Report 2016 „The Future of Jobs“ unsere Situation wie folgt: „According to many industry observers, we are today on the cusp of a Fourth Industrial Revolution. Developments in previously disjointed fields such as artificial intelligence and machine learning, robotics, nanotechnology, 3D printing and genetics and biotechnology are all building on and amplifying one another. Smart systems—homes, factories, farms, grids or entire cities—will help tackle problems ranging from supply chain management to climate change. Concurrent to this technological revolution are a set of broader socio-economic, geopolitical and demographic developments, each interacting in multiple directions and intensifying each another.“ (World Economic Forum, 2016, S. 5ff) Als konkrete Treiber der Veränderung reiht der Report in technologischer Hinsicht „Mobile Internet, cloud technology“ (34%), „Processing power, Big Data“ (26%), „New energy supplies and technologies“ (22%), „Internet of Things“ (14%) und „Sharing economy, croudsourcing“ (12%). In demografischer und sozioökonomischer Hinsicht listet der Report in absteigender Reihenfolge „Changing nature of work, flexible work“ (44%), „Middle class in emerging markets“ (23%), „Climate change, natural resources“ (23%), „Geopolitical volatility“ (21%) und „Consumer ethics, privacy issues“ (16%).
Das VUCA-Konzept beschreibt die unsicheren Rahmenbedingungen unserer gegenwärtigen Phase mit den Begriffen von Unbeständigkeit (volatility), Ungewissheit (uncertainty), Komplexität (complexity) und Mehrdeutigkeit (ambiguity). Dabei handelt es sich um eine Strategiemethode, die vom amerikanischen Militär entwickelt und von Managementexperten übernommen wurde. Sie richtet ihr Augenmerk auf die Fragen, wie sehr man Situationen/Ereignisse voraussehen kann und wie viel man über die Situation bzw. das Ereignis weiß (vgl. Hofert, 2016, S. 23). „Traditionell ist Management auf die Entwicklung, Umsetzung und Ausführung von klar definierten Strategien und Prozessen ausgerichtet. Das ist ein sinnvolles Vorgehensmodell für eine verlässliche Umwelt“ (Weinreich, 2016, S. 12). Umso komplexer und dynamischer die unternehmerische Umwelt wird, umso öfter versagen die herkömmlichen Steuerungs- und Führungsmethoden (vgl. Weinreich, 2016, S. 13).
Für diese veränderten unternehmerischen Umwelten sind viele Unternehmen nicht ausreichend vorbereitet und gerüstet. Von Ameln und Wimmer meinen, dass Organisationen in der Zwischenzeit so gebaut sein müssen, dass sie angesichts dieser neuen Qualität an Veränderungsdynamik ihrer relevanten Umwelten antwortfähig bleiben. „Dafür sorgen neue Formen der Strukturierung der organisationsinternen Verhältnisse, alternative Organisationsdesigns, eine Abflachung der Hierarchien, netzwerkförmige, auf Flexibilität und Agilität ausgelegte Kooperationsformen“ (von Ameln, Wimmer, 2016, S. 14). Damit in Zusammenhang stehen auch veränderte Führungspraktiken, die anspruchsvollere Führungsleistungen zur Verfügung stellen, um diesen neuen Herausforderungen gerecht zu werden (vgl. von Ameln, Wimmer, 2016, S. 12ff).
Das deutsche Bundesministerium für Arbeit und Soziales hält in seinem „Grünbuch - Arbeit 4.0 - Arbeit weiter denken“ fest, dass durch den kulturellen und gesellschaftlichen Wandel neue Ansprüche an Arbeit entstehen. Auch die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen verändert sich. Und: „Wie die zukünftige Arbeitswelt im Einzelnen aussehen wird, ist noch offen“ (BM für Arbeit und Soziales, 2015, S. 35).
Festgehalten werden kann dabei, dass MitarbeiterInnen im Mittelpunkt aller Organisations- und Führungsstrukturen stehen müssen, denn er/sie ist es, der/die ein Unternehmen erfolgreich macht. Das Wissen, die Motivation und die Ideen von MitarbeiterInnen führen zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
„Das Ziel einer zukunftsfähigen Unternehmensführung muss es daher sein, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das allen Mitarbeitern Bestleistungen ermöglicht und ihre Fähigkeiten für den Erfolg des Unternehmens nutzt“ (Haufe Whitepaper, 2015, S. 3). Das menschliche Leistungsvermögen wird aufgrund der Veränderungen der unternehmerischen Umwelten auf ganz neue Weise und in einem ganz neuen Umfang benötigt. „ Durch […] ist die Leistungsfähigkeit von Organisationen heutigen Zuschnitts in einem noch nie dagewesenen Ausmaß davon abhängig geworden, dass Beschäftigte nicht nur ihre festgelegte und vorprogrammierte Arbeit erledigen, sondern dass sie in jedem Augenblick mit hoher Aufmerksamkeit das Geschehen (intern und extern) verfolgen, mit großer Urteilskraft das je anzutreffende Situationspotential einschätzen und, wenn erforderlich, eigenverantwortlich die notwendigen Entscheidungen für das, was ansteht, herbeiführen“ (von Ameln, Wimmer, 2016, S.13).
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der Frage, wie Organisationen Arbeit erfolgreich organisieren. Und wie, gemäß den veränderten Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft, neue, veränderte Formen des Organisierens von Arbeit, konkret aussehen könnten. Der Fokus dieser Arbeit über neue Organisationsformen von Arbeit liegt dabei auf den Wechselwirkungen zwischen Hierarchiefreiheit bzw. reduzierten Hierarchien in Unternehmen auf der einen Seite und Faktoren wie Partizipation, Selbstorganisation, neuen Entscheidungsabläufen und einem Transparenzparadigma auf der anderen Seite. Die Suche nach dem besten Weg Arbeit zu organisieren, beschäftigt bei gleichen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowohl gewinnorientierte als auch nicht gewinnorientierte Organisationen. Der Autor beschränkt sich in dieser Forschungsarbeit auf die Untersuchung gewinnorientierter Unternehmen.
Als Human Resources Professional sieht der Autor die immense Herausforderung für HR, eine adäquate Übersetzungsleistung dieser veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in die Unternehmensorganisation zu bewerkstelligen. Die berufliche Sozialisation des Autors in multinationalen IT-Konzernen westlicher und östlicher Kulturprägung ist gekennzeichnet von Erfahrungen mit hierarchischen Organisationsmodellen. Erfolgsfaktoren und Dysfunktionalitäten der pyramidalen Unternehmensstrukturen bieten die Ausgangsbasis für das persönliche Forschungsinteresse des Autors im Rahmen dieser Masterarbeit. Sollte der Trend hin zu neuen Organisationsformen von Arbeit anhaltend sein, dann erwartet der Autor massive Auswirkungen auf das unternehmerische Denken und Handeln, auf die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins sowohl auf persönlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene, auf die Felder Forschung, Lehre, Beratung und das gesamte Schulsystem.
1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen
Die Bezeichnung „Neue Organisationsformen“ ist kein einheitlich definierter Begriff. Neue Organisationsformen sind kein vollkommen neues Phänomen. Kreative, disruptive QuerdenkerInnen haben ihren Produkt- und Dienstleistungsideen auch immer wieder traditionsbrechende oder visionäre Organisationsformen folgen lassen. Die meisten davon führten ein relativ unerkanntes Inseldasein. Nur wenige dieser Unternehmen sind damit vor den Vorhang getreten und haben ihre inneren Funktionsweisen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit besteht in der Neugierde, die Motive und Antriebe von UnternehmensgründerInnen bzw. UnternehmenslenkerInnen zu erforschen, die in ihrem Unternehmen eine Abkehr vom klassischen Paradigma der tayloristischen Unternehmensführung in die Wege geleitet haben und der interessierten Fachwelt zugänglich zu machen. Um den Forschungsfokus zu gestalten, wurden Themenbereiche zur Erforschung ausgewählt, die das „warum“, „was“ und „wie“ von neuen Organisationsformen erklärbar machen.
Zugrunde liegen Fragen nach den Beweggründen, aus welchen Gründen und aus welchen Motiven Unternehmen einen intendierten Veränderungsprozess angestrebt haben. Welche Sehnsüchte, Hoffnungen, Notwendigkeiten oder Strategien stellen die Antriebsenergien dar? Ist es ein „weg von“ konventionellen oder ein „hin zu“ neuen Organisationsformen? Und was genau soll es dem Unternehmen bringen? Die Frage nach dem Nutzen unterstellt einen subjektiv empfundenen Mehrwert der neuen Organisationsform für das Unternehmen. Spezifisch interessant ist, welche Gruppen oder Stakeholder des Unternehmens einen Vorteil aus der veränderten Organisationsform ziehen und was konkret als Nutzen empfunden wird.
Näher untersucht werden soll, wie sich „neue“ Organisationsformen nun von konventionellen Unternehmen unterscheiden. Welche anderen, eventuell neuen Praktiken oder Aspekte weisen sie auf bzw. setzen sie im Unternehmensalltag ein? Hinterfragt werden soll, ob und welche Bedingungen es braucht, damit eine Transformation gelingen kann. Welche speziellen Effekte dieser Art treten in Unternehmen auf, die unterscheidbar sind von den vielleicht bekannten Phänomenen in konventionellen Organisationen? Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stehen auch die besonderen Schwierigkeiten, die Stolpersteine, die Herausforderungen, die in „neuen“ Organisationformen auftreten und wie diese gelöst werden. Interessant ist dabei die Frage nach den Gründen, die eine Rückkehr zu einer konventionellen Organisationsform sinnvoll erscheinen lassen. Im Speziellen soll auch die Begrifflichkeit und Tatsächlichkeit der Hierarchiereduktion und der Heterarchie genauer geprüft und einer kritischen Bewertung zugeführt werden.
Diese Herangehensweise mündet in einer Hauptforschungsfrage und zwei Unterforschungsfragen:
Hauptforschungsfrage: Was bewegt Unternehmen zur Transformation in Richtung hierarchiefreie oder hierarchiereduzierte Organisationsformen und welchen Nutzen ziehen sie aus ihrer Sicht daraus?
Erste Unterforschungsfrage:Welche neuen Aspekte der Organisationsgestaltung weisen neue Organisationsformen von Arbeit auf und welche Bedingungen und Effekte zeichnen sie aus?
Zweite Unterforschungsfrage:Was sind die größten Herausforderungen in neuen Organisationsformen und welche Gründe sprechen für eine mögliche Rückkehr zu einer konventionellen Organisationsform?
1.3 Forschungsstrategie
Die Erarbeitung der theoretischen Grundlagen dienen der hinreichenden Beantwortung der Forschungsfragen und dem besseren Verständnis und Interpretation der Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Zusammenhänge bei diesem Thema erfolgte bisher nach Meinung des Autors unzureichend. Wesentliche Phänomene neuer Organisationsformen wurden bis dato bloß theoretisch, zu isoliert und ohne ausreichende Berücksichtigung der Kontexte betrachtet. Als Ausnahme ist Frederic Laloux zu sehen, der mit „Reinventing Organizations“ ein multiperspektivisches Grundlagenwerk auf Basis der Analyse von 11 Unternehmen geschaffen hat. Durch diese Masterarbeit soll ein wesentlicher Beitrag zur Diskussion erfolgen, ob und wie neue Organisationsformen die richtige Antwort auf das veränderte unternehmerische Umfeld sein können.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zwei große Abschnitte. In den theoretischen Grundlagen werden relevante Aspekte der Unternehmensführung, der Organisationsentwicklung und der Wirtschaftspsychologie dargestellt und diskutiert. Eine umfassende Aufarbeitung der Literatur zu diesem Thema bildet die Grundlage für ein Verständnis des Bereiches „Neues Organisationsformen“ und den theoretischen Unterbau für die Ergebnisse der empirischen Untersuchung.
Die empirische Untersuchung wurde in Form von neun qualitativen Experteninterviews mit GründerInnen, GeschäftsführerInnen und MitarbeiterInnen von fünf Unternehmen durchgeführt, die kürzlich eine Transformation in Richtung hierarchiefreie oder hierarchiereduzierte Organisationsform gestartet haben oder sich bereits länger in einer Transformationsphase befinden. Insgesamt wurden dabei die Sichtweisen von elf Personen erhoben. Anschließend erfolgt die Darstellung, Interpretation und Deutung der Ergebnisse und ein Ausblick in die Zukunft.
2 Theoretische Grundlagen
In diesem Abschnitt werden jene Modelle, Theorien und Begrifflichkeiten dargestellt, die dem Leser / der Leserin ein grundlegendes Verständnis für neue Organisationsformen ermöglichen sollen. Die theoretischen Grundlagen beschreiben die vielfältigen organisationalen Aspekte, auf deren Basis die Ergebnisse der empirischen Untersuchung interpretiert, eingeordnet und verstanden werden können. Um der Breite des Themas gerecht zu werden, wird in dieser Arbeit wiederholt auf allzu detaillierte Beschreibungen verzichtet und stattdessen auf weiterführende Quellen verwiesen.
Die Gliederung der theoretischen Grundlagen beschreibt das Überblicksschema von Organisationsmodellen nach Frederic Laloux. Laloux (2015, S. 11ff) unternahm den Versuch, die Entwicklungen von Organisationsformen von Arbeit basierend auf bzw. in Zusammenhang mit den menschlichen Evolutionsstufen zu charakterisieren. Dafür greift Laloux auf bereits existierende Modelle zurück, wie die Integrale Theorie von Ken Wilber oder Spiral Dynamics von Don Beck/Chris Cowan, die ihrerseits wieder auf den Forschungen von Clare Graves aufbauen. Aus dieser Beschreibung verwendet der Autor vier Paradigmen und ordnet jedem Paradigma wissenschaftliche Erkenntnisse, einschlägige Informationen und Gestaltungselemente aus der Unternehmensführung, der Wirtschaftspsychologie und der Organisationsentwicklung zu.
Tab. 1: Entwicklung von Organisationsformen nach Frederic Laloux. Darstellung von fünf Organisationsformen, gereiht nach der Entwicklung von Bewusstseinsstufen. Laloux weist den Stufen Farben zu, die der Autor zum Zweck der Vollständigkeit anführt, Quelle: Laloux, 2015, S. 36f und eigene Ergänzungen
2.1 Das traditionelle konformistische Paradigma
Dem traditionellen konformistischen Paradigma ordnet Laloux die Farbe Bernstein zu und attestiert ihm zwei neue Kennzeichen des evolutionären Fortschritts (vgl. Laloux, 2015, S. 17ff): erstens eine langfristige Perspektive des Unternehmens durch stabile Prozesse und zweitens Größe und Stabilität durch formelle Hierarchie. Formelle Titel, feste Hierarchien und Organigramme gestalten eine stabile Pyramide mit einer Kaskade formeller Kommunikationswege von den Mächtigen zu den Untergebenen (vgl. Laloux, 2015, S. 20). Im Allgemeinen lässt sich eine Hierarchie als Gesamtheit von Elementen charakterisieren, die durch Über- und Unterordnungsbeziehungen miteinander verbunden sind. Im Kontext von Organisationen können der Hierarchie vier Funktionen zugeordnet werden: erstens eine Vereinfachung und Verkürzung von Entscheidungen, quasi eine Lösung für das „Problem der großen Zahl“. Zweitens schafft sie eine stabile Ordnung mit generalisierten Verhaltenserwartungen, die auch bei häufigem Wechsel der Mitglieder gewährleistet werden kann. Drittens schafft Hierarchie persönliche Autorität, die nicht ständig neu legitimiert werden muss. Und viertens ermöglichen hierarchische Weisungsrechte die bessere Kontrolle von opportunistischem Verhalten (vgl. Wirtschaftslexikon, 2017, Hierarchie). Zum besseren Verständnis des traditionellen konformistischen Paradigmas soll nun folgend auf die Methoden von Taylor und Ford eingegangen werden.
1911 legte Frederick Winslow Taylor als Chefingenieur von Stahlwerken mit seinem Buch „The Principles of Scientific Management / Die Grundsätze wissenschaftlicher Betriebsführung“ (vgl. Kieser, 2016, S. 99f) den Grundstein für ein System strategischer Gestaltungsziele: 1. Trennung von Hand- und Kopfarbeit, 2. Pensum und Bonus, 3. Auslese und Anpassung der Arbeiter. Taylor`s Grundsatz, Faustregeln durch wissenschaftliche Ansätze zu ersetzen, manifestierte sich unter anderem in Zeit- und Bewegungsstudien, die zu einer Maximierung von Leistungsmöglichkeiten führten (vgl. Kieser, 2016, S. 99f). Die Planung und Ausführung von Arbeit sind strikt getrennt, denn das Denken geschieht oben und das Tun unten. Die Entscheidungen, die oben gefällt werden, gelangen durch aufeinanderfolgende Managementebenen nach unten, die mit subtilen und verfeinerten Kontrollmechanismen sanktioniert werden. Dazu wird ein ganzer Katalog von Regeln formuliert. Einige Mitarbeiter werden damit beauftragt, die Befolgung dieser Regeln zu überprüfen und Disziplinarmaßnahmen und Strafen zu verhängen, wenn sie gebrochen werden (vgl. Laloux, 2015, S. 20).
Nach diesem Ansatz verhalten sich die Arbeiter wie Teile einer komplizierten Maschine: Wenn sie die richtige Arbeit auf die richtige Weise zur richtigen Zeit erledigten, würde die Maschine problemlos funktionieren. Menschen würden rational auf äußere Antriebskräfte wie Belohnung und Bestrafung (extrinsische Motivatoren) reagieren und dadurch sich selbst und dem Unternehmen Erfolg bringen (vgl. Pink, 2010, S. 29). Vieles im tayloristischen Prinzip zielte darauf ab, Kontrolle über die Arbeiter und ihr Verhalten zu bekommen und so die Arbeiter im Griff zu haben (vgl. Schermuly, 2016, S. 27). Man muss ihnen sagen, was von ihnen erwartet wird. Das Management muss Anweisung und Kontrolle nutzen, um Resultate zu erzielen. „Die Arbeitsplätze in der Produktion haben eine enge Aufgabenbeschreibung und basieren auf Routine. Innovation, kritisches Denken und Selbstausdruck sind nicht wichtig (und werden oft als hinderlich gesehen). Information wird nur geteilt, wenn es nötig ist. Menschen sind im Grunde austauschbare Ressourcen; individuelle Talente werden nicht erkannt und entwickelt“ (Laloux, 2015, S. 20f).
Die Fortsetzung dieses Ansatzes ist eng mit der Fließbandproduktion und dem Namen Henry Ford verbunden, der die Messmethoden von Taylor in praktisches Management umsetzte (vgl. Geschwill, Nieswandt, 2016, S. 38). Durch die Bedingungen der Fließfertigung konnte man die Arbeiter noch besser und sogar kostengünstiger kontrollieren (vgl. Schermuly, 2016, S. 28). Damit begründeten Taylor und Ford Management als eine Organisationsmethodik, die sich aus Sicht von Kritikern nicht wesentlich von unserem heutigen Management unterscheidet (vgl. Pfläging, 2014, S. 12).
Laloux wählt als Analogie für die traditionelle, hierarchische Organisation die Armee. „In einer rigiden Hierarchie muss es eine eindeutige Befehlskette, formelle Prozesse und klare Regeln geben, womit festgelegt wird, wer welche Aufgabe hat. Von den einfachen Arbeitern am Boden der Pyramide wird erwartet, dass sie die Befehle genau befolgen und keine Frage stellen, um dafür zu sorgen, dass das Bataillon in guter Ordnung marschiert“ (Laloux, 2015, S. 21).
2.2 Das moderne leistungsorientierte Paradigma
Das moderne leistungsorientierte Paradigma (Orange) charakterisiert Laloux durch 3 Durchbrüche: Innovation, Verlässlichkeit und Leistungsprinzip (vgl. Laloux, 2015, S. 25f). „Aus Befehl und Kontrolle traditioneller Organisationen wird das Vorhersehen und Kontrollieren moderner Organisationen“ (Laloux, 2015, S. 26). Zum Zweck des Konkurrenzvorteils wird die Intelligenz vieler MitarbeiterInnen genutzt. Das Management führt nach Zielvorgaben. Ziele werden gesetzt, kontrolliert und man meint, dass Menschen durch materiellen Erfolg motiviert werden. Traditionelle Organisationen benutzten noch die Peitsche, in modernen Organisationen kommt Zuckerbrot zum Einsatz (vgl. Laloux, 2015, S. 26).
2.2.1 Führung und Management
Eine bedeutende Aufgabe kommt im modernen leistungsorientiertem Paradigma dem Thema Management und Führung zu. Aus diesem Grund wird nachfolgend ein kurzer Überblick über die Entwicklung von Führung und Management gegeben und einige Führungsansätze konkret beschrieben.
Obwohl die die Geschichte des Managements weit zurückreicht, hat die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert die Nachfrage nach Management explodieren lassen. Die grundlegende Annahme war zunächst, dass Organisationen Maschinen sind, die analytisch berechenbar sind und gesteuert werden können (vgl. Boos, Mitterer, 2014, S. 83f). Dieses Bild einer Organisation basiert auf klaren Hierarchien und Aufgabenverteilungen. MitarbeiterInnen sind kleine Rädchen in einem größeren System und Abweichungen müssen zentral ausgesteuert und korrigiert werden. Der Manager wird zum Ingenieur, der Standardisierungen und Vereinfachungen von Prozessen und Strukturen sicherstellt und die Maschine optimiert. Der Ingenieur ist selbst nicht Teil jener Organisation, die es zu optimieren gilt: er ist der Konstrukteur (vgl. Boos, Mitterer, 2014, S. 12f). Daraus abgeleitet wurden zuerst Führungsstile, die den Stil des Führenden beschreiben: Z.B von Kurt Lewin der autoritäre, demokratische und laisser-faire Führungsstil (vgl. Frey, Hauser, 2013, S. 97). Weiterentwickelt wurden feinere Modelle von Führungsverhalten, die den Menschen in seiner Ganzheit Stück für Stück mehr berücksichtigten und nützten. Die transaktionale Führung basiert auf der Idee des Tausches: Für das Engagement und die Zielerreichung bekommt der /die MitarbeiterIn eine Belohnung. Management by Objectives und Zielvereinbarungen sind die Methoden der transaktionalen Führung (vgl. Hofert, 2016, S. 45).
Das Modell der transformationalen Führung ist als wesentliche Weiterentwicklung der transaktionalen Führung zu sehen. Hier liegen die Schwerpunkte auf Vorbild sein und Vertrauen schaffen (Identification), durch Herausforderungen motivieren, die auf Werten basieren (Inspiration), zur selbständigen, kreativen Problemlösung anregen (Stimulation) und individueller Förderung und Coaching (Consideration). Zu einem späteren Zeitpunkt wurden drei weitere Aspekte ergänzt: effektive Kommunikation (Fairness), unternehmerische Haltung (Innovation) und Umsetzungsstärke (Ergebnisorientierung) (vgl. Korn, 2016, S. 135).
Der Ansatz des Collaborative Leadership stellt die Aspekte Creativity, Communication, Consensus und Contribution in den Beziehungsmittelpunkt zwischen Führungskraft und MitarbeiterIn (vgl. Pichler, 2016b, S. 37f).
Weiterführende Konzepte verstehen sich bereits als Ergänzung und/oder Alternative zu traditionellen hierarchischen Führungskonzepten. Als ein Beispiel kann Shared Leadership (SL)/Geteilte Führung gesehen werden: als gegenseitiger Beeinflussungsprozess von Personen in einer Gruppe um sich gegenseitig zu einem Gruppen- oder organisationalen Ziel zu führen. Inkludiert sind dabei sowohl KollegenInnen als auch hierarchisch über- oder untergeordnete Personen. Dabei wechseln die Gruppenmitglieder je nach Notwendigkeit aktiv und intentional die Führungsrolle. Vier Typen werden beschrieben: direktive SL, transaktionale SL, transformationale SL und empowering SL (vgl. Winkler, 2012, S. 4).
Das Konzept der lateralen Führung wurde als Instrument für hierarchische Organisationsformen erdacht. Diese Führungskonzeption steht allen Organisationsmitgliedern zur Verfügung mit der Absicht, auf andere einzuwirken, über die sie keine hierarchischen Weisungsbefugnisse haben. Genutzt werden dabei die Einflussmechanismen Verständigung, Macht und Vertrauen. Laterales Führen soll Handlungsmöglichkeiten eröffnen, ohne dass die formalen Strukturen einer Organisation grundlegend geändert werden müssen (vgl. Kühl, Schnelle, 2009, S. 51f).
Obwohl bereits in den 1970er Jahren entwickelt, ist der Begriff Servant Leadership/dienende Führung noch nicht etabliert. Die Idee des Begründers Robert Greenleaf war die kompromisslose Orientierung am Wohl der Organisation und ihrer Individuen durch den/die Führende/n. Servant Leadership beginnt mit dem Bedürfnis des Führenden, zunächst einen eigenen Beitrag zum Wohl einer Organisation oder anderer Individuen zu leisten. Das ruft Vertrauen hervor, das die Geführten daraufhin in die Führung dieser Person setzen – um ihr sodann freiwillig zu folgen (vgl. Schnorrenberg, 2016).
Abhängig von Kultur, Unternehmenskultur, Branche, Größe und Entwicklungsphase des Unternehmens findet man heute die gesamte Bandbreite an Führungsmodellen.
Exkurs: 1960 veröffentlichte Douglas McGregor „The human side of enterprise“. Darin beschrieb er zwei Menschenbilder, die er Theory X und Theory Y nannte: „Entweder man geht davon aus, dass die Menschen von Natur aus faul und dumm sind, so wenig wie möglich arbeiten und Verantwortung meiden wo es nur geht, die Regeln überlisten und sich einen egoistischen Vorteil verschaffen, auch wenn das auf Kosten der Gemeinschaft geht. Kreativität und schöpferische Fähigkeiten sind nur einigen wenigen in die Wiege gelegt worden. Oder man geht davon aus, dass sie Menschen von Natur aus motiviert sind, den unbedingten Willen haben, sich zu entfalten und zu entwickeln. Sie haben ihren eigenen Antrieb etwas zu leisten, und sind unter den richtigen Bedingungen bereit, alles zu geben und ihre Kreativität zielgerichtet und zum Wohle des Ganzen einzusetzen, um Probleme zu lösen“ (Pfläging, 2009, S.20f). McGregor wies auf den Missstand hin, dass, wenn alle autoritären Chefs alle Menschen und folglich auch ihre MitarbeiterInnen für „von Natur aus faul“ halten und sie sie deshalb immer nur bevormunden, dies zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung führt. Denn wem nichts zugetraut wird, der zeigt bald tatsächlich ein rein passives Arbeitsverhalten. McGregor wandte sich mit Nachdruck gegen das damals vorherrschende tayloristische Gedankengut und plädierte dafür, dass Chefs besser davon ausgehen sollten, dass sich der Mensch durch Arbeit, Eigeninitiative und Kreativität selbst verwirklichen will. McGregor empfahl daher dringend, die MitarbeiterInnen bei der Zielfindung und bei Entscheidungen mitreden zu lassen und Verantwortung zu delegieren (vgl. Pichler, 2016a, S. 16f).
Tab. 2: Beschreibung Theorie „X“ und Theorie „Y“. Die Punkte 1–8 sind nach McGregor formuliert, 9 und 10 wurden von Hofert hinzugefügt, Quelle: Hofert, 2016, S.49
2.2.2 Motivation
Das Leistungsprinzip ist von wesentlicher Bedeutung im modernen leistungsorientieren Paradigma und steckt schon in dessen Namen. Das Leistungsprinzip ist nicht nur ein Durchbruch sozialer Fairness (vgl.Laloux, 2015, S. 27). Es wirft den Blick auf das Individuum und seine persönliche Motivation, sich im Rahmen des Leistungsprinzips zu positionieren. Nachfolgend führt der Autor einige grundlegende Perspektiven und Strömungen aus der Motivationsforschung aus.
Zu Beginn steht eine Klärung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Erstens resultiert Verhalten, das intrinsisch motiviert ist, aus einem personeninternen Antrieb, während extrinsisch motiviertes Verhalten durch personenexterne Faktoren verursacht wird. Zweitens führt bei einem intrinsisch motivierten Verhalten die Durchführung der Aktivität unmittelbar zu einer Bedürfnisbefriedigung, so dass die Handlung um ihrer selbst willen angestoßen wird. Im Vergleich dazu beinhaltet eine extrinsisch motivierte Handlung ein spezifisches Ziel, dessen Erreichen unabhängig von der Aktivität eine Bedürfnisbefriedigung herbeiführt. Somit dient die extrinsische Motivation im Gegensatz zur intrinsischen Motivation einer mittelbaren Befriedigung der Bedürfnisse (vgl. Kunz, Quitmann, 2011, S. 58).
Frederick Herzberg baute seine Motivationsforschung nicht auf den Motiven des Handelns auf, so wie das Abraham Maslow vor ihm getan hatte, sondern erforschte die Anreize für das Handeln des Menschen im Arbeitskontext. Seine Forschungsergebnisse fokussierten sich auf zwei Klassen von Faktoren: Hygienefaktoren und Motivatoren (vgl. Trimpop, 2013, S. 84ff). Solange Hygienefaktoren nicht erfüllt sind, führt das zu Unzufriedenheit. Werden sie aber erfüllt, führt das nicht zu Zufriedenheit, sondern zu einem neutralen Erlebniszustand, der als Nicht-Unzufriedenheit bezeichnet wird. Beispiele dafür sind die Unternehmenspolitik, die fachliche Führung, die Beziehung zu Vorgesetzen, die formalen Arbeitsbedingungen, die Entlohnung und auch die Beziehung zu KollegInnen. Zufriedenheit wird hingegen von den Motivatoren erzeugt, die überwiegend mit der Tätigkeit unmittelbar verknüpfte Faktoren thematisieren (Leistungserlebnisse, Anerkennung, die Arbeit selbst, Verantwortung, Beförderung und Wachstum). Das Modell von Herzberg fordert ein komplexeres Wenn-Dann-Denken, statt einfacher Reiz-Reaktionsmuster. Herzberg hält fest: „Wenn man MitarbeiterInnen motivieren will, muss man dafür sorgen, dass erstens die Hygienefaktoren nicht stören und zweitens die Motivatoren erfüllt sind“ (Trimpop, 2013, S. 87).
Abb. 1: Darstellung der Hygienefaktoren und Motivatoren nach Herzberg, links/hellgrau: Hygiene-Faktoren, rechts/dunkelgrau: Motivatoren, Quelle: Trimpop, 2013, S. 87
Hackman und Oldham bauten 1975 ihr Job Characteristics Model (JCM) auf der Grundlage von Herzbergs Zweifaktoren Modell. Grundlegend dabei sind fünf Merkmale der Tätigkeit, die, vermittelt über psychologisches Erleben, auf die Arbeitszufriedenheit und die Arbeitsmotivation wirken. Das erste Merkmal ist die wahrgenommene Autonomie, die man bei der Planung und Ausführung der Arbeit wahrnimmt und die sich auf den psychologischen Erlebniszustand der wahrgenommenen Verantwortlichkeit auswirkt. Das zweite Tätigkeitsmerkmal ist die Rückmeldung durch die Aufgabe an sich, die sich über das (psychologische) Wissen um die Resultate der Arbeit positiv auf die Arbeitsmotivation auswirkt. Die nächsten drei Merkmale wirken zusammengenommen auf die erlebte Bedeutsamkeit der Arbeit ein und können so die Arbeitsmotivation erhöhen. Das dritte Merkmal ist die Ganzheitlichkeit. Sie beschreibt, wie sehr die Arbeitenden eine in sich vollständige und abgeschlossene Tätigkeit von Anfang bis Ende durchführen können. Mit der Vielfalt wird beschrieben, inwiefern die Tätigkeit unterschiedliche Aufgaben umfasst. Und das fünfte Merkmal Bedeutsamkeit der Tätigkeit ist dadurch gekennzeichnet, dass die eigene Arbeit für das Leben anderer Menschen wichtig ist (vgl. van Dick, Stegmann, 2016, S. 50). Van Dick und Stegmann weisen in ihren Studien nach, dass, je bedeutsamer die Befragten ihre Tätigkeit wahrnahmen, desto mehr identifizierten sie sich mit ihrem Unternehmen. Diese Identifikation führte wiederum zu mehr Arbeitszufriedenheit, zu mehr Organizational Citizenship Behavior, geringeren körperlichen Beschwerden und geringeren Kündigungsabsichten (vgl. van Dick, Stegmann, 2016, S. 54ff).