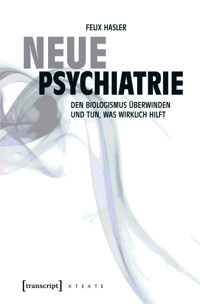
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: X-Texte zu Kultur und Gesellschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
»Leidet die Psyche, ist das Gehirn erkrankt«. Dieses Dogma der Biologischen Psychiatrie hat das Fach über lange Zeit als zentrales Paradigma der Forschung beherrscht. Die neurowissenschaftliche Wende hat den psychiatrischen Blick auf Gene und Moleküle gelenkt - und dabei den Menschen aus den Augen verloren. Kluge Wissenschaftler*innen, jahrzehntelange Forschung und Multimilliarden-Investitionen konnten der Biologischen Psychiatrie zu keiner Relevanz für die klinische Praxis verhelfen. Doch leise und allmählich zeichnen sich Veränderungen ab. Die Zukunft der Psychiatrie wird multiprofessionell, flexibel, digital und praxisorientiert sein. Felix Haslers pointierte Analyse ist ein vorgezogener Nachruf auf eine erfolglose, aber nebenwirkungsreiche Idee und ein Plädoyer für eine Neue Psychiatrie des pragmatischen Handelns.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Ähnliche
Felix Hasler (Dr. pharm.) ist Research Fellow an der Berlin School of Mind and Brain der Humboldt-Universität zu Berlin, Gastwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und Wissenschaftsjournalist. Zuvor forschte er an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich.
»Leidet die Psyche, ist das Gehirn erkrankt«. Dieses Dogma der Biologischen Psychiatrie hat das Fach über lange Zeit als zentrales Paradigma der Forschung beherrscht. Die neurowissenschaftliche Wende hat den psychiatrischen Blick auf Gene und Moleküle gelenkt – und dabei den Menschen aus den Augen verloren. Kluge Wissenschaftler*innen, jahrzehntelange Forschung und Multimilliarden-Investitionen konnten der Biologischen Psychiatrie zu keiner Relevanz für die klinische Praxis verhelfen. Doch leise und allmählich zeichnen sich Veränderungen ab. Die Zukunft der Psychiatrie wird multiprofessionell, flexibel, digital und praxisorientiert sein. Felix Haslers pointierte Analyse ist ein vorgezogener Nachruf auf eine erfolglose, aber nebenwirkungsreiche Idee und ein Plädoyer für eine neue Psychiatrie des pragmatischen Handelns.
Felix Hasler
Neue Psychiatrie
Den Biologismus überwinden und tun, was wirklich hilft
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2023 transcript Verlag, BielefeldAlle Rechte vorbehalten. Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.
Umschlaggestaltung: Kordula Röckenhaus, Bielefeld
Umschlagabbildung: Haris Mulaosmanovic / photocase.de
Korrektorat: Maren Fritsch, Bielefeld
Print-ISBN 978-3-8376-4571-2
PDF-ISBN 978-3-8394-4571-6
EPUB-ISBN 978-3-7328-4571-2
Buchreihen-ISSN: 2364-6616
Buchreihen-eISSN: 2747-3775
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Vorbemerkung
Kapitel 1: Große Hoffnung, große Enttäuschung
Die Psychiater der Zukunft sind Neurowissenschaftler
Der heilige Gral der Biopsychiatrie
Vom Aberglauben zur Wissenschaft
Ein Starpsychiater schmeißt hin
Das Arzneibuch der Psychiatrie ist ausgeschöpft
Kapitel 2: Eine Vorhersage erfüllt sich nicht
Große Studien und verdächtige Gene
Immer mehr Daten, aber nicht mehr Erkenntnis
5‐HTTLPR ist schuld an allem
Journalisten erfinden eine blumige Metapher
Die Psychiatrieforschung halluziniert Luftschlösser
Es hätte so schön werden können: Bildgebende Verfahren in der Psychiatrie
Keine Unterschiede in der Gehirnaktivierung von Gesunden und Depressiven
Die biomedizinische Revolution in der Psychiatrie hat nicht stattgefunden
Kapitel 3: Kleine Geschichte der Schizophrenieforschung
»Fehler, die ich in meiner Forschungskarriere gemacht habe«
Schizophrenie, eine progressiv fortschreitende Gehirnerkrankung?
Ein schwerwiegender Verdacht
Dann eben andersrum: Schizophrenie als Gehirn‐Entwicklungsstörung
Kapitel 4: Psychiatrischer Neurozentrismus und seine Folgen
Eine wissenschaftliche Ideologie mit Nebenwirkungen
Antidepressiva im Dauer‐Boom
Ein Streit unter Psychiatern entbrennt
Die Realität widerlegt ein abenteuerliches Argument
Sonderfall Lithium
Wirkmechanismen von Psychopharmaka kennen wir meist nicht
Versprechung Präzision: Die personalisierte Psychiatrie
Fragwürdige Gentests
Einbildungen mit Einbildungen bekämpfen
Letzte Hoffnung OMICS
Kapitel 5: Weiter wie immer und alles ganz anders
Neuro‐Großprojekt I: Das Human Brain Project
Neue Bescheidenheit
Neuro‐Großprojekt II: BRAIN Initiative
Neuro‐Großprojekt III: Konnektomik
Letzte Hoffnung Maschinenintelligenz
Neuroplastizität: Im Extremfall reicht auch ein halbes Gehirn
Britische Psychologen proben den Aufstand
Fällt ein Stein, fallen alle
Vom biologischen Reduktionismus zum psychosozialen Reduktionismus
Muss Psychiatrie überhaupt ein medizinisches Fach sein?
Medizinische Diagnosen gewähren Schutz und Unterstützung
Das NIMH trifft eine schwierige Entscheidung
Ist das Ganze etwas anderes als die Summe seiner Teile?
Kapitel 6: Telepsychiatrie und das neue Zeitalter digitaler Interventionen
Ein unerwartetes Comeback der Verhaltensbeobachtung
Gut gelaunte Menschen sitzen vor Laptops
Und plötzlich geht alles ganz schnell
Therapieplätze sind Mangelware
Mit Maschinen über Sorgen reden
7,6 Minuten Zeit für einen Patienten
Der digital Divide – bald auch in der Psychiatrie?
Eine Tablette mit Sensor überwacht die Therapietreue
Hybride Therapiebeziehungen in einer digitalen Welt
Kapitel 7: Ein Comeback der Sozialpsychiatrie
Das Blickfeld der Psychiatrie erweitert sich
Die Psychiatrie‐Enquête, ein Meilenstein der Sozialpsychiatrie
Überstürzte Psychiatriereform überfordert Kranke und Angehörige
Gefängnisse sind Amerikas größte Psychiatrieeinrichtungen
Der Tod aus Verzweiflung nimmt zu
Dort hingehen, wo die Menschen sind
Warum Patienten mit der konventionellen Versorgung unzufrieden sind
Lebensqualität geht vor Symptomreduktion
Jeder kann Therapeut sein
»Psychiatrie ist die Disziplin der Geduld«
Sprache, Sprechen und die Dialogische Praxis
Transparente Strukturen und klare Regeln
Kapitel 8: Experten durch Erfahrung. Die Stimme der Betroffenen
Verhandeln statt Behandeln
Für die Krankenkasse bleibt ein Patient ein Patient
Ex‑Patienten stören den gewohnten Betrieb
Kapitel 9: Neo‐Psychedelik und die Hoffnung auf heilsame Trips
Die Psychopharmakologie steckt in der Krise. Moment mal – vielleicht doch nicht?
Von der Neurotransmitter‐Regulation zur pharmako‐spirituellen Erfahrung
Was ist neu an der neuen Psychedelik?
Eine republikanische Milliardärstochter finanziert MDMA‐Studie
Verzweiflung oder FDA‐bewilligt?
Investoren landen auf dem Boden der Tatsachen
Das Verteidigungsministerium wünscht sich nicht‑psychedelische Psychedelika
Wirkt Psilocybin auch unter Narkose?
Psychedelische Erfahrungen haben die gleichen Schwächen wie religiöse Bekehrungen
Mit Bewusstseinserweiterung gegen den Weltuntergang
Kapitel 10: Psychopharmaka – je weniger, desto besser
Auch Psychiater brauchen Hilfe beim eigenen Entzug
Antidepressiva können Depressionen verstärken
Selbsthilfegruppen haben Recht, die Leitlinien sind falsch
Absetz‐Syndrom klingt besser als Entzugserscheinungen
Zurück in die Zukunft: Ein Comeback für die Neurose?
Hausärzte verschreiben zu häufig Psychopharmaka
Medikamente sind schlecht, Psychotherapie ist gut?
Kapitel 11: Aufbruch in eine pragmatische Psychiatrie
Wir müssen akzeptieren, dass auch psychische Erkrankungen unheilbar und tödlich sein können
Der Wandel in der Psychiatrie wird von der Basis ausgehen
Die akademische Psychiatrie, eine Welt ganz für sich
Das ideologische Immunsystem der Wissenschaft wehrt sich
Auf dem Weg in eine neue Behandlungskultur
Es muss akzeptierte Möglichkeiten geben, seltsam zu sein
Vom Neuro‐Papst zum Sozialpsychiater
Veränderung ist möglich
Nachbemerkung
Literatur‐ und Quellenverzeichnis
Vorbemerkung
Irgendwann so um 2004 saß ich in meinem Büro, schaute zum Fenster hinaus und dachte: Seltsam. Kann das wirklich sein? Ich arbeitete damals an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich in der Fachgruppe Neuropsychopharmacology und Brain Imaging und suchte nach einer Literatur‐Referenz, die ich für eine wissenschaftliche Publikation benötigte. Es ging dabei nicht um eine technische Spitzfindigkeit, sondern um etwas ganz Grundlegendes. Ich suchte nach einer Übersichtsarbeit, die belegt, dass das Serotoninsystem bei psychischen Störungen eine wichtige Rolle spielt, insbesondere bei Depressionen. Schnell erledigt, dachte ich mir, das ist schließlich eine Tatsache. Aber je länger ich in Datenbanken und Lehrbücher abgestiegen war, umso klarer wurde, dass die vermeintliche Tatsache gar keine Tatsache ist, sondern eine pure Hypothese, für die nie ein wissenschaftlicher Nachweis erbracht wurde. Wohl gab es unzählige Untersuchungen zu Serotonin und Depression, aber die Ergebnisse waren unklar, widersprüchlich und letztlich unbrauchbar. Weit und breit kein Beweis für die Serotoninhypothese zu finden. An diesem Nachmittag an der Burghölzli Klinik hatte mein Selbstverständnis als biologisch forschender Wissenschaftler in der Psychiatrie einen ersten schweren Auffahrunfall mit der Realität zu verkraften. Wenn noch nicht einmal das stimmt, was kann ich überhaupt glauben?
Seitdem ist viel passiert. Zwanzig Jahre später glaubt in der Wissenschaft (fast) niemand mehr an die simple These, psychische Störungen seien Ausdruck einer gestörten Botenstoff‐Chemie im Gehirn. Eine vermeintliche wissenschaftliche Gewissheit ist eingeschrumpft zur »nützlichen Metapher«, um Patienten klar zu machen, warum sie Antidepressiva nehmen sollen. Die Erklärungsmodelle haben sich vielfach gewandelt bis hin zur gegenwärtigen Vorstellung, psychische Störungen beruhten auf fehlerhaften Schaltkreisen und gestörter Netzwerk‐Kommunikation. Das Vokabular des Computerzeitalters hat längst auch die Biopsychiatrie erreicht. Aber kein Modernisierungsschub und kein Hypothesen‐Update konnte das Grundproblem lösen: Die Biologie der erkrankten Psyche auf ein solides Fundament zu stellen, in der sie mehr ist als eine Behauptung. Mit naturwissenschaftlichen Verfahren sollten ursächliche Krankheitsmechanismen entdeckt und daraus wirksame Behandlungsmethoden entwickelt werden. Das klingt vernünftig, im Rest der Medizin ist dieses Vorgehen schließlich auch erfolgreich. Doch Psychiatrie ist nicht wie der Rest der Medizin und der Plan ging nicht auf. Die »dritte Welle der biologischen Psychiatrie« ist Mitte der 1980er Jahre mit großem Optimismus gestartet, im Lauf der Zeit ins Stocken geraten und mittlerweile im Zustand einer tiefen Krise angekommen. Davon handelt der erste Teil dieses Buchs, vom Aufstieg und Fall eines gigantischen Projekts, von großer Hoffnung und großer Enttäuschung.
In der Fachwelt herrscht bereits erstaunliche Einigkeit darüber, dass die biologisch ausgerichtete Psychiatrieforschung seine ambitionierten Ziele verfehlt und bis heute zu keiner relevanten Verbesserung der klinischen Praxis geführt hat. Kein besseres Krankheitsverständnis, keine besseren Medikamente, keine besseren Prognosen. Überaus erfolgreich hingegen war die Psychiatrie der Gene und Moleküle als ideologisches Programm. Dass psychische Störungen Erkrankungen des Gehirns seien, ist zum alles dominierenden Paradigma geworden. Nicht nur innerhalb der Psychiatrie, sondern auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Und das ist nicht ohne Folgen geblieben. Versteht man psychische Störungen als biologische Funktionsstörung, so macht es natürlich Sinn, diese medikamentös zu behandeln. Dieses Narrativ hat einen bis heute anhaltenden Psychopharmaka‐Boom ausgelöst. Mit großer Selbstverständlichkeit werden nicht nur ernsthafte psychische Erkrankungen wie schwere Depressionen oder Schizophrenien mit Medikamenten behandelt, sondern auch die ganz normalen Befindlichkeitsstörungen der vielen worrying well. Mit der Folge, dass heute Abermillionen von Menschen Psychopharmaka nehmen, die sie gar nicht nehmen sollten und die ihnen längerfristig mehr schaden als nutzen. Von den weitreichenden Folgen unserer neuro‐ und pharmakozentrischen Psychiatrie handelt das Kapitel 4.
Also einfach wieder eine neue Grundsatzkritik an der biologischen Psychiatrie? An der einen oder anderen Stelle wird man diesen Verdacht bestätigt finden. Inhaltlich will ich mich dafür auch gar nicht entschuldigen und hoffe stattdessen auf die überzeugende Kraft des guten Arguments in pointierter Sprache. Entschuldigen möchte ich mich hingegen bei den vielen engagierten Forscherinnen1, den klugen Doktoranden und den Postdocs mit ihren 60‐Stunden Arbeitswochen, die sich aufrichtig bemühen, mit guter Wissenschaft herauszufinden, was Gene und Moleküle mit Depression, Sucht oder Psychose zu tun haben könnten. Sollte ich bei ihnen zur Frustration beitragen, bitte ich dies als unerwünschte Nebenwirkung meiner Kritik zu entschuldigen. Denn selbstverständlich ist Grundlagenforschung wichtig und notwendig, nicht zuletzt im Bereich der neurologischen Erkrankungen, von Demenzen bis Multiple Sklerose, die von der biologischen Forschung ja auch in großem Ausmaß profitieren. Meine Kritik zielt vielmehr auf die Einseitigkeit der Ausrichtung und die erhebliche Unwucht in der Verteilung personeller und finanzieller Ressourcen. In den letzten Jahrzehnten sind fast alle Energien der akademischen Psychiatrie in die Erforschung von Genen und Molekülen geflossen und vakante universitäre Lehrstühle wurden konsequent mit Biopsychiatern besetzt. Im Zuge dieses zunehmenden Ungleichgewichts, machtvoll durchgesetzt von universitären Institutionen, Expertenorganisationen und der Pharmaindustrie, verarmte in der Psychiatrie auch das Bild vom Menschen. Wir werden gerade Zeugen einer immer radikaleren Entkopplung zwischen den Psychiatern, die Patienten studieren und denen, die sie behandeln. Was kann und soll das Ziel psychiatrischer Forschung sein? Wollen wir weiterhin hoch abstrakte Krankheitstheorien aus Vulnerabilitätsgen‐Konstellationen, molekularen Regulations‐Kaskaden und neuronalen Schaltkreis‐Anomalien konstruieren? Oder ganz praktisch dem real existierenden Patienten mit seinen real existierenden Problemen helfen? Zwischen diesen Optionen muss sich die akademische Psychiatrie in Zukunft entscheiden. Denn das eine, so versuche ich aufzuzeigen, hat mit dem anderen so gut wie nichts zu tun und Ressourcen sind bekanntermaßen beschränkt.
Während die akademische Psychiatrie sich zunehmend nur noch um sich selbst dreht, zeichnen sich in der Versorgungspsychiatrie wichtige Neuerungen ab. Die Vielfalt dieser Neuerungen und ihr innovatives Potenzial aufzuzeigen ist das Hauptanliegen des Buchs. Die gegenwärtigen Veränderungen sind, auf einen kurzen Nenner gebracht, technologischer, sozialer und pragmatischer Natur und orientieren sich an der grundvernünftigen Frage, was in der Praxis wirklich helfen könnte. Dass wir alle zwischenzeitlich mit Smartphones herumlaufen, ist auch den Psychiatern und Psychotherapeutinnen nicht verborgen geblieben. Durch die Covid‑19 Pandemie beflügelt, ist die »digitale Psychiatrie« zu einem neuen Experimentierfeld geworden, in dem mental health Apps, online‐Psychotherapien, Chatroboter und sogar messbasierte Frühwarnsysteme zur Erkennung psychischer Krisen ausgetestet werden. Auch die Psychiatrie ist im digitalen Zeitalter angekommen und Psychiaterinnen diskutieren mit IT‑Spezialisten eifrig über die Vor‐ und Nachteile von hybriden Therapiebeziehungen in realen und virtuellen Welten. In den vergangenen Jahren hat auch die Sozialpsychiatrie eine ganz neue Wertschätzung erfahren. Mit einem Stoßseufzer der Erleichterung werden viele zur Kenntnis nehmen, dass man in der Psychiatrie endlich wieder ernst nimmt, dass der Mensch mehr ist als ein medikamentös zu behandelnder Symptomträger. Psychiatrische Störungen sind im Kern soziale Störungen, verursacht durch Traumatisierung, Diskriminierung, Armut und andere Lebensdramen. An den real gegebenen Lebensverhältnissen der Patienten orientieren sich auch die neuen sozialpsychiatrischen Versorgungsangebote. In der »aufsuchenden psychiatrischen Arbeit« betreuen flexibel operierende, multiprofessionelle Teams die Erkrankten dort, wo sie sind: Zu Hause, in provisorischen Einrichtungen oder auch in der Obdachlosigkeit. Dazu kommen die »stationsäquivalente Behandlung«, dialogbasierte Therapieverfahren, dem Stand der Zeit angepasste Soteria Projekte und verschiedene Minimal Medication Services. Am Rand der Mainstream Psychiatrie tut sich gerade eine ganze Palette neuer sozialpsychiatrischer Behandlungsverfahren auf. Viele psychiatrisch Tätige, die Veränderung wollen, sind mit Engagement dabei, aus der Verbindung von altbewährten Verfahren und neuen Ideen eine innovative Sozialpsychiatrie 2.0 zu schmieden. Immer mehr Bedeutung wird auch den »Experten durch Erfahrung« zugestanden – Menschen, die selbst von psychischen Krisen betroffen waren und diese überwinden konnten. Dabei kommt ihnen nicht nur die Rolle zu, als Genesungsbegleiter akut Erkrankten und ihren Angehörigen Hoffnung zu vermitteln. Ihre Innenperspektive auf psychische Störungen kann auch mithelfen, zu definieren, worauf es in einer gelingenden Therapie wirklich ankommt. Noch ist das Gemeinschaftsprojekt »partizipative Forschung« zwischen Wissenschaftlerinnen, Betroffenen und Angehörigen eher Bekenntnis als Praxis. Aber auch das könnte sich schon bald ändern, Pilotprojekte in dieser Richtung sind bereits angelaufen. Auch wer irgendwann nach Jahren seine Psychopharmaka nicht mehr nehmen wollte, war bis vor kurzem ganz auf das Erfahrungswissen anderer Betroffener angewiesen. Internet‐Selbsthilfegruppen wie SurvivingAntidepressants.org waren über lange Zeit die einzige brauchbare Informationsquelle, wenn es um das Absetzen von Psychopharmaka und den Umgang mit Entzugssymptomen ging. Immerhin, mittlerweile hat auch die institutionelle Psychiatrie erkannt, dass sie sich nicht nur um das Verschreiben, sondern auch um das Entschreiben von Psychiatriemedikamenten kümmern sollte und hält dies in ihren neuen Behandlungsrichtlinien fest. Die Umschau, was sich am Horizont der Psychiatrie so alles an Innovation und Veränderung abzeichnet, bildet den zweiten Teil dieses Buchs.
Das Kapitel »Neo‐Psychedelik und die Hoffnung auf heilsame Trips« ist dann wohl das, was man ein Heimspiel nennt. Wenn ich am Burghölzli nicht gerade aus dem Fenster schaute und über fehlende Belege für wichtige Hypothesen nachdachte, habe ich nämlich Halluzinogenforschung gemacht. Und das über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren. 2005 und 2006 stand ich dabei sogar unter wissenschaftlicher Beobachtung. Der Anthropologe Nicolas Langlitz war für seine Feldforschung bei uns zu Gast und hat für das Treiben der Schweizer Halluzinogenforscher eine griffige Formel gefunden: »Neuro‐Psychedelik«.2 Nicks Wortschöpfung beschreibt das Revival der Halluzinogenforschung seit der Mitte der 1990er Jahre sehr treffend. Die Psychedelikforschung 2.0 war ganz ein Kind der Dekade des Gehirns, die gerade ihren Höhepunkt erreichte. In Franz Vollenweiders Labor in Zürich ging es um Rezeptorpharmakologie, neuronale Korrelate von Bewusstseinszuständen und die Frage, ob das Pilzhalluzinogen Psilocybin und seine Artverwandten vorübergehend Gehirnveränderungen hervorrufen, die zum Verständnis von Psychosen oder Manie beitragen könnten. In der Neuauflage wissenschaftlicher Forschung mit Halluzinogenen wurden Psychedelika entpolitisiert und möglichst wertneutral als Instrumente zur Untersuchung von Gehirn und Bewusstsein dargestellt. Man wollte, und dies aus gutem Grund, auf Maximaldistanz zu Halluzinogenforscher‐Vorgängern wie Timothy Leary gehen. Serotonin‑2A‐Rezeptor‐Agonismus statt Weltrevolution – diese ideologische Neugewichtung erleichterte sicher auch den Umgang mit den Behörden, die diese Forschung bewilligen mussten. Ganz so nüchtern, wie sich das gerade liest, war es natürlich nicht. Im Verlauf meiner Halluzinogenforscherjahre habe ich auch selbst von verschiedenen kosmischen Gewürzen genascht und staunend in andere Welten geblickt. Gut möglich, dass diese pharmakologischen Studienreisen zu meiner Überzeugung beigetragen haben, dass es ein völlig unmögliches Unterfangen ist, den phantastischen Kosmos unserer inneren Erfahrung mit neurowissenschaftlichen Methoden auch nur halbwegs adäquat einzufangen, geschweige denn zu erklären. Nicht ohne Stolz darf ich also davon ausgehen, auch selbst ein wenig Vorarbeit für den aktuellen Boom der medizinischen Psychedelik geleistet zu haben. Zwischenzeitlich schon tief in der klinischen Forschung angekommen, geht es mit dem Halluzinogen‐Revival in rasantem Tempo voran. Ohne Zweifel hat die moderne Kombination aus psychedelischer Psychopharmakologie und speziellen Psychotherapieverfahren ein beträchtliches Potenzial. Verschiedene Psychedelika‐unterstützte Behandlungsverfahren haben wegen starker Pilotdaten von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA den Status von breakthrough therapies zugesprochen bekommen, Biotech Start‐ups hoffen auf eine baldige Kommerzialisierbarkeit und die Wissenschaftskonferenz Psychedelic Science 2023 wurde bereits als »größte psychedelische Zusammenkunft der Geschichte« angekündigt. Kann das wirklich gut gehen? Oder wiederholt sich die Geschichte und auf Neo‐Psychedelik folgt schon bald Neo‐Prohibition?
Das Schlusskapitel schließlich macht, was sich für ein Schlusskapitel gehört: Es fasst zusammen und wagt einen Ausblick. Sucht man den ökonomischen Vergleich, könnte man den heutigen Zustand des Großprojekts »biologische Psychiatrie« am ehesten mit dem Endstadium einer spekulativen Blase vergleichen. Systemimmanente Sachzwänge, eine Vielzahl persönlicher und institutioneller Interessen und auch die auf Langfristigkeit ausgelegten Forschungskooperationen sorgen dafür, dass die Spekulationsblase nicht schon längst geplatzt ist. Aus ihr wird nur ganz allmählich die Luft abgelassen. Das System Psychiatrie befindet sich im Zustand der zunehmenden Entkopplung und Selbstentfremdung. Das hat sicher auch mit einer veränderten gesellschaftlichen Wahrnehmung zu tun. Der Neurohype der 2000er Jahre ist zwischenzeitlich abgeklungen und der materialistische »Homo cerebralis«3, der sein Ich‐Sein voll und ganz auf sein Gehirn bezieht, ist längst auf dem Rückzug. Dementsprechend geringer fällt heute auch das Medieninteresse aus, wenn Forscher wieder einmal glauben, ein neues Depressionsgen oder einen Schaltkreis für Sucht gefunden zu haben. Wie es scheint, erwartet auch die praktisch arbeitende Versorgungspsychiatrie schon lange nichts mehr vom akademisch forschenden Teil ihrer Zunft. Während sich die einen immer tiefer in Moleküle und Genmuster zurückziehen, arbeiten die anderen bereits an einer weitreichenden Umgestaltung. Zeiten der Krise sind Zeiten der Veränderung.
Ich wünsche mir, dass dieses Buch mehr ist als ein vorauseilender Nachruf auf eine erfolglose, aber nebenwirkungsreiche Idee. Es soll auch Hoffnung geben, dass sich die Dinge wirklich grundlegend verändern können.
Anmerkungen
1 Im Sinne einer gendergerechteren Sprache werden in diesem Buch männliche und weibliche Form abwechslungsweise verwendet.
2 Langlitz N (2013) »Neuro‐Psychedelia«.
3 Eine Wortschöpfung des Wissenschaftshistorikers Michael Hagner (2008).
Kapitel 1: Große Hoffnung, große Enttäuschung
Die Klinische Neurowissenschaft kann sich nun [im Jahr 2005] auf ein »Zeitalter der Umsetzung« freuen, mit zutreffenderen Diagnosen, besseren Behandlungen und sehr früher Erkennung und Prävention.1
Zu Beginn unseres Jahrhunderts herrscht gute Laune in der Psychiatrie. Von den Grundlagenforschern an den Universitätskliniken bis zur Pharmazeutischen Industrie – überall glaubt man den Anbruch eines neuen, goldenen Zeitalters zu erkennen. Nicht weniger als die Rettung des eigenen Fachs erhofft man sich von den allerorts boomenden Neurowissenschaften mit ihren scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten. Medizinisch‐naturwissenschaftliche Fakten sollen als objektive Kriterien ein für alle Mal die streitbare Subjektivität im Umgang mit psychischen Störungen ersetzen. Beeindruckt von den rasanten technologischen Entwicklungen in der neurobiologischen Grundlagenforschung, insbesondere bei den bildgebenden Verfahren, ist man zuversichtlich, schon in absehbarer Zeit ganz entscheidende Verbesserungen im Verständnis und in der Therapie psychischer Störungen zu erzielen.
2004 veröffentlicht das Wissenschaftsmagazin Gehirn und Geist sein viel beachtetes »Manifest der Hirnforscher«. Elf »führende Neurowissenschaftler« räsonieren in diesem Aufsatz über die Perspektiven der Hirnforschung im 21. Jahrhundert. Und so optimistisch sieht man damals die Zukunft: »Vor allem was die konkreten Anwendungen [der Neurowissenschaften, Anm. d. A.] angeht, stehen uns in den nächsten zehn Jahren enorme Fortschritte ins Haus. Wahrscheinlich werden wir die wichtigsten molekularbiologischen und genetischen Grundlagen neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson verstehen und diese Leiden schneller erkennen, vielleicht von vornherein verhindern oder zumindest wesentlich besser behandeln können. Ähnliches gilt für einige psychische Krankheiten wie Schizophrenie und Depression. In absehbarer Zeit wird eine neue Generation von Psychopharmaka entwickelt werden, die selektiv und damit hocheffektiv sowie nebenwirkungsarm in bestimmten Hirnregionen an definierten Nervenzellrezeptoren angreift. Dies könnte die Therapie psychischer Störungen revolutionieren – auch wenn von der Entwicklung zum anwendungsfähigen Medikament noch etliche weitere Jahre vergehen werden.«2
Und gut gelaunt ist man auch im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN)3. In ihrem Positionspapier »Psychiatrie 2020« erörtern die DGPPN‐Präsidenten Frank Schneider, Peter Falkai und Wolfang Maier4 ihre Perspektive auf die Psychiatrie in zehn Jahren. Schon im Vorwort verweisen die Autoren auf den großen Erkenntniszuwachs in der jüngsten Vergangenheit: »Kaum ein anderes medizinisches Fach hat eine derartig sprunghafte Entwicklung in dem letzten Jahrzehnt durchlaufen wie die Psychiatrie und Psychotherapie. Mit exzellenten Bildgebungsmöglichkeiten, molekulargenetischen sowie statistischen Methoden stehen uns seit kurzem vielfältige Möglichkeiten zur Erforschung der Ätiologie, der Pathogenese und teilweise auch schon der Diagnostik zur Verfügung, dies alles verbunden mit dem traditionellen ganzheitlichen Ansatz der psychiatrischen Arbeit.«5 Und Florian Holsboer, in jener Zeit Direktor des Max‐Planck‐Instituts für Psychiatrie in München und einer der einflussreichsten Psychiatrieforscher, benennt klar, wohin der Weg nun führt: »Unser Ziel muss es sein, eine Art Weltformel der Seele zu finden. Dort gehen hinein: aktuelle Symptomatik, biografische Situation, bildgebende Verfahren, Hormontests, neuropsychologische Tests, Protein‐ und Genanalysen … .«6
Die Psychiater der Zukunft sind Neurowissenschaftler
Die Maximalvariante der zukünftigen Bedeutung der Hirnforschung für die Psychiatrie formuliert allerdings Thomas Insel, damals Direktor des National Institute of Mental Health (NIMH)7: »Die Sichtweise, dass psychische Störungen Erkrankungen des Gehirns sind, legt nahe, dass die Psychiater der Zukunft als Neurowissenschaftler ausgebildet werden müssen.«8 Dass sich Thomas Insel damals fest auf die Neurowissenschaften abstützte, kann man durchaus wörtlich nehmen: In seinem Portrait auf der NIMH‐Webseite ruht sein Arm auf den »Principles of Neural Science« – einem der wichtigsten neurowissenschaftlichen Lehrbücher, mitherausgegeben von Nobelpreisträger Eric Kandel. Nähme man die Aussage wirklich ernst, dass die Psychiaterinnen der Zukunft Neurowissenschaftlerinnen sein werden, müsste es eigentlich zu einer Abschaffung der Psychiatrie kommen. Oder vielmehr zu einer Erweiterung der Neurologie um die Subdisziplin »Neurologische Störungen mit vorwiegend oder ausschließlich psychischer Symptomatik«. Und tatsächlich sprach man in den 2000er‐Jahren bereits von einer De‑Psychiatrisierung der Psychiatrie. Einfach deshalb, weil die »Psyche« (das »Seelische« oder auch der »mentale Raum«) als ursprünglich zentraler Begriff in der Psychiatrie immer unwichtiger geworden war. Es schien nur noch eine Frage der Zeit, bis die vollständige Somatisierung des Fachs hin zu einer Psychiatrie ohne Psyche vollzogen sein würde. »Psychiater und Neurologen sollten am besten als klinische Neurowissenschaftler aufgefasst werden, die die revolutionären Erkenntnisse der Neurowissenschaft bei der Behandlung derer anwenden, die eine Gehirnerkrankung haben« ist konsequenterweise das Fazit der Autoren Thomas Insel und Remi Quirion in ihrem berühmten Kommentar zur Psychiatrie der Zukunft.9 Schon in geraumer Zeit sollte es möglich sein, die grundlegenden pathophysiologischen Prozesse der wichtigsten psychischen Störungen auf biologischer Ebene zu verstehen und aus diesem Verständnis heraus völlig neue Medikamente zu entwickeln. Ganz im Sinne eines pharmazeutischen rational drug designs, wie dies typischerweise bei der Medikamentenentwicklung in der somatischen Medizin praktiziert wird. Gesucht sind neuartige Psychiatriemedikamente, die nicht wie bisher unspezifisch, unvollständig und nebenwirkungsreich auf einige Krankheitssymptome einwirken, sondern unmittelbar die zugrundeliegenden pathologischen Prozesse beeinflussen. Präzise und kurativ sollten sie sein, die Psychopharmaka der Zukunft. Und natürlich muss man für den treffsicheren Zugriff auf das Gehirn erst einmal die molekularen und funktionellen Mechanismen der Erkrankung selbst verstehen. Dass dies auf jeden Fall gelingen wird, war sich auch die Psychiaterin Nancy Andreasen sicher: »Übereinstimmende Daten aus verschiedenen neurowissenschaftlichen Verfahren deuten darauf hin, dass die neuronalen Mechanismen psychischer Erkrankungen als Funktionsstörungen in spezifischen neuronalen Schaltkreisen verstanden werden können und dass deren Funktionen und Funktionsstörungen durch eine Vielzahl kognitiver und pharmakologischer Faktoren beeinflusst oder verändert werden können. […] Diese Fortschritte haben ein Zeitalter geschaffen, in der eine wissenschaftliche Psychopathologie, die Geist und Gehirn miteinander verknüpft, Realität geworden ist.«10
Der heilige Gral der Biopsychiatrie
Biomarker! Diese Verheißung leuchtet in den 2000er Jahren besonders hell am Erkenntnishorizont. Sollte es gelingen, bei Erkrankten ein spezifisches Protein im Blut, ein eindeutig abweichendes Muster von Gehirnaktivität oder ein genetisches Profil zu identifizieren, das zweifelsfrei mit den Symptomen einer psychischen Störung einherging, käme dies einer Revolution der psychiatrischen Diagnostik gleich. Die Psychiatrie könnte endlich zu einem ganz normalen medizinischen Fach werden, in dem Krankheitsdiagnosen mit Laborwerten, Genetikdaten oder Bildgebungs‐Befunden untermauert und objektiviert werden. Und selbstverständlich sollten die besseren Diagnosen auch zu besseren Behandlungen führen: »Nachdem ein Arzt die Gehirnerkrankung eines Patienten genau bestimmt hat, wird er in der Lage sein, die Behandlung zu verschreiben, die am besten geeignet ist«, erklärte Neurowissenschaftler Steven Hyman, Harvard‐Professor und Vorgänger von Thomas Insel als Direktor am NIMH dem Magazin Scientific American.11 Vor allem aber sollten Biomarker die Früherkennung psychischer Störungen ermöglichen und das rechtzeitige Eingreifen erlauben, noch bevor das Vollbild der Krankheit aufgetreten ist: »Gentests bei Patienten könnten zeigen, wer ein hohes Risiko für das Auftreten einer Erkrankung wie Schizophrenie oder Depression trägt. Ärzte könnten dann bei diesen Hochrisikopatienten bildgebende Verfahren benutzen, um festzustellen, ob die Erkrankung tatsächlich schon begonnen hat«.12 Biomarker sollen das Feld der Vor‐Erkrankung auch für die Psychiatrie eröffnen. Man könnte dann gewissermaßen prä‐symptomatisch krank sein und bereits vorsorglich therapiert werden – oder wenigstens unter medizinische Beobachtung gestellt werden.
Kein Zweifel, das neue Jahrtausend begann verheißungsvoll für das »Zukunftsfach Psychiatrie«.13 Zwar befinde man sich jetzt noch in einer frühen Phase der Wissensproduktion, aber letztendlich würde der Durchbruch im neurobiologischen Verständnis psychischer Störungen ganz sicher gelingen. Das Erfolgsrezept sollten multidisziplinäre Studien sein: Die Verknüpfung von humaner Neuroanatomie und Neurophysiologie mit Tieruntersuchungen, die Weiterentwicklung der damals noch jungen SCAN‐Disziplinen,14 bessere theoretische und computergestützte Konzepte zur Funktionsweise des Gehirns und vor allem das Neuroimaging sollten die so lange erfolglos gesuchten Erkenntnisse liefern.15 Und überhaupt: Der Begriff »psychische Störung« sei doch ein anachronistischer Begriff, weil ja nun klar geworden sei, dass es sich dabei um Erkrankungen des Gehirns handle.
Vom Aberglauben zur Wissenschaft
Nicht nur Psychiaterinnen, auch viele Psychotherapeuten arbeiteten damals mit Hochdruck an einem modernen, nunmehr neurowissenschaftlich informierten Selbstverständnis. 2004 veröffentlichte der Psychotherapieforscher Klaus Grawe sein programmatisches Buch »Neuropsychotherapie«.16 Der Klinische Psychologe lässt darin keine Zweifel, worauf es wirklich ankommt: »Psychotherapie wirkt, wenn sie wirkt, darüber, dass sie das Gehirn verändert«.17 Für die Therapeuten sei nun an der Zeit, sich von ihrem teilweise abergläubischen Verhalten zu lösen und sich stattdessen »von der Konfession zur Profession« weiterzuentwickeln.18 Ganz besonders der Zunft der Pharmakologen traute Grawe einiges zu: »Man hat gerade erst mit der Erforschung neuronaler Korrelate psychischer Störungen begonnen. Aber es ist sicher, dass sich dieses Wissen bereits im nächsten Jahrzehnt sprunghaft vermehren wird, weil allerorten daran gearbeitet wird. Die Psychopharmakologen stehen auf dem Sprung, jeden diesbezüglichen Wissenszuwachs unmittelbar umzusetzen in verbesserte medikamentöse Behandlungen.«19 Klaus Grawes 2004 so optimistisch verkündetes nächste Jahrzehnt mit seiner »sprunghaften Wissensvermehrung« in den Neurowissenschaften und der in Aussicht gestellten Entwicklung neuer und hochwirksamer Psychopharmaka ging nun gerade zu Ende. Ein guter Moment also für einen Realitätsabgleich mit der tatsächlichen Faktenlage.
Ein Starpsychiater schmeißt hin
Im November 2015 standen bei Thomas Insel berufliche Veränderungen an. Der mächtigste Psychiater der Welt räumte überraschend seinen Direktorposten am National Institute of Mental Health, um sich Google Life Sciences20 anzuschließen.21 Zwei Jahre später wird auch der Öffentlichkeit klar, warum. Im Online‐Magazin Wired zieht Thomas Insel Bilanz zu seiner früheren Tätigkeit: »Ich habe dreizehn Jahre am NIMH damit zugebracht, mit Nachdruck die Neurowissenschaft und Genetikforschung zu psychischen Störungen voranzubringen. In der Rückschau denke ich, dass es mir zwar gelang, eine Menge wirklich cooler Publikationen von tollen Wissenschaftlern zu ziemlich hohen Kosten zu veröffentlichen – ich denke zwanzig Milliarden Dollar. Ich glaube aber nicht, dass wir für die Abermillionen von Menschen mit psychischen Erkrankungen etwas bewirkt haben, was die Verringerung von Suiziden angeht, den Rückgang der Krankenhausaufenthalte oder eine bessere Genesung. Ich übernehme dafür die Verantwortung.«22
Ein erstaunliches Fazit des Starwissenschaftlers, der doch wenige Jahre zuvor noch fest davon überzeugt war, dass die Zukunft der Psychiatrie ganz der Genetik und der Neurobiologie gehört und die Psychiater künftiger Generationen klinisch arbeitende Neurowissenschaftler sein werden. Knapp und nüchtern bringt Thomas Insel in seiner Rückschau das Dilemma auf den Punkt: Man hat Milliardensummen in die biologische Erforschung psychischer Erkrankungen gesteckt und dabei zweifellos interessante Grundlagenerkenntnisse zu Organisation und Funktionsweise des Gehirns gewonnen. Aber das eigentliche Ziel, die psychiatrische Diagnostik durch objektive Kriterien zu reformieren und die Therapie psychischer Störungen zu verbessern, wurde komplett verfehlt. Die praktische Relevanz der biologischen Psychiatrie für den depressiven, psychotischen oder zwangsgestörten Menschen ist bis heute gleich Null. Oder in den Worten des amerikanischen Psychiaters Allen Frances: »Die Ergebnisse der Grundlagenforschung sind faszinierend, hatten aber bislang nicht zur Folge, auch nur einem einzigen Patienten sinnvoll zu helfen.«23 Dabei war man sich doch auch im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde schon immer einig, dass Forschung nie akademischer Selbstzweck sein dürfe, sondern zum Wohl der Erkrankten gemacht werden müsse: »Die zentrale Aufgabe unseres Faches ist die Weiterentwicklung und Anwendung von besseren Therapien und Präventionsstrategien für psychisch Kranke. Diesem Ziel muss die Forschung in unserem Fach vordringlich dienen.«24
Das Arzneibuch der Psychiatrie ist ausgeschöpft
Nach der Euphorie des Aufbruchs ist in der Psychiatrie längst Ernüchterung eingetreten. Bemerkenswerterweise hat auch die Pharmazeutische Industrie wesentlich zu diesem Stimmungsumschwung beigetragen. So um 2010 begann Big Pharma nämlich ihren orchestrierten Ausstieg aus der Psychiatrieforschung. Als erster großer Pharmakonzern machte GlaxoSmithKline seine Forschungs‐ und Entwicklungsabteilung für den Bereich Psychopharmaka dicht. Vorstandschef Andrew Witty erklärte damals, dass es sich bei Schmerz, Depression und Angst um Behandlungsfelder handelt, bei denen »wir glauben, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit [ein neues wirksames Medikament zu entwickeln] relativ klein ist und die Kosten um Erfolg zu erzielen, unverhältnismäßig hoch sind.«25 Das ist schon erstaunlich, schließlich war die Pharmazeutische Industrie mächtiger Antriebsmotor und ökonomischer Profiteur der Sichtweise, psychische Störungen seien Erkrankungen des Gehirns und könnten demzufolge genau wie andere medizinische Probleme medikamentös behandelt werden. Wenige Wochen nach GlaxoSmithKline gab auch AstraZeneca bekannt, dass alle Forschungseinrichtungen in Europa und den USA geschlossen würden, die mit der Entwicklung von Medikamenten für Schizophrenie, bipolare Störung, Depression und Angst betraut sind.26 In rascher Folge haben weitere Pharmamultis von Novartis27 bis Pfizer ihre Forschungsanstrengungen zur Entwicklung neuer Psychopharmaka entweder komplett aufgegeben oder massiv heruntergefahren. 2016 erklärte Pharma‐Insider Harry M. Tracy, Herausgeber von NeuroPerspective, dass im letzten Jahrzehnt die Zahl der pharmazeutischen Forschungs‐ und Entwicklungsprogramme für Psychopharmaka um siebzig Prozent zurückgegangen sei.28 Der Industrieberater und Gründer von NI Research weiß um die gegenwärtig miserable Stimmung in der Branche: »Ich denke, es kam [bei der Pharmaindustrie] die Haltung auf, dass Psychiatrie ein Schwarzes Loch ist und dass man Geld hineinsteckt und nichts Gutes dabei herauskommt – auf jeden Fall ist seit langer Zeit nichts sonderlich Neues herausgekommen«.29
In einem Editorial der Fachzeitschrift Schizophrenia Bulletin fasst Psychiater Hans Christian Fibiger die missliche Lage kurz und knapp zusammen: »Die Psychopharmakologie steckt in der Krise. Die Daten sind auf dem Tisch und es ist klar, dass ein gigantisches Experiment gescheitert ist: Trotz Jahrzehnten der Forschung und Milliardeninvestitionen hat seit über dreißig Jahren kein einziges mechanistisch neues Medikament den Psychiatriemarkt erreicht.«30 Der Mann scheint zu wissen wovon er spricht, schließlich hatte der emeritierte Professor von der University of British Columbia Führungspositionen in Neuroscience‐Abteilungen mehrere Pharmakonzerne inne.31
Den Mangel an Innovation in der Psychopharmakologie hat Big Pharma Jahrzehnte lang lukrativ mit der Entwicklung unzähliger me too/me better‐Präparate kompensiert. Das zugrundeliegende Prinzip ist einfach und vor allem vergleichsweise risikoarm, was das spätere Scheitern in den klinischen Studien angeht. Man nimmt Substanzen, die bereits die behördliche Zulassung bekommen haben und macht kleine chemische Modifikationen an der Molekülstruktur. Verlaufen toxikologische Untersuchungen und klinischen Prüfung dieser minimal abgewandelten Testsubstanzen erfolgreich, wird sich am Ende sicher auch ein leicht verändertes Wirkungsprofil oder eine etwas bessere Verträglichkeit bei einer bestimmten Patientengruppe finden lassen. Mit der branchenüblichen Mischung aus Übertreibung und selektiver Darstellung lässt sich dann der neue Wirkstoff als »deutlich überlegen« gegenüber den Vorgängermedikamenten propagieren. Durch diese Strategie der immer neuen Abwandlung schon etablierter Wirkstoffe sind mittlerweile eine Vielzahl von »atypischen Neuroleptika« zur Schizophreniebehandlung und Antidepressiva des Typs »Selektive Serotonin‐Wiederaufnahmehemmer« (SSRI) auf dem Markt.32
Für die Pharmaindustrie ebenfalls bestens bewährt hat sich das Prinzip der Indikationserweiterung. Fast alle Psychopharmaka haben die engen Grenzen ihres ursprünglichen Einsatzgebietes längst verlassen und werden mittlerweile, mit behördlicher Zulassung, für alle möglichen Störungen verwendet. So kommen Antidepressiva vom SSRI‐Typ nicht mehr nur bei der klassischen unipolaren Depression zum Einsatz, sondern auch bei Dysthymie, Saisonal‐affektiver Störung, Generalisierter Angststörung, Panikstörung, Zwangsstörung, Sozialer Phobie, Posttraumatischer Belastungsstörung, bei Essstörungen, Somatoformer Störung und der »Prämenstruellen dysphorischen Störung«. Dazu »off label«33 bei Schizophrenien, schizo‐affektiven Störungen, ADHS, Parkinson und bei Persönlichkeitsstörungen.
Für den Ausstieg aus der Psychopharmakologie‐Forschung und ‑Entwicklung muss es für die Branche schon zwingende Gründe geben, wenn doch mit dem Verkauf der bereits verfügbaren Psychopharmaka Jahr für Jahr neue Rekordumsätze erzielt werden34 und ein neuartiger Wirkstoff für die psychiatrische Anwendung sichere Milliardengewinne bedeuten würde. Die Ursache, warum sich Big Pharma aus der Entwicklung von neuen Psychopharmaka zurückzieht, ist nachvollziehbar und hat mit etwas zu tun, das kaum zu beeinflussen ist: Glückstreffer und Zufälle.35 Auch wenn in der Öffentlichkeit noch immer die Meinung vorherrscht, Psychopharmaka seien das Produkt zielgerichteter pharmazeutischer Entwicklung, die spezifisch in eine vermeintlich entgleiste Biochemie des Gehirns eingreifen, sieht die Realität völlig anders aus. Es sei daran erinnert, dass alle der heute in der Psychiatrie gebräuchlichen Medikamente auf Modellsubstanzen basieren, die in den 1950er bis 1960er Jahren durch Zufall gefunden wurden.36 Dies gilt für die pharmazeutische Entdeckungsgeschichte quer durch alle Wirkstoffklassen, vom ersten Antipsychotikum (Chlorpromazin) über die sedierenden Benzodiazepine bis zu den ersten Antidepressiva (Iproniazid und Imipramin). Stets waren die Pharma‐Entwickler auf der Suche nach etwas ganz anderem, beispielsweise einem neuen Mittel gegen Tuberkulose (Iproniazid) oder einem neuen Anthistaminikum37 (Chlorpromazin). Es war das Verdienst einiger aufmerksamer Studienärzte, die dann zum Beispiel bemerkten, dass das vermeintliche Tuberkulosemittel zwar nicht gegen Tuberkulose hilft, aber vielleicht gut gegen Depressionen sein könnte. Klar, dass dem Pharma‐Marketing nach Jahrzehnten der psychopharmakologischen Innovationslosigkeit irgendwann die Lust vergangen ist, noch länger auf neue Zufallstreffer zu warten.
In der Psychopharmakologie werden wir gerade Zeugen einer fundamentalen Vertrauenskrise, nicht nur bei den Medikamentenherstellern, sondern auch bei den Finanzierern universitärer Grundlagenforschung und den Wissenschaftlern selbst. In seinem Buch »Our Psychiatric Future« fasst der britische Soziologe Nikolas Rose diese große Ernüchterung in einem Satz zusammen: »Der Traum von Spezifizität, von smarten, zielgerichteten Medikamenten, die wirksam sind und nur minimale Nebenwirkungen haben, weil sie die fehlerhafte Neurobiologie an der Wurzel des Problems beheben, oder von personalisierten Medikamenten, die genau auf das Problem jedes einzelnen zugeschnitten sind – nun, das bleiben Träume oder Versprechen, an die immer weniger Experten glauben.«38
Anmerkungen
1 Insel TR, Quirion R (2005) Journal of the American Medical Association, S. 2224. Sofern nicht anders vermerkt, stammt die deutsche Übersetzung fremdsprachiger Quellen vom Autor.
2 Monyer H, Rösler F et al. (2004) Gehirn und Geist.
3 2012 wurde auch die Psychosomatik in die Fachgesellschaft eingemeindet. DGPPN bedeutet seitdem »Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde«.
4 Frank Schneider war von 2009–2010 DGPPN‐Präsident, Peter Falkai von 2011–2012 und Wolfgang Maier von 2013–2014.
5 Schneider F, Falkai P, Maier W (2011) »Psychiatrie 2020«, S. V.
6 Lakotta B (2009) Der Spiegel vom 27.4.
7 Das NIMH gehört zum US‑Gesundheitsministerium und ist mit seinem Milliarden‐Dollar‐Budget die weltweit größte Einrichtung zur Erforschung von psychischen Störungen.
8 Insel TR, Quirion R (2005) Journal of the American Medical Association, S. 2223.
9 Ebd.
10 Andreasen NC (1997) Science. Es soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass ein fast identischer neuro‐optimistischer Zeitgeist schon hundert Jahre früher durch die akademischen Lehrstuben zog. Der Psychologe William James schrieb 1890: »Unser Wissen über die genauere Anatomie und Physiologie des Gehirns ist eine Errungenschaft der heutigen Generation, oder besser gesagt, der letzten zwanzig Jahre. Viele Punkte sind noch ungeklärt und werden kontrovers diskutiert, aber ein Verständnis dieses Organs wurde hinsichtlich seiner allgemeinen Eigenschaften erreicht; dies betrifft insbesondere auch plausible Vorstellungen über die Art, wie Gehirnprozesse und mentale Prozesse miteinander interagieren.« [zitiert in Finzen A (1998) »Das Pinelsche Pendel«, S. 16.].
11 Hyman SE (2003) Scientific American, S. 98.
12 Ebd., S. 103.
13 Schneider F, Falkai P et al. (2011) »Psychiatrie 2020«, S. 72.
14 »Social, Cognitive and Affective Neuroscience«.
15 Hyman SE (2002) Psychopathology, S. 140.
16 Grawe K (2004) »Neuropsychotherapie«.
17 Ebd., S. 18.
18 Zitiert in Padberg T (2019) Verhaltenstherapie & Psychosoziale Praxis, S. 245.
19 Grawe K (2004) »Neuropsychotherapie«, S. 19.
20 Nach interner Umstrukturierung bei Google X heißt die Abteilung zwischenzeitlich »Verily Life Sciences«.
21 https://www.nimh.nih.gov/about/dr-tom-insel-to-step-down-as-nimh-director (letzter Abruf 28.1.2023).
22 https://www.wired.com/2017/05/star-neuroscientist-tom-insel-leaves-google-spawned-verily-startup (letzter Abruf 28.1.2023), auch zitiert in Rose N (2018) »Our Psychiatric Future«, S. 88.
23 In einem Zeitungskommentar zum Abgang von Thomas Insel beim NIMH [Carey B (2015) The New York Times vom 15.9.].
24 Schneider F, Falkai P, Maier W (2011) »Psychiatrie 2020«, S. 13.
25 Miller G (2010) Science, S. 502.
26 Abbott A (2010) Nature; Miller G (2010) Science.
27 Abbott A (2011) Nature. 2013 hat Novartis ihre neurowissenschaftliche Forschung bereits wieder teilweise aufgenommen. Allerdings mit einem neuen Ansatz: Anstelle der pharmakologischen Neurotransmitter‐Modulation will man zukünftig ganze Hirnschaltkreise untersuchen [Abbott A (2013) Nature]. Mehr dazu in Kapitel 9.
28 O’Hara M, Duncan P (2016) The Guardian vom 27.1.
29 Ebd.
30 Fibiger HC (2012) Schizophrenia Bulletin, S. 649.
31 Unter anderem war Christian Fibiger »Vice President of Neuroscience« bei Eli Lilly und Amgen.
32 In Deutschland zugelassen sind die atypischen Neuroleptika Amisulprid, Aripiprazol, Asenapin, Cariprazin, Clotiapin, Clozapin, Olanzapin, Paliperidon, Quetiapin, Risperidon, Sertindol, Sulpirid und Ziprasidon sowie die SSRI‐Antidepressiva Citalopram, Escitalopram, Fluoxetin, Fluvoxamin, Paroxetin und Sertralin (Stand 2022).
33 Mediziner haben das Recht, Medikamente nach eigenem Gutdünken auch außerhalb der behördlich genehmigten Zulassungen zu verschreiben.
34 Zur Übermedikation als Folge der forcierten Biologisierung der Psychiatrie siehe Kapitel 4 in diesem Buch.
35 Hasler F (2014) BioSocieties.
36 Siehe dazu Healy D (2002) »The Creation of Psychopharmacology« und Whitaker R (2010) »Anatomy of an Epidemic«.
37 Wirkstoff gegen Allergien, der die Freisetzung des Botenstoffs Histamin verhindert.
38 Rose N (2018) »Our Psychiatric Future«, S. 117.
Kapitel 2: Eine Vorhersage erfüllt sich nicht
Heute hat man es schwer, jemanden mit Sachkenntnis zu finden, der glaubt, dass die biologische Revolution der 1980er Jahre die meisten – oder auch nur eines – ihrer therapeutischen und wissenschaftlichen Versprechen erfüllt hat. Die Kritik an diesem Vorhaben hat in den letzten Jahrzehnten scharf zugenommen. Der Öffentlichkeit wird nun immer deutlicher: Es wurde zu weit gegangen, zu viel versprochen, zu viele Diagnosen gestellt, zu viele Medikamente verabreicht und eigene Prinzipien kompromittiert.1
Was ist geschehen? Oder vielmehr: Was ist nicht geschehen? Warum ist es der Pharmaindustrie in jahrzehntelanger Forschung nicht gelungen, maßgeschneiderte und wirksame Psychopharmaka zu entwickeln? Weshalb haben international koordinierte multizentrische Forschungsanstrengungen und Multimilliarden‐Investitionen nicht zu einer veränderten Behandlungspraxis geführt? Und wieso haben Genetik und Neurowissenschaften noch immer so gut wie keine klinische Relevanz – weder für die Diagnose, noch für die Prognose und erst recht nicht für die Therapie psychischer Störungen? Im Wesentlichen, weil NIMH‐Direktor Thomas Insels optimistische Voraussage einer bevorstehenden »Dekade der Entdeckung« in der Psychiatrieforschung unerfüllt blieb: »In den 1990er Jahren – der ›Dekade des Gehirns‹ – gewannen wir wichtige Erkenntnisse über Gehirnschaltkreise und Gehirnfunktionen. Die gegenwärtige Dekade [2000–2010] könnte in der Rückschau einmal als ›Dekade der Entdeckungen‹ gelten, in der erstmals die wichtigsten Kandidaten‐Moleküle, ‑Zellen und ‑Schaltkreise für normale und abweichende Gehirnfunktionen entdeckt wurden.«2 Insel hat in seinem Kommentar von 2005 auch gleich erklärt, woher die neuen Erkenntnisse zur Biologie psychischer Störungen kommen werden: Aus der Genetikforschung und dem Neuroimaging.3
Beiden Hoffnungsträgern der Psychiatrieforschung wurde in den letzten Jahrzehnten enorme finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt. Das Psychiatric Genomics Consortium ist sogar die größte Arbeitsgemeinschaft in der Geschichte der Psychiatrie.4 Der 2007 gegründete Forschungsverbund besteht aus mehr als achthundert Wissenschaftlern aus über hundertfünfzig akademischen Institutionen auf der ganzen Welt.5 Erklärtes Ziel der kollektiven Forschungsanstrengung dieser Hundertschaft von Genetikern, Molekularbiologinnen und Psychiatern ist es, »Risikofaktoren der Familienanamnese [für eine psychische Erkrankung] in biologisch, klinisch und therapeutisch bedeutsame Erkenntnisse zu überführen.«6 Gemäß Selbstbeschreibung wurde dieses Genetikforschungsprogramm dazu entworfen, »umsetzbare Ergebnisse« zu erzielen, die »grundlegende biologische Mechanismen aufzeigen, die klinische Praxis beeinflussen und neue therapeutische Angriffsorte liefern.«7
Große Studien und verdächtige Gene
In der Zwischenzeit hat das Psychiatric Genomics Consortium mehr als vierhundert Fachaufsätze veröffentlicht, darunter mehrere Nature und Science Publikationen. Am meisten Beachtung in der akademischen Psychiatrie fanden die Veröffentlichungen zu ihren »Genomweiten Assoziationsstudien« (GWAs). Bei dieser breit angelegten genetischen Untersuchungstechnik, die gerne als »hypothesenfrei« – sprich unvoreingenommen – bezeichnet wird, sucht man nach Variationen des menschlichen Erbguts, genauer gesagt nach Variationen einzelner Basenpaare innerhalb der DNA.8 Die gefundenen Genvariationen werden dann mit bestimmten Erscheinungsmerkmalen korreliert, zum Beispiel mit einem Krankheitsbild. Das menschliche Genom umfasst Milliarden von Basenpaaren. Selbst wenn bei unserer Spezies nur verhältnismäßig wenig Variation vorkommt, ist schon von Natur aus mit Abermillionen von Polymorphismen zu rechnen. Aus statistischen Gründen sind deshalb für Genomweite Assoziationsstudien riesige Stichprobenzahlen erforderlich. Nur ein entsprechend groß angelegter Forschungsverbund ist überhaupt in der Lage, Zehntausende von Patienten und Kontrollprobandinnen zu untersuchen. Die erste Welle von GWAs in der Psychiatrieforschung, so etwa bis 2009, ergab schon deshalb kaum brauchbare Ergebnisse, weil die Studien statistisch hoffnungslos underpowered waren. Das kann man definitiv nicht von der Genomweiten Assoziationsstudie der Schizophrenie‐Arbeitsgruppe des Psychiatric Genomics Consortium behaupten, die im Juli 2014 in Nature publiziert wurde. Der Artikel »Biologische Erkenntnisse aus 108 Schizophrenie‐assoziierten Genloci« gehört zu den meist zitierten Fachpublikationen des Jahres.9 Die bis zu diesem Zeitpunkt größte jemals durchgeführte molekulargenetische Studie zur Schizophrenie umfasste 37'000 an Schizophrenie erkrankte Patienten und 113'000 Kontrollpersonen. Die Statistiker dieser Arbeitsgruppe haben bei mehr als hundert Positionen im Genom einen korrelativen Zusammenhang zwischen einer Genvariation und Schizophrenie gefunden.
Was also sind nun die »Biologischen Erkenntnisse aus 108 Schizophrenie‐assoziierten Genloci«? Nun, erst einmal wurde bestätigt, was wir schon längst wissen: Es gibt nicht das Gen und auch nicht das Zusammenspiel einiger weniger Gene, die mit einer Schizophrenie‐Erkrankung in Verbindung zu bringen sind. Das immerhin kann man jetzt mit noch mehr Sicherheit sagen. Was man hingegen findet, ist eine Vielzahl von schwachen, aber statistisch signifikanten korrelativen Zusammenhängen zwischen häufig auftretenden Genvariationen, die auch bei ganz anderen Merkmalen (ob gesund oder pathologisch) vorkommen. Das Psychiatric Genomics Consortium kommentiert dies so: »Wir wissen jetzt, dass diese genetischen Effekte relativ klein und nichtdeterministisch sind: die meisten Menschen mit einer starken Familienanamnese sind selbst nicht betroffen.«10 In anderen Worten: Keine der verdächtigten Genvarianten ist für sich notwendig oder hinreichend für die spätere Entwicklung einer Schizophrenie. Das gleiche gilt für das Zusammenspiel mehrerer und gar einer großen Zahl von Schizophrenie‐»Risiko«‐Genen. Erschwerend kommt hinzu, dass bei den als pathophysiologisch verdächtig eingestuften Genvariationen gar keine Spezifität für den Erkrankungstyp »Schizophrenie« besteht. Eine erhebliche Anzahl dieser identifizierten »Einzelnukleotid‐Polymorphismen« findet man auch bei anderen Zustandsbildern wie Bipolarer Störung, ADHS oder schweren Depressionen.11
In letzter Zeit ist man bei den Genomweiten Assoziationsstudien vermehrt dazu übergegangen, die Verteilung einer anderen Art der Genvariation zu untersuchen, die so genannte Kopienzahl‐Variation.12 Bei diesem molekulargenetischen Marker untersucht man, wie häufig bei einer bestimmten Erkrankung Abweichungen von der normalerweise vorhandenen Anzahl von Kopien eines Genabschnitts vorkommen. Den vermuteten Beitrag der Kopienzahl‐Variation zu den (genetischen) Ursachen der Schizophrenie wird vom Psychiatric Genomics Consortium in einer aufschlussreichen Tortengrafik gezeigt. Der vermutete genetische Beitrag zur Schizophrenie‐Erkrankung, wenn man ein bestimmtes Muster von Kopienzahl‐Variation im Genom hat, ist in der Darstellung als winziger Schlitz von vielleicht zwei Prozent der Gesamtfläche dargestellt. Der ganze Rest des Kuchens wird mit »unbekannt« angegeben.13
Immer mehr Daten, aber nicht mehr Erkenntnis
In der Genetikforschung zur Schizophrenie wird ein Trend besonders offenkundig, der in Variationen eigentlich für jedes Teilgebiet der biologischen Psychiatrie gilt. Der Umfang an Forschungsdaten nimmt seit Jahren in rasantem Tempo zu. In immer kürzeren Zeitabständen erscheinen immer mehr und immer umfassendere Publikationen, Bezug nehmend auf immense Datensätze. Die Autorenlisten von Genomweiten Assoziationsstudien sind zwischenzeitlich derart lang, dass man meint, sich auf ein CERN‐Experiment in einem Atomphysik Journal verlaufen zu haben. Ganze 434 Autoren umfasst die Liste einer unlängst ebenfalls in Nature erschienenen und abermals »größten je durchgeführten« Gen‐Mapping Studie zur Schizophrenie.14 Nun werden schon 287 Schizophrenie‐assoziierte Genloci berichtet, mehr als doppelt so viele wie noch 2014. »Wir identifizieren biologische Prozesse, die für die Pathophysiologie der Schizophrenie relevant sind […] und stellen eine Ressource von priorisierten Genen und Varianten zur Verfügung, um mechanistische Studien voranzutreiben«, würdigt das Autorenheer die gemeinsame Arbeit in der Zusammenfassung des Artikels. Und natürlich kommt auch der unvermeidliche Verweis auf das Potenzial, aus den Erkenntnissen zukünftig neue Therapien zu entwickeln: »Schizophrenie ist nach wie vor eine komplexe und heterogene Krankheit, aber diese Studie hat die Möglichkeit für neue Behandlungsansätze eröffnet« kommentiert die brasilianische Mitautorin Sintia Belangero die Studie.15 Die mit der Leitung der Untersuchung beauftragten Wissenschaftler von der Cardiff University unterstreichen, wie wichtig die großen Fallzahlen sind und fordern bereits eine abermalige Ausweitung: »Das Team versucht nun, weitere Studienteilnehmer zu rekrutieren und größere, vielfältigere Datensätze zu erstellen, um unser Verständnis der Schizophrenie weiter zu verbessern.«16 Die Medien allerdings scheinen von der Endlosspirale immer größerer, aber immer gleich folgenloser Genetikstudien zur Schizophrenie schon ermüdet zu sein. FAZ, Süddeutsche Zeitung, Spiegel oder NZZ – im Gegensatz zu früher fand die Nature Publikation in keinem Wissenschaftsteil der großen deutschsprachigen Bildungsbürger‐Blätter überhaupt noch Erwähnung.





























