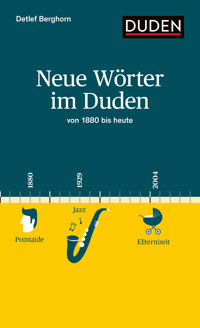
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliographisches Institut
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Duden - Sachbuch
- Sprache: Deutsch
Die Wörterbücher von Duden sind ein zentrales Zeitzeugnis der deutschen Sprache und der deutschen Geschichte. Der Historiker Detlef Berghorn nutzt diesen Schatz, um eine Chronik der Gesellschaft, Kultur und Politik Deutschlands der letzten 150 Jahre nachzuzeichnen. Über 2.300 ausgewählte Wörter machen deutlich, wann Themen ihre Sprache fanden, neu bewertet wurden oder in Vergessenheit gerieten. Dieses Buch zeigt uns, was wir mit Blick auf die sprachliche Chronik über die deutsche Geschichte lernen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Detlef Berghorn
Neue Wörter im Duden
Von 1880 bis heute
Inhalt
Zäsuren, Zeitgeist und Botokuden
Ein Vorwort
Dudenauflagen im Überblick
150 Jahre deutsche Sprach- und Kulturgeschichte
Von der Ottographie zur Orthographie
Die deutsche Reichsgründung und der erste »Duden« – oder doch der zweite?
Skandal und Maidenspeech
Wilhelminische Widersprüche: Politik und Gesellschaft im Kaiserreich
Creepy Onsie-Hater
Denglisch im Duden
Kolonie, Kautschuk und Kilimandscharo
Deutsche Kolonialgeschichte: kolonial, dekolonial, postkolonial
Dada, Keks und Simulanten
Der Erste Weltkrieg im Duden
Bubikopf und Männerdutt
Haariges im Duden
Vom Stutzer zum Fashion-Victim
Mode und Schönheit im Duden
Inflation, Foxtrott und Asphaltpresse
Der Duden in der Weimarer Republik
Machtergreifung und Volksverräter
Der Duden in der NS-Zeit
Hirtentäschel, Luftbrücke und Kollektivschuld
Die Nachkriegszeit: geteiltes Deutschland, geteilter Duden
Wirtschaftswunder, Schaschlik und Made in Germany
Kalter Krieg der Fernsehköche: Die Bundesrepublik in den 50er- und 60er-Jahren
Der Duden bittet zu Tisch
Speisen, Lebensmittel – und Ersatzprodukte
Fußballwörter von Mannschaft bis Videobeweis
Duden geht in die Verlängerung
Oblomowerei, Subbotnik und Towaristsch
Spitzbärte und andere Herausforderungen: Politik und Alltag in der DDR
Hitlerjungen, Halbstarke, Hippies, Hipster
»Yeah, Yeah, Yeah«: Jugendliche zwischen Krawall, Kommerz und Politik
Besser streiten mit dem Duden
Schimpfwörter aus 144 Jahren
Vom Waldsterben zum Waldbaden
Natur, Klima und Umwelt im Duden
Von ADAC bis Zeppelin
Unterwegs mit dem Duden
APO, Antibabypille und Abtreibungsparagraph
Westdeutschland zwischen Liberalisierung und Konservatismus
Liebe, Lust und ihre Folgen
Zwischenmenschliches im Duden
Zwölf Punkte für Europa!
Pailletten und Pop statt Panzer und Populismus
Mauerfall, Wendehals und Wegwerfmentalität
Die deutsche Wiedervereinigung – auch beim Duden
Mit dem Hackenporsche vor und zurück
Sprachwandel: »Haben wir denn sonst keine Probleme?«
Lemmata mit Migrationshintergrund
Die vielen Herkunftssprachen deutscher Wörter
Zäsuren, Zeitgeist und Botokuden
Ein Vorwort
Guter Rat
Ein Mensch, ein guter Orthograph,
Schrieb alles recht, sogar im Schlaf.
Er fehlte sozusagen nie:
Selbst was wie: »Idiosynkrasie«,
»Katarrh«, »Fayence«, »liniiert« –
Nie ist dem Menschen was passiert.
Doch eines Tags, wie’s halt so geht,
Schreibt er das schlichte Wort »Atlet«,
Und merkt zwar gleich den Fehler da,
Doch fragt er sich, wo steht das h.
Vergeblich sind da seine Finten,
Er zweifelt doch, ob vorn, ob hinten -
Ein Freund, den schließlich er befragt,
Hat kurz und bündig dies gesagt:
»Lebst Du denn bei den Botokuden?
Geh hin und kauf Dir einen Duden!«
Eugen Roth
Im Jahr 1880 erschien beim Verlag Bibliographisches Institut in Leipzig Konrad Dudens »Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache«. Das Werk stieß auf eine große Nachfrage; Neudrucke und Neuauflagen lösten sich in rascher Folge ab. Von staatlichen Stellen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bald als maßgebend in Fragen der Rechtschreibung anerkannt, wurde Konrad Dudens Wörterbuch schnell zu einer Institution, die nach seinem Tod 1911 auch seinen Namen im Titel führte, beginnend mit der Neuauflage von 1915: »Duden. Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache«. Noch heute wissen wohl die meisten deutschen Muttersprachlerinnen und Muttersprachler, was mit »Geh hin und kauf Dir einen Duden!« gemeint ist. Im Deutschen steht ›Duden‹ heute praktisch synonym für ›Wörterbuch‹.
Die Bedeutung des Duden geht aber über die praktische Nutzbarkeit als Wörterbuch sowie Ratgeber in Fragen der Rechtschreibung und Grammatik weit hinaus. Durch seine lange Geschichte ist der Duden zu einem einzigartigen kulturellen Gedächtnis angewachsen, das sich beginnend mit dem ›Schleizer Duden‹ von 1872 über mehr als 150 Jahre erstreckt – konserviert zunächst in Sprachkarteien, in jüngerer Zeit in der digitalen Datensammlung und immer wieder neu kuratiert und dargeboten in nunmehr 29 Auflagen. Von einer Ausnahme abgesehen, die aber nur eine kurze Episode blieb – die 14. Auflage des Ostdudens aus Leipzig speckte deutlich ab, als man eine inhaltliche Neuaufstellung versuchte –, nahmen die verzeichneten Stichwörter von Auflage zu Auflage zu: von 28.000 Lemmata in der Auflage von 1880 bis zu den 151.000 Lemmata in der 29. Auflage von 2024.
An dem stetigen Zuwachs – in den letzten Auflagen in der Regel um die 3.000 bis 5.000 Wörter – lässt sich die kontinuierliche Weiterentwicklung der deutschen Sprache ablesen; hinzu kommen die Erläuterungen zu einzelnen Lemmata, die ebenfalls Rückschlüsse auf sich verändernde Einstellungen und Bewertungen zulassen. Eine besondere Vergleichsmöglichkeit bieten zudem die parallelen Auflagen in den 40 Jahren der deutschen Teilung.
Bemerkenswert sind die Fälle früher Aufnahmen weiblicher Formen, bevor dies seit Ende der 1980er-Jahre zunehmend systematisch umgesetzt wird. Gammlerinnen1967 etwa hängen von Anfang an mit den Gammlern1967/L1967 ab: Sie waren offenbar ein sichtbarer und vieldiskutierter Teil dieser Jugend- und Protestkultur. Terroristinnen1986 folgen schon in den 1980ern den Terroristen1880 – was dem hohen Frauenanteil in der Roten-Armee-Fraktion1980/RAF1980 geschuldet sein dürfte. Die Frauenrechtlerin1915 findet sich zuerst in der 9. Dudenauflage. Begleitet wird sie zunächst noch von dem Frauenrechtler1915–1934, der jedoch in der martialischen1880NS.1941-Zeit aus dem Duden verschwindet und bis heute nicht wieder aufgetaucht ist. Immerhin gibt es seit der 25. Dudenauflage den Frauenversteher2009 (»ugs. für Mann, der sich Frauen gegenüber sehr einfühlsam gibt«) – ohne weibliches Pendant.
Überfliegt man eine mühsam erstellte, aber gut sortierbare Liste mit Wörtern und dem Jahr ihres ersten Erscheinens im Duden, werden sofort historische Zäsuren1905 sichtbar: der Erste Weltkrieg und der Übergang vom Kaiserreich zur Republik 1918/19, die Machtergreifung der Nazis, die Entnazifizierung auch des Duden nach Ende des Zweiten Weltkriegs, die Entwicklung zweier entgegengesetzter politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Systeme in West- und Ostdeutschland, die europäische Integration, die deutsche Wiedervereinigung und schließlich die jüngsten Krisen der Gegenwart. Alle Einschnitte gehen mit vielen Neuaufnahmen und Streichungen von Lemmata einher, etwa die zahllosen Komposita zu ›Blut‹, ›Rasse‹ und ›Volk‹ in der Nazizeit, dann deren weitgehendes Verschwinden nach 1945, das fließbandartige Wachstum der Wirtschaftswörter während des ›Wirtschaftswunders‹ im Westen, das spezialistische SED-Funktionärsvokabular im Osten, die Neuaufnahmen und Neubewertungen im Gefolge der Studentenbewegung und gesellschaftlichen Liberalisierung, die steigende Aufmerksamkeit für die europäischen Institutionen, der katastrophenartige Ausbruch der Corona-Wörter. So vermitteln die Lemmata und ihre Präsentation ein Gefühl für zeitgenössische Moden1880 und Paradigmen1880, den Zeitgeist1915, die Mentalitäten1929, Weltanschauungen1929und Trends1941, die Leitbilder1961/L1985 und Wertvorstellungen1973 sowie den allfälligen Sinneswandel1986 und aktuellen Mainstream2000.
Ein durchaus typischer Fall sind die Botokuden1915, die nach den oben zitierten herabwürdigenden Versen wohl in der Regel ohne Duden auskommen mussten. In Zeiten, als auch das Deutsche Reich Kolonien1880 in Übersee eroberte, wuchs das Interesse an der Völkerkunde1929 – nicht zuletzt zur Selbstversicherung der eigenen Überlegenheit; die volkstümliche1934 NS-Zeit hält sogleich eine Abwertung bereit; wie oft in den DDR-Ausgaben geht man ausführlicher auf Details aus Ländern der Dritten Welt1973/des globalen Südens ein – hier die Ableitung der Fremdbezeichnung von einem typischen hölzernen Körperschmuck –, und ›Volk‹ wird schließlich durch die korrektere ›Stammesgruppe‹ ersetzt; der ›Einheitsduden‹ orientiert sich vor allem an seinen bundesdeutschen Vorläufern; in der Gegenwart verzichtet man mittlerweile auf einen historisch unsinnigen Begriff und zeigt mehr Respekt für Gruppen, die in der Vergangenheit nicht gut gehört wurden.
Die Botokuden1915 im Duden
Auflage
Erläuterung
1915
Volk
1929
ostbras. Indianerstamm
1934
Indianerstamm in Brasilien; volksm. [volksmäßig, umgangs-, volkssprachlich] oft für Dummköpfe
1941, 1947
brasilian. Indianer; umg. für: Dummkopf
L1951
brasilan. Indianerstamm
1954–1986
bras. Indianer
L1957–L1976
Angehöriger eines indian. Volkes in Brasilien (portug. botoque »Lippenpflock«)
L1985
Angehöriger einer indian. Stammesgruppe in Brasilien (portug. botoque »Lippenpflock«)
1991, 1996
bras. Indianer
2000–2020
brasilian. Indianer
2024
(veraltet abwertend) Angehöriger einer brasilianischen indigenen Bevölkerungsgruppe
online
(veraltet abwertend) Angehöriger einer brasilianischen indigenen Bevölkerungsgruppe; (bildungssprachlich abwertend) ungebildeter Mensch mit schlechtem Benehmen
Die Erläuterungen in den Tabellen dieses Buchs sind leicht vereinheitlicht, orientieren sich aber möglichst an den Originaleinträgen.
Die farblich hervorgehobenen Wörter in den Texten sind Lemmata1905. Unter Umständen werden auch die Erläuterung im Duden angegeben – hier: »(gr.[iechisch]); das ›Genommene‹; Aufschrift, Lehnsatz«. Verwendungsbeispiele und weitere Informationen wie das Blaue vom Himmel1934 werden wie das Lemma selbst, in diesem Fall das schon früher verzeichnete Blaue1915, behandelt. Die hochgestellten Zahlen geben das Jahr der Dudenauflage an, in der das Lemma zuerst aufgenommen wurde: In den Beispielen handelt es sich um die 8. Dudenauflage von 1905, die 9. Dudenauflage von 1915 und die 11. Dudenauflage aus dem Jahr 1934. Berücksichtigt werden dabei nur die jeweiligen Erstausgaben, nicht die unzähligen Nachdrucke.
Lemmata aus den ostdeutschen Dudenausgaben in der Zeit der deutschen Teilung, als zwei Parallelverlage in Ost und West jeweils die Auflagenzählung ab der 13. Auflage von 1947 fortführten, sind wie bei Disko1980/L1985 mit einem L markiert, gegebenenfalls ergänzt um eine Angabe zur Aufnahme im westdeutschen Duden. Dass nur die Leipziger Ausgaben besonders gekennzeichnet sind, soll kein Fall von Othering2024 sein: Um Schriftbild und Lesefluss nicht unnötig zu stören, sind die Zusatzangaben auf ein Minimum reduziert. Der Westduden aber hatte im Vergleich sehr viel mehr Stichwörter als der Ostduden, überholte diesen mit seiner 19. Auflage und bildete daher später auch die Grundlage für den ›Einheitsduden‹ von 1991. Es macht also Sinn, hier der Einfachheit halber nur die DDR-Auflagen hervorzuheben und auf eine Kennzeichnung mit M für Mannheim zu verzichten – zumal die erste westdeutsche Auflage als Verlagsort Wiesbaden hatte, was noch ein verwirrendes W nötig gemacht hätte.
Man mag es kaum glauben, aber die Grundlage dieses Buchs bildet keine digitale Datenbank. Am Anfang gab es nur eine recht übersichtliche Liste mit Lemmata hauptsächlich aus der Gegenwart. So mussten über Wochen und Monate mehr als 30 Dudenbände, viele davon echte Raritäten und sehr fragil, immer wieder durchblättert werden, um die Erstaufnahme eines Stichworts und – besonders tückisch – gelegentlich auch sein Verschwinden und Wiederauftauchen herauszufinden. Allen, die mir dabei mit endloser Geduld geholfen haben, danke ich sehr!
Dudenauflagen im Überblick
150 Jahre deutsche Sprach- und Kulturgeschichte
Diese Übersicht zeigt die bisherigen Dudenauflagen und die Jahreszahl ihres Erstdrucks. Das L vor den Jahreszahlen der DDR-Ausgaben steht für »Leipziger Duden«.
(›Schleizer Duden‹
1872)
1. Auflage
1880
2. Auflage
?
3. Auflage
1887
4. Auflage
1893
5. Auflage
1897
6. Auflage
1900
7. Auflage
1902
(›Buchdruckerduden‹
1903)
8. Auflage
1905
9. Auflage
1915
10. Auflage
1929
11. Auflage
1934
12. Auflage
1941
13. Auflage
1947
14. Auflage
DDR
L1951
BRD
1954
15. Auflage
DDR
L1957
BRD
1961
16. Auflage
BRD
1967
DDR
L1967
17. Auflage
BRD
1973
DDR
L1976
18. Auflage
BRD
1980
DDR
L1985
19. Auflage
BRD
1986
20. Auflage
1991
(›Einheitsduden‹)
21. Auflage
1996
22. Auflage
2000
23. Auflage
2004
24. Auflage
2006
25. Auflage
2009
26. Auflage
2013
27. Auflage
2017
28. Auflage
2020
29. Auflage
2024
Von der Ottographie zur Orthographie
Die deutsche Reichsgründung und der erste »Duden« – oder doch der zweite?
Der Stand der »Orthographischen Frage« hat sich seit dem Erscheinen der vorigen Auflage dieses Buches zu Anfang des Jahres 1900 wesentlich verändert. Mußte ich mich damals damit begnügen, am Schluß des Vorwortes die Hoffnung auszusprechen, »es werde dem unerträglichen Übelstand, daß die jungen Leute die Rechtschreibung, die sie in der Schule haben lernen müssen, nicht anwenden dürfen, wenn sie in den Staatsdienst treten, in absehbarer Zeit ein Ende gemacht werden«, so darf ich heute der lebhaften Freude Ausdruck geben, daß es den vereinten Bemühungen der Reichsbehörden, der deutschen Bundesregierungen und besonders des preußischen Unterrichtsministeriums gelungen ist, ein noch viel höheres Ziel zu erreichen. Die Regierungen haben nämlich auf Grund der Beschlüsse der »Orthographischen Konferenz«, die vom 17. bis zum 19. Juni 1901 in Berlin getagt hat, wirklich und wahrhaftig eine einheitliche Rechtschreibung für das ganze Deutsche Reich geschaffen. [Hervorhebungen im Original, DB]
Für einen preußischen Geheimen Regierungsrat – so wie man ihn sich vorstellt: korrekt zugeknöpft, gepflegter Bart und Brille – geradezu euphorisch leitet Dr. Konrad Duden (1829–1911) das Vorwort der 7. Auflage seines »Orthographischen Wörterbuchs der deutschen Sprache« von 1902 ein. Sein ganzes Berufsleben war Duden bestrebt gewesen, die deutsche Rechtschreibung zu vereinheitlichen. Dabei orientierte er sich an praktischen Erwägungen aus seinem Alltag als Lehrer und Schuldirektor zunächst in Soest, dann in Schleiz und zuletzt in Hersfeld.
In Schleiz traf Duden auf eine typische Situation: Jeder Lehrer unterrichtete seine eigene Rechtschreibung. Duden diskutierte das Problem im Kollegium und stellte ein kleines Buch zusammen, den sogenannten Schleizer Duden, mit knapp 6.000 Lemmata, der 1872 unter dem Titel »Die deutsche Rechtschreibung. Abhandlung, Regeln und Wörterverzeichniß mit etymologischen Angaben« in Leipzig im Verlag B. G. Teubner erschien und vor allem schwierig zu schreibende Ausdrücke enthielt. Diese und andere Veröffentlichungen Dudens erregten die Aufmerksamkeit der preußischen Schulverwaltung, und 1876 nahm er auf Einladung des preußischen Kultusministers an der Ersten Orthographischen Konferenz teil, zu der sich auch Vertreter des Deutschen Buchdruckervereins und des Deutschen Buchhändlerverbands sowie Delegierte aus Baden, Württemberg und Bayern einfanden.
Über Jahrhunderte hatten sich die Schreibweisen des Deutschen in seinen verschiedenen mundartlichen Ausprägungen zunehmend angeglichen. Von Schriftstellern, Sprachforschern und Lexikografen wie Justus Georg Schottelius (1612–1676), Johann Christoph Gottsched (1700–1766) und Johann Christoph Adelung (1732–1806) waren wichtige Impulse ausgegangen hin zu allgemeingültigen deutschen Schriftnormen. Von einem eindeutigen Regelwerk war man aber auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch weit entfernt. In akademischen Kreisen standen sich zwei Positionen gegenüber: Auf der einen Seite die als Leffel-Partei verspottete ›historische Schule‹, die im Rückgriff auf Jacob Grimm eine Schreibweise auf Basis des durch die Sprachentwicklung längst überholten Mittelhochdeutschen einführen wollte, wobei zum Beispiel der titelgebende Löffel1880 als Leffel zu schreiben gewesen wäre, obwohl ö gesprochen wird. Und auf der anderen Seite die fi-Partei, benannt nach der angestrebten Schreibweise des Wortes Vieh1880 in einer rein phonetischen Form. Konrad Duden als Mann der Praxis lehnte die ›historische Schule‹ als rückwärtsgewandt und elitär ab: »Die Schrift ist nicht für die Gelehrten, sondern für das ganze Volk da […], und dieses verlangt nichts weiter von der Schrift, als daß sie genau, und daß sie leicht zu handhaben sei« Obwohl der phonetischen Lösung zuneigend, war der Pragmatiker Duden jedoch zu weitgehenden Kompromissen und Übergangslösungen bereit. So plädierte er unter anderem für eine erst allmähliche Durchsetzung einer einfacheren Schreibung von Wörtern in verschiedenen Varianten wie bei Sofa1880/Sopha1880 und eine Eindeutschung der Schreibweise von Fremdwörtern wie bei Büro1915 statt Bureau1880.
Die Reichsgründung 1871 brachte das Dilemma der verschiedenen Schreibweisen noch deutlicher ins öffentliche Bewusstsein. Der 1815 nach den Napoleonischen1880 Kriegen gegründete Deutsche Bund aus einer Vielzahl im Prinzip souveräner Fürstenstaaten sowie einigen freien Städten war eine Kompromisslösung, die niemanden so recht befriedigte. Der Wunsch nach nationaler1880 Einheit und Überwindung des Partikularismus1880 blieb lebendig, selbst nachdem ein erster Anlauf unter demokratischen1880 Vorzeichen in der Revolution1880 von 1848/49, in der sich auch Duden als junger Student engagiert hatte, gescheitert war. Der Dualismus1880 zwischen Preußen und Österreich, den mächtigsten Gliedern des Deutschen Bundes, und die damit einhergehende Frage einer nationalen Vereinigung im Sinne einer großdeutschen1915 (unter Einschluss der Habsburgermonarchie) oder kleindeutschen (unter preußischer Hegemonie1880) Lösung wurde im Deutschen Krieg1893 von 1866 zugunsten der Preußen entschieden. Der Deutsch-Französische Krieg1915 von 1870/71 führte schließlich zur Kaiserproklamation im Spiegelsaal von Versailles1929 vor den Toren Paris’: Der deutsche Nationalstaat, das Deutsche Reich1880 mit dem König von Preußen als deutschem Kaiser1880 und seinem preußischen Ministerpräsidenten als Reichskanzler1880, wurde im Zeichen des Sieges über den ›Erbfeind1915‹ Frankreich quasi ›von oben‹ vollendet.
Zu den vielen Baustellen, die noch einer Vereinheitlichung bedurften – so wurde etwa die Mark1880 bis 1876 als Reichswährung durchgesetzt und im Bereich der Justiz 1879 ein Reichsgericht1915 als oberste Instanz festgelegt – gehörte auch die deutsche Orthographie1880/Orthografie1996. Doch die Vorschläge der Ersten Orthographischen Konferenz stießen auf heftigen Widerstand von konservativer Seite, der an die erhitzten Sprachdebatten der Gegenwart erinnert. In der Folge gaben besonders die größeren deutschen Teilstaaten sowie Österreich zunächst eigene Regelwerke zur Rechtschreibung heraus.
In den preußischen Vorschriften sah Konrad Duden, wie immer um realistische Lösungen bemüht, die größten Chancen, dass von ihnen eine gesamtdeutsche Vereinheitlichung ausgehen könnte, schließlich war Preußen der größte und mächtigste Gliedstaat des Reichs und beheimatete allein mehr Deutschsprachige als der Vielvölkerstaat1929 der Habsburger. Ausgehend von dem preußischen Regelbuch, aber auch Bestimmungen etwa aus Bayern berücksichtigend, brachte Duden, der mittlerweile in den preußischen Schuldienst gewechselt war, im Jahr 1880 das »Vollständige Orthographische Wörterbuch der deutschen Sprache« heraus. Dieser erste offizielle »Duden« erschien im Verlag Bibliographisches Institut, der im Grunde bis heute die Dudenauflagen begleitet.
Konrad Dudens Wörterbuch fand schnell Verbreitung, nicht nur an Schulen, sondern auch unter Druckern, Setzern und Korrektoren. Die große Nachfrage machte immer neue Auflagen und stets erweiterte Überarbeitungen notwendig, mit denen Duden sich bis zu seinem Tod persönlich beschäftigte. Die 1. Auflage umfasst ungefähr 28.000 Lemmata. Die 4. Auflage von 1893 nahm mundartliche Ausdrücke aus der Literatur auf ebenso wie Fachbegriffe etwa aus Technik und Landwirtschaft. Die 5. Auflage ergänzte 1897 Ausdrücke aus der Seefahrt, die 6. von 1900 Begriffe aus Justiz und Militär.
Doch wie von Konrad Duden im einleitenden Zitat beklagt, durfte die in den Schulen vermittelte Rechtschreibung zunächst nicht im preußischen Staatsdienst angewandt werden. Der deutsche Reichskanzler und preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck ließ die in der Schule gültige Orthografie »bei gesteigerten Ordnungsstrafen« in der Verwaltung verbieten. Hier hatte man der ›Ottographie‹ zu folgen, wie sich hinter dem Rücken des ›Eisernen Kanzlers‹ über dessen konservative Haltung lustig gemacht wurde.
König Wilhelm I. von Preußen, der erste deutsche Kaiser, hatte seinem Ministerpräsidenten und Kanzler Bismarck weitgehend freie Hand gelassen. Auf dieses Zusammenwirken und die Führungspersönlichkeit Bismarcks waren die Reichsverfassung und das politische System des Reichs wesentlich ausgelegt. Schwierigkeiten traten jedoch auf, als nach dem kurzen Zwischenspiel des liberal gesinnten, aber schwer kranken Kaisers Friedrich III. im sogenannten Dreikaiserjahr 1888 der junge Wilhelm II. seinem Vater auf den Thron folgte und alsbald mit dem altgedienten Kanzler in Streit geriet. Am Ende musste Bismarck 1890 zurücktreten, und der ambitionierte Wilhelm II. nahm in den folgenden Jahren starken Einfluss auf die Politik, was das Reich in immer unruhigere Fahrwasser führte. Konrad Duden immerhin bedachte Bismarck1893, seinen Gegenspieler in der »Orthographischen Frage«, schon in der dem Rücktritt des Kanzlers folgenden 4. Auflage mit einem ersten knappen Eintrag.
Allerdings fehlen in den Dudenauflagen der Kaiserzeit zeitgenössisch gebräuchliche, aber kontroverse Stichwörter wie ArbeiterbewegungL1967/1980 und DreiklassenwahlrechtL1957/1967, die orthografisch nicht weniger anspruchsvoll sind als andere Zusammensetzungen wie Arbeitgeber1915 oder Dreikaisersaal1915 – ein simpler Festsaal in einem Bonner Hotel. Immerhin schaffte es der Kulturkampf1915–1934/1961 zur lange zurückliegenden Auseinandersetzung Bismarcks mit der katholischen Kirche für einige Auflagen in den Duden, um dann 1941 – während das NS-Regime Konflikte mit den Katholiken vermeiden und offenbar auch nicht daran erinnert wissen wollte – zunächst wieder zu verschwinden. Konrad Duden selbst nennt im oben zitierten Vorwort unter anderem den patriotisch um Sprachreinigung bemühten Allgemeinen Deutschen Sprachverein, die Felddienstordnung1902 und die Militärstrafgerichtsordnung sowie das erst 1900 in Kraft getretene Bürgerliche Gesetzbuch als wichtige Quellen seiner Arbeit. In diesem Setting ist wohl auch die Erläuterung zur Socialdemokratie1887/Sozialdemokratie1902, immerhin seit 1890 stimmenstärkste Partei bei Reichstagswahlen, zu verorten: »nach Umsturz der gesellschaftlichen Ordnung strebende Partei«, was erst 1915 zu »polit. Partei« neutralisiert wird. Bismarcks sogenanntes Sozialistengesetz wiederum, das zwischen 1878 und 1890 linke Vereinigungen und Schriften verbot und als Schlagwort verbreitet war, ist nicht zu finden – sollte man es mit c oder z schreiben?
Die von Konrad Duden gepriesene Zweite Orthographische Konferenz legte 1901 schließlich eine deutsche Rechtschreibung auf Basis der preußischen und der davon kaum abweichenden bayerischen Schulorthografien fest. Vertreter Österreichs schlossen sich an, die Schweiz hatte ohnehin schon 1892 die Schreibweise des Duden als verbindlich anerkannt. Selbst in den deutschen Schulen Nordamerikas galt sein Wörterbuch als maßgebend, wie Konrad Duden ausführt. Als Kompromiss bestanden vor allem für Fremdwörter noch mehrere Varianten weiter. Es waren die Buchdruckervereine aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die hier weitere Fortschritte vorantrieben, und unter Mithilfe Konrad Dudens entstand 1903 der sogenannte Buchdruckerduden, der die unterschiedlichen Schreibweisen von Wörtern weitgehend beseitigte. Im Jahr 1909 vereinbarte Konrad Duden mit dem Bibliographischen Institut eine Zusammenführung und Erweiterung des klassischen Duden mit dem Buchdruckerduden. Dieses Werk, als 9. Auflage gezählt, erschien 1915 nach dem Tod Konrad Dudens und trug erstmals seinen Namen: »Duden. Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache«. »Der Große Duden« folgte schließlich als 10. Auflage 1929. Duden1915 war zu einer Institution geworden und wird entsprechend im Wörterbuch selbst aufgenommen als »Fn. [Familienname]« und »Rechtschreibbuch«; ab 1929 heißt es spezifischer »dtsch. Sprachgelehrter«. Die DDR-Ausgaben behalten das Stichwort bei, in den westdeutschen Auflagen wird es zuletzt 1954 aufgeführt – Understatement1967 kannte man in der Mannheimer Dudenredaktion da aber noch nicht.
Ein bis heute ungelöstes Mysterium1880 ist der Verbleib der 2. Auflage des Duden. Ein Belegexemplar1905 hat sich nicht erhalten – ungewöhnlich bei der schon damals weiten Verbreitung des Wörterbuchs. Das Werk, das 1880 erstmals im Leipziger Verlag Bibliographisches Institut erschien, machte zunächst noch keine Angaben zur Auflagenzahl. Die umgearbeitete und vermehrte Auflage von 1887 wurde dann als dritte angeführt. Möglicherweise hatte man dabei einen Nachdruck der 1. Auflage mitgezählt. Einer anderen Theorie zufolge könnte damals der sogenannte Schleizer Duden stillschweigend als eigentliche 1. Auflage gewertet worden sein, die aber von einem anderen Verlag 1872 herausgebracht worden war. Später habe dann das Bibliographische Institut1929–1996, das sich ab der 10. Auflage auch durch ein eigenes Lemma vertreten ließ, aus Gründen des Renommees1880 und im Nachhinein die allererste Auflage eines »Duden« für sich reklamiert.
Skandal und Maidenspeech
Wilhelminische Widersprüche: Politik und Gesellschaft im Kaiserreich
Als die Leserinnen und Leser im November 1906 die neuesten Ausgaben der »Zukunft« durchblätterten, entfaltete sich vor ihnen einer der größten Skandale der deutschen Geschichte – heute fast vergessen oder ins Anekdotenhafte entpolitisiert, damals jedoch international genüsslich wahrgenommen und weitergetragen. Maximilian Harden, Herausgeber und eifrigster Beiträger seiner weit über die deutschen Grenzen hinaus rezipierten Wochenzeitschrift – gebildete internationale Kreise beherrschten selbstverständlich neben Französisch auch Deutsch – berichtete mit vielen Andeutungen, die Eingeweihte sofort verstanden und alle anderen umso neugieriger machten, über das engere Umfeld Wilhelms II., des deutschen Kaisers und Königs von Preußen.
Unter Verwendung von Tarnnamen drohte Harden zwei engen Freunden des Herrschers, Philipp Fürst zu Eulenburg (»der Harfner«) und Kuno Graf von Moltke (»der Süße«), mit der Veröffentlichung von kompromittierenden Briefen, in denen auch der Kaiser (»das Liebchen«) erwähnt werde. Dabei waren die Artikel mit den bezeichnenden Überschriften »Praeludium« (= Vorspiel) sowie »Dies irae« (= Tage des Zorns, als Anspielung auf das Jüngste Gericht) nur der Auftakt zu einer gezielten Pressekampagne gegen eine vermeintliche Kamarilla1880 von homosexuellen1915 Höflingen1880 und Pazifisten1929 mit allzu großem Einfluss auf das sogenannte persönliche Regiment Wilhelms II. jenseits der parlamentarischen Strukturen. Hardens Kritik zielte dabei vor allem auf den Sturz Eulenburgs ab, dem er eine seiner Meinung nach zu kompromissbereite und frankreichfreundliche Außenpolitik anlastete.
Zeitgenossinnen und -genossen war sofort klar, welche Sprengkraft dieses Outing1996avant la lettre entfaltete und dass das Ansehen der Monarchie und des Reichs auf dem Spiel standen. Die aktuelle Geschichtsschreibung zieht Parallelen zur Dreyfus-Affäre, die einige Jahre zuvor Frankreich auf eine innere Zerreißprobe gestellt hatte, als rechte Kreise in Militär, Politik und Justiz den jüdischen Offizier Alfred Dreyfus gegen offenbare Beweise wegen Spionage verurteilt hatten.
Aus Götterhimmel und Gossensprache: Bezeichnungen für queere2017 Menschen
2004
Gay
ugs. für Homosexueller
1973
Homo
ugs. für: Homosexueller
1915
Homosexualität
Gleichgeschlechtlichkeit
1986
Homosexueller
–
1941
invertiert
(geschlechtlich) verkehrt (empfindend)
1915
Kinäde
Urning
1941
Päderast, Weichling
1967
Päderast, Weichling, Lüstling
1973
männl. Hetäre im alten Griechenland, Päderast
1915
Lesbierin
–
1991
homosexuell veranlagte Frau
2013–
seltener für Lesbe
1980
Lesbe
ugs. für: Lesbierin
2000
ugs. u. Selbstbezeichnung für Lesbierin
2013–
ugs. u. Selbstbez. für homosexuell veranlagte Frau
2024
LGBTQ+
umfasst alle nicht dem heteronormativen Mann-Frau-Konzept entsprechenden Personen
2017
queer
einer anderen als der heterosexuellen Geschlechtsidentität zugehörig
1967
Schwule
derb für: Homosexueller
1986
ugs. für: Homosexueller
2000
ugs. u. Selbstbez. für Homosexueller
1915
Tribade
widernatürliche Unzucht treibendes Weib
1929
lesbischer Liebe ergebene Frau
1991
veraltet für Lesbierin
1905
Tunte
affektierte, zimperliche Person
1915
ma.: zimperlicher Mensch
1934–
fehlt
1967
1973
ugs. abschätzig für: langweilige, dumme Person, bes. Frau
1980
ugs. abschätzig für: langweilige, dumme Person, bes. Frau; Homosexueller
1986
ugs. abschätzig für: Frau, Homosexueller
1991
ugs. für Frau; Homosexueller mit femininem Gebaren
1934
Uranismus
[1954:] nach Uranos, dem Vater der ohne Mutter geborenen Urania; Homosexualität
1967
Uranist
Homosexueller
1902
Urning
angeblich von (Venus) Urania; Knabenschänder
1905
Anhänger der Knabenliebe
1929
Anhänger der Männerliebe
1934
der gleichgeschlechtlichen Liebe Verfallener
1967
svw. Uranist
Nicht zuletzt das ungeschickte Krisenmanagement des Kaisers und seines Kanzlers Bernhard von Bülow führte zu einer Welle von Sensationsprozessen – beobachtet von zahlreichen Auslandskorrespondenten –, die die Aufmerksamkeit und öffentliche Empörung nur noch vergrößerten. Im Sommer 1909, nach drei Jahren und einem Nervenzusammenbruch Wilhelms II., endeten die Auseinandersetzungen mit einer Reihe von Absprachen zwischen Harden und seinen Gegnern, während ein Verfahren gegen Eulenburg wegen Meineids aus Rücksicht auf dessen Gesundheit auf unbestimmte Zeit ausgesetzt wurde.
In der ganzen Affäre offenbarten sich wie unter einem Brennglas die Widersprüche von Politik und Gesellschaft des deutschen Kaiserreichs1915 vor dem Ersten Weltkrieg – in der Rückschau wilhelminisches Zeitalter1929 »nach Kaiser Wilhelm II. benannt«, wie die 10. Dudenauflage erläutert. Einerseits war das Land auf vielen Gebieten führend, etwa in der Medizin, den Naturwissenschaften oder im Bereich der technischen Innovationen; wirtschaftlich hatte es Großbritannien, das Mutterland der Industriellen Revolution, überholt. Das deutsche Bildungswesen genoss einen hervorragenden Ruf; Musik, Literatur und Philosophie erhielten wichtige Impulse. Frauenbewegung und Lebensreform stießen gesellschaftliche Veränderungen an, und selbst die moderne Homosexuellenbewegung hatte hier ihren Ursprung. Demgegenüber standen ein rückwärtsgewandtes politisches System und überkommene Strukturen, die den alten Eliten1880 und allen voran dem deutschen Kaiser und König von Preußen einen großen Einfluss auf die Staatsführung einräumten. Nicht nur Frauen waren vom Wahlrecht ausgeschlossen: In Preußen, dem größten Teilstaat des Reichs, sorgte ein Dreiklassenwahlrecht auf Landesebene für eine Bevorzugung wohlhabender konservativer Wähler1880 und ihrer Interessen; hinzu kam eine Wahlkreiseinteilung, die die großen Industriestädte und die dort dominierende Socialdemokratie1887/Sozialdemokratie1902 benachteiligte – gerrymandering auf preußisch. Es wundert daher nicht, dass einige Begriffe des politischen Alltagsgeschäfts als Anglizismen1902 beziehungsweise Lehnwörter1915 aus dem fortschrittlicheren britischen System übernommen werden mussten und so ihren Weg in die zeitgenössischen Dudenausgaben fanden.
Politische Wörter nach Vorbild des britischen Parlamentarismus1880
1880
Budget
Komitee
Legislatur
Parlamentarismus
1887
Maidenspeech
1897
Caucus
Parlamentarier
1915
Suffragette
Die erst 1871 verwirklichte deutsche Reichsgründung unter Ausschluss Österreichs war durch Kriege erreicht worden, dementsprechend groß war die Bedeutung der Armee1880 und neuerdings der Marine1880 – ein Steckenpferd1915 des Kaisers. Drill1902, Korpsgeist1902 und generell die Idealisierung alles Soldatischen1880 war ein prägendes Element der Kaiserzeit; Byzantinismus1880 und Militarismus1880 gingen Hand in Hand – literarisch festgehalten in »Der Untertan« von Heinrich Mann aus dem Jahr 1914. Nach außen trat das Deutsche Reich unter Wilhelm II. im Streben nach Weltgeltung zunehmend aggressiv1880 auf. Chauvinistisch1880 fühlte man sich anderen Nationen auch moralisch1880 weit überlegen – umso stärker erschütterte der Eulenburg-Skandal das Selbstverständnis der Elite und ihre Normen deutscher Männlichkeit1915.





























