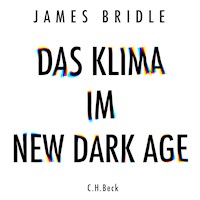9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Während neue Technologien immer schneller und immer massiver bis in die letzten Winkel unseres Lebens vordringen, sind wir immer weniger dazu in der Lage, sie unseren Erfordernissen anzupassen. Sie sind längst zu einer Bedrohung für humane Lebensformen geworden. Eine japanische Touristenfamilie folgt an der Küste Australiens ihrem Navi bis in den Ozean, obwohl die Straße längst verschwunden ist. Auch die Ranger im Death Valley in Arizona kennen dieses Phänomen, dass Ortsfremde der Technik mehr vertrauen als den eigenen Sinnen. Sie haben sogar einen eigenen Begriff dafür: "Tod durch GPS". Doch dieser makabre "automation bias" ist nur ein Gleichnis für die Lage, in der sich die Menschheit heute befindet. Während neue Technologien immer schneller und immer massiver bis in die letzten Winkel unseres Lebens vordringen, sind wir immer weniger dazu in der Lage, sie unseren Erfordernissen anzupassen. Sie sind längst zu einer Bedrohung für humane Lebensformen geworden. In einer rasanten Tour de Force führt uns James Bridle, der "Orwell des 21. Jahrhunderts", durch die technologischen Dystopien der Gegenwart - vom Klimawandel und dem Internet bis zur Automatisierung der Arbeitswelt und der omnipräsenten Datenerfassung. Doch er zeigt noch mehr: Wir müssen eine unberechenbar gewordene Welt anders denken lernen, wenn wir uns in unserem "New Dark Age" noch zurecht finden wollen. Bridle ist ein junger Harari noir - kompetent, funkelnd und düster wie ein Roman von H.P. Lovecraft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
James Bridle
Der Sieg der Technologie und das Ende der Zukunft
Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn
C.H.Beck
ZUM BUCH
Während neue Technologien immer schneller und immer massiver bis in die letzten Winkel unseres Lebens vordringen, sind wir immer weniger dazu in der Lage, sie unseren Erfordernissen anzupassen. Sie sind längst zu einer Bedrohung für humane Lebensformen geworden. In einer rasanten Tour de Force führt uns James Bridle durch die technologischen Dystopien der Gegenwart – vom Klimawandel und dem Internet bis zur Automatisierung der Arbeitswelt und der omnipräsenten Datenerfassung. Bridle ist ein junger Harari noir – kompetent, funkelnd und düster wie ein Roman von H. P. Lovecraft.
«New Dark Age gehört zu den klügsten und zugleich beunruhigendsten Büchern über die digitale Welt, die ich jemals gelesen habe, was nichts anderes heißt als dass es zu den klügsten und erhellendsten Büchern über das Leben von heute gehört, die ich jemals gelesen habe.»
The New Yorker
ÜBER DEN AUTOR
James Bridle (*1980) ist Künstler und Autor. Er hat Computer Science und Cognitive Science am University College, London, studiert und über Künstliche Intelligenz promoviert. Seine künstlerischen Arbeiten und Installationen wurden in Galerien und Museen weltweit ausgestellt. Seine Texte sind in «Wired», «Frieze», «The Atlantic», dem «Guardian» und «Observer» erschienen. 2015 wurde er vom Magazin «Wired» zu den 100 einflussreichsten Menschen in Europa gezählt. «New Dark Age» ist sein erstes Buch.
INHALT
KAPITEL 1: KLUFT
KAPITEL 2: COMPUTERISIERUNG
KAPITEL 3: KLIMA
KAPITEL 4: KALKULATION
KAPITEL 5: KOMPLEXITÄT
KAPITEL 6: KOGNITION
KAPITEL 7: KOMPLIZENSCHAFT
KAPITEL 8: KONSPIRATION
KAPITEL 9: KOLLATERALE
KAPITEL 10: CLOUD
DANK
ANMERKUNGEN
KAPITEL 1: KLUFT
KAPITEL 2: COMPUTERISIERUNG
KAPITEL 3: KLIMA
KAPITEL 4: KALKULATION
KAPITEL 5: KOMPLEXITÄT
KAPITEL 6: KOGNITION
KAPITEL 7: KOMPLIZENSCHAFT
KAPITEL 8: KONSPIRATION
KAPITEL 9: KOLLATERALE
KAPITEL 10: CLOUD
REGISTER
Fußnoten
Für Navine
KAPITEL 1
KLUFT
Wenn die Technik doch nur irgendwas erfinden würde, womit wir uns in einem Notfall mit Ihnen in Verbindung setzen könnten!», sagte mein Computer, immer und immer wieder.
Nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl 2016 begann ich, ähnlich wie mehrere meiner Bekannten und womöglich durch das Schwarmdenken der sozialen Medien dazu animiert, mir die Serie The West Wing (dt. Im Zentrum der Macht) noch einmal anzuschauen: eine Übung in heilloser Nostalgie. Sie brachte keine Erleichterung, aber ich gewöhnte mir an, mir, wenn ich allein war, am Abend nach der Arbeit oder im Flugzeug ein oder zwei Folgen anzusehen. Nach der Lektüre der neuesten apokalyptischen Forschungsberichte zum Klimawandel, zur totalen Überwachung und zu den Unwägbarkeiten der weltpolitischen Lage war ein neoliberales Kammerspiel aus den Nullerjahren nicht das Schlechteste, um darin zu versinken. Eines Abends befand ich mich mitten in einer Folge aus der dritten Staffel, und Leo McGarry, Stabschef von Präsident Bartlett, bedauert es sehr, einer Ausschusssitzung beigewohnt und deshalb die ersten Phasen eines Notfalls – ein mit Uranbrennstäben beladener LKW ist verunglückt – verpasst zu haben.
«Was hätten Sie vor einer halben Stunde getan, was nicht bereits getan worden ist?», fragt ihn daraufhin der Präsident.
«Ich hätte», erwidert McGarry, «vor einer halben Stunde gewusst, was ich jetzt weiß. Und genau aus diesem Grund gehe ich auch nicht mehr zu meinem Meeting – kleiner Luxus.»
Bartlett umkreist McGarry und meint voll beißender Ironie: «Ich weiß. Wenn die Technik doch nur irgendwas erfinden würde, womit wir uns in einem Notfall mit Ihnen in Verbindung setzen könnten! Irgendwie so eine Art Telefongerät mit einer ganz persönlichen Nummer, die wir anrufen könnten, um Sie wissen zu lassen, dass wir Sie brauchen.» Er greift in Leos Hosentasche und zieht dessen Pager heraus. «Vielleicht würde es ja etwa so aussehen, Mr. Moto!»
Doch so weit kam die Folge gar nicht. Das Bild auf dem Schirm änderte sich fortwährend, aber mein Laptop war abgestürzt, und ein Satz der Tonspur lief in Endlosschleife: «Wenn die Technik doch nur irgendwas erfinden würde, womit wir uns in einem Notfall mit Ihnen in Verbindung setzen könnten! Wenn die Technik doch nur irgendwas erfinden würde, womit wir uns in einem Notfall mit Ihnen in Verbindung setzen könnten! Wenn die Technik doch nur irgendwas erfinden würde, womit wir uns in einem Notfall mit Ihnen in Verbindung setzen könnten!»
Dieses Buch handelt davon, was die Technik uns in einem Notfall zu sagen versucht. Es geht aber auch darum, was wir wissen, wie wir Wissen erlangen und was wir nicht wissen können.
Im Verlauf des vergangenen Jahrhunderts hat die technologische Beschleunigung unseren Planeten, unsere Gesellschaften und uns selbst verändert, doch unser Verständnis dieser Dinge hat sie nicht geändert. Die Gründe dafür sind vielschichtig, und Gleiches gilt für die Antworten, nicht zuletzt deshalb, weil wir selbst vollständig in technologische Systeme eingebunden sind, die ihrerseits beeinflussen, wie wir handeln und wie wir denken. Wir können uns nicht außerhalb davon stellen; wir können nicht ohne sie denken.
Unsere Technologien sind an den größten Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, beteiligt: einem außer Kontrolle geratenen Wirtschaftssystem, das viele Menschen ins Elend stürzt und die Kluft zwischen Reich und Arm immer größer werden lässt; dem Zusammenbruch des politischen und gesellschaftlichen Konsenses überall auf der Welt, was wachsende Nationalismen, gesellschaftliche Spaltungen, ethnische Konflikte und Schattenkriege zur Folge hat; und einem Klimawandel, der uns alle existenziell bedroht.
Überall in den Wissenschaften und in der Gesellschaft, in Politik und Bildung, in Krieg und Handel steigern neue Technologien nicht nur unsere Fähigkeiten, sondern prägen und lenken diese aktiv, zum Besseren wie zum Schlechteren. Wir müssen zunehmend in der Lage sein, neue Technologien anders zu denken und ihnen gegenüber kritisch zu sein, um sinnvoll an dieser Prägung und Lenkung teilhaben zu können. Wenn wir nicht verstehen, wie komplexe Technologien funktionieren, wie Technologiesysteme miteinander vernetzt sind und wie Systeme von Systemen interagieren, sind wir innerhalb dieser Systeme machtlos, und egoistische Eliten und unmenschliche Unternehmen können sich ihres Potenzials umso leichter bemächtigen. Gerade weil diese Technologien auf unerwartete und oftmals seltsame Weise miteinander interagieren und weil wir vollständig darin eingebunden sind, lässt sich dieses Verständnis nicht auf praktische Fragen danach, wie Dinge funktionieren, beschränken: Es muss sich auch darauf erstrecken, wie Dinge zu dem geworden sind, was sie sind, und inwiefern ihre Funktionsweisen in der Welt oft unsichtbar und miteinander verwoben sind. Was wir brauchen, ist nicht Verständnis, sondern Bildung.
Echte Bildung in Sachen Systeme besteht aus weit mehr als schlichtem Verstehen und lässt sich auf vielfältige Weise begreifen und praktizieren. Sie reicht über eine funktionale Nutzung eines Systems hinaus, sie will dessen Kontext und Konsequenzen verstehen. Sie weigert sich, die Anwendung irgendeines Systems als Allheilmittel zu betrachten, und beharrt darauf, dass Systeme in einer Wechselbeziehung stehen und dass jeder einzelnen Lösung Grenzen gesetzt sind. Sie spricht nicht nur die Sprache eines Systems fließend, sondern auch dessen Metasprache – also die Sprache, mit deren Hilfe es über sich selbst spricht und mit anderen Systemen interagiert – und ist sensibel gegenüber den Grenzen und dem potentiellen Nutzen wie auch gegenüber dem Missbrauch dieser Metasprache. Vor allem aber ist echte System-Bildung dazu in der Lage, Kritik zu üben und auf Kritik zu reagieren.
Eines der Argumente, das als Reaktion auf ein geringes öffentliches Verständnis von Technologie häufig vorgebracht wird, ist die Forderung nach mehr technologischer Bildung – was auf eine ganz einfache Formel gebracht bedeutet: programmieren zu lernen. Eine solche Forderung wird häufig von Politikern, Technikern, Meinungsmachern und Wirtschaftsführern erhoben, und sie wird häufig in rein funktionalen und marktorientierten Kategorien vorgebracht: Die Informationsökonomie benötigt mehr Programmierer, und junge Menschen brauchen zukünftig Arbeitsplätze. Das ist ein guter Ausgangspunkt, aber programmieren zu lernen reicht nicht, so wie es nicht reicht, einen Abfluss zu installieren, um die komplexen Interaktionen zwischen Grundwasserspiegel, politischer Geographie, in die Jahre kommender Infrastruktur und Sozialpolitik zu verstehen, wie sie die Lebenserhaltungssysteme in einer Gesellschaft tatsächlich bestimmen, beeinflussen und produzieren. Ein schlicht funktionales Verständnis von Systemen genügt nicht; man muss auch über Geschichten und Folgen nachdenken können. Wo kamen diese Systeme her, wer hat sie zu welchem Zweck entworfen, und welche dieser Intentionen lauern heute noch in ihnen?
Die zweite Gefahr eines rein funktionalen Technologieverständnisses ist das, was ich als computational thinking bezeichne, als Computerdenken in dem Sinne, dass Menschen wie Computer denken. Computerdenken ist eine Ausweitung dessen, was andere als Solutionismus bezeichnet haben: die Überzeugung, dass sich jedes Problem durch die Anwendung von Berechnung nach Art eines Computers lösen lässt. Ganz gleich, mit welchem praktischen oder gesellschaftlichen Problem wir es zu tun haben, gibt es dafür eine App. Aber auch der Solutionismus ist unzureichend; das ist eines der Dinge, die uns unsere Technologie zu vermitteln versucht. Abgesehen von diesem Irrtum geht Computerdenken – oftmals unbewusst – davon aus, dass die Welt wirklich so ist, wie die Solutionisten sie sich vorstellen. Es verinnerlicht den Solutionismus dermaßen, dass sich die Welt überhaupt nicht mehr in Kategorien denken oder artikulieren lässt, die nicht berechenbar sind. Computerdenken herrscht in der heutigen Welt vor und befeuert die schlimmsten Entwicklungen in unseren Gesellschaften und Interaktionen, und ihm muss man eine echte systemische Bildung entgegensetzen. Wenn die Philosophie der Teil des menschlichen Denkens ist, der sich mit dem befasst, was sich nicht wissenschaftlich erklären lässt, dann ist systemische Bildung das Denken, das sich mit einer nicht berechenbaren Welt beschäftigt und gleichzeitig anerkennt, dass sie unwiderruflich durch Berechnung (im Sinne von Computerisierung) geprägt und bestimmt ist.
Das Argument, es reiche, programmieren zu lernen, führt auch noch anderweitig in die Irre: Man sollte in der Lage sein, technologische Systeme zu verstehen, ohne überhaupt programmieren lernen zu müssen, so wie man kein Klempner sein muss, um zu kacken oder um ohne Angst davor zu leben, dass einen das eigene Abwassersystem umbringen will. Man sollte allerdings die Möglichkeit, dass unser Abwassersystem uns tatsächlich umzubringen versucht, nicht ganz ausschließen: Die Infrastruktur unserer heutigen Gesellschaft beruht großteils auf komplexen Computersystemen, und wenn die Menschen sie nicht sicher nutzen können, dann wird uns auch noch so viel Wissen darüber, wie schlimm sie sind, auf lange Sicht nicht retten können.
In diesem Buch werden wir ein paar Klempnerarbeiten verrichten, aber wir müssen uns zu jeder Zeit der Bedürfnisse der Nicht-Klempner bewusst bleiben: des Bedürfnisses zu verstehen und des Bedürfnisses zu leben, selbst wenn wir nicht immer verstehen. Wir haben oft Mühe, Ausmaß und Dimensionen neuer Technologien zu begreifen und zu beschreiben, was bedeutet, dass wir Mühe haben, sie überhaupt zu denken. Wir brauchen keine neue Technologie, sondern neue Metaphern: eine Metasprache, um die Welt, die komplexe Systeme erschaffen haben, zu beschreiben. Wir brauchen eine neue Kurzschrift, eine, welche die Realität einer Welt, in der Menschen, Politik, Kultur und Technik vollständig miteinander verflochten sind, anerkennt und thematisiert. Wir waren schon immer miteinander verbunden – ungleich, unlogisch und die einen mehr als die anderen, aber trotzdem vollständig und unvermeidlich. Das Neue am Netzwerk ist, dass diese Verbindung sichtbar und nicht mehr zu leugnen ist. Wir sind die ganze Zeit mit der radikalen Vernetztheit von Dingen und unserem Ich konfrontiert, und wir müssen mit dieser Erkenntnis auf neue Weise umgehen. Es reicht nicht, davon zu sprechen, dass allein das Internet oder amorphe Technologien, ohne dafür Verantwortung tragen zu müssen, die Kluft in unserem Verständnis und in unserer Handlungsfähigkeit verursachen oder beschleunigen. Mangels eines besseren Begriffs verwende ich den Terminus «Netzwerk», um uns und unsere Technologien zu einem riesigen System zusammenzufassen – um menschliches und nicht-menschliches Handeln und Verstehen, Wissen und Nichtwissen zu einer Handlungssuppe zu verrühren. Die Kluft besteht nicht zwischen uns und unseren Technologien, sondern innerhalb des Netzwerks selbst, und durch dieses Netzwerk erlangen wir überhaupt erst Kenntnis davon.
Schließlich ermöglicht System-Bildung Kritik, sie übt Kritik und reagiert auf Kritik. Die Systeme, mit denen wir uns beschäftigen werden, sind zu wichtig, als dass nur ein paar wenige sie denken, verstehen, entwerfen und umsetzen sollten, insbesondere wenn diese wenigen sich allzu leicht mit älteren Eliten und Machtstrukturen verbünden oder von diesen vereinnahmt werden. Es besteht eine konkrete und kausale Beziehung zwischen der Komplexität von Systemen, mit denen wir es jeden Tag zu tun haben, der Intransparenz, mit der die meisten dieser Systeme konstruiert oder beschrieben werden, und grundlegenden globalen Fragen der Ungleichheit, der Gewalt, des Populismus und des Fundamentalismus. Allzu oft werden neue Technologien so dargestellt, als seien sie per se emanzipatorisch. Aber das ist seinerseits ein Beispiel von Computerdenken, dessen wir alle uns schuldig machen. Diejenigen von uns, die neue Technologien immer sofort übernehmen und bejubeln, die wir ihre vielfältigen Vorzüge genießen und von ihren Möglichkeiten profitieren und die wir folglich, oftmals naiv, für ihre weitere Verbreitung eintreten, sind nicht minder davor gefeit, sie unkritisch anzuwenden. Doch Kritik kann nicht auf individuellen Bedrohungen oder auf der Identifikation mit den weniger Begünstigten oder den weniger Versierten gründen. Individualismus und Empathie sind beide im Netzwerk unzureichend. Überleben und Solidarität müssen ohne Verstehen möglich sein.
Wir verstehen nicht alles, können gar nicht alles verstehen, aber wir sind in der Lage, es zu denken. Die Fähigkeit zu denken, ohne zu behaupten oder gar danach zu streben, etwas vollständig zu verstehen, ist der Schlüssel zum Überleben in einem New Dark Age, einem neuen finsteren Zeitalter, denn wie wir sehen werden, ist Verstehen oftmals unmöglich. Technologie kann bei diesem Denken Orientierung und Hilfe leisten, vorausgesetzt, dass wir ihre Ergebnisse nicht privilegiert behandeln: Computer sind nicht dazu da, uns Antworten zu geben, sondern sie sind Werkzeuge, um Fragen zu stellen. Wie wir in diesem Buch immer wieder sehen werden, ermöglicht es das tiefreichende und systemische Verständnis einer Technologie oftmals, ihre Metaphern im Dienste anderer Denkweisen umzuformen.
In den 1950er Jahren schlich sich allmählich ein neues Symbol in die Diagramme, die Elektroingenieure zeichneten, um die von ihnen geschaffenen Systeme zu beschreiben. Das Symbol war ein undeutlicher Kreis, eine Art Bovist oder eine Gedankenblase. Schließlich und endgültig nahm es die Form einer Wolke an. Woran auch immer der Ingenieur arbeitete, er konnte es mit dieser Wolke verbinden, das war alles, was man wissen musste. Die andere Wolke konnte ein Machtsystem oder ein Datenaustausch oder ein anderes Computernetzwerk oder was auch immer sein. Es spielte keine Rolle. Die Wolke bot eine Möglichkeit, Komplexität zu reduzieren: Sie ermöglichte es, sich auf das Naheliegende zu konzentrieren, ohne dass man sich Gedanken darüber machen musste, was dort drüben passierte. Als die Netzwerke mit der Zeit immer größer wurden und immer enger verflochten waren, gewann die Wolke an Bedeutung. Kleinere Systeme wurden über ihre Beziehung zur Wolke definiert, darüber, wie schnell sie Informationen damit austauschen konnten, was sie aus dieser Wolke beziehen konnten. Die Wolke wurde gewichtiger, sie wurde zu einer Ressource: Die Wolke konnte dies tun, sie konnte jenes tun. Die Wolke konnte mächtig und intelligent sein, sie wurde zu einem Modewort der Wirtschaft und zu einem Verkaufsargument, sie war fortan mehr als nur ein Kürzel für Ingenieure; sie wurde zu einer Metapher.
Heute ist die Wolke – die Cloud – die zentrale Metapher des Internets: ein globales System enormer Macht und Energie, dem gleichwohl immer noch die Aura des Noumenalen (im Kant’schen Sinne) und Numinosen anhaftet, von etwas, das fast unmöglich zu greifen ist. Wir verbinden uns mit der Cloud; wir arbeiten in der Cloud; wir speichern Dinge in der Cloud und holen sie dort wieder ab; wir denken durch die Cloud. Wir zahlen dafür und bemerken sie nur, wenn sie nicht mehr funktioniert. Die Cloud ist etwas, das wir die ganze Zeit erleben, ohne wirklich zu verstehen, was sie ist oder wie sie funktioniert. Wir üben uns darin, ihr zu vertrauen, ohne die geringste Vorstellung davon, was wir ihr anvertrauen und was das ist, dem wir uns da anvertrauen.
Abgesehen davon, dass sie nicht immer funktioniert, ist der erste Kritikpunkt an dieser Cloud, dass es sich um eine sehr schlechte Metapher handelt. Die Cloud ist nicht gewichtslos; sie ist nicht amorph oder gar unsichtbar, wenn man weiß, wo man danach suchen muss. Die Cloud ist nicht irgendein magischer ferner Ort, der aus Wasserdampf und Funkwellen besteht, wo alles einfach funktioniert. Wir haben es mit einer physischen Infrastruktur zu tun, die aus Telefonleitungen, Fiberoptik, Satelliten, Unterwasserkabeln und riesigen Lagerhallen voller Computer besteht, die ungeheure Mengen an Wasser und Energie verbrauchen und nationaler Gesetzgebung unterliegen. Die Cloud ist eine neuartige Industrie, sie ist eine gierige Industrie. Die Wolke wirft nicht einfach nur einen Schatten; sie hinterlässt einen Fußabdruck. In der Cloud werden viele der vormals gewichtigen Gebäude der Bürgersphäre absorbiert: die Orte, wo wir einkaufen, Bankgeschäfte tätigen, uns treffen, Bücher ausleihen und unsere Stimme abgeben. So versteckt, werden sie weniger sichtbar und sind weniger der Kritik, der Nachprüfung, der Bewahrung und der Regulierung unterworfen.
Ein weiterer Kritikpunkt ist der, dass dieses mangelnde Verstehen durchaus gewollt ist. Es gibt gute Gründe – von der nationalen Sicherheit über Firmengeheimnisse bis zu vielfältigsten Vergehen –, um zu verbergen, was sich in der Cloud befindet. Was sich dabei verflüchtigt, sind Handlungsmacht und Besitz: Die meisten unserer E-Mails, Fotos, Statusmeldungen, Geschäftsdokumente, Bibliotheks- und Abstimmungsdaten, Krankenakten, Bonitätsbewertungen, Likes, Erinnerungen, Erlebnisse, persönlichen Präferenzen und unausgesprochenen Wünsche befinden sich in der Cloud, in der Infrastruktur von jemand anderem. Es gibt gute Gründe, warum Google und Facebook ihre Rechenzentren gerne in Irland (niedrige Steuersätze) und Skandinavien (billige Energie und Kühlung) errichten. Es gibt gute Gründe, warum globale, angeblich postkoloniale Imperien an winzigen umstrittenen Territorien wie Diego Garcia und Zypern festhalten, denn an solchen Orten lässt sich die Cloud nieder, und der unklare Status dieser Orte lässt sich nutzen. Die Cloud formt sich zu Geografien der Macht und des Einflusses, und sie dient dazu, beides zu verstärken. Die Cloud ist eine Machtbeziehung, und die meisten Menschen sind dabei nicht obenauf.
Das sind gewichtige Kritikpunkte, und eine Möglichkeit, die Cloud zu befragen, besteht darin, zu schauen, wohin ihr Schatten fällt: den Orten der Rechenzentren und der Seekabel nachzuspüren und zu sehen, was sie uns über die heute wirklich herrschende Machtverteilung erzählen. Wir können die Cloud säen, können sie kondensieren und dazu zwingen, einige ihre Geschichten aufzugeben. Wenn sie verblasst, können bestimmte Geheimnisse sichtbar werden. Wenn wir verstehen, inwiefern das Bild der Wolke dazu genutzt wird, um die eigentliche Funktionsweise von Technologie zu verbergen, können wir allmählich begreifen, auf wie vielfältige Weise die Technologie ihre eigene Handlungsmacht verbirgt – durch undurchschaubare Maschinen und nicht entschlüsselbare Codes genauso wie durch physische Distanz und rechtliche Konstrukte. Und daraus wiederum können wir etwas über die Funktionsweise von Macht selbst lernen, die solche Dinge schon machte, lange bevor sie über Clouds und Black Boxes verfügte, in denen sie sich verstecken konnte.
Doch können wir jenseits dieser ebenfalls wieder funktionalen Sicht der Cloud, jenseits ihrer Wieder-Erdung das Bild der Wolke noch einmal umdrehen, um eine neue Metapher zu erhalten? Kann die Cloud nicht nur unser mangelndes Verständnis absorbieren, sondern auch unser Verständnis dieses fehlenden Verstehens? Können wir grundlegendes Computerdenken durch Cloud-Denken ersetzen, das ein Nichtwissen anerkennt und daraus produktiven Regen macht? Im 14. Jahrhundert verfasste ein unbekannter christlicher Mystiker ein Werk über die «Wolke des Nichtwissens», die zwischen Menschheit und Gottheit hängt: der Verkörperung von Güte, Gerechtigkeit und rechtem Handeln. Diese Wolke lässt sich nicht mittels Denken durchdringen, sondern indem man das Denken schweifen lässt und auf dem Hier und Jetzt – und nicht der prophezeiten, berechneten Zukunft – als dem eigentlichen Handlungsfeld beharrt. «Zieh die Erfahrung dem Bescheidwissen vor», drängt uns der Verfasser. «Der Stolz des Wissens kann dich blenden; doch diese zarte und liebende Zuneigung wird dich nicht täuschen. Wissen bläht auf, Liebe aber baut auf. Wissen ist verbunden mit Mühe, Liebe aber mit Frieden und Ruhe.»[1] Diese Wolke haben wir durch Computerisierung zu bezwingen versucht, aber diese Versuche werden immer wieder durch die Realität dessen, was wir versuchen, zunichtegemacht. Wolkiges Denken, die Anerkennung des Nichtwissens könnte die Abkehr vom Computerdenken ermöglichen, und genau das ist es, was uns das Netzwerk selbst aufdrängt.
Die bedeutsamste Eigenschaft des Netzwerks ist das Fehlen einer konkreten, festen Absicht. Niemand hat sich aufgemacht oder angeordnet, das Netzwerk oder sein größtes verwirklichtes Exemplar, das Internet, zu erschaffen. Im Laufe der Zeit wurden ein System nach dem anderen, eine Kultur nach der anderen miteinander verbunden – durch staatliche Programme und private Investitionen; durch persönliche Beziehungen und technologische Protokolle; in Form von Stahl, Glas und Elektronen; im physischen Raum genauso wie in der Sphäre des Geistes. Das Netzwerk wiederum verschaffte den grundlegendsten und den höchsten Idealen Ausdruck, es enthielt und bejubelte die banalsten und die radikalsten Wünsche, von denen so gut wie keiner von seinen Schöpfern – die wir alle sind – vorhergesehen wurde. Es ging und geht nicht darum, irgendein Problem zu lösen, sondern nur um ein kollektives Unterfangen: die aufkommende, unbewusste Erzeugung eines Instruments zur unbewussten Erzeugung. Das Netzwerk zu denken macht die Unangemessenheit des Computerdenkens und die Vernetztheit aller Dinge wie auch ihre Endlosigkeit deutlich; es beharrt auf der fortwährenden Notwendigkeit, seine Gewichtungen und Gegengewichte, seine kollektive Intention und seine kollektiven Misserfolge, seine Rollen, Verantwortlichkeiten, Vorurteile und Möglichkeiten zu überdenken und zu reflektieren. Das ist es, was uns das Netzwerk lehrt: Wir müssen wirklich alles in den Blick nehmen.[2]
Unser größter Fehler im bisherigen Nachdenken über das Netzwerk bestand in der Annahme, seine Handlungen seien ihm inhärent und deshalb unvermeidlich. Mit inhärent meine ich die Vorstellung, dass sie quasi ex nihilo aus den von uns geschaffenen Dingen erwuchsen, statt unsere eigenen Handlungen als Teil dieser Gemeinschaftsschöpfung zu betrachten. Mit unvermeidlich meine ich den Glauben an eine direkte Linie des technologischen und historischen Fortschritts, der wir schlicht nichts entgegenzusetzen haben. Solcherlei Überzeugungen werden seit Jahrzehnten von Gesellschaftstheoretikern und Philosophen immer wieder attackiert, doch bislang konnte ihnen nicht der Garaus gemacht werden. Vielmehr nahmen sie in der Technologie selbst konkrete Gestalt an: in Maschinen, die ihre eigenen eingebetteten Wünsche verwirklichen sollen. Damit haben wir unsere Vorbehalte gegen einen linearen Fortschritt aufgegeben und sind in den Abgrund des Computerdenkens gestürzt.
Die wichtigste Welle, von der der Fortschritt in den letzten Jahrhunderten getragen wurde, war die zentrale Idee der Aufklärung: dass mehr Wissen – mehr Information – zu besseren Entscheidungen führt. Was genau mit «besser» gemeint ist, kann natürlich jeder für sich selbst bestimmen. Trotz der Angriffe von Moderne und Postmoderne definiert dieser Glaubenssatz nicht nur, inwiefern neue Technologien umgesetzt werden, sondern was überhaupt als möglich erachtet wird. In seinen ersten Jahren wurde das Internet häufig als «information superhighway» bezeichnet, als eine Art Wissensleitung, die im flackernden Licht der Glasfaserkabel die Welt erhellt. Jedes Faktum, jedes Quäntchen Information ist auf Tastendruck verfügbar – oder zumindest wollen wir das glauben.
Und so sind wir heute mit ungeheuren Wissensbeständen verbunden und haben doch nicht gelernt zu denken. Im Gegenteil: Das, was die Welt eigentlich aufklären und erleuchten soll, verdunkelt sie in der Praxis. Die Überfülle an Information und die Vielzahl an Weltanschauungen, die uns heute über das Internet zur Verfügung stehen, produzieren keine kohärente Konsensrealität, sondern eine Wirklichkeit, die vom fundamentalistischen Beharren auf simplifizierenden Narrativen, Verschwörungstheorien und postfaktischer Politik zerfressen ist. Auf diesem Widerspruch beruht die Vorstellung von einem New Dark Age: einem Zeitalter, in dem der Wert, den wir dem Wissen beigemessen haben, durch den Überfluss an dieser profitablen Ware zerstört wird und in dem wir nunmehr bei uns selbst nach neuen Möglichkeiten des Weltverständnisses suchen. 1926 schrieb H. P. Lovecraft:
«Die größte Gnade auf dieser Welt ist, so scheint es mir, das Nichtvermögen des menschlichen Geistes, all ihre inneren Geschehnisse miteinander in Verbindung zu bringen. Wir leben auf einem friedlichen Eiland des Unwissens inmitten schwarzer Meere der Unendlichkeit, und es ist uns nicht bestimmt, diese weit zu bereisen. Die Wissenschaften – deren jede in eine eigene Richtung zielt – haben uns bis jetzt wenig gekümmert; aber eines Tages wird das Zusammenfügen der einzelnen Erkenntnisse so erschreckende Aspekte der Wirklichkeit eröffnen, dass wir durch diese Enthüllung entweder dem Wahnsinn verfallen oder uns aus dem tödlichen Licht in den Frieden und die Sicherheit eines neuen, dunklen Zeitalters fliehen werden.»[3]
Wie wir unseren Platz in der Welt und unser Verhältnis untereinander sowie zu Maschinen verstehen und denken, wird letztlich darüber entscheiden, ob unsere Technologien uns in den Wahnsinn oder zum Frieden führen. Die Finsternis, von der ich schreibe, ist keine wörtlich zu nehmende Finsternis, und sie steht auch nicht für die Abwesenheit oder den Ausschluss von Wissen, wie die gängige Vorstellung von einem dunklen Zeitalter behauptet. Sie ist kein Ausdruck von Nihilismus oder Hoffnungslosigkeit. Vielmehr verweist sie sowohl auf den Charakter als auch auf die Chance der gegenwärtigen Krise: eine offenkundige Unfähigkeit, klar und deutlich zu sehen, was vor uns liegt, und mit Entschiedenheit und Gerechtigkeit sinnvoll in der Welt zu agieren – zugleich können wir durch die Anerkennung dieser Finsternis nach neuen Möglichkeiten suchen, mit Hilfe eines anderen Lichtes zu sehen.
In ihrem privaten Tagebuch hielt Virginia Woolf am 18. Januar 1915, in den düstersten Stunden des Ersten Weltkriegs, fest: «Die Zukunft ist dunkel, was – im Ganzen gesehen – wohl das Beste ist, was die Zukunft sein kann, finde ich.»[4] Rebecca Solnit meinte dazu: «Das ist eine außergewöhnliche Bekundung, wonach das Unbekannte nicht durch falsche Prophezeiung oder die Projektion grausiger politischer oder ideologischer Narrative in Bekanntes verwandelt werden muss; es ist eine Feier der Finsternis, die bereit ist – worauf das ‹finde ich› verweist –, selbst im Hinblick auf die eigene Behauptung unsicher zu sein.»[5]
Donna Haraway beschäftigt sich eingehender mit diesem Denken[6] und weist darauf hin, dass Woolf in ihrem 1938 veröffentlichten Essay Drei Guineen darauf beharrte:
«Also lassen Sie uns denken. Lassen Sie uns in Büros denken; in Omnibussen; während wir in der Menge stehen und Krönungen und Amtsantrittsumzüge von Oberbürgermeistern beobachten; lassen Sie uns denken, während wir am Kenotaph vorbeigehen; lassen Sie uns in Whitehall denken; auf der Galerie des Unterhauses; in den Gerichtshöfen; lassen Sie uns bei Taufen und Hochzeiten und Beerdigungen denken. Lassen Sie uns nie aufhören zu denken – was ist diese ‹Zivilisation›, in der wir uns befinden? Was sind das für Zeremonien, und warum sollten wir daran teilnehmen? Was sind diese Berufe, und warum sollten wir mit ihnen Geld verdienen? Wohin führt sie uns, kurz gesagt, die Prozession der Söhne gebildeter Männer?»[7]
Die klassenspezifischen und gesellschaftlichen Konflikte, die historischen Hierarchien und Ungerechtigkeiten, auf die Woolf mit ihren Prozessionen und Feierlichkeiten anspielt, haben sich heute keineswegs verringert, doch einige der Orte, die einen daran denken lassen, haben sich vermutlich verändert. Die Menschenmassen, die 1938 die Krönungsparaden und die Amtsantrittsumzüge des Londoner Bürgermeisters säumten, sind heute über das Netzwerk verstreut, und die Galerien und Orte der Verehrung sind ebenfalls in Rechenzentren und Unterwasserkabel abgewandert. Wir können das Netzwerk nicht aus dem Denken verbannen; wir können nur durch und innerhalb des Netzwerks denken. Wir können ihm zuhören, wenn es versucht, uns in einem Notfall zu verständigen.
Nichts hier ist ein Einwand gegen Technologie: Das zu versuchen hieße, gegen uns selbst zu argumentieren. Ich plädiere vielmehr für eine nachdenklichere Beschäftigung mit Technologie, gepaart mit einem radikal anderen Verständnis dessen, was sich über die Welt denken und wissen lässt. Computersysteme als Werkzeuge betonen einen der eindrücklichsten Aspekte der Menschheit, nämlich unsere Fähigkeit, in der Welt wirksam zu handeln und sie nach unseren Wünschen zu gestalten. Doch diese Wünsche zu erkennen und zu artikulieren und sicherzustellen, dass sie die Wünsche anderer nicht herabsetzen, schmälern, verdrängen oder zerstören, das bleibt unser Privileg.
Technologie ist mehr als nur Werkzeugherstellung und Werkzeuggebrauch: Sie ist die Erzeugung von Metaphern. Mit der Herstellung eines Werkzeugs erzeugen wir ein bestimmtes Verständnis der Welt, das, auf diese Weise Gestalt geworden, in der Lage ist, bestimmte Wirkungen in dieser Welt zu erzielen. Es wird somit zu einem weiteren beweglichen Teil unseres Weltverständnisses – wenn auch oft unbewusst. Wir könnten also davon sprechen, dass es sich um eine versteckte Metapher handelt: Es kommt zu einer Art Übertragung oder Transfer, aber gleichzeitig auch zu einer Art Verfremdung, zur Ablagerung eines bestimmten Gedankens oder einer Denkweise in einem Werkzeug, wo es dann keines Denkens mehr bedarf, um es zu aktivieren. Um wieder oder aufs Neue zu denken, müssen wir unsere Werkzeuge wieder verzaubern. Die vorliegende Darstellung ist nur der erste Teil einer solchen Wiederverzauberung, ein Versuch, unsere Werkzeuge neu zu denken – was nicht zwangsläufig eine Umnutzung oder eine Neudefinition bedeutet, sondern einen bedachtsameren Umgang mit ihnen.
Für jemanden, der einen Hammer hat, so ein Sprichwort, sieht alles wie ein Nagel aus. Aber das heißt, den Hammer nicht zu denken. Ein richtiger Hammer nämlich hat viele Verwendungszwecke. Man kann damit Nägel herausziehen und einschlagen; er kann Eisen schmieden, Holz und Stein bearbeiten, Fossilien freilegen und Kletterhaken fixieren. Er kann ein Urteil fällen, zur Ordnung rufen oder in einem Leichtathletikwettbewerb geworfen werden. Von einem Gott geschwungen macht er das Wetter. Thors Hammer namens Mjölnir, der für Blitz und Donner sorgte, wenn mit ihm zugeschlagen wurde, ließ auch hammerförmige Amulette entstehen, die Schutz vor Gottes Zorn bieten sollten – oder, weil sie an Kreuze erinnerten, vor erzwungener Bekehrung. Prähistorische Hämmer und Äxte, die von den Pflügen späterer Generationen zu Tage gefördert wurden, wurden als «Donnersteine» bezeichnet, weil sie angeblich bei Unwettern vom Himmel gefallen waren. Diese mysteriösen Werkzeuge wurden somit zu magischen Gegenständen: Als ihr ursprünglicher Zweck verblasste, konnten sie eine neue symbolische Bedeutung annehmen. Wir müssen unsere Hämmer – all unsere Werkzeuge – wieder verzaubern, damit sie eher Thors Hammer und weniger dem eines Zimmermanns ähneln. Damit sie eher wie Donnersteine sind.
Technologie wird zudem nicht vollständig – ex nihilo – von Menschen erschaffen. Sie hängt, wie unser eigenes Leben (Bakterien, Getreide, Baumaterialien, Kleidung und Begleitarten), vom Angebotscharakter nichtmenschlicher Dinge ab. Die Infrastruktur des Hochfrequenzhandels (die wir in Kapitel 5 genauer erkunden werden) sowie das Wirtschaftssystem, das er beschleunigt und bestimmt, sind ein «Gebilde» aus Silizium und Stahl, aus Glasfasertechnik, aus Nebel und Vögeln und Eichhörnchen. Technologie kann ein ausgezeichnetes Lehrstück in Sachen Handlungsmacht nichtmenschlicher Akteure sein, von Felsen bis zu Käfern, wenn sie unsere Kommunikationswege und Energieflüsse behindern oder ermöglichen, durchbeißen oder kurzschließen.
Richtig verstanden ist diese Beziehung auch eine Realisierung der der Technologie innewohnenden Instabilität: ihrer zeitlichen und zeitweiligen Verbindung oder Resonanz mit bestimmten anderen ungewissen Eigenschaften von Materialien und Lebewesen, die Veränderungen unterliegen. Kurz: ihrer Wolkigkeit, ihrer Cloudhaftigkeit. Ein Beispiel dafür ist (in Kapitel 3) der sich verändernde Angebotscharakter der Materialien für die Computerisierung als Reaktion auf Umweltstress: Dinge tun Dinge im Laufe der Zeit immer wieder anders. Die Technologie umgibt eine Aura der Starrheit: Einmal in Dinge eingeschlossen, scheinen Ideen verfestigt und unanfechtbar zu sein. Hämmer können sie, richtig eingesetzt, wieder aufbrechen. Indem wir ein paar Werkzeuge wieder verzaubern, könnten wir erkennen, auf wie vielfältige Weise diese Realisierung in den zahlreichen Formen heutigen Alltagslebens enthalten ist. Dabei sollte man zu dem, was möglicherweise als «Offenbarung» der «Wahrheit» dieser Welt präsentiert wird, stets gebührenden Abstand halten, denn das ist bloßes (oder nicht bloßes; vielmehr klägliches) Überdenken dieser Welt. Tatsächlich sollte die Armeslänge die resonante, repräsentative Geste dieses Werkes sein, denn etwas auf Armeslänge Abstand zu halten hat anders gesehen den Effekt, dass man auf etwas anderes in der Ferne verweist, auf etwas jenseits der unmittelbaren Verwirklichung, auf etwas Vielversprechenderes.
Die in diesem Buch entwickelte These lautet, dass die Auswirkungen der Technologie ähnlich wie der Klimawandel weltweit zu spüren sind und bereits all unsere Lebensbereiche erfasst haben. Diese Auswirkungen sind potentiell katastrophal und eine Folge der Unfähigkeit, die Unruhe stiftenden und vernetzten Ergebnisse unserer eigenen Erfindungen zu begreifen. Insofern bringen sie das, was wir naiverweise für die natürliche Ordnung der Dinge halten, durcheinander und verlangen ein radikales Überdenken der Art und Weise, wie wir die Welt denken. Doch der andere Tenor dieses Buches lautet, dass noch nicht alles verloren ist: Wenn wir wirklich dazu in der Lage sind, auf neue Weise zu denken, sind wir auch in der Lage, die Welt neu zu denken und sie damit anders zu verstehen und anders in ihr zu leben. Und so wie unser gegenwärtiges Weltverständnis aus unseren wissenschaftlichen Entdeckungen erwächst, so muss unser Überdenken aus und parallel zu unseren technologischen Erfindungen entstehen, die ganz reale Manifestationen des umkämpften, komplexen und widersprüchlichen Zustands der Welt sind. Unsere Technologien sind Fortsätze von uns selbst, kodifiziert in Maschinen und Infrastrukturen, in Bezugsrahmen des Wissens und des Handelns; wahrhaftig gedacht, liefern sie das Modell einer wahrhaftigeren Welt.
Wir sind darauf geeicht, die Finsternis für einen Ort der Gefahr, ja des Todes zu halten. Doch die Finsternis kann auch ein Ort der Freiheit und der Möglichkeit sein, ein Ort der Gleichheit. Für viele werden meine Ausführungen offensichtlich sein, denn sie haben schon immer in dieser Finsternis gelebt, die auf die Privilegierten so bedrohlich wirkt. Wir müssen noch viel über das Nichtwissen lernen. Ungewissheit kann produktiv, ja sogar erhaben sein.
Die letzte und wichtigste Kluft ist diejenige, die sich zwischen uns als Individuen öffnet, wenn wir es nicht schaffen, die gegenwärtige Situation anzuerkennen und zu artikulieren. Täuschen Sie sich nicht, bestimmte Aspekte des New Dark Age sind ganz reale und unmittelbare existenzielle Bedrohungen, was am offensichtlichsten für den Klimawandel auf diesem Planeten und dessen kollabierende Ökosysteme gilt. Da sind des Weiteren die anhaltenden Auswirkungen eines schwindenden Konsenses, versagender Wissenschaften, reduzierter Vorhersagehorizonte sowie öffentlicher und privater Paranoia – all das zeugt von Zwietracht und Gewalt. Einkommens- und Verständnisdisparitäten sind auf gar nicht so lange Sicht gleichermaßen tödlich. All das ist miteinander verbunden: All das entsteht, wenn wir es nicht schaffen, zu denken und zu sprechen.
Es ist nicht angenehm, über das New Dark Age zu schreiben, selbst wenn ich das Ganze mit vernetzter Hoffnung abmildern kann. Es verlangt, Dinge zu sagen, die besser ungesagt blieben, Dinge zu denken, die besser ungedacht blieben. Das hinterlässt oft ein flaues Gefühl im Magen, eine Art Verzweiflung. Aber es nicht zu tun würde bedeuten, die Welt, wie sie ist, nicht anzuerkennen, weiter in Fantasien und Abstraktionen zu leben. Ich denke an meine Freunde und die Dinge, die wir uns sagen, wenn wir ehrlich sind, und daran, wie sehr uns das in Angst versetzt. Es hat etwas Beschämendes, über die Erfordernisse der Gegenwart zu sprechen, und zeugt von einer tiefen Verwundbarkeit, aber es darf uns nicht vom Denken abhalten. Wir dürfen uns jetzt nicht gegenseitig im Stich lassen.
KAPITEL 2
COMPUTERISIERUNG
Im Jahre 1884 hielt der Kunstkritiker und Sozialphilosoph John Ruskin an der London Institution zwei Abendvorträge mit dem Titel «The Storm-Cloud of the Nineteenth Century». Am 14. und am 18. Februar gab er einen Überblick über Himmels- und Wolkendarstellungen, wobei ihm als Quelle nicht nur die antike und die europäische Kunst dienten, sondern auch die Berichte von Bergsteigern in den von ihm so geliebten Alpen sowie eigene Beobachtungen des Himmels über Südengland in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts.
In diesen Vorträgen vertrat er die Ansicht, der Himmel weise eine neuartige Wolke auf. Diese Wolke, die er als «Sturmwolke» oder mitunter auch als «Plagewolke» bzw. «Plagewind» bezeichnete,
«wurde einzig und allein von jetzt lebenden oder kürzlich noch lebenden Augen gesehen. (…) Es gibt, soweit ich bislang weiß, keine Beschreibung dieser Wolke von irgendeinem antiken Beobachter. Weder bei Homer noch bei Vergil, weder bei Aristophanes noch bei Horaz finden sich derartige Wolken unter denen, die Jupiter zusammenbraut. Chaucer hat keine Bezeichnung für sie, ebenso wenig Dante; Milton nicht, und auch nicht Thomson. In modernen Zeiten kennen sie weder Scott noch Wordsworth noch Byron; und der aufmerksamste und fleißigste Wissenschaftler, De Saussure, sagt kein Wort davon.»[1]
Ruskins «fortwährende und genaue Beobachtung» des Himmels hatte ihn zu der Überzeugung gebracht, es wehe überall in England und auf dem Kontinent ein neuer Wind, ein «Plagewind», der neues Wetter mit sich brachte. Als Beleg dafür zitierte er aus seinem eigenen Tagebuch den Eintrag vom 1. Juli 1871:
«Der Himmel ist überzogen mit grauen Wolken; – nicht Regenwolken, sondern einem trockenen schwarzen Schleier; den kein Sonnenstrahl durchdringt; teilweise aufgelöst in Dunst, schwachen Dunst, genug, um Dinge in der Ferne unkenntlich zu machen, aber ohne wirkliche Substanz, ohne Kräuselung, ohne eigene Farbe (…).
Und das ist etwas Neues für mich, etwas ganz Schauderhaftes. Ich bin jetzt über fünfzig Jahre alt; und seit ich fünf bin, habe ich die besten Stunden meines Lebens im Frühling und im Sommer in der Morgensonne erlebt; doch so etwas wie das habe ich bis jetzt noch nie gesehen.
Und die Wissenschaftler arbeiten eifrig wie Ameisen, untersuchen die Sonne und den Mond und die sieben Sterne, und sie können mir jetzt, so glaube ich, alles darüber erzählen; darüber, wie sie sich bewegen und woraus sie bestehen.
Und mir für meinen Teil ist es egal, wie sich zwei Kupferflitter bewegen oder woraus sie bestehen. Ich kann sie nicht anders bewegen, als sie das tun, und nichts Besseres aus ihnen machen als das, woraus sie gemacht sind. Aber mir läge viel daran und ich würde viel dafür geben, wenn mir jemand erklären könnte, woher dieser bittere Wind kommt und woraus er besteht.»[2]
Im Weiteren führt Ruskin viele ähnliche Beobachtungen an: von starken Winden wie aus dem Nichts, von finsteren Wolken, welche die Sonne zur Mittagszeit verdecken, von pechschwarzem Regen, der seinen Garten verfaulen lässt. Zwar weist er darauf hin, dass es in der Gegend, in der er seine Beobachtungen gemacht hat, zahlreiche Industrieanlagen gebe, die zudem immer mehr würden – Bemerkungen, die Umweltschützer seither gerne aufgegriffen haben –, aber ihm geht es in erster Linie um die moralische Natur einer solchen Wolke, darum, inwiefern sie den Schlachtfeldern und Schauplätzen gesellschaftlicher Unruhe zu entströmen scheint.
«Was sollten wir tun, fragen Sie mich? Die Antwort ist klar. Ganz gleich, ob Sie die Zeichen des Himmels beeinflussen können oder nicht, die Zeichen der Zeit können Sie auf alle Fälle beeinflussen.»[3] Die Metaphern, mit deren Hilfe wir die Welt beschreiben, wie etwa Ruskins Plagewolke, bestimmen und beeinflussen auch unser Weltverständnis. Heute bieten andere Wolken, die oft Orten des Protests und der Auseinandersetzung entströmen, neue Möglichkeiten, wie wir die Welt denken können.
Ausführlich räsonierte Ruskin über die andersartige Qualität des Lichts, wenn es von der Sturmwolke beeinflusst wird, denn auch Licht hat für ihn eine moralische Eigenschaft. In seinen Vorträgen vertrat er die Ansicht, das «fiat lux der Schöpfung» – also der Augenblick, in dem der Gott der Genesis «Es werde Licht!» sagt – sei auch ein fiat anima, eine Erschaffung des Lebens. Licht, so beharrte er, ist «genauso die Ordnung des Verstandes wie die Ordnung des Sehens». Was wir sehen, prägt nicht nur, was wir denken, sondern auch wie wir denken.
Ein paar Jahre zuvor, 1880, hatte Alexander Graham Bell erstmals ein Gerät namens Photophon vorgeführt. Dieses Lichttelefon, das in gewisser Weise parallel zum Telefon erfunden wurde, ermöglichte die erste «drahtlose» Übertragung der menschlichen Stimme. Es funktionierte dergestalt, dass ein Lichtstrahl von einer reflektierenden Oberfläche, die von der Stimme eines Sprechers in Schwingungen versetzt wurde, zurückgeworfen und von einer primitiven Photovoltaikzelle gebündelt wurde, welche die Lichtwellen in Töne zurückverwandelte. Über den Dächern Washingtons konnte sich Bell allein mittels Licht über eine Entfernung von gut 200 Metern verständlich machen.
Das Photophon, das mehrere Jahre vor der Verbreitung elektrischen Lichts auf der Bildfläche erschien, hing ganz davon ab, dass ein klarer Himmel den Reflektor mit hellem Licht versorgte. Das heißt, die Verhältnisse in der Atmosphäre beeinflussten den produzierten Klang und veränderten das Ergebnis. Begeistert schrieb Bell: «Ich hörte Sprache, die durch das Sonnenlicht artikuliert wurde! Ich hörte einen Sonnenstrahl lachen und husten und singen! Ich konnte einen Schatten hören und vernahm mit dem Ohr, wie eine Wolke sich vor die Sonnenscheibe schob.»[4]
Die anfängliche Reaktion auf Bells Erfindung war wenig vielversprechend. Ein Kommentar in der New York Times fragte sarkastisch, ob man an Telegrafenmasten eine «Leitung Sonnenstrahlen» befestigen könne und ob man diese isolieren müsse. «Bis man tatsächlich jemanden mit einer Kabelspule Sonnenstrahlen auf der Schulter durch die Straßen laufen und sie von Mast zu Mast aufhängen sieht, wird man doch eher das Gefühl haben, dass Professor Bells Photophon eine enorme Herausforderung an die menschliche Gutgläubigkeit darstellt», hieß es in der Zeitung.[5]
Diese Sonnenstrahlenleitung ist natürlich genau das, was sich heute über den Globus legt. Bells Erfindung nutzte erstmals Licht als Träger komplexer Information – wie der Kommentator unwissentlich bemerkte, bedurfte es lediglich der Isolation des Sonnenstrahls, um ihn über unvorstellbare Entfernungen zu transportieren. Heute ordnen Bells Sonnenstrahlen die Daten, die unter den Wellen der Meere in Gestalt lichtübertragender Glasfaserkabel unterwegs sind, und diese wiederum ordnen die kollektive Intelligenz der Welt. Sie ermöglichen es, riesige Computerinfrastrukturen zusammenzuspannen, die uns alle organisieren und lenken. Ruskins fiat lux als fiat anima gewinnt im Netzwerk Gestalt.
Mittels Maschinen zu denken ist älter als die Maschinen selbst. Die Existenz der Infinitesimalrechnung beweist, dass sich manche Probleme bearbeiten lassen, noch ehe es möglich ist, sie praktisch zu lösen. Betrachtet man die Geschichte als ein solches Problem, so könnte man sie in eine mathematische Gleichung umwandeln, die dann, ist sie gelöst, die Zukunft produziert. Das war die Überzeugung der frühen Berechnungsdenker des 20. Jahrhunderts, und die Tatsache, dass sie unhinterfragt und sogar unbewusst bis in unsere Zeit Bestand hat, ist Gegenstand dieses Buches. Die Geschichte des Computerdenkens, das heute in der digitalen Cloud verkörpert ist, beginnt mit dem Wetter.
1916 war der Mathematiker Lewis Fry Richardson an der Westfront im Einsatz; als Quäker war er überzeugter Pazifist und hatte sich deshalb zur Friends’ Ambulance Unit gemeldet, einer Quäker-Einheit, der auch der Künstler Roger Penrose sowie der Philosoph und Science-Fiction-Autor Olaf Stapledon angehörten. Über mehrere Monate hinweg gelang Richardson, zwischen Fronteinsätzen und Ruhephasen in feuchten Scheunen in Frankreich und Belgien, die erste vollständige Berechnung der atmosphärischen Wetterverhältnisse mittels numerischen Verfahrens: die erste rechnergestützte tägliche Wettervorhersage, noch ohne Computer.
Vor dem Krieg war Richardson Leiter des Observatoriums Eskdalemuir gewesen, einer abgelegenen Wetterstation im Westen Schottlands. Zu den Unterlagen, die er mit in den Krieg nahm, gehörten die vollständigen Wetteraufzeichnungen eines einzigen Tages, die am 20. Mai 1910 von Hunderten Beobachtern in ganz Europa zusammengetragen worden waren. Richardson war der Überzeugung, mit Hilfe verschiedener mathematischer Operationen, die aus jahrelangen Wetterdaten gewonnen wurden, sei es möglich, die Beobachtungen numerisch zu verbessern und damit vorherzusagen, wie sich die Wetterverhältnisse über mehrere Stunden entwickeln würden. Zu diesem Zweck erstellte er eine Reihe von Rechenformularen, die mehrere Spalten für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Luftdruck und andere Informationen enthielten. Allein diese Vorbereitungsmaßnahmen dauerten mehrere Wochen. Er unterteilte den Kontinent in eine Reihe gleichmäßig verteilter Beobachtungspunkte und nahm seine Berechnungen mit Stift und Papier vor; sein Arbeitszimmer war «ein Heuhaufen in einer kalten Scheune».[6]
Als Richardson damit fertig war, überprüfte er seine Vorhersagen anhand der tatsächlich beobachteten Daten und stellte fest, dass seine Zahlen deutlich zu hoch lagen. Trotzdem war die Brauchbarkeit der Methode belegt: Zerlege die Welt in eine Vielzahl von Planquadraten und wende eine Reihe mathematischer Verfahren an, um die atmosphärischen Gleichungen für jedes Quadrat zu lösen. Was fehlte, war die Technik, um solches Denken entsprechend den Dimensionen und der Geschwindigkeit des Wetters anzuwenden.
In seiner 1922 veröffentlichten Schrift Weather Prediction by Numerical Process überprüfte Richardson seine Berechnungen und fasste sie zusammen. Um sie mit der damaligen Technologie effizienter durchführen zu können, stellte er ein kleines Gedankenexperiment an. In diesem Experiment waren die «Computer» noch menschliche Wesen, und die Abstraktionen, die wir später als digitale Berechnung verstehen sollten, wurden anhand der Architektur entworfen:
«Ist nach so vielen mühsamen Gedankengängen ein kleiner Ausflug in die Fantasie erlaubt? Stellen Sie sich einen großen Saal vor, wie ein Theater, nur dass die Ränge und Balkone ganz herumreichen und auch den Teil besetzen, wo sich üblicherweise die Bühne befindet. Die Wände dieses Raums sind rundum so bemalt, dass sich daraus eine Weltkarte ergibt. Die Decke steht für die Regionen des Nordpols, England thront oben auf dem Balkon, die Tropen sitzen im zweiten Rang, Australien im Oberrang und die Antarktis befindet sich unten im Parterre.
Unzählige Rechenmaschinen [Richardson spricht hier tatsächlich schon von ‹computers›] arbeiten am Wetter des Teils der Weltkarte, an dem sie jeweils sitzen, aber jede Rechenmaschine kümmert sich nur um eine Gleichung oder einen Teil einer Gleichung. Die Arbeit jeder Region wird von einem höherrangigen Beamten koordiniert. Zahlreiche kleine ‹Nachtzeichen› zeigen die momentanen Werte an, so dass benachbarte Rechner sie lesen können. Jede Zahl wird dabei in drei aneinandergrenzenden Zonen angezeigt, um die Kommunikation in Richtung Norden und Süden auf der Karte sicherzustellen.
Im Parterre erhebt sich eine große Säule, die bis auf halbe Höhe des Saales reicht. Oben drauf befindet sich eine ausladende Kanzel. Darin sitzt der für das gesamte Theater Verantwortliche, umgeben von mehreren Assistenten und Boten. Eine seiner Aufgaben besteht darin, in allen Teilen der Welt für ein einheitliches Arbeitstempo zu sorgen. Darin ähnelt er dem Dirigenten eines Orchesters, nur dass die Instrumente hier Rechenschieber und Rechenmaschinen sind. Und statt einen Taktstock zu schwingen, richtet er einen rötlichen Lichtstrahl auf jede Region, die dem Rest enteilt ist, und einen blauen Strahl auf diejenigen, die hinterherhinken.
Vier Bürovorsteher in der zentralen Kanzel sammeln das künftige Wetter, sobald es berechnet ist, und leiten es via Rohrpost in einen stillen Raum weiter. Dort wird es verschlüsselt und telefonisch an die Rundfunkstation übermittelt. Boten bringen stapelweise benutzte Rechenformulare in einen Lagerraum im Keller.
In einem Nachbargebäude befindet sich eine Forschungsabteilung, wo sie Verbesserungen erfinden. Doch es bedarf jeder Menge Experimente im kleinen Rahmen, bevor an den komplexen Abläufen im Rechentheater etwas geändert wird. In einem Kellerraum beobachtet ein Tüftler die wirbelnden Bewegungen der flüssigen Auskleidung einer riesigen Schüssel, die sich dreht, doch bislang erweist sich die Arithmetik als überlegen. In einem anderen Gebäude befinden sich die üblichen Büros für Finanzen, Korrespondenz und Verwaltung. Draußen gibt es Sportplätze, Häuser, Berge und Seen, denn man war der Ansicht, diejenigen, die das Wetter berechnen, sollten frei durchatmen können.»[7]
In einer Vorbemerkung zu seinem Bericht schrieb Richardson:
«Vielleicht wird es eines Tages in ferner Zukunft möglich sein, die Berechnungen schneller anzustellen, als sich das Wetter entwickelt, und kostengünstiger als die Ersparnis, die der Menschheit aus den gewonnenen Informationen erwächst. Doch das ist ein Traum.»[8]
Es sollte noch fünfzig Jahre ein Traum bleiben und fand erst seine Erfüllung durch die Anwendung von Militärtechnologien, was Richardson selbst sicherlich abgelehnt hätte. Nach dem Krieg arbeitete er wieder für den britischen Wetterdienst, weil er seine Forschungen fortsetzen wollte, kündigte jedoch 1920, als die Behörde vom Luftfahrtministerium übernommen wurde. Die Forschung zur numerischen Wettervorhersage stagnierte jahrelang, bis sie durch den schlagartigen Zuwachs an Rechenleistung wieder angekurbelt wurde, den ein erneuter Konflikt, nämlich der Zweite Weltkrieg, mit sich brachte. Der Krieg sorgte dafür, dass Unmengen an Geld in die Forschung gesteckt wurden, damit man sie so schnell wie möglich anwenden könnte, schuf jedoch auch verzwickte Probleme: einen ungeheuren, überwältigenden Strom an Informationen, der sich aus einer neuartig vernetzten Welt ergoss, und ein rasant wachsendes System der Wissensproduktion.
In einem Aufsatz mit dem Titel «As We May Think», der 1945 in der Zeitschrift The Atlantic erschien, schrieb der Ingenieur und Erfinder Vannevar Bush:
«Es gibt einen wachsenden Berg von Forschungen. Aber gleichzeitig wird zunehmend klar, dass wir uns in einer immer stärkeren Spezialisierung festfahren. Der Forschende ist überwältigt von den Ergebnissen und Schlussfolgerungen Tausender anderer Arbeitender – Schlussfolgerungen, die aufzufassen er keine Zeit findet, geschweige denn sie zu erinnern, wie sie erscheinen. Dennoch wird die Spezialisierung zunehmend wichtig für den Fortschritt, und die Bemühung, zwischen den Disziplinen Brücken zu schlagen, ist entsprechend oberflächlich.»[9]
Bush fungierte während des Krieges als Leiter des Office of Scientific Research and Development (OSRD), der wichtigsten US-Behörde für militärische Forschung und Entwicklung. Er war einer der «Väter» des Manhattan Project, des streng geheimen Forschungsprojekts, das während des Krieges zur Entwicklung der amerikanischen Atombombe führte.
Bushs Lösungsvorschlag für beide Probleme – das Übermaß an Information, die forschenden Köpfen zur Verfügung stand, und die zunehmend destruktiven Zwecke wissenschaftlicher Forschung – war ein Apparat namens Memex:
«Ein Memex ist ein Gerät, in dem ein Individuum all seine Bücher, Akten und seine gesamte Kommunikation speichert und das so konstruiert ist, dass es mit außerordentlicher Geschwindigkeit und Flexibilität benutzt werden kann. Es stellt eine vergrößerte persönliche Ergänzung zum Gedächtnis dar. Der Memex besteht aus einem Schreibtisch, und obwohl er auch aus einer gewissen Entfernung bedient werden kann, arbeitet der Benutzer vor allem direkt an diesem Möbelstück. Oben befinden sich schräge durchscheinende Schirme, auf die das Material bequem lesbar projiziert werden kann. Es gibt eine Tastatur und eine Reihe von Knöpfen und Hebeln. Ansonsten sieht es wie ein gewöhnlicher Schreibtisch aus.»[10]
Im Wesentlichen – und im Nachhinein betrachtet – schlug Bush hier den elektronischen, vernetzten Computer vor. Seine bedeutsame Erkenntnis bestand darin, auf genau die gleiche Weise, wie ein Memex jedermann dazu in die Lage versetzen sollte, vielfältige Entdeckungen aus zahlreichen Disziplinen – Fortschritten in den Bereichen Telefonie, Maschinenbau, Fotografie, Datenspeicherung und Stenografie – in einer einzigen Maschine zu vereinen. Die Einbeziehung der Zeit in diese Matrix erzeugt das, was wir heute als Hypertext bezeichnen würden: die Fähigkeit, kollektive Dokumente auf vielfältige Weise miteinander zu verlinken und neue Verbindungen zwischen verschiedenen Bereichen vernetzten Wissens zu schaffen: «Ganz neue Arten von Enzyklopädien werden entstehen, bereits versehen mit einem Netz assoziativer Pfade, bereit, in den Memex eingebaut und dort erweitert zu werden.»[11]
Eine solche Enzyklopädie, die dem forschenden Geist zur Verfügung steht, würde das wissenschaftliche Denken nicht nur erweitern, sondern auch zivilisieren:
«Die Anwendung der Wissenschaften hat der Menschheit ein gut ausgestattetes Haus gebaut und sie gelehrt, gesund darin zu leben. Sie hat Menschenmassen in die Lage versetzt, einander mit grausamen Waffen zu bekriegen. Sie könnte es der Menschheit auch gestatten, sich ihre gewaltigen Aufzeichnungen wahrhaft dienlich zu machen und an der Weisheit ihrer Erfahrung zu wachsen. Es mag sein, dass die Menschheit im Konflikt untergeht, bevor es ihr gelingt, diese Aufzeichnungen zu ihrem Nutzen einzusetzen. Aber dies scheint ein ausgesprochen unglücklicher Zeitpunkt zu sein, mit der Nutzbarmachung der Wissenschaft im Dienste des Menschen innezuhalten oder die Hoffnung auf ein positives Ergebnis zu verlieren.»[12]