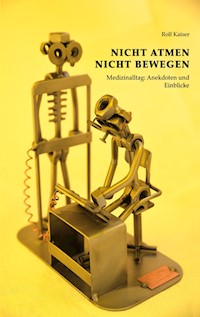
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Diese Geschichten beschreiben und erzählen Ereignisse und Konflikte, auf die Medizinstudenten während des Studiums und Ärztinnen und Ärzte während der klinischen Aus- und Weiterbildung nicht vorbereitet werden. Leidtragende sind häufig die anvertrauten Patienten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Das Messer
In Flagranti
Das EKG
Prostatamaschine
Der Simulator
Klinische Prüfung
Heitere Posse mit Gesang
Vielen Dank für die freundliche Überweisung
Das Krankenblatt
Alltag.
Fragwürdig
Der Name war Rose
Mister X
Rote Spritze
Der Schnellschnitt
Halbwertzeit
In der Anatomie
Von Menschen u. Mäusen u. anderen Tieren
Der Würfel ist gefallen
Der kollegiale Umgang
Briefwechsel.
Diavortrag
Murphys Gesetz
Hypo oder Hippo?
Zubrot
Auf Leben und Tod
Blutlaken
Das Rennen
Der Zahn der Zeit
Das Lineal.
Die 1. Reihe
Der Sparstrumpf
Krawattenzwang.
Klopfkurs
Valium und Rectiolen
Heinz.
Schuld oder Schicksal.
Der Kniefall
Vorwort
Eine in den 1970er durchgeführte Befragung beschäftigt sich mit der Motivation junger Medizinstudenten diesen Beruf zu ergreifen. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass zu Beginn des Studiums die meisten Medizinstudenten das Studium mit dem ernsthaften Wunsch antreten, kranken Menschen zu helfen. Zum Ende des Studiums dagegen, so die damalige Studie, verlieren die meisten Studenten diesen moralischen Anspruch. Gesellschaftliche Anerkennung und das Geldverdienen rücken stattdessen zunehmend in den Vordergrund der Motivation, Arzt oder Ärztin zu werden.1
Was bewirkt die Veränderung vom altruistischen Helfer zum egoistischen Geldverdiener? Was widerfährt den Medizinstudenten während ihres Studiums oder anschließend im Verlauf ihrer fachärztlichen Weiterbildung? Warum versandet ihr idealistischer Anspruch und schlägt häufig in Frustration und Zynismus um oder in eitles Streben nach Karriere?
Den jahrelangen Prüfungsstress, die medizinischen Staatsexamen bewältigen sie. Sie akzeptieren das Erlernen eines umfangreichen theoretischen Wissens. Dann stehen sie nach erfolgreich abgelegtem Staatsexamen und erteilter Approbation am Krankenbett und sind so klug als wie zuvor.
Wie wende ich mein auswendig gelerntes zusammenhangloses
faktisches Wissen an?
Ich muss Entscheidungen treffen, aber auf welcher Grundlage?
Was kann ich mir zutrauen, ohne dem Patienten zu schaden?
Wann brauche ich Hilfe?
Welche Infusion hänge ich dem Patienten an?
Was verordne ich gegen starke Schmerzen?
Was ist bei einem akuten Schlaganfall oder Herzinfarkt zu tun?
Wie lerne ich, einen Bandscheibenvorfall zu operieren,
oder einen Tumor im Kopf zu entfernen?
Vor mehr als 30 Jahren hatte ich für kurze Zeit die Muße und das Bedürfnis, den Frust über meine Erlebnisse und Erfahrungen während meines Medizinstudiums und meiner klinischen Weiterbildung in Geschichten festzuhalten. Damit diese nicht ungelesen bleiben, veröffentliche ich sie nun, da sie an Aktualität nichts verloren haben. Auch heute noch macht der eine oder andere Student oder Assistent ähnliche Erfahrungen.
Unangebrachtes Selbstbewusstsein in Kombination mit unglücklichen Umständen im klinischen Alltag führen bei der Behandlung kranker Menschen zu fatalen Fehlentscheidungen. Die hierarchischen Strukturen im Krankenhaus spielen dabei durchaus eine wesentliche Rolle.
Wo und wie lerne ich, mich in diese Strukturen einzufügen? Gehe ich den Weg des geringsten Widerstands, um meine Karriere nicht zu gefährden?
Autoritätskonflikte mit den Chefs sind unvermeidlich und entstehen aus banalen Anlässen wie auch der Ärger mit den konkurrierenden Kollegen. Ein nicht zugeknöpfter Arztkittel kann zu unerwartetem Stress führen, wenn der konservative Chef darin eine Minderung seiner Autorität vermutet. Dabei erzeugt doch ein offen wehender Arztkittel eines zur Arbeit eilenden Assistenzarztes mehr Dynamik auf den Fluren der Station, so könnt man meinen.
Folgende Geschichten zeigen exemplarisch den Zustand der klinischen oder praktischen Medizin, wie er in den siebziger und achtziger Jahren in weiten Teilen typisch für den Alltag eines Mediziners war. Es sind lustige Begegnungen und Anekdoten, aber auch drastische Schilderungen menschlicher Tragödien und ärztlichen Versagens.
Ferner gibt es zahlreiche Beispiele für Frust und Stress bei Medizinstudenten und Assistenzärzten, denen die Realität am Krankenbett während des Studiums und der Ausbildung zum Facharzt nicht ausreichend nahegebracht wurde. Diese Geschichten beschreiben daher auch den Schock, den Studenten und Assistenzärzte erfahren, wenn sie auf die Praxis treffen und in Situationen geraten, auf die sie nicht vorbereitet wurden. Die damit einhergehende Hilflosigkeit kann zu einer allgemeinen Verunsicherung und zu einer fehlerhaften Behandlung anvertrauter Patienten führen.
Die meisten Geschichten habe ich während meiner klinischen Ausbildung unmittelbar erlebt oder erfahren. Manchmal wurden Originaldokumente benutzt, überwiegend sind die Geschichten aus dem Gedächtnis geschrieben.
Handelnde oder beteiligte Personen sind nicht namentlich aufgeführt und ausreichend verfremdet. Jede Ähnlichkeit mit noch lebenden Personen wäre rein zufällig.
1 Wolfgang Eckart und Klaus Peter Pohl (1976): Das Studium der Medizin und die Fächer „Theorie der Medizin“ und „Geschichte der Medizin“ im Urteil der Medizinstudenten. Ergebnisse einer Umfrage-Untersuchung unter den Studenten der Medizinischen Fakultät der Universität Münster im Wintersemester 1975/76 in K.E. Rothschuh und R. Toellner (Hrsg.): Münstersche Beiträge zur Geschichte und Theorie der Medizin. Münster. Nr. 12
Das Messer
Nachtdienste im Krankenhaus sind bei vielen Assistenzärzten so beliebt wie das angekaute Ende einer Currywurst. Es sei denn, die Kollegen wollen sich von dem gut entlohnten Zubrot eine Villa im Tessin leisten. Alle hassen die Zeit zwischen 3 und 4 Uhr morgens, wenn ich bis dahin alle Hände voll zu tun hatte, spüre ich meinen absoluten körperlich und geistigen Tiefpunkt überhaupt nicht. Schlimmer wird es, wenn ich bereits tief und fest geschlafen habe und vom Telefon oder dem Pieper, den ich immer bei mir trage, geweckt werde. Ich empfinde das Telefonklingeln als unwirklich und lästig, da ich gerade träumte, das Wollkleid von Brigitte Bardot aufzudribbeln.
Aber das Klingeln bleibt hartnäckig und quält sich schließlich in mein Bewusstsein vor. Völlig schlaftrunken und gerädert wälze ich mich aus dem wohlig warmen Bett und erfummel den Knopf der Nachttischlampe, die neben dem Telefon steht, um das Licht anzuknipsen. “Glück gehabt”, ein halb geleertes Glas Wasser habe ich gerade noch verfehlt und nicht versehentlich vom Tisch gewischt. Ich schnappe mir den Hörer und vernehme die Botschaft, dass der diensthabende Kollege aus der Chirurgie mich zu einer Patientin ruft. Er erwartet mich in der Aufnahmeambulanz und verlangt von mir ein neurochirurgisches Konsil. Er versorgt eine junge Frau, die von ihrem Mann mit einem Brotmesser traktiert und mehrfach am Kopf getroffen worden ist. So ein Mist, denke ich. Können die sich denn nicht friedlicher auseinandersetzen? Ich bin noch schlafverschwitzt, das verflixte Hemd sträubt sich und lässt sich nur mit Mühe und Verrenkungen über den Kopf streifen, ganz zu schweigen von den Ärmeln, die irgendein Idiot zugenäht zu haben scheint. Torkelnd und schlaftrunken erreiche ich die Ambulanz und muss unwillkürlich blinzeln, weil sich das helle, kalte Neonlicht in den blau gekachelten Wänden der Ambulanz spiegelt. Der diensthabende Chirurg steht am Kopfende einer Liege. Er trägt eine blutverschmierte Plastikschürze wie ein Metzgergeselle kurz vor Feierabend. Er versorgt eine junge, regungslose Frau, dick und blutverschmiert. Ihr Gesicht weist viele zum Teil noch blutende Schnittwunden auf. Aus einer Arterie der Kopfschwarte schießt pulsierend hellrotes Blut, die Schnittränder klaffen, man schaut auf den bloßen Schädelknochen. Der Kollege versucht verzweifelt, diese kleine Schlagader zu unterbinden. Mit seinen blutverschmierten und glitschigen Handschuhen ist diese Näharbeit etwa so mühevoll, wie das Aufheben einer Stecknadel mit abgekauten Fingernägeln.
Schnuppernd sauge ich die Luft ein. Neben dem typischen Desinfektionsmittelgeruch nehme ich etwas anderes wahr, es ist der Geruch von abgestandenem, verschaltem Bier. Bald stellt sich heraus, dass die junge Dame über zwei Promille im Blut hat. Der Chirurg bittet mich, einen Blick auf die Röntgenbilder vom Kopf der Frau zu werfen. Ihm sei dort eine helle Linie aufgefallen, die er nicht einordnen könne. An einem grell erleuchteten Lichtkasten an der Wand hängen zwei Röntgenaufnahmen vom Schädel. Der Kollege deutet mit seinen halb sterilen blutigen Handschuhen auf einen kurzen weißen Strich am Schläfenknochen, der so gar nicht zum übrigen Röntgenbild passen will. Diese Linie sieht aus wie zufällig eingekratzt, eine andere Idee fällt mir dazu nicht ein. Ohne die Bilder ausreichend zu analysieren, teile ich dem Kollegen daraufhin voreilig und lustlos mit, dass es sich bei diesem auffälligen Strich um ein Artefakt, also ein Kunstprodukt handelt. Verschmutzungen oder mechanische Einflüsse können gelegentlich in der Entwicklermaschine auf Röntgenfilmen eigenartige Muster hinterlassen. Wenn diese Struktur bedeutungsvoll wäre, dann hätte das sofort weitere Konsequenzen nach sich gezogen. Die rufbereite Mannschaft von der Computertomographie (CT) hätte aus dem Schlaf getrommelt werden müssen. Je nach Ergebnis der CT-Untersuchung vom Kopf hätte ich meinen Oberarzt wecken und informieren müssen, ob eventuell operative Konsequenzen anstünden, dann wäre die neurochirurgische OP-Mannschaft als nächstes fällig gewesen. Kurz, die ohnehin miese Nacht wäre vollends im Eimer und der nächste Tag versaut.
Ich widme ich mich der dicken Frau, um sie neurologisch zu untersuchen. Ihre Augäpfel wandern hin und her, die Pupillen sind klein. Ich kneife sie in die Innenseite der Oberarme, um ihre Schmerzreaktion festzustellen. Das tut höllisch weh, und fast jeder noch einigermaßen Lebendige reagiert auf dieses Kneifen mit Abwehrbewegungen. Diese Frau nicht. Ich kitzle ihre Fußsohlen, um den sogenannten Babinski Reflex zu prüfen, aber eine nennenswerte Reaktion der Großzehen ist nicht zu registrieren. Ihre Arme und Beine hebe ich von der Unterlage und lasse sie fallen. Sie plumpsen schlaff auf die Liege. Mir erscheint das in Anbetracht des Alkoholspiegels im Blut der Frau durchaus verständlich. Wie oft bin ich nachts gerufen worden, um dieselben Reaktionen bei unzähligen nicht mehr ansprechbaren Alkoholikern feststellen zu müssen. Viele sind mit Stoff so abgefüllt, dass nichts sie aus ihrem Dämmerzustand herauszuholen vermag. Immer wieder reißt man dich nachts aus dem Schlaf, um Besoffene untersuchen zu müssen, die in ihrem Suff in Kellerlöcher stürzen, über Bordsteinkanten stolpern, gegen Autos laufen, oder die sich einfach hemmungslos aufs Pflaster stürzen. Als Untersucher ist man nicht in der Lage sicher zu unterscheiden, ob die Leute nur stinkbesoffen sind, oder möglicherweise halbtot, wegen einer Blutung im Kopf. Gott sei Dank sind sogar bei einer gesicherten Blutung viele Alkoholiker nicht akut gefährdet. Aufgrund des langjährigen Alkoholkonsums erleiden sie häufig einen Gehirnschwund, der so ausgeprägt sein kann, dass sogar eine größere Blutung innerhalb der fest geschlossenen Schädelkapsel keine lebensbedrohende Wirkung entfalten kann. Ich fange an, die Alkoholiker zu hassen.
Eine sinnvolle Untersuchung ist nicht möglich. Manchmal sträuben sie sich derart gegen erforderliche diagnostische Maßnahmen, dass sogar fünf oder sechs Helfer nicht ausreichen, die Tobenden zu bändigen. Da geht es gelegentlich durchaus handfest zu. Sie teilen gezielte Fausthiebe aus, oder rammen die Knie gegen die Köpfe der Pfleger oder Ärzte, die ihnen beim Untersuchen zu nahekommen. Wenn ich eine Röntgenaufnahme vom Kopf anfertigen lassen will, um dieses edle Teil ohne Verwackelungen auf das schöne Röntgenbild zu bannen, sei achtsam! Unverhofft schlägt dich einer und reflexhaft schlage ich derbe zurück. Das führt häufig zum zweiten blauen Auge, oder zum dritten, wenn man selbst nicht schnell genug der gegnerischen Faust ausweichen konnte. Manche kotzen einen regelrecht an und bringen es dabei auf eine beachtliche Treffergenauigkeit. Es ist nicht möglich, diese Leute nach Hause zu schicken; denn ein Zuhause haben sie oft nicht und wenn doch, dann verdient es den Namen nicht. Auf die Straße zurück geht auch nicht, also ab in die Ausnüchterungszelle. Vorher aber muss eine ärztliche Untersuchung erfolgen, an die sich gegebenenfalls diagnostische und therapeutische Maßnahmen anschließen. Es hat früher mehrfach großen Ärger gegeben, weil zwei Alkoholiker in dieser Klinik in der Ausnüchterungszelle an ihrem eigenen Erbrochenem erstickt sind. Jetzt hat die bis unter die Decke gekachelte Zelle eigens eine Videoüberwachung. Ohnehin ist der Raum sehr wohnlich ausgestattet, mit einem Abfluss in der Mitte, einer offenen Kloschüssel – “Modell unverwüstlich” - und einer bequemen großen Gummimatratze, wie man sie vom Schulsport kennt. Einen Big Brother, der ständig überwachen kann, gibt es dennoch nicht, weil in der Notaufnahmeambulanz durchweg soviel zu tun ist, dass keine Zeit bleibt, ständig ein wachsames Auge auf die zusammengekrümmte Gestalt in der Zelle zu werfen. Ein gelegentlicher flüchtiger Blick muss genügen.
Der Kollege hat unterdessen die Schlagader unterbunden, die zahlreichen Schnittwunden vernäht und vorschriftsmäßig den Schädelknochen auf einen Bruch hin abgetastet. Er hat nichts Auffälliges bemerkt. Seine Bemerkung, vielleicht doch noch ein CT zu veranlassen, wische ich souverän zur Seite. Dabei käme sowieso nichts heraus, meine ich selbstgefällig und freue mich schon auf mein vielleicht noch warmes Bett. Der Kollege widerspricht nicht, hat vielleicht auch keine Lust zu diskutieren und entlässt mich mit einem kollegialen Dankeschön. Beim Herausgehen frage ich noch, warum sich diese Messerstecherei denn eigentlich ergeben hat.
Die Geschichte ist kurz erzählt. Die Frau ist verheiratet. Ihr Mann ist Alkoholiker und arbeitslos. Auch sie ist bekanntermaßen dem Alkohol nicht abgeneigt, hatte aber von ihrem Mann endgültig die Nase voll, weil er sie immer wieder im volltrunkenen Zustand verprügelt hat. Sie hat sich durchgerungen und war an diesem Tag beim Anwalt, um die Scheidung zu beantragen. Vielleicht erhofft sie sich von dieser Entscheidung, dass sie und ihre kleine Tochter ein gewaltfreies Leben führen können, wenn sie sich von ihrem Mann trennt. Abends sagt sie es ihrem Mann. Sie stehen sich in der Küche der gemeinsamen Wohnung gegenüber. Sie hat ihre kleine Tochter an der Hand. Glaubt sie, dass ihr das Stärke verleiht? Er packt sich ein Brotmesser vom Küchentisch und drischt auf ihr Gesicht, ihren Kopf ein. Es wird wohl sehr laut in der Wohnung gewesen sein und die Kleine hat sehr geweint. Die Nachbarn haben die Polizei alarmiert. Jetzt ist die junge dicke Frau in der Klinik, die Tochter bei den Nachbarn, der Mann festgenommen. Ich komme in mein Bereitschaftszimmer zurück, kuschel mich wohlig ins noch warme Bett und schlafe die wenigen, noch verbleibenden Stunden bis zum regulären Dienstbeginn störungsfrei.
Am nächsten Tag eile ich zur Röntgenbesprechung, die wie üblich am frühen Nachmittag stattfindet. Meine Stationsarbeit habe ich rechtzeitig erledigt und alle dreißig Patienten sind gut versorgt und auch in der Ambulanz hat es keine nennenswerten Probleme gegeben. Der Radiologe demonstriert eine überaus eindrucksvolle Computertomographie vom Kopf einer jungen Frau, die vormittags auf der chirurgischen Intensivstation verstorben ist. Irgendein Kollege dort hatte diese Untersuchung noch am frühen Vormittag veranlasst. Ich werde blass. Diese Röntgenuntersuchung beweist es. Der Mann der jungen dicken Frau hat es doch tatsächlich geschafft, ihr das Brotmesser seitlich durch den Schläfenknochen zu rammen. Das war die auffällige Stelle auf dem Röntgenbild der letzten Nacht, auf die der Kollege hingewiesen hatte. Die Klinge ist quer durch das Gehirn gefahren, an die gegenüberliegende Innenseite des Schädelknochens geprallt, und muss, ohne abzubrechen, wieder herausgezogen worden sein. All das war auf dem CT anhand einer eindrucksvollen Blutspur quer durch das Gehirn hervorragend zu sehen. Mir blieb die wenig tröstliche Gewissheit, ein noch in der Nacht angefertigtes CT hätte zwar die korrekte Diagnose erbracht, aber zugleich die infauste Prognose offenbart. Diese Messerverletzung war so schwerwiegend, dass die Frau selbst bei einer Operation keinesfalls überlebt hätte.
In Flagranti
Die Indikationen zur Röntgenuntersuchung des Kopfes mittels der Computertomographie sind vielfältig, angefangen von Kopfschmerzen bis hin zur Tumordiagnostik oder Schädel-Hirn-Verletzungen. Da die Anforderungsscheine für diese Röntgenuntersuchung fast immer unzureichend ausgefüllt sind - die Bilder werden es ja schon zeigen – ist man genötigt, die Patienten, die am CT untersucht werden sollen, persönlich zu befragen. Dabei erfährt man doch eine Menge interessanter Dinge, die das Leben so würzig machen.
Zurück zum Alltag: Vor mir sitzt ein verschmitzt lächelnder junger Mann, trotz seines turbanartigen Kopfverbandes, der an einigen Stellen Blut durchtränkt ist. Ich kann nicht so recht verstehen, warum er noch lächeln kann, so als ob er einer schönen Erinnerung nachhängen würde. Auf der Anforderung zur CT-Untersuchung steht: frische Fraktur der Schädelkalotte. Ausschluss einer Blutung. Der junge Mann gibt bereitwillig Auskunft. Er sei gerade mit einer drallen Blondine in höchstem missionarischem Eifer beschäftigt gewesen, als seine Frau überraschend in der Wohnung aufgetaucht sei. Der Anblick, der sich ihr bot, habe sie wohl so wütend und rasend gemacht, dass sie den nächstbesten greifbaren Gegenstand auf seinen Kopf gedonnert habe. Und das sei nun mal ein schwerer Glasaschenbecher gewesen. Die Röntgenuntersuchung bestätigte den Bruch im Schädelknochen und eine kleine Blutung im benachbarten Gehirnteil. Er wurde für einige Tage stationär aufgenommen und beobachtet. Da sich sein Befinden nicht verschlimmerte, war eine Operation nicht erforderlich und er konnte nach Hause gehen. Einige Wochen später kam ich zufällig in der Ambulanz vorbei. Im Flur saßen Patienten, allein oder mit Angehörigen. Ein verschmitzt lächelnder junger Mann saß auch da, mit einem frischen turbanartigen Kopfverband, der an einigen Stellen Blut durchtränkt war. Ich stutzte und dachte: Das kann doch wohl nicht wahr sein! Aber er war es. Ich muss wohl arg verdutzt ausgeschaut haben, denn er meinte sofort: “Nein! Nein! Herr Doktor, nicht das, was Sie denken!” Er gab wieder bereitwillig Auskunft: Es war Zahltag und er war vom Betrieb mit seiner Lohntüte direkt auf eine Bar losgesteuert. An der Theke hatten wohl einige üble Gestalten mitbekommen, dass er seinen Wochenlohn dabei hatte. Beim Verlassen der Bar hatten diese Ganoven ihm aufgelauert, ihn mit einem Totschläger bewusstlos geschlagen und dann mit seinem vollen Portemonnaie unerkannt das Weite gesucht.
Das EKG
Das Elektrokardiogramm, kurz EKG, ist eine unverzichtbare diagnostische Hilfe. Das Ableiten der Ströme, die bei der Kontraktion des Herzmuskels auftreten, und die Interpretation der auf Papier aufgezeichneten Linien und Zacken, ermöglichen die weitgehende Abklärung von Erkrankungen des Herzens. Das EKG wird auch auf der Intensivstation intensiv genutzt. Die sorgfältig auf der Brust des Patienten verklebten Kabel leiten die Herzaktionen an einen Fernsehmonitor weiter, der ein beständiges, gut sichtbares Bild liefert. Häufig ist sogar eine Fernleitung zur Zentrale der Intensivstation gelegt, so dass auch ohne Anwesenheit im Intensivkrankenzimmer jederzeit ein rasches Eingreifen beim Versagen des Herzmuskels möglich ist. Zusätzlich zu dem zackigen Fernsehbild ertönt ein akustisches Signal, das die Herzaktionen in Form eines Pieptons wiedergibt. Versagt die Pumpe, dann ertönt ein akustisches Warnsignal. Eine lückenlose Überwachung ist also durchgehend gewährleistet. Sollte der Ernstfall eintreten - ein Dauerpiepton und eine durchgezogene, unbewegte Linie auf dem Monitor - löst das beim Pflegepersonal und den Ärzten einen bedingten Reflex aus, der sofortiges, rasches und richtiges Verhalten erfordert. Eines der effektiven Verfahren, die Herzaktion bei Stillstand wieder in Gang zu setzen, ist ein kräftiger Faustschlag auf das Brustbein. Ein beherztes Zuschlagen ist dabei wesentliche Voraussetzung für den möglichen Erfolg. Nichts für Schwächlinge also!
Aber was schief gehen kann, geht auch schief. Während einer Oberarztvisite auf der Intensivstation ertönt der Alarm. Wir alle rennen in das Zimmer eines alten, lieben Mütterchens. Sie liegt leblos im Bett, die Zeitung, die sie noch gelesen hatte, war ihr auf die Brust gesunken, der rechte Arm, die Handfläche nach oben, hing aus dem Bett. Der Monitor zeigte eine Nulllinie, es ertönte ein Dauerpiepton. Der Oberarzt muss ein beherzter Mann sein - sonst wäre er nicht Oberarzt - und schlägt der alten Frau die Faust aufs Brustbein, dass die Zeitung halb zerfleddert. „Aber Herr Doktor, was machen Sie denn da mit mir?“ Erschrocken fährt die Frau im Bett hoch. Sie war beim Zeitungslesen eingeschlafen und hatte dabei mit der herabsinkenden rechten Hand aus Versehen ein Elektrodenkabel von ihrer Brust gelöst. Diese alte Überwachungstechnik war wohl nicht ausgereift genug. Heutzutage wird natürlich ein solcher Fehlalarm von der Technik erkannt und als solcher gemeldet. Aber gegen langweilige Zeitungen hilft natürlich auch die ausgereifteste Technik nicht.
Die Prostatamaschine
Die Prostata, oder auch Vorsteherdrüse genannt, ist sicher eines der bekannteren männlichen Organe, die aus unerfindlichen Gründen weiblich konnotiert ist. Ihre Aufgaben im Organismus lassen wir unerwähnt. Sie rückt meist ins Bewusstsein älterer Männer, weil ihre Vergrößerung zunehmende Schwierigkeiten beim Urinieren zur Folge hat. Man stottert beim Pinkeln, und Ehefrauen schimpfen über gelbe Flecken in der Unterhose. Vielleicht hat Sokrates in diesem Fall seiner Xanthippe keinen Anlass zum Streit gegeben, weil er typisch griechische Gewänder trug. Wie dem auch sei, die Prostata ist populär.
Eine Zeit lang stand sie obenan im öffentlichen Interesse, als der Chirurg Hackethal behauptete, dass durch diagnostische Manipulationen ein Prostatakrebs überhaupt erst richtig bösartig würde. “Vom Haustierkrebs zum Raubtierkrebs”, so hieß sein Bestseller. Diese Behauptung wurde anfänglich von der herrschenden Lehrmeinung der Medizin als Patientenverunsicherung abgetan. Im Stillen, und später im regulären medizinischen Wissenschaftsbetrieb, wurde dann experimentell diese Behauptung überprüft. Ohne eindeutige sichere Resultate, so oder so. Der Prostatakrebs bleibt von Interesse, weil seine Früherkennung echte Heilungschancen bietet. Eine routinemäßige Untersuchung ist daher auch Bestandteil der sogenannten Vorsorgeuntersuchung. Sie beinhaltet die digitale Abtastung der Prostata, das heißt, der Arztfinger, geschützt durch einen übergestreiften Fingerling, ertastet durch die Afteröffnung die Beschaffenheit dieses Organs. Da es sich hierbei um einen sinnlichen Vorgang handelt, müssen die Tastsinne des Untersuchers geschärft werden. Dies geschieht zweckmäßigerweise während der Ausbildung zum Mediziner. Zunächst lernt der Medizinstudent die Prostata jedoch im literarischen Zusammenhang kennen. Auf alten Hörsaalbänken fand sich der Spruch, der den angehenden Mediziner zu wahren Beifallsstürmen hinriss:
Der Gonokokkus sitzt und lauscht
wie der Urin vorüber rauscht
mal sitzt er hier
mal sitzt er da
doch meistens an der Prostata.
Heutzutage sind derartige literarische Höhenflüge durch die Unmöglichkeit begrenzt, in Resopal beschichtete Tische Sprüche von Ewigkeitswert einritzen zu können. Bedauert jemand den Verlust dieser Kommunikationsform? Also, die Tastsinne müssen geschärft werden, damit der angehende Mediziner eine gesunde von der kranken Prostata zu unterscheiden lernt. Optimal wäre natürlich, wenn der Medizinstudent vor Ort Erfahrung sammeln könnte. Aus ästhetischen Gründen, sowie aus betriebsorganisatorischen Gegebenheiten heraus, sehen sich die verantwortlichen Ausbilder leider genötigt, diese Form der empirischen Erkenntnisgewinnung auf ein Mindestmaß zu beschränken, das heißt es kommt praktisch kaum vor. In einer urologischen Universitätsklinik ist jemand auf eine geniale Idee gekommen.
Während des kurzen theoretischen Praktikums in der Urologie, die sich wissenschaftlich mit der Prostata befasst, wird der Student in einen Raum geführt, in dessen Mitte sich dem argwöhnisch Eintretenden ein Plastikarsch entgegenstreckt. Auf einem Tisch ist gewissermaßen in Rückenlage ein unvollständiges Plastikmodell der menschlichen Hinterbacken platziert und mit Schrauben an der Tischplatte befestigt. Die Farbe des Gebildes ist pink-rosa und absolut sauber, klinisch rein. In der Mitte zwischen den Arschbacken findet sich das Berlichinger Loch. Nach einer kurzen feierlichen Ansprache erfolgt die theoretische Unterweisung, wie die Prostata zu untersuchen sei und was der Untersucher an Befunden zu erheben habe. Dann wird aus der Mitte der unglücklichen Studenten einer aufgefordert, das soeben gewonnene Wissen praktisch umzusetzen. Ich streife mir vorsichtig den Fingerling über und schmiere ihn mit Vaseline ein. Zögernd stecke ich dann meinen Digitus in das Loch - ich weiß ja nicht, was mich erwartet - und fühle etwas Festes, Rundes. Laut darf ich den Umstehenden mitteilen, was mein Fingersinn ertastet. “Das ist es also!”, denke ich triumphierend. Doch meine Miene verfinstert sich sofort, als der Professor für Urologie mit geheimnisvoller Geste und vor den Blicken der Studenten versteckt, einen verborgenen Mechanismus in Gang setzt. Ein mechanisches Brummen ertönt, ich will meinen Finger in Sicherheit bringen und werde doch durch den strengen Professorenblick daran gehindert. Nur einige Sekunden hält das irritierende Brummen an, dann kehrt wieder Ruhe ein. Ich werde erneut aufgefordert, laut meinen Kommilitonen mitzuteilen, was ich denn jetzt ertasten könne. Und - oh Wunder! - ich fühle etwas anderes, jetzt derb und höckerig, immer noch fest, aber nicht mehr rund. Die Scheu ist verflogen, jeder will ran und lernen. Als Belohnung wird schließlich das Geheimnis offenbart. Der Tisch mit dem pink-rosafarbenen Plastikarsch wird umgedreht und dem ehrfurchtsvollen Betrachter offenbart sich die geniale Konstruktion.
Im Abstand von einigen Zentimetern vom Berlichinger Loch - von innen aus betrachtet - ist auf einem Elektromotor ein mittels Knopfdruck drehbares Prostatamodell montiert. Verschiedene in Plastikmasse ausgeformte krankhafte Veränderungen der Prostata können mit Hilfe des elektrischen Stromes so vor die Öffnung platziert werden, dass der Medizinstudent seinen Tastsinn schärfen kann. Das ist medizinische Didaktik.
Der Simulator
Der Raum war nicht sehr groß, viereckig vom Grundriss her und vollständig dunkel, ohne Fenster. Er diente der Bestrahlungsplanung. An einer Seite befanden sich große breite Türen, durch die man Betten fahren konnte, falls Tumorkranke nicht mehr in der Lage waren, zu Fuß zu kommen. Mit Hilfe eines Röntgendurchleuchtungsgerätes, das mitten im Raum stand, wurde das spätere Bestrahlungsfeld festgelegt. Die mutmaßliche Lage des zu bestrahlenden Krebses konnte mittels beweglicher Metallstäbe über ein Lichtvisier und unter Durchleuchtung eingegrenzt werden. Die Haut wurde dann mit einem Filzstift markiert - in Kreisform oder in Form von Rechtecken. Das war die Tumorgeometrie. Auf keinen Fall sollte diese Farbmarkierung abgewaschen werden, was für einen Bestrahlungszeitraum von mehreren Wochen für die meisten Menschen gar nicht so leicht zu realisieren ist. Falls doch jemand auf Dusche oder Bad nicht verzichten wollte, riskierte er eine Unschärfe seiner Tumorgeometrie. Dann wurde einfach eine approximative Konturkorrektur mit dem Filzstift vorgenommen. Man zeichnete die ungefähre Lage des verwaschenen Bestrahlungsfelds einfach neu nach. Auch in der Strahlentherapie gibt es einen Ermessensspielraum.
Dieses Röntgengerät mit der speziellen Eigenschaft, Bestrahlungsfelder zu lokalisieren und entsprechend zu markieren, wurde Simulator genannt. Tausende von Patienten sind in vielen Jahren hier durchgeschleust worden und haben anschließend die Klinik als Gezeichnete verlassen. Manche von ihnen trugen ihr Mal im Gesicht, das sie schamhaft verborgen hielten, um nicht nach den Gründen der auffälligen Kriegsbemalung befragt zu werden. Wer erzählt schon gern, dass er einen oft aussichtslosen Kampf zu führen gedenkt? Also, dieser Simulator trug seinen Namen zu Recht; denn hier wurde ja nicht bestrahlt, sondern nur so getan, als ob, einmal abgesehen von den Röntgenstrahlen. Die Gammastrahlen der Kobaltbombe simulieren dann nicht mehr. Eines Tages trat ein älterer, aber rüstiger Mann ein, eine Baskenmütze auf dem Kopf. Dies hätte mich warnen sollen. Er stand im Raum, schaute sich um und stellte lapidar fest: „Was für eine kafkaeske Situation.“ „Oh“, meinte ich etwas süffisant, „Sie haben Kafka gelesen?“ Den literarischen Exkurs, den er mir lächelnd um die Ohren haute, habe ich leider wieder vergessen, aber ich glaube, dass ich damals kurzfristig mehr von Kafka verstanden habe als jemals zuvor. „Sind Sie Pfleger? Oder was?“ Stolz trat ich näher und wies auf mein Arztschildchen an meiner linken Kittelbrust. Er schaute kurz und sah unbeeindruckt aus, denn er sah - nichts. Konnte er auch nicht, denn das verdammte Schildchen musste im Laufe der vormittäglichen Simulatortätigkeit wohl auf den Boden gefallen. So stand ich vor ihm, namenlos ohne Identitätsschildchen und bückte mich augenblicklich, um das Ding wiederzufinden. Ich hatte schließlich Erfolg, nachdem ich die Deckenbeleuchtung eingeschaltet hatte. Nun stand einer korrekten Vorstellung meinerseits nichts mehr im Wege. Ich merkte, dass er mir Glauben schenkte, mein Selbstvertrauen kehrte zurück.
Der Rest war Routine. Durchleuchtung des Brustkorbes, Lokalisierung eines Lungentumors, Begrenzung des Bestrahlungsfelds und Markierung mit Filzstiften, Anfertigen einer Röntgenaufnahme, der Gang in die Dunkelkammer, um das Bild zu entwickeln und einen neuen Film in die Kassette einzulegen - die MTRA (medizinisch-technische Röntgenassistentin), eine nette ältere Dame, fütterte derweil ihre Lieblingsamsel vom Vorraum aus, der mit einem Fenster versehen war und Tageslicht einließ. Ich suchte meinen Oberarzt auf, um das Bild und die korrekte Lokalisation absegnen zu lassen. Dann folgte ein abschließendes Gespräch zwischen mir und der Baskenmütze, um den ersten Bestrahlungstermin zu vereinbaren. Meiner mit vorsichtiger Zurückhaltung vorgetragenen Bitte, sich doch einmal ausführlicher mit ihm unterhalten zu dürfen, wurde zu meiner Überraschung entsprochen. Er lud mich zu sich nach Hause ein. Es war ein schöner warmer Spätherbst, und wir haben einige Male draußen vor seinem kleinen, idyllischen Bauernhäuschen gesessen, französischen Cognac getrunken und Gauloises ohne Filter geraucht, über Gott und die Welt geredet, und ich habe viel von ihm erfahren. Ihm konnte ich nicht viel geben! Nicht einmal Hoffnung konnte ich ihm lassen, die er so nötig gehabt und gewollt hätte:
HIERMIT GEBE ICH MEIN EINVERSTÄNDNIS ZU DER VORGESEHEN STRAHLENBEHANDLUNG. NACH UNTERRICHTUNG DURCH DEN ARZT UND DURCHSICHT DES MERKBLATTES A- 2 HABE ICH EINE ZUTREFFENDE VORSTELLUNG VON DER NOTWENDIGKEIT UND DEN MÖGLICHEN AUSWIRKUNGEN DER BESTRAHLUNG GEWONNEN.
“Sehr geehrter Herr Kollege! Vielen Dank für die freundliche Zuweisung des o.g. Pat., bei dem wir in Anschluss an die schon durchgeführte Chemotherapie, die Strahlentherapie am Kobalt - 60 - Tele - Therapiegerät fraktioniert durchführen wollen. Wie vorgeschlagen wird das Mediastinum mit 40 Gy und der periphere Herd rechtsseitig ebenfalls mit 40 Gy bestrahlt werden. Zur Verlaufskontrolle dürfen wir Sie freundlicherweise bitten, uns einige der in X angefertigten Röntgenaufnahmen möglichst in Kopie zu überlassen. Wir werden am Ende der Bestrahlungsserie erneut berichten.” Ich habe sie sehr gern gehabt, die Baskenmütze. Der engagierte Schriftsteller ist bald gestorben. Seine Beerdigung fand unter schwirrenden Schatten von Polizeihubschraubern statt, weil die anwesende Politprominenz vor den Nachfolgern der RAF (Rote Armee Fraktion) geschützt werden musste. Der Chef der universitären Strahlenklinik hatte sich, trotz der Bitte des damaligen Bundespräsidenten, nicht persönlich um die Baskenmütze gekümmert. Dieser war ja nur Kassenpatient.
Klinische Prüfung
„Einverständniserklärung“
U





























