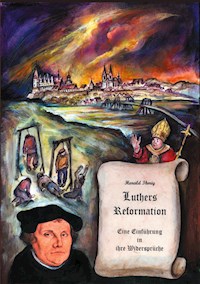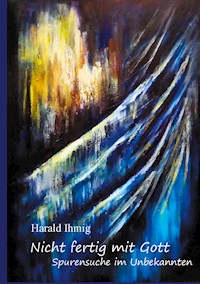
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Es ist schwierig, von Gott zu reden, und gefährlich, ihn totzuschweigen." Das habe ich vor Jahren geschrieben. Nun kehre ich, als lang gedienter Hochschullehrer und nach anderweitigen Beschäftigungen zurück zu dem immer noch Unbekannten. In Miniaturen, ehemals Ansprachen an Studierende, MitarbeiterInnen und Senioren, kreist dieses Buch versuchsweise um Gott, das "ungeheure Du", und seine Spuren zwischen Menschen. Zudem riskiert es vorwitzige theologische Gedanken über Gott und den Sinn des Christseins,- mit Anleihen bei Martin Buber und mehr noch bei Etty Hillesum. Ins Zentrum ist mehr und mehr die Auseinandersetzung mit der Gewalt und Gottes andersartiger Macht geraten. Es sind Tastversuche eines Christenmenschen, der in die Jahre gekommen ist und weiter probiert, "mit Gott ein Verhältnis zu haben." Ich hoffe, dass sie auch anderen etwas sagen können, die nicht fertig sind mit Gott, weder so, dass sie über ihn Bescheid wüssten, noch so, dass sie ihn los würden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 716
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Penka
Inhalt
Vorwort
Suchbewegungen
Abenteuer Leben
Gott
Gott suchen
Schöpfer-Geist
Hauch des Lebens
Paradise lost?
Der letzte Adam
Totenerweckung
Die vergessene Speise
glauben
Glaube als Macht
Abba-Vater
Die Perle
Spurenlese
3 Geschichten zur Diakonie
Lärm schlagen fürs Leben
Arm dran
Brüderschaft und seine Brüder
Etwas wie Gemeinde
Machthaber
Leitung
Feinde
„Leben wird es geben“ – Gorleben
Tschernobyl
Abrüstung
Ein Kapitel Theologie
Von Gott reden
Theologie-was ist das?
Ist Gott ein Konstrukt?
Einführung in die Kontroverse
Projektionsverdacht als kritisches Instrument
Monotheistische Religionskritik
Atheistische Religionskritik
Re-konstruktion Gottes?
Gottesvorstellungen als Suchbilder
Das ungeheure Du
Geeinzeltes und ewiges Du
Es-Welt und Du-Welt
Gott als ewiges Du
Zwischenmenschliches und ewiges Du
Kritische Anmerkungen zu Bubers Konzeption
Routinehandeln und dialogisches Prinzip
Ausgehen zum Du und Rückbiegung
Meditieren und beten
Fragen und Antworten
Zur Tradition des christlichen Meditierens
Kritik des Betens
Etty – das Mädchen, des nicht knien konnte
Etty Hillesum – eine Hinführung
Etty Hillesum – Zitate
Gottesrede in der Bibel
Zu Geschichte und Thema der Bibel
10 Worte Gottes? Der Dekalog
Konturen des Dekalogs
Gottesrede im Dekalog
Erläuterung zu einzelnen Geboten
Spricht Gott?
Nächstenliebe und Gottesliebe
Zum Inhalt von Lev 19
Zur Begründung
Gottesbeziehung als Lebensbeziehung
Gottes Liebe als Impuls der Nächstenliebe
„Dein Wille geschehe“
Anabasis
Gottes Wille und unser Wille
Textanhang: M. Buber, Rechtssammlungen
Gottes Macht und die Gewalt
Übt Gott Gewalt? Alttestamentliche Spannungen
Die Machtprobe des Jesuswegs
Diakonie der Macht
Unterwegs mit Jesus
Der Blinde – Wunder und Weg
„Kommt und folget mir nach!“
Das Lebenszeichen in der Nacht – Abendmahl
Du lässt mich nicht im Tode
Nach diesem Frühling
Neue Wüste
Zum Kern der Einsamkeit
Spiele und Nähe
Was Menschen brauchen
lieben
Erlösung
In Christus
Ohne mich könnt ihr nichts tun
Frucht
Verlorenes retten
Gott auf Wohnungssuche
Wohnen
Etty‘s Wohnungssuche
Das Leben herauslesen aus den Menschen
Unsichtbares
Jesus sehen
Missglückte Begegnung
Das Leid und die Leidenschaft
Pfahl ins Fleisch
Gott lieben
Lust
Die Herrlichkeit Gottes schauen
leben
Abschied
Herbstblätter
Mandelzweig
Ertrag
Was bleibt
Sich rechtfertigen
Botschaften
Und hat dich lieb
wertgeschätzt
Gottes freie Kinder
Vorwort
Ich habe mich geraume Zeit mit den Dingen dieser Welt, der Ökonomie, der Gewalt und den Menschenrechten, herumgeschlagen und den Faden ein bisschen oder ganz verloren, von dem in diesen alten Andachten so viel die Rede ist. Ich habe angefangen, sie wieder zu lesen, und habe gemerkt, dass sie mir etwas zu sagen haben.
Dabei kam mir die Vermutung, dass sie vielleicht auch anderen etwas sagen könnten. So entstand diese Sammlung von Tastversuchen, die sich probeweise auch an andere wendet, die es betreffen mag. Ich bin ein Theologe, Hochschullehrer, der in die Jahre gekommen ist und immer noch probiert, „mit Gott ein Verhältnis zu haben.“ Ich bin, anders gesagt, ein Christenmensch, der Gott mit Freisinn sucht.
Ich habe das Angedachte so unfertig belassen, wie es war. Trotzdem ist daraus ein ziemlich dickes Buch geworden, ein Mosaik aus Miniaturen. Man muss es nicht im Stück, sondern kann es kreuz und quer lesen, so wie es entstanden ist.
Ich habe es in 5 Kapitel geteilt. Es beginnt mit kleinen Texten – Andachten und Meditationen – zu meinen, vielleicht auch Ihren Suchbewegungen ins Unsichtbare. Es geht weiter mit Spurenlese im Miteinander der Menschen, die mehr und mehr auf das Erzübel der Gewalt stößt.
Hier bricht die Darstellung ab, was meinen Lebensweg betrifft. Meine Versuche, gegen die Gewalt aufzustehen, habe ich aus diesem Buch ausgespart.
Statt dessen habe ich hier ein Kapitel Theologie eingeschoben. Während die Andachten mehr zu Gott sprechen, geht es in diesen Seminar-Texten darum, wie von Gott geredet werden kann bzw. nicht geredet werden sollte. Ich habe dabei besonders Martin Buber und Etty Hillesum zu danken,
Das Thema der Gewalt – Gottes und unserer, das dabei mehr und mehr ins Zentrum rückte, wird im folgenden Abschnitt auf andere Weise wieder aufgenommen. „Unterwegs mit Jesus“ taucht es wieder auf, im Kern des Christentums, in der Passion, die ich als Machtprobe gegen die Gewalt verstehe.
Das Schlusskapitel handelt von einem Gott, der auf Wohnungssuche ist, und unserer Bereitschaft oder Weigerung, ihm Raum zu geben. Auch hierbei bin ich von Etty’s Vermächtnis berührt.
Das Buch und sein Autor werden nicht fertig mit Gott, weder so, dass sie über ihn Bescheid wüssten, noch so, dass sie ihn loswürden.
Suchbewegungen
Abenteuer Leben1
Je mehr ich in die Jahre komme, desto öfter denke ich an Abraham. Ich gebe zu, er war nicht ganz normal. Er hat Stimmen gehört. Mit 75 hat er sich von zu Hause aufgemacht, um jahrelang im Zelt herumzuziehen. Fragte jemand den späten Wandervogel, was er denn eigentlich im Sinn habe, so gab er zur Antwort: "ein weites Land entdecken für meine Nachkommen" - und lachte laut, weil er das selber etwas ulkig fand. Hatte er es doch als hochbetagter Greis mit einer neunzigjährigen Frau noch immer nicht zu einem einzigen Sohn gebracht. Ein ziemlich verrückter Typ. Paulus hat ihn "Vater der Glaubenden" genannt, weil mit ihm diese merkwürdige Verirrung angefangen habe, dass Menschen mit etwas leben, was man nicht sieht.
Denke ich an Abraham, wundert es mich, dass heute eher die normalen Menschen Christen sind, das Christentum aber doch erfunden wurde von Leuten, die nicht ganz normal waren.
Der biblische Erzähler hat zuvor in der Geschichte vom Festungsbau zu Babel beschrieben, wie Menschen normalerweise versuchen, das Leben zu bestehen: durch Verfestigung den Bestand sichernd. Mit Abraham, der Heimat, Verwandtschaft und Haus verlässt, um ein unbekanntes Land zu suchen, lässt er einen anderen Versuch beginnen; den Versuch, das Leben als Abenteuer zu erleben. Abraham, der mobile Greis, hat tatsächlich Nachkommen bekommen, ich meine: auch Bewegliche, nicht nur die Vielen, die sich in seinen Spuren wieder festgesetzt haben. Israel hat es sich, längst etabliert und behäbig geworden, nie erlaubt, seine beweglicheren Anfänge zu vergessen. An jedem Erntefest hat es sich in einem seiner ältesten Glaubensbekenntnisse daran erinnert: "ein herumirrender Aramäer war mein Vater“. Und auch in der Tradition des Christentums spielen nicht Besonnene die erste Rolle, sondern Abenteurer. Der Menschensohn selbst war ein Nichtsesshafter, der nicht hatte, wo er sein Haupt hinlege, und ebenso seine ersten Boten, die ohne Heimat, Familie, Besitz und Schutz den Frieden des Gottesreiches austrugen. "Vagabundierende Wandercharismatiker" hat man sie genannt.
Alle diese Leute sind keine Besitzer, die Vorräte sammeln, keine Verbraucher, die in dem schwelgen, was ihnen geboten wird, aber auch keine Asketen, die Verzicht leisten, sondern Abenteurer, die alles, was sie haben, verkaufen, um den Schatz im Acker oder die köstliche Perle zu kaufen, die alles auf eine Karte setzen, um Größeres zu gewinnen. Es sind keine Lebenskünstler, die geschickt überleben, das Leben sichern, verwalten oder genießen, sondern Abenteurer, die gründlich in das Leben eindringen und es mehren wollen. Abraham bricht auf, um gesegnet zu werden und ein Segen zu werden, heißt es in der Erzählung. Ist es so, dass nur die das Leben mehren, reicher machen, überfließend auf andere, "Segen bringen", die es als Abenteuer nehmen?
Ich bin nicht wie Abraham. Ich komme mir eher vor wie Adam. Der war schwerfälliger, ein Ackersmann, ein Sesshafter; in einen Garten gesetzt wie in ein gemachtes Bett, darin zu Haus. In Einklang mit der Natur, dem Mitmenschen, mit Gott und sich selbst erlebt er "Wohnlichkeit im Dasein", die manchmal wirklich ist, für eine Weile. Als Adam die Begrenzung nicht einhält und ins Grenzenlose fortschreiten will, Gutes und Schlechtes, alles ausprobieren will, da fällt er aus diesem Traum heraus in ein Land der Dornen und Disteln und ein zähflüssiges Leben, in dem alles schwerfällt und wenig gelingt. Adam würde sich gern festsetzen in seinem Glück, es ausbauen und ausdehnen. Aber er ist erdenschwer: mal hebt ihn das Leben empor, dann wirft es ihn in hohem Bogen umso härter auf die Erde zurück.
So ist es dann geblieben mit unseren Paradiesen, mit Urlaub, Wochenende, Blockseminaren, den Träumen von der beschaulichen Landkommune mit biologischem Ackerbau und Kleingewerbe, mit dem Dahintreiben in der Sonne und noch mit dem tiefdringenden Glück: dass sie sich nicht halten lassen gegen die harten Rhythmen des Alltags. Ja, das hat uns Adam vererbt: am Morgen schwer aufwachen, noch gefangen in süchtigen Träumen nach einem verlorenen oder einem gewünschten Paradies, und vor uns nichts als Tage und Wochen der stets wiederkehrenden Mühsal, Sitzungen, Seminare, die überstanden werden müssen, ohne dass wir in sie hinein wollen, hinein kommen und sie uns mitnehmen. Wenn die Arbeit nicht mehr leicht von der Hand geht, sondern abgepresst wird, wenn die Entsprechung zu. den ändern nicht mehr gelingt und wir einander fremd zur Last fallen, wenn wir gar aus einer Liebe, die immer tiefer und weiter zu gehen schien, herausfallen, dann wird die Lebenslust brüchig. Heimatvertrieben traut man sich nicht mehr heraus und versucht, am Tag vorbei zu schleichen.
Dann fange ich an, die Vielen zu beneiden, die ich sehe: die nicht glücklich sind und nicht unglücklich, sondern einfach normal; die das Leben gleichmäßig ablaufen lassen ohne größere Leidenschaft. In solchen Phasen der Verdrießlichkeit, wenn ich Tag und Tag als gleichförmige Wiederkehr des Beschwerlichen erlebe, wenn ich zurück möchte in vergangenes Glück oder wenigstens neutral und arbeitsfähig sein, wenn ich teilnahmslos bin gegenüber dem neuen Tag, da tut es mir gut, an Abraham zu denken. Nicht so sehr wegen seines dramatischen Aufbruchs in die Ferne; so weit will ich gar nicht gehen. Ich denke an Abraham, weil er das Leben nicht greisenhaft als etwas Altbekanntes nimmt, das im Wesentlichen hinter ihm liegt, sondern als ein noch zu entdeckendes; weil er sich aus den halben oder ganzen Paradiesen, in denen wir für eine Weile geborgen sind, und aus den erstarrten Rollen, in denen wir uns wichtigmachen, auch wieder löst, um das Leben von neuem zu riskieren; weil er Fuß fasst in neuem Land, ohne sich festzusetzen; weil er so verrückt damit rechnet, dass im längst Sterilen sich wieder etwas regen und entspringen kann. Wie Abraham hätte ich gern einen wacheren Sinn für die Verlockungen eines Gottes, der noch in den Öden des Alltags neues Land verspricht. Weil es da heißt: "Der Herr sprach zu Abraham: "geh in ein Land, das ich Dir zeigen werde", haben allerdings besonders Fromme aus dem Abenteurer Abraham etwas ganz anderes gemacht. Nämlich einen beflissenen Subalternen, der sich gehorsam von seinem Herr-Gott abkommandieren lässt. 0h nein, so grob geht es nicht zu, wenn man von Gott etwas mitkriegen will, dem Lockruf ins neue und grenzenlose Leben. Das sind keine Kommandos, sondern ganz feine Schwingungen, überhörbare, verlierbare, in uns, von andern her, zwischen uns, für die man sehr hellhörig und feinfühlig werden muss, um ihnen - ohne Nötigung - "folgen" zu können. Man muss gleichsam das Gras wachsen hören. Man muss den kleinen Anfängen, den zarten Andeutungen, vielleicht nur Ahnungen des besseren und tieferen Lebens trauen und sich von ihnen anstecken und mitnehmen lassen. Man darf nicht so sicher sein, was Wirklichkeit ist und was wirklich werden kann.
Religion sei, so heißt es bei einem Philosophen, nicht eine Regel der Sicherheit, sondern ein Abenteuer des Geistes, ein Flug ins Unerreichbare. Das ist sie wohl: eine abenteuerliche Einstellung zum Leben.
Wir können es als die belanglose Wiederholung des immer Gleichen, der gleichen Menschen, Probleme und Handlungen ablaufen lassen. Wir können aber auch glauben, dass in allem Leben die Verlockung Gottes, des grenzenlosen Lebens, spürbar ist, tiefer in es einzudringen. Wenn wir das Leben fristen wollen, genügt die Routine; wenn wir gründlich in es eindringen wollen und es sich durch uns mehren soll, auf andere übergehend, dann müssen wir mit allen Sinnen dabei sein und es als Abenteuer nehmen.
Es ist etwas anderes, ob wir eine Ausbildung absolvieren oder studieren, d.h. miteinander auf Entdeckungsreise gehen;
ob wir empfinden: dieselben Leute wie gestern -oder: wer bist du eigentlich? ein Tag wie jeder andere - oder: heute;
alles Scheiße - oder: es ist etwas im Gang.
Ach, dass wir nicht gar so schnell vergreisen!
Behüte uns vor Studenten, die nicht studieren wollen, und vor Dozenten im Ruhestand!
Ich möchte mehr wie Abraham werden.
Ich hoffe, ich werde nicht ganz normal.
1 Zum Semestereröffnungsfest am 11.4.1980. Veröffentlicht in Der Brüder-Bote Nr. 3,1980, diakon März/April 1984 und INFO IV Nr.2 der John-Eberly Gesellschaft
GOTT2
Nur ein Thema hat die Theologie, sagt Thomas von Aquin: Gott. Über alles andere spricht sie von daher und daraufhin.
Es ist schwierig, von Gott zu reden, und gefährlich, ihn totzuschweigen.
Versuche, ein Feuer in Worte zu fassen! Oder versuche, es in Dir zu ersticken: es kann Dich das Leben kosten.
Ich fange an mit einigen subjektiven Bemerkungen zu einer theologischen Operation3
Ein aufgeklärter Theologe führt vor, wie man Gott konstruiert. Er meint es nicht zynisch, nicht nur entlarvend, es hat für ihn einen guten Sinn. "In Gott sucht der Mensch alles zu bündeln, was ihm selber wichtig und von bleibender Bedeutung ist. Gott... ist ein vom Menschen aus sich selbst herausgesetzter geistiger Punkt, auf den hin er sich ausrichtet, an dem er sich orientiert, durch den er sich kontrolliert, mit dem er sich motiviert... Mit Gott geht er dabei gleichsam zu sich selber auf Distanz, um jenseits der vielen eigenen Unsicherheiten einen festen Punkt zu gewinnen, von dem her er die eigene Existenz besser in den Griff bekommt." Wer sich in den Griff bekommen will, so Schulz, tut also durchaus gut daran, sich einen Gott zu konstruieren.
Was ich daran wunderlich finde: die doppelte List des aufgeklärten Denkens. Zuerst überlistet es das religiöse Bewusstsein, führt ihm vor, dass gar nicht Gott, sondern es selbst der Ursprung sei. Und dann überlistet es auch noch sich selbst und mutet zu, uns gleichwohl einzulassen auf sein Konstrukt, als könne es die tragen, auf denen es steht. Es heißt, es sei ein sinnvolles Konstrukt. Wohl, aber lässt sich Sinn re-konstruieren? Die Sinnbeschaffung "ist selbstdestruktiv, sobald der Modus der 'Beschaffung' durchschaut wird"4.
Was mich daran irritiert: will ich eigentlich - soll ich eigentlich meine Existenz in den Griff bekommen? Was für ein Gott, der das Leben griffig macht! Hat es nicht dem Leben unendlichen Abbruch getan, "die Beziehungen von Mensch zu Mensch aus dem Flussbett unendlicher Möglichkeiten herausgehoben auf eine brache Uferstelle, der nichts geschieht" (Rilke), dass wir den Sinn für das Unerhörte, Wundersame und Unaufklärbare, den Sinn für das Abenteuer des Lebens aufgeopfert haben für überschaubare, griffige Sicherheiten?
Was mich empört: "Uns erkennbar ist nur eine einzige Wirklichkeit, nämlich unsere diesseitige Welt. In dieser einen Wirklichkeit müssen wir uns zurechtfinden, orientieren, leben. Aus dieser einen Wirklichkeit heraus ist Gott extrapoliert -über uns selbst hinaus ausgedehnt. Deshalb gehört Gott im Reden des Menschen immer zum festen Bestand dieser unserer Welt hier."
Das heißt für mich: dieser Gott ist eine tote Sache, ein Denkding, ein Gedankengerinnsel, ein erstarrter Fixpunkt. Ein letzter Schlussstein über dem Gehäuse unserer Wirklichkeit, im "Diesseits" festgebacken. An Gott zu glauben hieße dann, sein Leben auszurichten auf ein Prinzip ohne Leben, ohne Überraschung, ohne Geheimnis. Natürlich hat Schulz Recht mit seiner Kritik am Herrgott, dem Machthaber Gott, der Menschen klein hält oder ihnen den Omni-potenzwahn eingibt. Gott muss freiwerden von den Verunstaltungen, die ihm seine Verehrer angetan haben, aber nicht durch Operationen, die ihn vollends um sein Leben bringen.
Wenn der Name Gott wirklich auf etwas verweist, so ist es etwas zutiefst Lebendiges-Belebendes, Bewegtes-Bewegendes, kaum schon Entdecktes, eine abschüssige Tiefe, ein Sturzbach, der uns manchmal fortreißt, bis wir uns erschrocken fest klammern, ein Crescendo, in dem wir mitschwingen für einen kurzen Augenblick, in dem wir es ertragen, ein freier Flug im Rhythmus eines anderen, bis uns der Mut verlässt:
Ab und zu
Du
Gott noch immer Unbekannter
Berührst uns
Wie der an die Decke
der Sistina gemalte
den eben erst
Erschaffenen Adam
Nur mit einem Finger
Da fliegen wir
Dir im Convoi
Da nährst Du uns
Von Kuppe zu Kuppe
Mit dem Mut Deines Anfangs
Wir aus demselben Stoff gemacht
Wie Du
Noch ohne Blutgeruch
Und Brandgeruch
Schöpfer Geschöpf
Wir flogen
Liebten uns
Uneingeschränkt
Zum ersten, letzten Mal
Der alte Brunnen
Noch lange nicht ausgeschöpft
Nicht oft genug
angegangen...
M.-L. Kaschnitz
An Gott glauben, das heißt nicht, das Diesseits abrunden, abdichten, überdachen, sondern einen Flug ins Unerreichbare wagen, einen Absprung ins Ungewisse, eine Wanderung voller Engpässe und Durchbrüche, nicht ein für alle Mal in Diesseits und Jenseits sortiert, als hätte die Wirklichkeit nur zwei Seiten, gar nur eine.
"Gott" steht nicht fest, er lässt sich nicht feststellen. Er ist in Bewegung - den Anschluss darin finden wir - träge und ängstlich - nur selten und halten wir meist nur kurze Zeit. Manchmal gelingt es, dass wir aufleben im Überschwang eines anderen Lebens. Gott ist das Leben, nicht als Bestand, Dosis, gehortet und sich aufbrauchend, bekannt und im Griff, sondern als Quelle, frisch entspringend, nicht auszuschöpfen, als Strom, der in unbekannte Tiefen und Weiten trägt. Es ist schwer, Worte zu finden, die treffen. Zuerst aber müssen wir aufhören, von Gott in der Sprache der Dinge, der Feststellungen zu sprechen.
Es ist besser, wenn einem das Wort "Gott" nicht leicht von den Lippen kommt. In religiösen Kulturen, heute sind es Subkulturen, wirtschaftet es leicht ab zu einer nichts mehr bedeutenden Floskel, einer abgegriffenen Vokabel. Oder, von wenigen Theologen als austauschbare Chiffre im Umlauf gehalten, zum Zwecke der Vermittlung zwischen Tradition und "modernem Wirklichkeitsver-ständnis", dient es der Beschwichtigung. Beides bedeutet, den Namen Gott unnütz zu führen. Wenn das Wort Gott mir leicht von den Lippen kommt, ist besser, ich spreche es nicht aus und suche ein anderes. Wenn ich dabei ins Stolpern gerate, ins Stottern, dann ist es gerade recht.
Wie gut, dass das Wort nicht mehr in unsere regulierten Sprachspiele passt, wenn wir erst einmal aus dem religiösen Gehege ausgewandert sind! Dann, als Fremdwort, als Reizwort, als Verwirr-wort, gewinnt es seine Transzendenz zurück. Je weniger es passt, umso wichtiger wird es mir. Nur wenn es sich nicht mehr einfügt - in unsere Sprache, in unsere "Wirklichkeit" - kann es sie verrücken. Ein Gott, der unsere "Wirklichkeit" nicht ver-rückt, ist kein Gott.
Gott ist uns nicht vorgesetzt. Er gehört nicht zu der handlichen Art von Wirklichkeit, auf die wir stoßen, ob wir sie suchen oder nicht. Wenn wir Gott suchen, so suchen wir im Unsichtbaren, im Dunkeln. Manchen scheint es so, als sei die einzige Alternative zu einem vorgesetzten Gott ein selbstgemachter. Als würden unsere Akte, die ins Unabsehbare gehen, nur dann nicht leer bleiben, wenn sie selbst sich füllen, wenn sie konstruieren. Akte der Konstruktion schließen sich in sich selbst und durch sich selbst, sie stellen ihren Gegen-stand und Zielpunkt her. Gott wäre dann: ein verfestigter Gedanke, eine Hypostase. Es gibt aber noch eine andere Art von Akten, die ihren Gegenstand weder einfach vorfinden (Gott im Buch, im Himmel, im Inneren), noch ihn erzeugen: erfinderische Akte, die dennoch aufs Finden, nicht aufs Machen aus sind, Akte des Tastens, Aufspürens, des Harrens, des Ausseins, dass uns etwas geschieht. In ihnen liegt immer ein konstruktives Moment, ein Sich-Ausrichten auf etwas, ein Entwerfen, ein Pro-jizieren, aber sie sind zugleich, oft schmerzhaft, offen. Unsere Gedanken über Gott sind, wenn sie sich nicht "absolut setzen" (Schulz) und zu Hypostasen, Idolen verselbständigen, Suchbilder, nicht der Gegenstand selbst, Medien einer möglichen Erfahrung. Gott zu konstruieren bedeutet, das Suchbild zu fixieren, es an die Stelle der Erfahrung zu setzen. Wer sich entschließt zu konstruieren oder es unbewusst tut, bricht den Schmerz des Suchens ab, das sich offenhalten muss, auch wenn es nicht findet. Der Ausweg ins Machen bringt uns aber auch um das Glück, dass uns geschieht, was wir nicht gemacht haben, was uns entgegenkommt, um das, was man in einer nur noch schwer vernehmbaren Sprache die "Gnade" genannt hat.
Weil Gott nicht feststeht, dürfen ihn auch unsere Gedanken und unsere Sprache nicht dort feststellen, wo wir ihn einmal angetroffen haben. Sie müssen in Bewegung bleiben. Gott ist selten zweimal an derselben Stelle, im gleichen Gedanken zu fassen, mit denselben Worten kenntlich zu machen. Darum müssen wir feinfühliger werden in unserer Sprache, unserer Suche. Wenn's in der Religion ums Rechthaben ginge, dann ließe sich das Richtige feststellen (die rechte Lehre). Wenn's aber in der Religion um ein Verhältnis mit Gott geht, eine Liebschaft, dann sucht sie immer nach Worten.
Gott können wir nur mit unserem Leben suchen, weil er selbst das Leben ist, der Schöpfer-Geist, in dem es entspringt. Das aber bedeutet, dass wir beweglich werden, dem Unsichtbaren zugetan, uns nicht am Greifbaren haltend. Noch in den erfüllten Zeiten, in denen die Frage nach Gott verstummt, weil wir seiner inne sind, sind wir nicht am Ziel: noch dann ist Gott auch das Dunkel, das Unausgeschöpfte, Unausgemachte, in das wir mit unserer Liebe, mit unseren Belastungen "das Zutrauen riskieren" (P. Schulz).
Wo ist Gott zu fassen -
irgendwo, nirgendwo, überall?
Ein Rabbi sagte zu einem Jungen,
erzählt Martin Buber:
ich gebe dir einen Gulden,
wenn du mir sagst, wo Gott wohnt.
Der Junge antwortete: und ich gebe dir zwei,
wenn du mir sagen kannst, wo er nicht wohnt.
Zwängt er sich in eine Lücke unserer Welt,
oder verläuft er sich in allem,
oder hat er seine eigene Weite?
Wo auch immer, ich will nicht von ihm reden wie von einem Ding, das es vielleicht gibt, vielleicht auch nicht.
Eher will ich von ihm sprechen, wie man von einer Liebe spricht, besser noch: einer Liebschaft.
"Mit Gott ein Verhältnis haben", das trifft es gut: es ist moralisch nicht ganz auf der Höhe, nicht besonders ordentlich und anständig, mit Heimlichkeiten, in Bewegung, und man weiß nicht recht, wohin es führt.
Man kann Gott nicht erörtern, man muss ihn mit dem Leben suchen.
2 SS 1979, erschienen im Brüderboten 1/1980 und in diakon 2/1980.
3 Im Anschluss an die Analyse der Predigt von Paul Schulz "Wo aber ist Gott?" in einem theologischen Wahlkurs. Diese subjektiven Bemerkungen erlaube ich mir, nachdem die strengere gedankliche Kritik durchgeführt wurde, als eine andere Form der Auseinandersetzung und des Weiterprobierens.
4 J. Habermas, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, S.99.
Gott suchen5
Der Gott sucht, denen wird das Herz leben.
Ps 69,33
Was ist das eigentlich: Gott suchen? Ich will darüber sprechen, wie ich es verstehe.
Es ist ja wohl nicht gerade unsere Hauptbeschäftigung, Gott zu suchen, Wir haben es jeden Tag mit vielerlei anderen Sachen zu tun. Darunter sind eine Menge Kleinkram, den wir routinemäßig erledigen, größere Brocken, die uns ernstlich zu schaffen machen, und schließlich Dinge, die uns wirklich nahe gehen, an die wir unser Herz hängen oder die uns quälen. Das können handgreifliche Dinge sein, z. B. Menschen, oder auch 'bloße' Vorstellungen, z. B. Vorstellungen von dem, was wir erreichen wollen, genauer: was wir früher vielleicht einmal erreichen wollten, jetzt aber erreichen müssen, wenn wir noch vor uns selbst bestehen wollen. Wir versuchen, in dieses Vielerlei eine Ordnung hineinzubringen. Die zeigt sich am deutlichsten darin, wie wir unsere Zeit einteilen, z.B. den Tag, den wir jetzt gerade beginnen.
Diese Dinge, die für uns zählen - mehr oder weniger, wie Essen, Trinken, Wohnen, Familienleben, Urlaub, Hobbys, die Arbeit, Vorgesetze, Untergebene; Ängste zu verlieren: die Gesundheit, die Stellung, Partner, Wünsche nach Glück in Form von Geld, Macht, Ansehen, geliebt werden oder wenigstens doch beliebt sein,
all diese Dinge, um die wir uns drehen und für die wir uns Zeit lassen, machen unsere Welt aus, unseren Lebensraum. Man kann es auch weniger großspurig ausdrücken: die Dinge, die wir um uns stellen und die uns umstellen, bilden das Gehäuse, in dem wir leben. Drinnen wissen wir recht gut Bescheid, was wichtig, was richtig und was wirklich ist. Was wir darin nicht untergebracht haben, kommt uns versponnen vor und macht uns unsicher. Wir meinen dann, dass die Dinge so seien, wie wir sie sehen, und unterschlagen dabei, dass wir an dieser Welt selbst gebaut haben.
Für viele ist auch Gott ein Bestandteil dieser Welt, gehört zum Gehäuse. Es gibt dann Zeiten und Orte, an denen man selbstverständlich von ihm reden kann oder wo man sich mit ihm beschäftigt. Wir führen Gespräche mit der Vorstellung, die wir von ihm haben. Es hat Vorteile und Nachteile, Gott als festen Bestandteil seiner Welt zu haben.
Manche verfolgt er wie ein Doppelgänger. Er schiebt sich aufdringlich zwischen sie und die Menschen und Situationen, mit denen sie zu tun haben. Er sitzt ihnen im Nacken und peitscht: in den missionarischen Galopp.
Anderen ist er ein Rückhalt. Sie führen ihn nicht ständig im Munde. Wir lassen ihn dann über unseren Geschäften zurücktreten, wissen aber immer, er ist da. Suchen müssen wir ihn eigentlich nicht, höchstens aufsuchen, zu bestimmten Anlässen hervorholen. Es tut uns ganz gut, meine ich, so einen Gott zu haben, den wir in unseren Ritualen festhalten und an den wir uns halten können, der uns nicht ständig entgleitet. Vielleicht ist er uns der Schlussstein, der das ganze Gehäuse zusammenhält. Nur: ver-rücken kann er die Dinge nicht.
Vielleicht ist er uns eine Zuflucht, wenn das Gehäuse wankt. Nur: ein Risiko ist er uns so nicht.
Vielleicht hält er uns am Leben. Nur: eigentlich lebendig macht er uns so nicht.
Ich glaube schon, es ist mit Gott wie mit der Liebe: will man sie lebendig haben, muss man sie aus der Gewohnheit kommen lassen. Diese Art von Fasten ist genauso wichtig wie geregelte Mahlzeiten. Der Gott, den man suchen muss, ist nicht von unserer Welt.
Es gibt noch einen anderen Raum. Manchmal merken wir etwas davon am Mangel; wenn wir nicht satt werden von dem, was wir uns beschafft haben, wenn nicht einmal die Spiele, die wir gewinnen, uns glücklich machen. Dann merken wir, dass das nicht alles gewesen sein kann, dass es noch eine tiefere Herausforderung an uns geben müsste, als anderen zuvorzukommen; dass es noch ein durchdringenderes Glück geben müsste als das, was wir in Besitz nehmen können; dass es noch eine unumstößlichere Gewissheit geben müsste als unsere Entscheidungen samt ihren übernommenen oder selbstfabrizierten Maßstäben.
Oder wir entdecken diesen anderen Raum, wenn wir etwas Wichtiges verlieren, wenn ein Fundament in unserem Gehäuse einstürzt und wir, so sehr wir uns anklammern, unaufhaltsam hinabgerissen werden, stürzen und im freien Fall, uns fallen lassend, mit einem Mal getragen werden.
Oder es versetzt uns etwas, das uns ganz durchdringend berührt, in diesen anderen Raum. Es ist dann, als ob ein Blitzschlag in unser Gehäuse fährt, kalt in den Schrecksekunden von Angst oder Schmerz, heiß in einem Augen-Blick der Liebe, die in uns fährt und uns ungestüm aus unserem Gehäuse wirbelt.
Wir kommen in diesen anderen Raum, trotz der Lichtblicke, nicht leicht hinein. Die Dinge, die wir ordentlich um uns aufgebaut haben, halten uns mit langen Armen fest. Kaum sind sie aufgebrochen, kleistern wir die Risse im Gehäuse schon wieder geschäftig zu, mit dem Gerede und der Routine. Am ehesten, scheint mir, ist noch die Stille durchlässig, wenn sie in uns selbst einzieht und noch das innere Kreisen unserer Welt in uns selbst still stellt.
Chr. Blumhardt hat einmal gesagt: „Wollen wir frei werden, so muss erst Gott frei werden in unserer Stille und in unserem Schweigen“.
In solchen Momenten, in denen wir die Welt anhalten, treten wir zuweilen mit allem, was um uns ist, aber nun unaufdringlich, in einen anderen Raum: vor Gott. Ich muss sagen, dass ich solche Momente nicht gerade suche. Gott zu suchen, ist eine gefährliche Sache. Es bedeutet einzutauchen in einen anderen Raum, in dem die Dinge, die man betreibt und die einen treiben, in ihre Wahrheit kommen. Damit ändern sie sich, ändern vor allem ihr Gewicht. Solange ich die Dinge festhalte, auf meinen Wünschen, Ängsten, Entscheidungen, Plänen bestehe, sie nicht aufs Spiel setzen will, komme ich gar nicht in diesen Raum hinein. Ich bleibe in meinen Kreisen. Das Festhalten, und sei es auch nur in einem Punkt, ist wie eine Sperre.
Was mir Angst macht vor dem Gottsuchen ist: es hat zur Bedingung, die Dinge loszulassen, sie herzugeben, und ich weiß nicht, ob und wie ich sie zurückbekomme. Gott suchen heißt, die Dinge, um die ich mich drehe, auf eine absolute Probe stellen. Es ist ein hartes Geschäft, die Dinge, an denen wir hängen, in ihre Wahrheit zu entlassen. Wenn wir die Dinge hergeben, fällt all das von ihnen ab, womit wir sie wichtig gemacht haben, damit sie uns Gewicht geben. Sie können dann von sich aus wiederkommen, in einer neuen Klarheit, so wie sie sind. Nur: vorher weiß man nicht, was der Probe standhält. Manches, was uns unverzichtbar vorkommt, löst sich einfach auf, anderes tritt zurück. Was heil zurückkommt, ist nun ganz frisch, rückt näher, hat einen tieferen Grund. Es ist dann aufgenommen von Gott und kehrt gelöst zurück in dem warmen Strom, diesem sanften Frieden, der uns in diesem Raum durchflutet.
Eigentlich weiß ich, von den Dingen allein, die ich um mich aufgebaut habe, kann ich nicht lange zehren. Ich brauche sie auf und sie brauchen mich auf. Von innen lebendig macht mich das andere, einzutauchen in die Stille, die Gelöstheit, die Klarheit vor Gott.
"Die Gott suchen, denen wird das Herz leben".
Vielleicht ist es ja doch das größere Risiko, Gott nicht zu suchen.
Ich schließe mit einem Gebet.
Lieber Vater im Himmel,
es fällt uns schwer, den Sinn auf dich zu richten,
zu sehr sind unsere Sinne gefangen von den Dingen, die wir besorgen.
Wir sind zu gewaltsam und zu laut.
Komm uns entgegen, auch wenn wir dich ungeschickt suchen!
Rühre uns an und löse uns von dem Bann!
5 29.4.1981
Schöpfer-Geist6
Beim Nachdenken, was Leben ist, bin ich auf ein Pauluswort gestoßen:
Fleischlich gesinnt sein ist Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden.
Rö 8,6
Es ist eines dieser ärgerliches und arrogant wirkenden Worte, von denen auch das Johannesevangelium voll ist, die all unser Leben, unsere Geschäfte, Freuden, Bestrebungen schlicht als "Tod" abqualifizieren, wenn ihm das eine, der Geist, fehlt, der allein wahres Leben sein und geben soll. Nur was dieser Geist sei, bleibt leider trotz jährlicher Pfingstfeste und einzelner Erfahrungen und Ahnungen heute recht blass. Es ist eine ärgerliche Pose, wenn einer sich im Besitz des einzig wahren Lebens wähnt und sich nun darin gefällt, alles andere schwarz in schwarz zu malen. Ich interessiere mich nicht so sehr für die Abwertung aller nicht rechtgläubigen Lebensformen, ich höre lieber auf das, was diese Worte versprechen, wohin sie locken: ein Leben des Geistes, der nicht nur lebt, sondern - das ist in der Bibel seine Grundbestimmung - unentwegt lebendig macht und noch lebendiger.
Ich fange einmal an mit einer Vermutung.
Der Geist, das ist nicht eine Kraft in uns, eine kurzlebige Begeisterung, die wir manchmal haben und öfter nicht, mit der wir, wenn wir sie haben, leichter und beschwingter leben und uns mutiger an die täglichen Dinge heranmachen. Gut, das ist er auch, etwas uns Bewegendes in uns, aber nicht so, dass er in uns, unsere Körper eingeschlossen wäre als inneres Licht - wie ein Licht im schützenden Scheffel, dass draußen gleich ausgeblasen würde. Nach der Bibel hat es der Geist vielmehr selbst mit dem Blasen zu tun, die Grundbedeutung von Geist ist Hauch, Atem und Wind, und nach dem 1. Schöpfungsbericht rumorte der Gottesgeist schon zu Anfang über dem Wasser. Man könnte auch übersetzen: Es brauste ein Mordssturm über das Wasser. Also auszublasen ist er nicht so leicht, und so ganz und gar innerlich kann er auch nicht sein.
Ich denke es mir so: der Geist, Gottes Geist, ist das Gewebe, in dem alles, was wir kennen, ist, alles umfassend und alles durchdringend. So umfassend wie der endlose Raum, in den wir blicken, und umfassender; so durchdringend wie die feinsten der uns bekannten Strahlungen - und noch feiner. Er ist das Spannungsfeld, in dem alles, was wird, schwelt und endlich hervorbricht, Gestalt annimmt. Er ist das Energiefeld, aus dem alles, was wirkt, seine Kraft nimmt. Und er ist das Lebensfeld, in dem alles, was lebt, aufblüht, in seiner einmaligen Schönheit erstrahlt und seine Vollendung sucht. Er, der Schöpfer-Geist, ist der schöpferische Grund, aus dem unsere Welt hervorgeht, und er wohnt in ihr-, nein, er rumort in ihr: er ist die Unruhe, die die Welt und unser Leben daran hindert, in Dingen und Abläufen zu erstarren und sie und uns zwingt, Schöpfung zu sein.
Der Physik fällt es nicht mehr so schwer, sich so etwas Ähnliches, ein umfassendes Energiefeld zu denken, das vor aller Materie besteht, in dem die festen Körper erst nach und nach auftauchen. Die Biologie tut sich damit heutzutage noch viel schwerer. So wie die Physik ehedem die Kraft noch als Eigenschaft der Körper verstand, bis sie den Gedanken der reinen, freien Energie fasste, die sich erst sekundär in Masse und Körper umsetzt, so versteht die Biologie noch das Leben als Funktion der Zelle, die wächst und sich fortpflanzt, sich ernährt, sich aktiv bewegt und auf Reize reagiert - die fünf Kriterien des Lebens. Es könnte aber auch sein, und es gibt allerlei merkwürdige Hinweise dafür, dass die Zelle eher eine Kristallisation eines vorgegebenen Lebensfeldes ist, dass die Lebewesen Geschöpfe des Lebensgeistes sind. Vielleicht wird sich so auch einmal der Widerspruch lösen, dass die Wissenschaft das Leben von den Lebewesen her versteht und für ein spätes Produkt hält, während für die Bibel das Leben am Anfang steht - in Gott, vor allen Lebewesen.
Sowieso liegt der hartnäckigste Widerstand gegen die Vorstellung von der Wirklichkeit als Geist in unserer Erfahrungswelt. darin, wie wir mit den Dingen unserer Welt und uns selbst umgehen. Wenn es wahr ist, dass alles, was ist, hervorgerufen, getragen, miteinander verwoben und belebt ist von dem alles umfassenden und durchdringenden Geist Gottes, so liegt unsere tägliche Täuschung darin, eben dies nicht wahrzunehmen, und diese Täuschung schafft eine eigene Welt, die zwar Illusion, aber nichts desto weniger real ist. Das ist die Welt des Fleisches, wie Paulus sie nennt, in der wir uns selbst gefangen setzen. Wenn wir das Lebendige vom Belebenden abschneiden, die Wirklichkeit vom Geheimnis der Schöpfung, dem Geist, dann bleibt die Welt der festen Körper und ihrer Abstände übrig, die einfach da sind, wie selbstverständlich, einschließlich unserer selbst. Und unser Leben ist dann der Verkehr dieser festen Körper: ihre Geschäfte, soweit es mehr um Dinge, und ihre Affären, soweit es mehr um die Subjekte geht. In den lichten Augenblicken hingegen, wo uns die Welt als Schöpfung erscheint, ist nichts bloß und stumpf da, sondern alles Sein ein Wunder (nicht bloß die Wunder!), tritt es hervor aus einem unfassbaren Hintergrund und trägt den Zauber dieses Geheimnisses noch in sich, ja ist von ihm umgeben. Wir kennen diese Wandlung von einem stumpfen Nebeneinander und Gegeneinander in das feinfühlige, lösende, schwebende Miteinanderverwobensein der Liebe und die. atemlose Verwunderung und Freude an einem Kind, einer Blume, einem Vogel. Es ist nicht bloß so, dass wir ein Objekt anders sehen, sondern wir treten mit ihm in einen anderen Zusammenhang. Es öffnet sich uns eine weitere Welt, in der wir berührt mitschwingen. Ihre Andersartigkeit finde ich getroffen in einem Gedicht über einen Abend im Moor:
Feinhalmige Gräser
braun rot gelb
glühend in der versunkenen Sonne
zünden den Brand
Zauberfäden
über das Moor gespannt
alles verwoben
nichts mehr für sich
nichts mehr wirklich
alles geschieht
in Rätsel getaucht
Du und ich
im magischen Netz
wir gehen
ganz sacht
keine Fäden zerreißen
lassen die Worte
eine Brücke nur die gelösten Hände
für den Gleichklang der Seelen
gehen miteinander
Gefährten
achtsam
ahnend
in das Geheimnis
für das Wundersame bereit
spüren das Wesen
folgen der unsichtbaren Spur
immer langsamer
in der lebendigen Stille
immer tiefer
in das schwebende Sein
In solchen Augenblicken scheint es, als sei der Schleier weggezogen, der die Lebendigkeit der Dinge verhüllt. Oder ist der Schleier nur das Verhängnis, das wir mit unseren eigenen Abtötungsmanö-vern im Interesse des Lebens anrichten: Leben als unablässiges Bemühen, uns Dinge anzueignen (Menschen eingeschlossen), entweder in Form von Herrschaft oder in Form von Sucht, in beiden Fällen den feinen Zauber zerstörend, der zwischen ihnen und uns wirkt. Ohne dies Innehalten und die Achtsamkeit auf das, was zwischen uns entspringen und wirken kann, die schöpferischen Anfangspunkte des Geistes, entsteht eine Welt aus Abläufen. Alles — und vor allem das Leben - läuft ab. Die Geschäfte des Fleisches, wie Paulus es nennt, laufen sich zu Tode. Der Bestand unseres Lebens, durch Austausch angereichert oder beschädigt, schrumpft langsam aber sicher seinem Ende zu. Unsere angestrengten Strategien der Bedürfnisbefriedigung kriegen damit letztlich einen Nonsenscharakter. Warum nur verfehlen wir ständig in dem Bemühen, aus uns etwas zu machen, das eigentlich viel Einfachere: zu sein? Wir sind ja nicht leer und nichtssagend, sind Kinder des Geistes, in dem sich seine Schönheit und Lebendigkeit auf einzigartige Weise bricht. Warum nur verfehlen wir in unserem Tun ständig unser Sein? Warum können wir nicht, jeder auf seine Art, Gottes Geist sei n?
Ich will jetzt nicht mehr versuchen, über Wege nachzudenken. Vielleicht ist es schon eine Hilfe, in der stumpfen, langweiligen, trübsinnigen Welt, in der wir oft stecken, zu wissen oder zu glauben, dass diese Welt eine Illusion ist, eine Täuschung. Eine Welt aus leeren Abläufen könnte überhaupt nicht bestehen. So wirklich wie alles, was lebt, ja überhaupt nur ist, ist auch der Geist, aus dem alles lebt und ist. Alles, was ist, ist ein Wunder und von seinem Geheimnis durchdrungen. Die Abläufe unseres Lebens sind nur eine klägliche Kümmerform, eine Verstellung des Lebens, das in Wahrheit, Tag für Tag, neue Schöpfung ist und für uns werden kann. Wenn unser Leben nur noch ab-läuft, ist dies ein Zeichen, dass wir nicht sehen. Wir können es wieder lernen - manchmal, indem wir die Augen schließen, und manchmal, indem wir sie aufmachen.
6 13.6.1984
Hauch des Lebens7
Der 2. Schöpfungsbericht der Bibel beginnt so:
"Noch gab es kein Gesträuch des Feldes auf Erden,
und noch wuchs kein Kraut auf dem Felde;
denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf die Erde,
und es war kein Mensch da, den Boden zu bebauen;
ein Wasserschwall aber brach hervor aus der Erde und tränkte alles Land.
Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden
und hauchte ihm Lebensodem in die Nase;
so ward der Mensch ein lebendiges Wesen."
In diesen Versen spiegelt sich deutlich die Welt des Erzählers, eine Welt, in deren Mitte der Mensch seinen Acker bestellt, umgeben von Steppe und Wüste, in der das Leben vom Regen abhängt, der in der Steppe die Sträucher, im Kulturland die Saat wachsen lässt. Eine Welt also, die der des Bauern in Palästina entspricht. All dies, heißt es hier, gab es noch nicht, denn die Grundbedingung der bäuerlichen Kultur, der Regen, fehlte noch. Dann bricht eine Quelle hervor, bewässert den Boden, und aus dieser feuchten Ackerkrume formt Gott den Menschen. Zwei Vorstellungen aus seiner eigenen Erfahrung verbindet hier der Erzähler, um das Entstehen menschlichen Lebens anschaulich zu machen:
Das bildnerische Formen eines Stoffes, wie etwa das Töpfern, und das Einhauchen des Atems; das Atmen unterscheidet ja Lebendige und Tote. Aber in diesem Bild vom Anfang menschlichen Lebens steckt doch mehr als naive Erklärung.
Der Mensch ist ein "irdisches" Wesen, aus den Elementen der Erde gebaut. Er hat eine feste Substanz, das macht ihn solide, stabil, handfest und erdenschwer. Nur: sein Leben macht das gerade nicht aus, das ist anderer Art. Es ist, möchte man sagen nur ein Hauch, eingehaucht für die kurze Spanne der Zeit, in der er sich aus dem Staub erhebt, um wieder in ihn zurückzukehren. Was ihn belebt, dieses scheinbar so massive Wesen, ist selbst nicht massiv. Der Mensch verfügt nicht über sein Leben, es kommt ohne sein Zutun an ihn heran, und es geht ihm wieder aus, ohne dass er es halten könnte. "Nimmst Du ihren Odem hin, so verscheiden sie und werden wieder zu Staub. Sendest Du Deinen Odem aus, so werden sie geschaffen", heißt es im Psalm 104 von den Lebewesen. Nur ein Hauch trennt Leben und Tod. Auch das Wort, dass wir mit leben schaffendem "Geist" übersetzen, heißt wörtlich eben dies: Hauch.
Aber es ist nicht nur der Tod, an dem wir merken, dass unser Leben an einem hauchdünnen Faden hängt. Wir spüren das immer, wo wir das Leben - oder sein Schwinden - wirklich spüren, und es nicht nur ablaufen lassen. Ein drastisches Beispiel sind die Helden bei Homer. Da stehen sie muskelbepackt und waffenstrotzend vor dem Kampf und rufen ihre Götter an: "Gib mir Kraft", als wären sie verzagte Pietisten. Wenn es wirklich darauf ankommt, dann tuts nicht die Kraftreserve, der Vorrat an Energie, dann muss erst der Kampfgeist in sie fahren.
Und ebenso wenig gelingt es uns mit dem, was wir speichern - weniger Körperkraft als geistige Konserven, Lebensmittel aller Art, Vermögen, Positionen, Genüsse - das Glück zu zwingen. Das ist nur etwas anderes als Wohlstand und Zufriedenheit, etwas Durchdringenderes und häufiger etwas unersetzbar Entbehrtes. Ein Hauch, der durch und durch geht, wärmend, brennend, manchmal im äußersten Glück, manchmal im Elend. Es sind zarte Schwingungen, die uns erfassen, beleben, verwandeln, nicht der Lärm, die mechanischen Rhythmen, die hastigen Bewegungen und Erregungen, mit denen wir uns gewöhnlich in Gang setzen. Es ist kein Zufall, dass Menschen leise sprechen, wenn sie sich etwas wirklich Wichtiges oder Schönes zu sagen haben, auch wenn niemand sie belauscht.
Allerdings, wenn wir in unserem Gleichmaß dahinleben, arbeiten, uns ein bisschen wichtigtun und ein bisschen Erholung suchen beieinander, uns zufrieden vorkommen, weil von Glück und Unglück gleich weit entfernt, dann scheint es im Leben um handfestere Dinge zu gehen. Wenn wir aber von einer Liebe leben oder einer Hoffnung, dann trennen Glück und Unglück nur ein Hauch.
Noch an einer anderen Stelle fällt mir auf, wie recht der biblische Erzähler mit seiner Schöpfungsgeschichte hat. Wenn man mit Menschen zu tun hat, die irgendwann herausgefallen sind aus dem Leben, noch nicht hinaus - und nicht mehr hineinkommen; wenn das Leben, das doch wie von selbst zu fließen scheint, ins Stocken geraten ist, zähflüssig wird, uns nicht mehr mitnimmt und mühsam weiterbewegt werden muss, über endlose Stunden, Tage der Leere hinübergeschoben werden muss; und wenn man, einem solchen Menschen nahe, spürt, dass alle realen Schwierigkeiten eigentlich beweglich wären, wenn nur im Inneren das Leben wieder entspringen würde; wenn unsere Belebungsversuche nichts fruchten und doch nur ein Hauch zu fehlen scheint, ein Funke, den wir nicht geben können.
Aus diesen Erfahrungen stimme ich dem zu, was mir diese Stelle der Bibel zu sagen scheint: was auch immer wir speichern, unser Leben bleibt ein Hauch. Das heißt, dass es brüchig, zerbrechlich ist, und wir behutsam damit umgehen müssen. Menschen sind nie wirklich robust, unberührbar, wie wir es immer von unseren Gegnern anzunehmen pflegen, um dann gleich etwas härter zuzuschlagen. Dass wir mit ganz Unscheinbarem einander ans Leben gehen können, aber auch einander beleben können. Dass wir einander Raum lassen müssen, um frei atmen zu können, noch wo wir streiten, statt uns fürsorglich oder gehässig die Luft zu nehmen. Dass wir achtsam sein sollten auf die feineren Schwingungen, die von Menschen ausgehen, oft ganz abseits ihrer Worte, und auch in uns selbst - Gottes Hauch in unserem Atem -, dass wir ihnen Zeit geben und sie in uns sammeln.
Gottes Atem ist nicht nur ein Hauch, der unversehens durch uns hindurch fährt. Wir können es auch lernen, mit ihm zu atmen. Dann schwingt er bleibend in uns, als Güte, als Liebe, als Zuversicht. Und weil wir wohl mit ihm atmen, ihn aber nicht speichern und lagern und besitzen können, darum bitten wir immer neu: "Komm, Schöpfer, Geist!"
7 8.10.1980
Paradise lost?8
Letzte Woche waren wir mit den neuen Studenten auf einem Blockseminar und haben uns dort mit dem Anfang der Bibel, den Schöpfungsgeschichten, befasst. Ich möchte davon etwas für unsere Andacht herausgreifen. Weil der Text bekannt ist und zu lang, lese ich nur ein paar Sätze daraus vor und erzähle das Übrige so nach, wie ich es verstehe. Es ist die Geschichte vom Bauern Adam und seiner Frau und wie es ihnen im Garten Eden ergangen ist.
"Und Jahwe Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren"
heißt es dort. So lebte unser Stammvater also dort in der Natur wie in einem Garten, sie umgibt ihn mit ihrer Schönheit, sie nährt ihn, er arbeitet an ihr als ihr Gärtner, noch nicht wie später als räuberischer Parasit, er arbeitet nicht nur für sich, auch für sie. Ein Dasein in der Sonne, von dem auch wir träumen, wenn wir in der Sonne sind.
Sein Glück wird Adam aber erst zu eigen, als er es teilen kann: seine Freude, seine Arbeit, sich selbst mit einem Partner, der ihm entspricht. - der mit ihm spricht und ihm beisteht in seiner Hilflosigkeit.
"Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“,
heißt es im Text.
Es tut uns nicht gut, ganz allein zu sein, mit uns selbstallein zu sein, auch nicht nur mit Gott allein zu sein! Nicht einmal Gott will allein sein, das ist ja der Sinn aller Schöpfungsgeschichten. Der Mann braucht die Frau, die ihn aus den Verliesen seiner Einsamkeit herausholt, in denen er sich selbst und auch noch seinen Gott einsperrt. Erst die Anziehung, die von dem anderen ausgeht, baut die Spannung auf, in der ich selbst lebendig werden und das Glück erfahren kann, zum anderen hinüberzugehen, ihn zu erreichen und von ihm gefunden zu werden, ein Fleisch zu werden, wie es im Text heißt.
Adam im Glück, möchte ich dieses erste Kapitel der Menschheitsgeschichte überschreiben.
Der Verfasser der Geschichte, die Alttestamentler nennen ihn Jah-wist, träumt zurück von einer möglichen, vielleicht wirklich einmal wirklicheren Welt, wo die Menschen im Einklang mit der Natur, den Mitmenschen, mit Gott, mit sich selbst lebten. Das gestörte Leben, das wir heute leben - verkrampfte Beziehungen, mühselige Arbeit, ausgeplünderte Natur, ein mörderischer Kampf ums Überleben, -das ist nicht das Erste und ist nicht das Letzte, sagt er uns.
Warum aber hält Adam es in diesem Glück nicht aus, warum können wir selbst dieses einfache Glück auch nicht halten, wenn es uns noch heute manchmal, für Augenblicke berührt?
Adams Glück war begrenzt, begrenzt durch Vorgaben eines Gottes, der ihm wohl gewogen war. Er hat sich nicht selbst geschaffen und den Garten nicht selbst angelegt und auch die geheimnisvolle Entsprechung zwischen Menschen und Mitmensch taucht ohne sein Zutun auf. In diesen Grenzen eines geschenkten Glückes konnte er sich frei bewegen, nicht verbraucht von der Sorge ums Überleben und nicht gegängelt von einem Chef, sondern frei gelassen von einem großzügigen Schöpfer, der ihm interessiert zuschaut. Aber diese Grenze wird dem Menschen zum Problem. Da ist dieser Baum in der Mitte des Gartens, von dem er nicht essen soll, und diese Grenze zwischen Gott und Mensch reizt ihn, er möchte werden wie Gott selbst, gutes und Schlechtes, alles erkennen und ausprobieren. Gott reizt ihn, so zu werden wie er selbst, er ist die Grenze und die Versuchung. Die Schlange hat Eva mit dem Versprechen grenzenloser Erkenntnis nicht betrogen, sie hat sie mit der Wahrheit verführt. In der Tat wandern ja die Grenzen menschlicher Erkenntnis unabsehbar weiter. Nur hat die Schlange das Risiko unterschlagen. Der Mensch, der der Verlockung der unbegrenzten Möglichkeit folgt, wird - im Doppelsinn des Wortes - zu allem fähig.
Schon der Jahwist hat gesehen, dass mit dem menschlichen Fortschritt, der Ausdehnung des Wissens und der Technik auch die Untaten immer gewaltiger werden, das grenzenlose Experiment kostet uns das begrenzte Glück. Es zeigt sich, dass das Verbot, die Begrenzung noch einen anderen Sinn hat, als Gott vor den Menschen zu schützen und den Menschen klein zu halten, wie die Schlange und nach ihr viele Atheisten meinten. Nämlich den Sinn: den Menschen vor sich selbst zu schützen. Zu allem fähig geworden, wird er unfähig, die Richtung auf das Leben festzuhalten, das Gute zu wählen und das Schlechte von sich fernzuhalten. Seine Augen werden ihm aufgetan, aber er schaut nur in die Augen des anderen, der auch zu allem fähig geworden ist und ihn unberechenbar bedroht, - und bekommt es mit der Angst zu tun. Nicht einmal mehr der Bruder ist sicher, auch dieses Tabu zerbricht. In die unbefangene Beziehung schleicht sich die Angst vor dem undurchschaubar anderen ein, die Abschirmung, die Abwehr, die Abschreckung, die ihrerseits bedroht. Nun wird die Natur maßlos ausgebeutet und misshandelt, und die Arbeit nimmt Formen an, die den Arbeiter ums Leben bringen.
In dieser so trostlos mit der Vertreibung aus dem Paradies endenden Geschichte gibt es aber doch einen Hoffnungsschimmer. Am Ende nimmt Adam seine Frau, auf die er zuvor noch alle Verantwortung abwälzen wollte, zu sich und nennt sie, vom Tode bedroht, nun gerade, mit einem Unterton des Trotzes, scheint mir: Eva, Mutter der Lebenden. Er nimmt sie, die gestörte Beziehung und das Leben, das, wie er weiß, nun mühsam und schmerzhaft sein wird, an. Adam, dieser einfältige Bauer, der nicht einmal wie Eva mit Leidenschaft sündigen konnte, ist heimlich anders geworden: tapfer. Und auch Gott erscheint in dieser Abschiedsszene gar nicht als unberührbarer Machthaber, Rechthaber. Er legt den Menschenkindern, die jetzt ihren Weg gehen, behutsam und fürsorglich die Kleider um, die sie nun zu ihrem Schutz brauchen. Es ist eine Geste der Zärtlichkeit Gottes zu seinem Geschöpf, scheint mir. Es ist nicht mehr alles gut in unserer Welt, wie es Gott in der ersten Schöpfungsgeschichte noch von der Schöpfung in ihrer Frische sagen konnte.
Aber in dieser Schlussszene ist angedeutet, was wir glauben können: es wird doch noch gut. Und es beginnt damit: dass wir unsere Welt, so wie sie ist, uns selbst und die Menschen mit uns, so wie wir sind, annehmen, unverdrossen, und noch Hoffnung ineinander setzen. Gottes Schöpfung geht auch in der schlechten Wirklichkeit weiter, mit uns unvollkommenen Geschöpfen, wenn wir uns nicht an nichtsnutzigen Fortschritten berauschen, uns aber auch nicht kleinmütig verkrümeln, als käme es auf uns nicht an: wenn wir behutsam etwas von Gott gutem Geist in uns und zwischen uns wachsen lassen. Und manchmal, wenn wir gelöst sind und uns nicht anklammern, schenkt er uns auch einen Hauch des Vollkommenen.
8 13.4.1982
Der letzte Adam9
Liebe Schwestern und Brüder, für unsere Andacht heute Abend habe ich einen Text ausgewählt aus den 1. Korintherbrief, c. 15, v.45:
" Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele; der letzte Adam zu lebendig machendem Geist."
Ein kurzer Text, aber weit gespannt: vom ersten zum letzten Menschen, vom Anfangs- zum Endpunkt der Menschengeschichte. Zweimal Adam, beide ziemlich weit weg von uns, scheint es. Der Text redet aber auch von uns: von unserer Herkunft und von unserer Bestimmung. Er redet von zwei Arten Leben.
Näher scheint uns noch der erste Adam. Er ist wenigstens kein Geist. Er ist aus festem Stoff, wie schon der Name "Adam“ sagt: mit "Erdling" könnte man ihn übersetzen. Kein Wunder, dass er dazu neigt, sich aufs Feste festzusetzen. Von Adam haben wir die Erdenschwere geerbt. Im Grunde - meint der Adam in uns, der Realist -zählt doch nur das Handgreifliche: was wir auf die Beine stellen, was wir uns aneignen, wozu wir's bringen und wie wir uns durchsetzen. Das Leben, das ist der Stoffwechsel zwischen handfesten Körpern, Geschäfte um Dinge und Affären zwischen Personen. Gewiss, die Körper, die Personen sind belebt, und ohne das würden die Spiele zwischen uns ja auch keinen rechten Spaß machen - meistens Macht-, seltener Liebesspiele. Aber das Leben scheint in den Körpern zu stecken wie die Elektronik in der. Uhr. Es fängt mit ihnen an und hört mit ihnen auf. Es gehört ihnen an. Dass wir nicht so recht wissen, woher das Ganze kommt, wieso wir überhaupt da sind und diese merkwürdig quirlige, lebendige Welt, können wir ganz gut vergessen. Solche Fragen riechen ohnehin nach Philosophie oder Theologie und nach Leuten, die Zeit für so etwas haben. Reell schein es, sich an das Gegebene zu halten, an das, was das ist, so als sei das Gegebene das Selbstverständliche. Wir sind halt da und haben zu tun. Nach dem Ursprung zu fragen und nach dem Ziel, das erscheint uns, wenn wir mit beiden Beinen im Leben stehen, doch recht versponnen.
Gelegentlich wird unserer Erinnerung aufgeholfen. Das sind die Momente, wo Adam die Puste ausgeht. Die Puste ist ja schon im Schöpfungsbericht Adams Problem. Er kriegt sie eingehaucht von seinem Schöpfer, in die Nase, aber er kann sie nicht in die Hand nehmen. Sie geht ihm auch wieder aus, und er kann sie nicht halten. Die Bewegung des Lebens geht durch uns hindurch, regt uns an, aber sie sitzt nicht in uns; bzw. wir wurzeln nicht in ihr. Wenn uns Realisten also die Puste ausgeht, dann wacht vorübergehend unser Sinn für Höheres auf. Dann möchten wir die Kraft wieder herbeirufen die uns geschwunden ist; möchten den Lebensfunken wieder entfachen lassen, der nur noch flackert, dann beten wir vielleicht gar zu einem Gott, der in unserer normalen Wirklichkeit eigentlich gar keinen Platz hat. Nun soll unsere handfeste, sonst doch so gut abgedichtete Wirklichkeit plötzlich Löcher bekommen, durch die so etwas wie Gott uns das wieder einpusten kann, was uns ausgegangen ist und auf die handfeste Weise nicht zu kriegen ist. Wenn wir so außer Atem gekommen sind, scheint es uns, dass es doch noch mehr geben müsste als die Unrast unserer Geschäfte und Affären, einen Ruhepunkt, wo Leben neu entspringt, wo Frieden in uns einfließt und Kraft quillt.
Nun wenn tatsächlich einmal etwas eingeflossen ist, merkwürdig, wie hurtig wir unsere Wirklichkeit wieder zumachen. Da haben wir schnell Erklärungen zur Hand: wir haben uns halt wieder aufgerappelt, es war alles gar nicht so schlimm, wir hatten eben Glück. Alles ging ganz natürlich zu. Und natürlich geht es so wieder zu - das Loch.
Vielleicht ist da auch überhaupt kein Loch, sondern die Weite. Und in dieser großen Weite sitzen wir in unserer Enge, in einer selbstgebastelten Kapsel, unserem Panzer und unserem Weltbild, und halten uns für das Universum. Vereinzelte undichte Stellen ermöglichen den gelegentlichen Verkehr mit so etwas wie Gott. Diesen fast zwanghaften Selbstabschluss, diesen Schließreflex nennt die Bibel Sünde. Er ist, obwohl wir uns so das Leben sichern wollen, tödlich.
Das von Adam geerbte Problem ist nicht, dass wir irdische Wesen sind. Das ist ganz in Ordnung und schön und eine Bereicherung Gottes. Darum ist auch Christus ein Adam, wird Fleisch. Das von Adam geerbte Problem ist, worein wir unseren Schwerpunkt legen und wohin es uns deshalb zieht. Das Problem ist nicht das Feste, sondern unsere Verfestigung. Als „Erdlinge“ aus den Elementen der Erde gebaut, haben wir eine feste Substanz. Nur: unser Leben macht das gerade nicht aus; es ist anderer Art. Was uns massive Wesen belebt, ist selber nicht massiv. Es ist nur ein Hauch. Und weil es uns so flüchtig erscheint, nicht zu fassen, und wir nicht mitkriegen, woher es kommt und wohin es geht, drehen wir uns lieber um die festeren Dinge, als seien sie das Leben. Den Hauch, die feinen Schwingungen, die zarte Berührung in unserer Tiefe, diese Leise, aber von Grund auf Belebende, ersticken wir meist in den hastigen, mechanischen, habgierigen Bewegungen, mit denen wir uns über die Dinge hermachen, als gäben sie uns das Leben. Unser Problem ist, dass wir unseren Schwerpunkt, unseren Ruhepunkt nicht finden in dem Leben selbst, obwohl es doch in uns ist; dass es uns nicht gelingt zu sein, was wir sind: lebendige Seelen oder Lebewesen. Lebe - Wesen. Wenn es uns einmal gelingt, wenn wir von innen erglühen im Hauch, dann leuchten unsere Augen, dann sind wird schön: für Augenblicke Lebe - wesen.
Und wir rühren in diesen Augenblicken an Ewiges. Das Widersinnige ist, dass wir trotzdem immer wieder dem verfallen, unser Leben in das Feste zu setzen; aber das Feste, an das wir uns halten, ist ja gerade das Hinfällige. Es ZERFÄLLT, KAUM dass das Leben aus ihm entweicht, in Staub, nicht nur die Körper, auch die Beziehungen und die Werke. Mir kommt dazu ein mittelalterlicher Spruch in den Sinn, den ich gestern in der Aufführung eines mittelalterlichen Totentanzes gehört habe:
Die Seele, denn sie ist geboren zur Ewigkeit,
hat keine wahre Ruh, in Dingen dieser Zeit.
Drum ist's verwunderlich, dass du die Welt so liebst,
und aufs Vergängliche dich allzu sehr begibst.
Das andere, das Unvergängliche, das ewige Leben, ist uns dabei gar nicht so fern. Der erste Adam ist ein lebendiges Wesen, aber er kriegt sein Leben nicht zu fassen. Es ist auch gar nicht zu fassen in unserer zugeschlossenen Welt. Dort taucht es auf, wer weiß woher, und verzehrt sich langsam aber sicher. Wenn wir der Bibel trauen dürfen, ist das nur die halbe Wahrheit. Das Leben hat noch eine andere Seite, hat sein eigenes Reich. Es füllt, immer schon und lange bevor es sich Körper erschuf, die große Weite, in der wir noch heute mit unserer Welt sind. Immer noch speist dieses uranfängliche Leben, diese nie versiegende Quelle, alles Leben in dieser Welt, alles durchdringend und ins Sein und ins Wachsen rufend als ein schöpferisches Feld. "Geist" nennt die Bibel dieses ursprüngliche Leben, es ist das Wort für Hauch und Wind. Der Geist ist Gottes Leben: Leben, das nicht nur lebt und sich auslebt, sondern das unentwegt belebt, lebendig macht. Erst in dieser Weite ist das Leben, das wir gleichsam nur en Passant erfahren, im Vorübergehen, ein Ganzes. In dieser Weite hat der Hauch den wir spüren, sein Woher und seit Wohin. In diesem Ganzen gibt es keinen Tod als Ende, nur Verwandlungen, ist das Leben immerwährend, ewig. Nur leider haben wir den Faden verloren. Nicht unsere Bestimmung. Die Jesusgeschichte handelt von einem Adam, der den verlorenen Faden wieder knüpft und uns zurückführt in das Ganze des Lebens, das wir verloren haben. Der zweite Adam, ein Mensch wie wir, hat den Geist nicht nur als flüchtigen Hauch. Er "wohnt" in ihm, wie es heißt, oder wie Johannes es ausdrückt: er hat das Leben bleibend in sich. Hat nicht nur den Einfluss des Lebens wie jedes lebendige Wesen, sondern seine Quelle. Er ist nicht nur ein Durchgangspunkt, sondern er ist im Ausgangspunkt des Lebens. Der zweite Adam, sagt uns die Jesusgeschichte, hat die Erdenschwere überwunden und seinen Schwerpunkt, seinen Ruhepunkt in Gott bewahrt. So hat er Gottes Geist eine menschliche Gestalt gegeben, einen Leib, andere lebendig machend und selbst zu Tode gebracht von den Wächtern des menschlichen Gefängnisses, den damaligen, so wie wir alle unsere Gefängnisse bewachen. Und daraufhin erst recht lebendig und lebendig machend, nicht mehr gebunden in die Welt der festen Körper, frei, eingetaucht in Gottes Weite, selbst das Zentrum des Geistes, den er gibt. Siehe, der Mensch - zu guter Letzt doch noch ins Leben gedrungen!
Unter den vielen, die es zu Ende bringen, ein "Anfänger des Lebens" gefunden: einer mit Todesmalen, der fängt nun erst recht mit dem Leben an. Gottes Geist - Mensch geworden und a1s Mensch frei geworden, Jesus, das lebendige Zentrum eines Leibes, der durch die Zeiten wächst aus allen, die ihm sich anschließen, bis sie alle sein werden, was er ist: für immer Lebe - Wesen.
Nun gut, ich habe ein bisschen viel geredet von etwas, wovon ich viel zu wenig weiß. Das leuchtet mir aber ein: dass der Geist des Lebens, Gottes Geist, der uns immer wieder aus unserem zerstückelten Leben entschwindet, nun einen Namen hat und eine Menschengestalt. Dass wir nun einen Haftpunkt haben für das Leben, das wir suchen, eine Spur, der wir nachgehen können, und eine richtiges "Lebewesen", das wir liebhaben können und das uns in der Liebe zu sich zieht. Mit dem letzten Adam tut sich uns dann eine neue Lebenslinie auf, der Lebenslinie des ersten Adam entgegengesetzt, ohne sie aufzuheben: dass wir nicht nur allmählich in den Tod sinken, sondern endlos ins Leben wachsen. Je mehr der erste Adam das Leben in eigene Hand nimmt, desto mehr wächst er aus ihm heraus. Je mehr wir uns an den letzten Adam halten, desto mehr wachsen wir ins Leben hinein. Nicht jeder für sich, sondern alle miteinander sein Leib, ein Lebensfeld in dieser Welt. Je inniger die Verbindung zu ihm wird, dem lebendig machenden Geist, desto weiter können wir uns vorwagen in die Bereiche, wo der Tod vorherrscht.
Lasse Gott uns wachsen in der dreifachen Bewegung des Geistes: im Leben schöpfen, im Lebendig werden und im Lebengeben.
9 Andacht am 25.11.85 im Konvikt Nordost